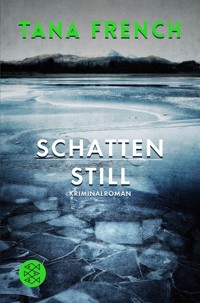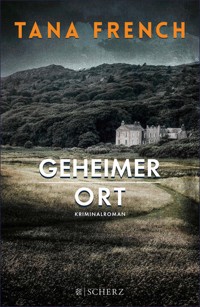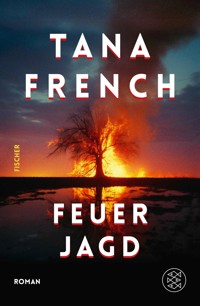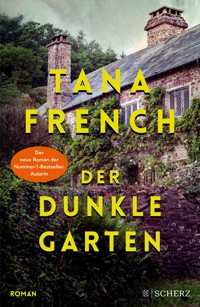
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Identität, Erinnerung und Mord: der neue große Roman der SPIEGEL-Bestseller-Autorin. Toby Hennessy, 28, führt ein unbeschwertes Leben in Dublin. Bis er eines Nachts in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen wird. Toby überlebt nur knapp, kann sich nicht mehr auf seine Erinnerungen verlassen. Er flüchtet sich in das »Efeuhaus« – das alte Anwesen der Familie, wo er sich um seinen sterbenden Onkel Hugo kümmern soll. Doch der dunkle Garten des Hauses birgt ein schreckliches Geheimnis. »In der besonderen Zone zwischen Spannung und Literatur, mit einer Sprache wie Satin, ein Glücksfall für den Leser.« Stephen King »Tana Frenchs bisher bestes Buch: Krimi, Familiengeschichte, psychologische Studie. Spannend, berührend und beunruhigend bis zum Schluss.« hr2 Kultur Von der international gefeierten irischen Schriftstellerin Tana French, Autorin von »Grabesgrün«, »Totengleich«, »Geheimer Ort«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 934
Sammlungen
Ähnliche
Tana French
Der dunkle Garten
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER E-Books
Für Kristina
Ach Herr, wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht, was wir werden können.
William Shakespeare, Hamlet
(Akt IV, Szene 5)
Kapitel 1
EIGENTLICH HABE ICH mich immer für ein Glückskind gehalten. Ich meine nicht, dass ich jemand wäre, der mal eben die Zigmillionen-Euro-Lottozahlen richtig tippt oder der knapp das Flugzeug verpasst, dessen Absturz dann keiner überlebt. Ich meine bloß, dass ich ohne die üblichen Widrigkeiten durchs Leben gekommen bin, von denen man so hört. Ich wurde nicht als Kind missbraucht, in der Schule nicht schikaniert. Meine Eltern sind nicht früh gestorben, sie hatten keine Suchtprobleme, haben sich nicht getrennt, und wenn sie mal Streit hatten, dann nur wegen irgendwelcher Lappalien. Keine meiner Freundinnen hat mich je betrogen, zumindest nicht, dass ich wüsste, oder irgendwie dramatisch verletzend mit mir Schluss gemacht. Ich wurde nie von einem Auto angefahren, meine schlimmste Erkrankung waren die Windpocken, und sogar das Tragen einer Zahnspange blieb mir erspart. Nicht dass ich mir viele Gedanken darüber gemacht hätte, aber als es mir irgendwann bewusst wurde, hatte ich das beruhigende Gefühl, dass alles genauso lief, wie es laufen sollte.
Und außerdem gab es da natürlich das Ivy House. Ich glaube, selbst heute könnte mir niemand einreden, das Ivy House wäre kein Glücksfall für mich gewesen. Ich weiß, so einfach war das nicht, ich kenne alle Argumente bis ins letzte, gestochen scharfe Detail. Ich kann sie schön ordentlich aufreihen, nüchtern und runenartig wie schwarze Zweige auf Schnee, kann sie anstarren, bis ich es mir fast selbst eingeredet habe; aber dann genügt schon der Hauch des richtigen Dufts – Jasmin, Lapsang Souchong, eine spezielle altmodische Seife, die ich nie identifizieren konnte – oder ein schräger Strahl Nachmittagslicht in einem bestimmten Winkel, und ich bin verloren, von Neuem gebannt.
Unlängst habe ich sogar meine Cousine und meinen Cousin deswegen angerufen. Es war kurz vor Weihnachten, ich hatte nach einer schrecklichen Firmenparty zu viel Glühwein intus, sonst hätte ich sie niemals nach ihrer Meinung gefragt – oder ihrem Rat oder was auch immer ich in dem Moment von ihnen hören wollte. Susanna fand die Frage offensichtlich albern. »Na ja, klar hatten wir Glück. Das Haus war toll.« Und in mein Schweigen hinein: »Falls du über das ganze andere Zeug nachgrübelst« – langer glatter Schnitt von Schere durch Papier, weihnachtliche Chormusik im Hintergrund, sie war dabei, Geschenke einzupacken –, »lass es bleiben. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber, Toby, jetzt mal im Ernst, was bringt es, nach so vielen Jahren noch darauf rumzureiten? Aber du kannst es nicht lassen, oder?« Leon, der anfangs ehrlich erfreut geklungen hatte, von mir zu hören, machte prompt dicht: »Woher soll ich das wissen? Ach, übrigens, wo ich dich gerade an der Strippe habe, ich wollte dir schon mailen, dass ich Ostern wahrscheinlich nach Hause komme, bist du dann –« Ich reagierte leicht aggressiv, verlangte eine Antwort von ihm, obwohl ich genau weiß, dass das schon immer die falsche Art war, mit Leon umzugehen, und er tat so, als hätte er keinen Empfang mehr, und legte auf.
Und dennoch, und dennoch – es ist wichtig. Es ist, soweit ich das beurteilen kann – auch wenn das mittlerweile keinen mehr interessiert –, wichtiger als alles andere. Ich habe ohnehin erst so spät verstanden, was Glück sein kann, wie herrlich griffig und trügerisch, wie unnachgiebig verdreht und verknotet in seinen ganz eigenen Verstecken – und wie tödlich.
Jene Nacht. Ich weiß, es gibt unendlich viele Punkte, an denen Geschichten anfangen können, und mir ist durchaus klar, dass jeder, der in dieser Geschichte eine Rolle spielt, Einwände gegen meine Entscheidung erheben würde – aber für mich beginnt alles mit dieser Nacht, dem dunklen rostigen Scharnier zwischen dem Davor und Danach, der Zwischenschicht Trickglas, die alles auf der einen Seite mit trüben Farben tönt und alles auf der anderen weiter strahlen lässt, quälend nah, unberührt und unberührbar. Obwohl es nachweislich Unsinn ist – schließlich steckte der Schädel zu dem Zeitpunkt schon jahrelang in dem Loch, und ich denke, es ist ziemlich klar, dass er in jenem Sommer ohnehin entdeckt worden wäre –, glaube ich doch auf irgendeiner Ebene, die tiefer ging als Logik, dass das alles ohne diese Nacht nie passiert wäre.
Es fing eigentlich mit einem schönen Abend an, einem tollen Abend sogar. Es war ein Freitag im April, der erste Tag, der sich wirklich frühlingshaft angefühlt hatte, und ich war mit meinen besten Freunden, die ich schon aus der Schule kannte, was trinken. Das Hogan’s war gerammelt voll, die Frauen hatten von der Wärme des Tages weich fließendes Haar, die Männer hatten die Ärmel hochgekrempelt, eine Melange aus Gesprächen und Gelächter verdichtete die Luft, bis die Musik bloß noch ein unterschwelliges fröhliches Reggae-Wumm-Wumm-Wumm war, das vom Boden nach oben in unsere Füße drang. Ich war total aufgekratzt – nicht von Koks oder so. Anfang der Woche hatte es ziemlich Ärger im Job gegeben, aber an dem Tag hatte sich das alles geregelt, und von dem Triumph war ich ein bisschen überdreht. Dauernd ertappte ich mich dabei, dass ich zu schnell redete oder mein Bier zu schwungvoll in mich reinkippte. Eine megaattraktive Brünette am Nebentisch versuchte, mich anzumachen, lächelte mich immer eine Sekunde zu lange an, wenn ich zufällig zu ihr rübersah. Ich würde nicht darauf eingehen – meine Freundin war eine tolle Frau, und ich hatte keineswegs die Absicht, sie zu betrügen –, aber es war trotzdem ein schönes Gefühl, dass ich noch immer gut ankam.
»Die steht auf dich«, sagte Declan und deutete mit dem Kinn auf die Brünette, die den Kopf übertrieben in den Nacken warf, als sie über den Witz ihrer Freundin lachte.
»Eine Frau mit Geschmack.«
»Wie geht’s Melissa?«, fragte Sean überflüssigerweise. Selbst wenn Melissa nicht gewesen wäre – die Brünette war nicht mein Typ. Sie hatte spektakuläre Kurven, die fast aus ihrem engen roten Vintagekleid platzten, und sie sah aus, als hätte sie lieber in einem Gauloises-verqualmten Bistro gesessen und dabei zugesehen, wie sich mehrere Männer ihretwegen eine Messerstecherei lieferten.
»Super«, sagte ich, was auch stimmte. »Wie immer.« Melissa war das Kontrastprogramm zu der Brünetten: klein, hübsch, mit zerzaustem blondem Haar und ein paar Sommersprossen, von Natur aus zu allem hingezogen, was sie und ihre Mitmenschen glücklich machte – buntgeblümte weiche Baumwollkleider, selbstgebackenes Brot, zu irgendwelchen Songs im Radio tanzen, Picknicks mit Stoffservietten und ausgefallenen Käsesorten. Ich hatte sie seit Tagen nicht gesehen, und bei dem Gedanken an sie sehnte ich mich nach allem, was ich mit ihr verband, ihr Lachen, ihre Nase an meinem Hals, den Honigduft ihrer Haare.
»Sie ist eine tolle Frau«, sagte Sean ein bisschen allzu bedeutungsschwanger.
»Stimmt, ja. Brauchst du mir nicht zu sagen. Schließlich bin ich mit ihr zusammen. Ich weiß, dass sie toll ist. Sie ist toll.«
»Bist du auf Speed?«, wollte Dec wissen.
»Nee, deine Gesellschaft macht mich einfach high. Du, mein Freund, bist das menschliche Äquivalent des reinsten, weißesten kolumbianischen –«
»Du bist auf Speed. Her damit. Du Geizhals.«
»Ich bin so clean wie nur was. Du alter Schnorrer.«
»Und wieso schielst du dann dauernd zu der Frau rüber?«
»Sie ist schön. Ein Mann kann sich an Schönheit erfreuen, ohne –«
»Zu viel Kaffee«, sagte Sean. »Zieh dir noch mehr davon rein, das bringt dich wieder runter.« Er zeigte auf mein Bierglas.
»Für dich tu ich alles«, sagte ich und leerte den Rest auf ex. »Ahhh.«
»Die ist ein echtes Sahnestück«, sagte Dec und beäugte die Brünette sehnsüchtig. »Was für eine Verschwendung.«
»Mach dich an sie ran«, sagte ich. Er würde es nicht tun, wie immer.
»Jaja, klar.«
»Na los. Wenn sie gerade rüberguckt.«
»Die guckt nicht mich an. Die guckt dich an. Wie üblich.« Dec war untersetzt und ein bisschen verklemmt, hatte eine Brille und widerspenstiges rotes Haar. Eigentlich sah er ganz okay aus, aber irgendwann mal hatte er sich eingeredet, dass dem nicht so wäre.
»Hey«, sagte Sean gespielt gekränkt. »Mich gucken Frauen an.«
»Ja, hast recht. Weil sie sich fragen, ob du blind bist oder ob dein Hemd so ’ne Art Mutprobe ist.«
»Neid«, sagte Sean traurig und schüttelte den Kopf. Er war ein großer Kerl, eins siebenundachtzig, mit einem breiten, offenen Gesicht und Rugby-Muskeln, die gerade erst anfingen, schlaffer zu werden. Er bekam tatsächlich ganz schön viel weibliche Aufmerksamkeit, die allerdings auch verschwendet war, weil er schon seit der Schule glücklich mit derselben zusammen war. »Neid ist so eine hässliche Sache.«
»Keine Sorge«, beruhigte ich Dec. »Für dich wird sich ja jetzt alles ändern. Mit den …« Ich deutete unauffällig mit dem Kinn auf seinen Kopf.
»Den was?«
»Du weißt schon. Denen da.« Ich zeigte kurz auf seinen Haaransatz.
»Wovon redest du?«
Diskret über den Tisch vorgebeugt, betont leise: »Die eingepflanzten Haare. Alle Achtung, Mann.«
»Ich hab mir keine Haare einpflanzen lassen!«
»Dafür musst du dich nicht schämen. Heutzutage lassen alle großen Stars das machen. Robbie Williams. Bono.«
Was Declan natürlich nur noch mehr empörte. »Mein Haar ist völlig in Ordnung!«
»Fällt auch nicht auf«, versicherte Sean ihm.
»Es fällt nicht auf, weil ich nichts hab machen lassen. Ich hab keine –«
»Komm schon«, sagte ich. »Ich seh’s doch. Hier und –«
»Finger weg!«
»Verstehe. Fragen wir doch deine Angebetete, was sie meint.« Ich fing an, der Brünetten zu winken.
»Nein. Nein, nein, nein. Toby. Im Ernst, ich bring dich um.« Dec versuchte, meine winkende Hand zu packen. Ich wich aus.
»Das ist der perfekte Gesprächsauftakt«, stellte Sean fest. »Du wusstest nicht, wie du sie ansprechen sollst, hab ich recht? Tja, jetzt hast du deine Chance.«
»Ihr Arschlöcher«, sagte Dec und stand auf. »Ihr seid echte Vollidioten, wisst ihr das?«
»Och, Dec«, sagte ich. »Verlass uns nicht.«
»Ich geh zum Klo. Die nächste Runde geht auf dich, Witzbold«, sagte er zu Sean.
»Er geht nachsehen, ob noch alles richtig liegt«, raunte Sean mir zu. »Du hast sie zerzaust. Die eine Strähne da, siehst du, die ist jetzt ganz –« Dec zeigte uns beiden den Mittelfinger und drängte sich dann durch die Menge Richtung Klo, wobei er sich zwischen Hintern und erhobenen Biergläsern hindurchschob und sowohl unser Gelächter als auch die Brünette angestrengt ignorierte.
»Er ist tatsächlich kurz drauf reingefallen«, sagte Sean. »Der alte Trottel. Noch mal dasselbe?«
Während er zur Bar ging und ich einen Moment allein war, schickte ich Melissa eine Nachricht: Bin was mit den Jungs trinken. Ruf dich später an. Liebe dich. Sie schrieb postwendend zurück: Hab den irren Steampunk-Sessel verkauft!!!, und zig Feuerwerk-Emojis. Die Designerin hat vor Freude am Telefon geheult, und ich hätte fast mitgeheult, weil ich mich für sie so gefreut hab :-). Grüß die Jungs von mir. Liebe dich auch xxx. Melissa hatte einen kleinen Laden in Temple Bar, wo sie skurriles, in Irland designtes Zeug verkaufte, ulkige kleine Sets von miteinander verbundenen Porzellanvasen, Kaschmirdecken in knalligen Farben, handgeschnitzte Schubladengriffe in Form von schlafenden Eichhörnchen oder verästelten Bäumen. Sie hatte seit Jahren versucht, den Sessel zu verkaufen. Ich textete zurück: Glückwunsch! Du bist ein Verkaufsgenie.
Sean kam mit vollen Gläsern, und Dec kam vom Klo. Er sah jetzt wesentlich gelassener aus, blickte aber betont nicht in Richtung der Brünetten. »Wir haben deinen Schwarm gefragt, was sie meint«, erklärte Sean. »Sie sagt, die neuen Haare sind eine Pracht.«
»Sie sagt, sie bewundert sie schon den ganzen Abend«, schob ich nach.
»Sie fragt, ob sie sie mal anfassen darf.«
»Sie fragt, ob sie mal dran lecken darf.«
»Ihr könnt mich mal, alle beide. Ich verrat dir trotzdem, warum sie dich die ganze Zeit anglotzt, du Arschgesicht«, sagte Dec zu mir und zog seinen Stuhl näher. »Nicht weil sie auf dich steht. Sondern weil sie deine schmierige Visage in der Zeitung gesehen hat, und jetzt weiß sie nicht mehr, ob’s darum ging, dass du eine Oma um ihre ganzen Ersparnisse betrogen oder eine Fünfzehnjährige gevögelt hast.«
»Was sie überhaupt nicht interessieren würde, wenn sie nicht auf mich stände.«
»Träum weiter. Der Ruhm ist dir zu Kopf gestiegen.«
Ein paar Wochen zuvor war ein Foto von mir in der Zeitung gewesen – im Gesellschaftsteil, mit der Folge, dass ich furchtbar verarscht wurde –, weil ich beruflich auf einer Ausstellungseröffnung gewesen war und zufällig mit einer altgedienten Soap-Schauspielerin geplaudert hatte. Zu dem Zeitpunkt machte ich PR und Marketing für eine mittelgroße, ziemlich renommierte Kunstgalerie im Stadtzentrum, bloß ein paar Ecken von der Grafton Street entfernt. Eigentlich hatte ich nach der Uni eher die großen PR-Firmen im Visier und war nur aus Übungszwecken zu dem Vorstellungsgespräch gegangen. Aber als ich da war, stellte ich erstaunt fest, dass mir der Laden gefiel, das hohe, spartanisch renovierte georgianische Haus mit den verwinkelten Stockwerken und Richard, der Inhaber, der mich über seine schief sitzende Brille musterte und nach meinen irischen Lieblingskünstlern fragte (zum Glück hatte ich mich ein bisschen vorbereitet, so dass ich tatsächlich einigermaßen intelligent antworten konnte, und wir führten ein langes und launiges Gespräch über Louis le Brocquy und Pauline Bewick und etliche andere Leute, von denen ich eine Woche zuvor noch nie was gehört hatte). Außerdem gefiel mir die Vorstellung, freie Hand zu haben. In einer großen Firma hätte ich die ersten paar Jahre damit verbracht, vor einem Computer zu hocken und brav die Ideen anderer Leute für geniale Social-Media-Kampagnen zu hegen und zu pflegen und mir Gedanken darüber zu machen, ob ich rassistische Troll-Kommentare über irgendeine furchtbare neue Chipssorte löschen oder zulassen sollte, weil sie für eine gewisse Aufmerksamkeit in den Medien sorgen würden. In der Galerie konnte ich meine Anfängerfehler gleich selbst ausbügeln, ohne dass mir einer über die Schulter guckte – Richard wusste nicht so genau, was Twitter war, wusste aber, dass er wirklich einen Account haben sollte, und er war ganz offensichtlich jemand, der die Dinge auch mal laufenließ. Als ich den Job zu meiner gelinden Überraschung angeboten bekam, zögerte ich nur kurz. Ein paar Jahre, dachte ich mir, ein paar schöne PR-Coups, die sich prima in meinem Lebenslauf machen würden, dann könnte ich den Sprung in eine der großen Firmen schaffen.
Inzwischen waren fünf Jahre vergangen, und ich hatte begonnen, schon mal meine Fühler auszustrecken, mit durchaus erfreulichen Reaktionen. Ich würde die Galerie vermissen – mir gefiel nämlich nicht bloß die Freiheit, die ich hatte, sondern auch die Künstler mit ihren albernen Ansprüchen auf Perfektionismus, die Befriedigung, allmählich genug Ahnung von der Sache zu haben, um nachvollziehen zu können, warum Richard sich begeistert auf den einen Künstler stürzte und den anderen glatt abblitzen ließ. Aber ich war achtundzwanzig, Melissa und ich sprachen davon, zusammenzuziehen, und die Galerie zahlte ganz anständig, aber nicht annähernd so viel wie die großen Firmen. Ich fand, es wurde an der Zeit, Ernst zu machen.
Das alles hätte sich in der letzten Woche beinahe in Rauch aufgelöst, aber mein Glück hatte gehalten. Meine Gedanken sprangen hin und her wie ein Border Collie, und das war ansteckend, Sean und Dec konnten sich vor Lachen kaum halten – wir planten für den Sommer einen Urlaub, nur wir drei, konnten uns aber nicht entscheiden, wo. Thailand? Moment, in welcher Jahreszeit ist da noch mal Monsun?, Handys gezückt, in welcher Jahreszeit wird da geputscht? – Dec bestand aus irgendwelchen Gründen auf Fidschi, was anderes als Fidschi kommt nicht in Frage, so eine Chance kriegen wir nie wieder, nicht nachdem – und ein vermeintlich subtiles Nicken in Seans Richtung. Sean würde Weihnachten heiraten, und obwohl das nach zwölf Jahren keine große Überraschung war, fanden wir es doch irgendwie erschreckend und unnötig, und immer, wenn das Thema zur Sprache kam, wurde er unweigerlich und gnadenlos auf den Arm genommen: Sobald du ja gesagt hast, sind deine Tage gezählt, Mann, eh du dich’s versiehst, wirst du Vater, und dann bist du geliefert … Trinken wir auf Seans letzten Urlaub! Trinken wir auf Seans letzten Abend in Freiheit! Trinken wir auf Seans letzten Blowjob! Dec und ich mochten Audrey eigentlich sehr, und das ironische Grinsen in Seans Gesicht – gespielt genervt, insgeheim rundum glücklich mit sich und der Welt – ließ mich an Melissa denken, wir waren jetzt seit drei Jahren zusammen, und vielleicht sollte ich ihr doch bald mal einen Heiratsantrag machen, und das ganze Gerede über letzte Gelegenheiten veranlasste mich, zu der Brünetten rüberzuschielen, die gerade irgendeine Anekdote erzählte und mächtig herumgestikulierte, knallrote Fingernägel, und irgendwas an der Art, wie sie den Hals bog, verriet mir, dass sie haargenau mitbekommen hatte, dass ich sie ansah und dass das nichts mit dem Foto in der Zeitung zu tun hatte – Wir sorgen schon dafür, dass du in Thailand auf deine Kosten kommst, Sean, keine Bange – Trinken wir auf Seans erste Transe!
Danach wird meine Erinnerung an den Abend für eine Weile lückenhaft. Natürlich habe ich im Nachhinein zigtausend Mal darüber nachgedacht, bin wie besessen jedem Faden gefolgt, um den Knoten zu finden, der das Muster unwiederbringlich zerstörte, habe gehofft, dass es da dieses eine Detail gab, dessen Bedeutung mir entgangen war, den kleinen entscheidenden Eckstein, um den herum sich alles wie von selbst ordnen würde, und auf einmal würden Jackpot-Ringe aus bunten Lämpchen aufleuchten und ich würde hochspringen und Heureka! schreien. Die fehlenden Teile waren da keine Hilfe (sehr verbreitet, beruhigten mich die Ärzte, völlig normal, ja, wirklich ganz normal): Vieles kam im Laufe der Zeit wieder, und ich schöpfte Seans und Decs Erinnerungen ab, soweit es ging, setzte den Abend mühsam zusammen wie ein altes Fresko aus erhaltenen Bruchstücken und schlauen Schlussfolgerungen, doch wie hätte ich mir sicher sein können, was sich in den Leerstellen verbarg? Hab ich jemanden an der Theke angerempelt? Hab ich im Höhenflug meiner Euphorie zu laut geredet oder bei einer ausladenden Geste jemandem das Bier aus der Hand geschlagen? Kochte der muskelprotzende Ex der Brünetten irgendwo in einer Ecke vor sich hin? Ich hatte mich nie als jemanden gesehen, der es drauf anlegt, sich Ärger einzuhandeln, aber nichts schien ausgeschlossen, nicht mehr.
Lange buttrige Streifen Licht auf dunklem Holz. Eine junge Frau mit Schlapphut aus rotem Samt, die an der Theke lehnte und mit dem Barkeeper über irgendeinen Gig redete, als ich die nächste Runde holte, osteuropäischer Akzent, die Handgelenke beweglich wie bei einer Tänzerin. Ein zertrampeltes Flugblatt auf dem Boden, grün und gelb, pseudo-naive Zeichnung einer Eidechse, die sich in den Schwanz beißt. Händewaschen auf dem Klo, Chlorgeruch, kühle Luft.
Ich weiß noch, dass mein Handy summte, mitten in einer urkomischen Diskussion darüber, ob der nächste Star-Wars-Film unweigerlich schlechter sein würde als der letzte, wie Dec aufgrund eines von ihm erfundenen komplizierten Algorithmus behauptete. Ich hechtete förmlich danach – ich dachte, es könnte irgendwie um die Situation in der Galerie gehen, dass Richard ein Update von mir haben wollte oder dass Tiernan mich vielleicht endlich zurückrief –, aber es war bloß eine Facebook-Einladung zu irgendeiner Geburtstagsparty. »Was war?«, wollte Sean wissen und blickte mit hochgezogenen Augenbrauen auf mein Handy, und mir wurde klar, dass ich ein bisschen zu hektisch danach gegriffen hatte.
»Nix«, sagte ich und steckte das Handy weg. »Aber sagt mal, was ist denn mit der Serie Taken, erst war die Tochter das Opfer, und dann wird sie auf einmal zur Komplizin –«, und schon waren wir wieder bei unserer Film-Diskussion, die längst so weitschweifig geworden war, dass keiner von uns noch wusste, welche Position er anfangs vertreten hatte. Das hatte ich an dem Abend gebraucht, genau das – ich zog mein Handy noch mal aus der Tasche und stellte es auf stumm.
Der Ärger in der Galerie ging nicht auf meine Kappe, oder wenn, dann nur indirekt. Verantwortlich dafür war Tiernan, der die Ausstellungen organisierte, ein schmächtiger Hipster mit langem Kinn, altmodischer Hornbrille und praktisch nur zwei Gesprächsthemen: obskure kanadische Indie-Folkbands und wie ungerecht es doch wäre, dass seine Kunst (akribische Ölporträts von Ravern mit stumpfsinnig glotzenden Taubenköpfen, solche Sachen, erschaffen in seinem von den Eltern finanzierten Atelier) noch nicht so erfolgreich war, wie sie es verdient hätte. Ein Jahr zuvor hatte Tiernan die Idee gehabt, eine Gruppenausstellung mit künstlerischen Darstellungen städtischer Räume von benachteiligten Jugendlichen auszurichten. Richard und ich waren beide Feuer und Flamme gewesen – so ein Projekt hätte nur dann noch mehr Furore machen können, wenn ein paar dieser benachteiligten Jugendlichen noch dazu syrische Flüchtlinge gewesen wären, am besten transgender, und Richard, der ansonsten immer leicht weltfremd und provinziell konservativ wirkte, war sich durchaus bewusst, dass die Galerie sowohl Prestige als auch Fördermittel brauchte, um im Geschäft zu bleiben. Nur wenige Tage nachdem Tiernan die Idee erstmals erwähnt hatte – ganz beiläufig in unserem monatlichen Meeting, während er Donut-Zuckerkrümel von seiner Serviette klaubte –, gab Richard ihm grünes Licht.
Das Ganze lief wie am Schnürchen. Tiernan machte sich in den miesesten Schulen und sozialen Brennpunkten auf die Suche (einmal hämmerte eine Bande Achtjähriger sein Fixie Bike mit einem Fäustel zu etwas, das von Dalí hätte stammen können, während er dabeistand) und fand etliche hinreichend verwahrloste Jugendliche mit halbwegs überschaubarem Vorstrafenregister und hingeschluderten Zeichnungen, in denen Spritzen vorkamen und schäbige Plattenbauten und hin und wieder ein Pferd. Fairerweise muss man sagen, dass nicht alles so klischeehaft war: Ein Mädchen war dabei, das aus Materialien, die es auf Industriebrachen zusammengesucht hatte, kleine, triste Modelle ihrer verschiedenen Pflegefamilien machte – ein Teerpappenmännchen lümmelte sich auf einer aus einem Betonstück gehauenen Couch, den Arm um ein kleines Teerpappenmädchen gelegt, auf eine Weise, die ich ziemlich verstörend fand; ein anderer Jugendlicher machte Pompeji-artige Gipsformen von Gegenständen, die er im Treppenhaus seines Sozialbaus gefunden hatte, ein zertretenes Feuerzeug, eine Kinderbrille mit verbogenem Bügel, eine kompliziert verknotete Plastiktüte. Ich war davon ausgegangen, dass diese Ausstellung ausschließlich auf ihre moralische Überlegenheit setzen würde, aber ein paar Stücke darin waren tatsächlich ziemlich gut.
Auf eine Entdeckung war Tiernan besonders stolz: ein Achtzehnjähriger, der sich Gouger nannte. Gouger bestand darauf, ausschließlich mit Tiernan zu reden, er weigerte sich, uns seinen richtigen Namen zu nennen oder irgendwelche Interviews zu geben. Er war im Laufe seines Lebens immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, hatte sich mit etlichen feindlichen Cliquen angelegt und fürchtete, die würden ihm nachstellen, wenn er jetzt reich und berühmt wurde – aber er war gut. Er verwendete Sprühfarbe, Fotos, Filzstift und Tinte mit einem ungestümen, hingerotzten Können. Sein Paradestück – ein gewaltiger Wirbel aus mit Kohle gezeichneten brüllenden Teenagern um ein Sprühfarbenlagerfeuer, Köpfe nach hinten geworfen, Bier, das in Neonbögen aus wild geschwenkten Dosen spritzt – trug den Titel BoHeroin Rhapsody, und es hatten schon einige Sammler Interesse daran angemeldet, seit ich es auf unsere Facebookseite gestellt hatte.
Die Kulturstiftung und die Stadt Dublin warfen uns das Geld praktisch hinterher. Die Medien berichteten ausführlicher, als ich erwartet hatte. Mehrere renommierte Gäste antworteten auf unsere Einladungen und beteuerten, sie würden sich freuen, zur Vernissage zu kommen. Richard lief lächelnd in der Galerie herum, summte Operettenmelodien und manchmal auch seltsames Zeug, das er irgendwo aufgeschnappt hatte (Kraftwerk??). Dann spazierte ich eines Nachmittags, ohne anzuklopfen, in Tiernans Büro und überraschte ihn dabei, wie er auf dem Boden kniend ein Detail in Gougers neustem Meisterwerk nacharbeitete.
Nach der ersten verblüfften Sekunde fing ich an zu lachen. Zum Teil wegen Tiernans Gesichtsausdruck, eine Mischung aus hochrotem schlechten Gewissen und aufgeblasenem Trotz, während er nach einer plausiblen Ausrede suchte; zum Teil über mich selbst, weil ich völlig ahnungslos und naiv bei der ganzen Chose mitgemischt hatte, wo es doch schon vor Monaten bei mir hätte Klick machen müssen (seit wann nahm Tiernan unterprivilegierte Jugendliche überhaupt wahr?). »Sieh mal einer an«, sagte ich noch immer lachend. »Wer hätte das gedacht?«
»Pssst«, zischte Tiernan, riss die Hände hoch und blickte hektisch zur Tür.
»Der gute alte Gouger. Wie er leibt und lebt.«
»Menschenskind, halt die Klappe, bitte, Richard ist gleich –«
»Du siehst besser aus, als ich dachte.«
»Toby. Hör mal. Nein, nein, hör mir zu.« Er hielt die halbgespreizten Arme über das Bild, so dass es lächerlicherweise aussah, als versuche er, es zu verstecken. Gemälde? Welches Gemälde denn? »Wenn das rauskommt, bin ich erledigt, dann krieg ich doch nie wieder –«
»Tiernan, hey«, sagte ich. »Jetzt beruhig dich mal.«
»Die Bilder sind gut, Toby. Sie sind gut. Aber das ist meine einzige Chance. Keiner guckt sie sich auch nur an, wenn sie von mir kommen. Ich war auf der Kunstakademie –«
»Geht’s bloß um die Gouger-Sachen? Oder auch noch um andere?«
»Bloß Gouger. Ehrenwort.«
»Mhm«, sagte ich mit einem Blick über seine Schulter. Das Bild war typisch Gouger, eine dicke Schicht schwarze Farbe, in die zwei erbittert kämpfende junge Männer hineingekratzt waren, und in sie wiederum eine Wand aus akribisch gezeichneten Balkonen, mit winzigen, anschaulichen Szenen, die sich auf jedem einzelnen von ihnen abspielten. Er musste ewig daran gearbeitet haben. »Seit wann hast du das geplant?«
»Schon länger, ich weiß nicht.« Tiernan blinzelte mich an. Er war sehr aufgewühlt. »Was hast du jetzt vor? Gehst du zu …?«
Wahrscheinlich hätte ich schnurstracks zu Richard marschieren und ihm die ganze Geschichte erzählen sollen. Zumindest hätte ich mir einen Vorwand ausdenken sollen, um Gougers Arbeiten aus der Ausstellung zu nehmen (seine Feinde waren ihm auf den Fersen, irgendwas in der Art – ihm eine Überdosis zu verpassen hätte ihn bloß noch faszinierender gemacht). Ehrlich gesagt, ich dachte nicht mal im Traum daran. Alles lief wie geschmiert, alle Beteiligten waren mehr als zufrieden. Die Notbremse zu ziehen hätte vielen Leuten die Stimmung versaut, und meiner Meinung nach bestand dafür überhaupt kein vernünftiger Grund. Selbst wenn man die Moralfrage hätte stellen wollen, war ich im Grunde auf Tiernans Seite: Der selbstquälerische Mittelschichtsglaube, dass Armut und Kleinkriminalität einen Menschen wie durch Zauberhand wertvoller machen, tiefer verbunden mit irgendeinem Urquell künstlerischer Wahrheit, ja sogar realer, war mir schon immer fremd. Für mich war die Ausstellung noch genau so, wie sie es vor zehn Minuten gewesen war. Wenn die Leute die absolut überzeugenden Arbeiten direkt vor ihren Augen übersehen und sich stattdessen lieber auf die erbauliche Illusion dahinter konzentrieren wollten, war das ihr Problem, nicht meins.
»Entspann dich«, sagte ich – in dem Zustand, in dem Tiernan war, wäre es grausam gewesen, ihn länger zappeln zu lassen. »Ich werde gar nichts machen.«
»Ehrlich nicht?«
»Indianerehrenwort.«
Tiernan atmete tief und zittrig aus. »Okay. Okay. Wow. Hatte gerade echt Panik.«
»Weißt du, was?«, sagte ich. »Du solltest noch mehr Lagerfeuerbilder machen. Eine ganze Serie.«
Tiernans Augen leuchteten auf. »Findest du?«, sagte er. »Gar keine schlechte Idee, vom Bau des Lagerfeuers, bis es zu Asche zerfällt, Dämmerung …« Er drehte sich zu seinem Schreibtisch um, griff nach Papier und Stift, die ganze Episode schon fast vergessen. Ich ließ ihn allein.
Nach diesem kleinen Wackler liefen die Vorbereitungen für die Vernissage ungestört weiter. Tiernan, der auf Hochtouren an Gougers Lagerfeuer-Serie arbeitete, schlief kaum mehr als zwei Stunden pro Nacht, aber falls irgendwem sein übermüdetes, ungepflegtes Äußeres und ständiges Gähnen auffiel, bestand noch lange kein Grund, einen Zusammenhang zu den Bildern herzustellen, die er mit triumphierender Regelmäßigkeit anschleppte. Ich machte aus Gougers Anonymität ein fast Banksy-artiges Mysterium, mit zig gefakten Twitter-Accounts, wo in halbgebildeter, mit Abkürzungen gespickter Sprache darüber diskutiert wurde, ob er der Typ aus Ballymun war, der damals mit dem Messer auf Mixie losgegangen war, und falls ja, dass Mixie es auf ihn abgesehen hatte. Die Medien stürzten sich darauf, und die Zahl unserer Follower ging durch die Decke. Tiernan und ich überlegten halb im Ernst, ob wir einen authentischen Asi als Gesicht des Produkts engagieren sollten. Wir hätten ihm genug bezahlt, dass er seine Sucht finanzieren könnte (natürlich hätte es ein Süchtiger sein müssen, um größtmögliche knallharte Authentizität zu gewährleisten), doch letztlich entschieden wir uns dagegen, weil ein Asi-Junkie nicht genügend Weitblick hätte, um zuverlässig zu sein: Früher oder später würde er entweder anfangen, uns zu erpressen, oder die kreative Kontrolle übernehmen wollen, und dann hätten wir ein echtes Problem.
Ich schätze, ich hätte mir Sorgen machen sollen, dass irgendwas schiefgehen könnte, aber ich hatte keine Bedenken. Sich wegen irgendwas Sorgen zu machen war mir immer wie eine unnütze Verschwendung von Zeit und Energie erschienen; es war so viel einfacher, fröhlich sein Ding zu machen, und sich mit dem Problem zu befassen, wenn es auftauchte, falls es auftauchte, was es meistens nicht tat. Deshalb war ich völlig unvorbereitet, als Richard von der Sache erfuhr, nur einen Monat vor der geplanten Ausstellungseröffnung und nur vier Tage vor jenem Abend.
Mir ist bis heute nicht ganz klar, wie eigentlich. Irgendein Telefonanruf, nach dem wenigen, was ich mitbekam (gegen meine Bürotür gepresst, den blättrigen weißen Anstrich anstarrend, mein Herzschlag immer schneller, bis er ein unangenehmes Pochen in der Kehle war), jedenfalls schmiss er Tiernan so schnell und mit einem solchen Wutausbruch raus, dass wir kein einziges Wort mehr wechseln konnten. Dann kam Richard in mein Büro – ich sprang gerade noch rechtzeitig zurück, um die Tür nicht ins Gesicht zu bekommen – und sagte, ich sollte verschwinden und mich vor Freitag nicht wieder blicken lassen. Bis dahin würde er sich überlegen, wie es mit mir weitergehen sollte.
Ein Blick auf ihn genügte – das Gesicht kalkweiß, Kragen verrutscht, Kiefer angespannt wie eine geballte Faust –, und ich wusste, dass ich besser den Mund hielt, selbst wenn ich die Chance gehabt hätte, mir irgendwas Sinnvolles einfallen zu lassen, bevor die Tür mit solcher Wucht hinter ihm zuknallte, dass Papiere von meinem Schreibtisch gefegt wurden. Ich packte meine Sachen und ging, mied die runden, sensationsgierigen Augen unserer Buchhalterin Aileen, die durch einen Türspalt lugte, bemühte mich auf der Treppe nach unten um möglichst lässige und schwungvolle Schritte.
Die folgenden drei Tage verbrachte ich größtenteils gelangweilt. Es wäre idiotisch gewesen, irgendwem zu erzählen, was passiert war, solange noch die Möglichkeit bestand, dass sich das Ganze in Wohlgefallen auflöste. Die schiere Intensität von Richards Zorn hatte mich erschreckt – aber ich war zuversichtlich, dass er bloß einen schlechten Tag gehabt hatte und sich schon wieder beruhigt haben würde, wenn ich zurück ins Büro kam. Also hockte ich den ganzen Tag zu Hause, damit mich keiner draußen herumspazieren sah, wo ich doch hätte arbeiten müssen. Ich konnte nicht mal irgendwen anrufen. Ich konnte auch nicht bei Melissa übernachten oder sie bei mir, weil wir manchmal morgens zusammen zur Arbeit gingen – ihr Laden lag nur fünf Minuten von der Galerie entfernt, deshalb liefen wir nach einer gemeinsamen Nacht meistens zu Fuß, plauderten dabei und hielten Händchen wie zwei Teenager. Ich erzählte ihr was von einer Erkältung, überredete sie, nicht zu mir zu kommen, um sich um mich zu kümmern, damit sie sich nicht ansteckte, und dankte Gott, dass sie keine Frau war, die gleich den Verdacht hatte, ich würde sie betrügen. Ich spielte viel zu viel auf meiner Xbox und zog mich arbeitsmäßig an, wenn ich einkaufen ging, nur für alle Fälle.
Zum Glück wohnte ich nicht in einer Gegend, wo sich die Nachbarn jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit fröhlich zuwinkten und jemand gleich besorgt mit Keksen bei mir auftauchte, wenn ich mich mal einen Tag nicht blicken ließ. Meine Wohnung lag im Erdgeschoss eines klobigen Backsteinbaus aus den 1970er Jahren, ein optischer Schandfleck, der zwischen herrliche viktorianische Villen in einem ausnehmend schönen Teil Dublins gequetscht worden war. Die Straße war breit und luftig, von riesigen alten Bäumen gesäumt, deren Wurzeln die Straßendecke an vielen Stellen angehoben hatten, und der Architekt war immerhin so feinfühlig gewesen, das mit zu berücksichtigen. Mein Wohnzimmer hatte große deckenhohe Fenster und Glastüren auf beiden Seiten, so dass der ganze Raum im Sommer ein herrliches Vexierspiel aus Sonnenschein und Laubschatten war. Aber abgesehen von diesem einen Geniestreich hatte er das Haus ziemlich vermurkst: Die Fassade war bedrückend zweckmäßig, und die Flure hatten das halluzinatorische, grenzwertige Ambiente eines Flughafenhotels, langer, schnurgerader brauner Teppichboden, der sich in der Ferne verlor, lange, schnurgerade Wände mit beiger Strukturtapete und billigen Holztüren auf beiden Seiten, dreckige Wandleuchten aus Kristallglas, die käsig gelbes Licht abgaben. Die Nachbarn bekam ich absolut nie zu Gesicht. Hin und wieder hörte ich einen dumpfen Knall, wenn jemand eine Etage über mir was fallen ließ, und einmal hielt ich die Tür für einen Buchhaltertyp mit Akne und etlichen Einkaufstüten von Marks & Spencer auf, doch ansonsten hätte ich auch genauso gut der einzige Bewohner sein können. Es würde also niemandem auffallen oder irgendwen interessieren, dass ich nicht zur Arbeit ging, sondern stattdessen MP-Nester in die Luft jagte und mir nette Galerie-Anekdoten einfallen ließ, die ich Melissa abends am Telefon erzählen konnte.
Dann und wann geriet ich doch ein wenig in Panik. Tiernan ging nicht ans Handy, selbst wenn ich von meinem rufnummerunterdrückten Festnetztelefon aus anrief, also hatte ich keine Ahnung, wie umfassend er mich in die Pfanne gehauen hatte, obwohl seine ausbleibende Kontaktaufnahme mich nicht gerade zuversichtlich stimmte. Ich redete mir ein, wenn Richard mich hätte feuern wollen, hätte er das auf der Stelle getan, so wie er das mit Tiernan gemacht hatte. Die meiste Zeit erschien mir das auch vollkommen und beruhigend logisch, aber immer mal wieder gab es Momente (meistens mitten in der Nacht, wenn ich die Augen jäh aufgerissen hatte, weil ein blasser Lichtstrahl bedrohlich über meine Schlafzimmerdecke glitt, während draußen kaum hörbar ein Auto vorbeifuhr), in denen mir das volle Ausmaß der ganzen Sache schlagartig und erschreckend klarwurde. Falls ich meinen Job verlor, wie sollte ich das vor anderen geheim halten – vor meinen Freunden, meinen Eltern, o Gott, vor Melissa –, bis ich einen neuen gefunden hatte? Überhaupt, was, wenn ich keinen neuen fand? Die ganzen großen Firmen, zu denen ich behutsam Kontakt aufgenommen hatte, würden meinen plötzlichen Abgang in der Galerie mitbekommen, und das wär’s dann: Falls ich je wieder Arbeit finden wollte, würde ich das Land verlassen müssen, und selbst das würde mir vielleicht nicht viel nützen. Und apropos das Land verlassen: Könnten sie Tiernan und mich wegen Betrügerei drankriegen? Wir hatten keines von Gougers Gemälden verkauft, Gott sei Dank, und wir hatten ja schließlich nicht behauptet, sie wären von Picasso, aber wir hatten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Fördermittel angenommen, das war doch bestimmt irgendwie strafbar …
Wie gesagt, ich war es nicht gewohnt, mir wegen irgendwas Sorgen zu machen, und die Intensität dieser Momente überraschte mich. Rückblickend ist es leicht, sie als vergebliche Vorwarnung zu sehen, ein wildes Gefahrensignal, das mir von der Wucht seiner eigenen Dringlichkeit entgegengeschleudert und dann von meinem begrenzten Verstand fehlgedeutet wurde, nur ganz leicht, aber verhängnisvoll. Damals betrachtete ich sie lediglich als Ärgernis, eines, von dem ich mich keinesfalls verrückt machen lassen würde. Wenn ich also einen Moment trudelnder Panik hatte, stand ich auf, schockte meinen Verstand mit dreißig Sekunden unter einer eiskalten Dusche aus dieser Endlosschleife, schüttelte mich wie ein Hund und machte weiter wie gehabt.
Am Freitagmorgen war ich ein bisschen nervös, immerhin so nervös, dass ich etliche Anläufe brauchte, um mich für ein Outfit zu entscheiden, von dem ich glaubte, dass es die richtige Botschaft vermittelte (seriös, zerknirscht, bereit, wieder an die Arbeit zu gehen) – letzten Endes entschied ich mich für meinen dunkelgrauen Tweedanzug mit einem schlichten weißen Hemd ohne Krawatte. Trotzdem war ich relativ zuversichtlich, als ich an Richards Tür klopfte. Selbst sein knappes »Herein« brachte mich nicht aus der Ruhe.
»Ich bin’s«, sagte ich und schielte zaghaft um die Tür.
»Ich weiß. Setz dich.«
Richards Büro war ein wildes Nest aus geschnitzten Antilopen, Sanddollars, Matisse-Drucken, Sachen, die er von Reisen mitgebracht hatte, allesamt wackelig auf Regalbrettern und Bücherstapeln und übereinander arrangiert. Er blätterte ziellos in einem dicken Packen Papiere. Ich zog einen Stuhl vor seinen Schreibtisch, leicht schräg, als wollten wir uns gemeinsam Druckproben von Werbebroschüren ansehen.
Er wartete, bis ich mich gesetzt hatte, und sagte dann: »Du weißt, worum es geht.«
Den Arglosen zu spielen wäre ein großer Fehler gewesen. »Gouger«, sagte ich.
»Gouger«, wiederholte Richard. »Genau.« Er nahm ein Blatt von seinem Stapel, starrte ein paar Sekunden lang blicklos darauf und ließ es wieder fallen.
»Wann bist du dahintergekommen?« Ich betete innerlich, dass Tiernan die Klappe gehalten hatte.
»Vor ein paar Wochen. Zwei. Vielleicht drei.« Es war sehr viel länger her. Dann sah Richard mich an. »Und du hast mich nicht informiert.«
Kalter Unterton in seiner Stimme. Er war noch immer wütend, richtig wütend. Ich drehte die Intensität ein bisschen höher. »Hätte ich fast. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, als ich es herausgefunden hab, war die Sache schon zu weit gegangen, fand ich. Gougers Zeug war auf unserer Website, auf der Einladung – ich weiß ganz genau, dass die Sunday Times und der Botschafter nur wegen ihm zugesagt hatten –« Ich redete zu schnell, quasselte, und das klang, als wäre ich schuldig. Ich zwang mich, langsamer zu werden. »Ich hab nur gedacht, wie suspekt das aussehen würde, wenn er so kurz vor der Vernissage verschwinden würde. Das hätte alles in ein schlechtes Licht rücken können. Die ganze Galerie.« Richards Augen schlossen sich einen Moment betroffen. »Und ich wollte dir nicht die Verantwortung aufhalsen. Also hab ich einfach –«
»Die hab ich jetzt aber. Und du hast recht, es wird tatsächlich extrem suspekt aussehen.«
»Wir können das hinkriegen. Ehrlich. Ich hab mir in den letzten drei Tagen eine Lösung überlegt. Bis heute Abend können wir alles regeln.« Wir, wir: Wir sind noch immer ein Team. »Ich setze mich mit den geladenen Gästen und Kritikern in Verbindung, erkläre ihnen, dass sich eine kleine Veränderung bei den Teilnehmern ergeben hat und dass wir dachten, das würde sie interessieren. Ich werde sagen, dass Gouger kalte Füße gekriegt hat – er denkt, seine Feinde sind ihm auf der Spur, er muss eine Zeitlang untertauchen. Ich werde sagen, wir sind ausgesprochen zuversichtlich, dass er seine persönlichen Probleme bald aus der Welt geschafft hat und dann doch noch bei uns ausstellen wird – wir müssen sie bei Laune halten, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich werde erklären, dass das eben die Risiken sind, die man eingeht, wenn man sich auf Menschen mit diesem sozialen Hintergrund einlässt, dass uns dieser Fehlschlag selbstverständlich leidtut, wir aber dennoch nicht bereuen, ihm eine Chance gegeben zu haben. Da müsste man schon ein Unmensch sein, wenn man damit Probleme hat.«
»Du bist sehr gut in so was«, sagte Richard matt. Er nahm seine Brille ab und massierte sich mit Daumen und Zeigefinger den Nasenrücken.
»Das muss ich auch sein. Ich hab bei dir was gutzumachen.« Er reagierte nicht. »Wir werden ein paar Kritiker verlieren, und vielleicht auch ein paar Gäste, aber nicht so viele, dass es ins Gewicht fällt. Ich glaube, wir haben gerade noch Zeit, das Programm zu ändern, bevor es in Druck geht. Wir können das Cover überarbeiten, Chantelles Sofa-Assemblage draufsetzen –«
»Und das alles wäre vor drei Wochen sehr viel leichter zu machen gewesen.«
»Ich weiß. Ich weiß. Aber es ist nicht zu spät. Ich rede mit den Medien, sorge dafür, dass sie die Sache nicht hochspielen, damit wir ihn nicht ein für alle Mal verscheuchen –«
»Oder«, sagte Richard und setzte seine Brille wieder auf, »wir könnten eine Pressemitteilung herausgeben und bekannt machen, dass wir Gouger als Betrüger entlarvt haben.«
Er sah zu mir hoch, sanfte blaue Augen, vergrößert und forschend.
»Nun ja«, sagte ich vorsichtig. Das »wir« hatte mir Mut gemacht, aber seine Idee war grottenschlecht, und das musste ich ihm begreiflich machen. »Könnten wir. Aber das würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Absage der gesamten Ausstellung bedeuten. Ich meine, ich könnte mir überlegen, wie wir das am besten darstellen, vielleicht darauf hinweisen, dass wir seine Arbeiten rausgenommen haben, sobald wir dahintergekommen sind, aber dann stehen wir trotzdem noch als unbedarft da, und das wirft dann Fragen auf, was die anderen –«
»Schon gut«, sagte Richard, wandte das Gesicht ab und hob eine Hand, um mich zu bremsen. »Das weiß ich alles. Wir werden’s nicht machen. Ich würde gerne, weiß Gott, aber wir lassen es bleiben. Los, mach das andere, alles, was du vorgeschlagen hast. Und zwar schnell.«
»Richard«, sagte ich aus tiefstem Herzen. Als ich ihn ansah, diese ungewohnte Erschöpfung sah, die an ihm zu zehren schien, fühlte ich mich furchtbar. Richard hatte mich immer fair behandelt; wenn ich auch nur geahnt hätte, dass ihn die Sache so mitnehmen würde, hätte ich es nicht so weit kommen lassen, niemals – »Es tut mir echt leid.«
»Tatsächlich?«
»Gott, ja, ich schwöre. Ich hab mich grundfalsch verhalten. Aber … die Bilder sind doch so gut. Ich wollte, dass die Leute sie sehen. Ich wollte, dass wir sie ausstellen. Ich hab mich da mitreißen lassen. So einen Fehler mache ich nie wieder.«
»Also gut. Schön.« Er sah mich noch immer nicht an. »Geh und häng dich ans Telefon.«
»Ich bring das in Ordnung. Versprochen.«
»Ganz bestimmt«, sagte Richard ausdruckslos, »jetzt geh«, und er fing wieder an, seine Papiere zu sortieren.
Ich nahm die Treppe nach unten zu meinem Büro im Laufschritt, total erleichtert, plante schon den Sturm aus Spekulationen und düsteren Prophezeiungen von Gougers Twitter-Followern. Richard war offensichtlich noch sauer auf mich, aber das würde sich schon legen, wenn er sah, dass alles geregelt und wieder auf Kurs war, oder spätestens dann, wenn die Ausstellungseröffnung ein Erfolg wurde. Es war schade um Tiernans Bilder – nach dieser Geschichte waren sie wohl dazu verdammt, in seinem Atelier Staub anzusetzen, obwohl ich nicht ausschließen wollte, dass ihm irgendwann doch noch eine andere Lösung einfallen würde –, aber er konnte ja schließlich neue machen.
Ich brauchte ein Bier, genauer gesagt, ich brauchte etliche Biere, genauer gesagt, ich brauchte einen richtig guten Abend in der Kneipe. Ich sehnte mich nach Melissa – normalerweise verbrachten wir mindesten drei Nächte die Woche zusammen –, aber was ich jetzt brauchte, waren meine Kumpel, das gegenseitige Gefrotzel und die leidenschaftlichen absurden Debatten und eine von diesen in letzter Zeit so selten gewordenen endlosen Sauftouren, nach denen alle so gegen Morgen bei irgendwem den Kühlschrank leerfuttern und auf dem Sofa einpennen. Ich hatte richtig gutes Haschisch zu Hause – in der Woche war ich mehrmals versucht gewesen, es rauszuholen, aber eigentlich trank oder kiffte ich nicht gern, wenn es gerade nicht gut lief, weil ich immer befürchtete, mich dann noch schlechter zu fühlen; deshalb hatte ich meinen Vorrat aufbewahrt, um zu beweisen, dass ich an ein Happy End mit Feier glaubte, und ich hatte recht behalten.
Also: das Hogan’s, auf dem Handy Strände auf den Fidschis angucken, dann und wann die Hand ausstrecken, um an Decs Haarsträhnen zu zupfen (»Lass den Scheiß!«). Ich hatte nicht vorgehabt, die Ereignisse der Woche zu erwähnen, aber ich war betrunken und sprudelte über vor Erleichterung, und etwa bei der fünften Runde erzählte ich ihnen die ganze Geschichte, ließ nur die nächtlichen Panikattacken weg – die mir im Rückblick noch alberner vorkamen – und streute hier und da zur Belustigung noch ein paar zusätzliche Pointen ein.
»Du Schwachkopf«, sagte Sean am Ende, aber er schüttelte den Kopf und lächelte etwas gequält. Ich war ein wenig erleichtert. Seans Meinung war mir schon immer wichtig, und Richards Reaktion hatte einen unangenehmen Nachgeschmack bei mir hinterlassen.
»Du bist echt ein Schwachkopf«, sagte Dec mit noch mehr Nachdruck. »Das hätte dir ganz schön um die Ohren fliegen können.«
»Es ist mir um die Ohren geflogen.«
»Nein. Ich meine so richtig. Ich meine, du hättest deinen Job verlieren, vielleicht sogar verhaftet werden können.«
»Tja, ist aber nicht passiert«, sagte ich gereizt – das war nun wirklich das Letzte, woran ich in diesem Moment denken wollte, und das hätte Dec klar sein müssen. »In welcher Welt lebst du eigentlich, dass du denkst, die Bullen würden sich dafür interessieren, ob ein Bild von irgendeinem Nobody im Trainingsanzug stammt oder von irgendeinem Nobody mit Seidenschal?«
»Die Ausstellung hätte abgesagt werden können. Dein Boss hätte die Notbremse ziehen können.«
»Hat er aber nicht. Und selbst wenn, wäre das ja wohl kein Weltuntergang gewesen.«
»Für dich vielleicht nicht. Aber was ist mit den Kids, die die Kunst machen? Die hängen sich so richtig rein, und du machst dich über sie lustig, als wären sie ein Witz.«
»Inwiefern hab ich mich über sie lustig gemacht?«
»Da haben die zum ersten Mal eine echte Chance, und du setzt das alles nur so zum Spaß aufs Spiel …«
»Ach, hör doch auf.«
»Wenn du das vermasselt hättest, wären die doch nie aus ihrem Elend rausgekommen.«
»Red keinen Scheiß. Die hätten zur Schule gehen können. Anstatt Klebstoff zu schnüffeln und die Seitenspiegel von Autos abzubrechen. Die hätten sich Jobs suchen können. Die Rezession ist vorbei. Jeder kann aus seinem Elend raus, wenn er das wirklich will.«
Dec starrte mich fassungslos mit großen Augen an, als hätte ich mir einen Finger tief in die Nase geschoben. »Du hast ja keine Ahnung, Mann.«
Dec war mit einem Stipendium in unsere Schule gekommen. Sein Dad war Busfahrer, und seine Mutter war Verkäuferin bei Arnotts, und beide waren nie im Gefängnis oder süchtig gewesen, deshalb hatte er mit den Ausstellungskids genauso wenig gemeinsam wie ich, aber manchmal machte er gern einen auf Armeleutekind, wenn er einen Vorwand brauchte, um mürrisch und selbstgerecht zu werden. Er war noch immer eingeschnappt wegen der Sache mit seinen Haaren. Ich hätte ihm entgegenhalten können, dass er selbst das beste Beispiel war, um seinen scheinheiligen Bullshit zu widerlegen – er hockte nicht in einer besetzten Wohnung und schnüffelte geklaute Sprühfarbe, nein, er hatte Zeit und Mühe investiert und Karriere in der IT-Branche gemacht, quod erat demonstrandum –, aber ich war nicht in der Stimmung, auf ihn einzugehen, nicht an diesem Abend. »Du bist mit der nächsten Runde dran.«
»Du hast echt keine Ahnung.«
»Es ist echt deine Runde. Gehst du jetzt an die Theke und holst uns Nachschub, oder soll ich das übernehmen, weil du sozial benachteiligt aufgewachsen bist?«
Er starrte mich noch einen Moment länger an, aber ich ihn auch, und schließlich schüttelte er demonstrativ den Kopf und ging zur Theke.
»Was war das denn gerade?«, wollte ich wissen, als er außer Hörweite war. »Was sollte der Scheiß?«
Sean zuckte mit den Achseln. Bei der letzten Runde hatte er ein paar Päckchen Erdnüsse mitgebracht – ich hatte abends nichts gegessen, weil das Krisenmanagement der Gouger-Situation mich zu lange im Büro festgehalten hatte –, und jetzt beäugte er interessiert eine Nuss, an der irgendwas Undefinierbares klebte.
»Ich hab niemanden verletzt, Sean. Keinem ist was passiert. Er tut so, als hätte ich seine Oma über den Haufen gefahren.« Ich hatte das ernsthafte Stadium des Abends erreicht; ich saß über den Tisch gebeugt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu weit vorgebeugt. »Und überhaupt, er soll mal schön die Klappe halten. Er hat auch schon Blödsinn angestellt. Mehr als einmal.«
Sean zuckte erneut mit den Achseln. »Er hat Stress«, sagte er durch die Erdnuss.
»Hat er doch immer.«
»Er überlegt anscheinend, wieder was mit Jenna anzufangen.«
»Ach du Schande«, sagte ich. Jenna war Decs neuste Ex, eine eindeutig verrückte Lehrerin, die ein paar Jahre älter war als er und die mir einmal unter einem Kneipentisch den Oberschenkel gestreichelt hatte. Als ich sie verblüfft ansah, hatte sie mir zugezwinkert und die Zunge rausgestreckt.
»Genau. Aber er findet das Singleleben furchtbar. Meint, er ist allmählich zu alt für erste Dates, und mit diesem Tinder-Mist kommt er nicht klar, und er will nicht der vierzigjährige Loser sein, den man aus Mitleid zum Essen einlädt und mit der geschiedenen Frau verkuppeln will, die dann den ganzen Abend über ihren Ex lästert.«
»Tja, das muss er aber nicht an mir auslassen«, sagte ich. Ehrlich gesagt, ich konnte mir tatsächlich vorstellen, dass Dec genau so enden würde, aber dann wäre das seine eigene Schuld, und in dem Moment fand ich, er hätte es auch verdient.
Sean saß entspannt zurückgelehnt, beobachtete mich mit einem Gesichtsausdruck, der Erheiterung hätte sein können oder bloß mildes Interesse. Er hatte schon immer diese Aura entspannter Distanziertheit gehabt, als hätte er – unangestrengt und ohne Überheblichkeit – die Lage ein bisschen besser im Griff als alle anderen. Irgendwie erklärte ich mir das immer mit der Tatsache, dass seine Mutter gestorben war, als er vier war – etwas, das ich mit einer Mischung aus Schrecken, Verlegenheit und Ehrfurcht betrachtete –, aber es könnte auch einfach daran gelegen haben, dass er so groß war: In jeder alkoholgeschwängerten Situation war Sean stets am wenigsten betrunken von allen. Er schüttelte sich den letzten Rest Erdnusskrümel in die hohle Hand und sagte: »Ehrlich? Ich finde, das ist Kinderkram.«
Ich wusste nicht genau, ob ich mich beleidigt fühlen sollte oder nicht – machte er meinen Job runter, wollte er mir sagen, dass es keine große Sache war, oder was? »Wie meinst du das?«
»Gefakte Twitter-Accounts«, sagte Sean. »Erfundene Bandenkriege. Irgendwelches Zeug hinter dem Rücken vom Boss einschmuggeln, drauf hoffen, dass es nicht rauskommt. Kinderkram.«
Diesmal war ich wirklich gekränkt, zumindest ein wenig. »Verdammt nochmal. Schlimm genug, dass Dec mir blöd kommt. Fang du nicht auch noch an.«
»Tu ich gar nicht. Bloß …« Er zuckte mit den Schultern und leerte sein Glas. »Ich heirate in ein paar Monaten, Alter. Audrey und ich überlegen, nächstes Jahr ein Kind zu bekommen. Da kann ich mich nur schwer dafür begeistern, dass du noch immer die alten Nummern abziehst.« Und als ich verärgert die Augenbrauen runterzog: »Solche Sachen hast du schon immer gemacht, seit ich dich kenne. Manchmal bist du erwischt worden. Hast jedes Mal noch die Kurve gekriegt. Das ist bloß wieder dein altes Strickmuster.«
»Nein. Nein. Das hier ist –« Ich machte eine weite, schwingende Armbewegung, die mit einem effektvollen Fingerschnippen endete; sie fühlte sich an wie eine eigenständige Aussage, doch Sean musterte mich noch immer forschend. »Das hier ist anders. Als die früheren Male. Das ist nicht dasselbe. Überhaupt nicht.«
»Und wo ist der Unterschied?«
Die Frage ärgerte mich. Ich wusste, dass es einen Unterschied gab, und ich fand es kleinlich von Sean, nach so viel Bier noch eine Erklärung von mir zu verlangen. »Schon gut. Vergiss, dass ich was gesagt hab.«
»Ich will dir nicht blöd kommen. Ich frage bloß.«
Er hatte sich nicht bewegt, aber jetzt war etwas Neues und Waches in seinem Gesicht, eine unverwandte Aufmerksamkeit, als wäre da irgendwas Wichtiges, was er von mir hören wollte. Ich verspürte den unerklärlichen Drang, mich ihm zu erklären, über Melissa zu reden, mein Alter, die großen Firmen und endlich Ernst zu machen, ihm zu erzählen, dass ich mir in letzter Zeit manchmal – Dec gegenüber hätte ich das niemals zugegeben, ich hatte es nicht mal Melissa gestanden – ein großes weißes georgianisches Haus mit Blick auf die Dublin Bay vorstellte, Melissa und ich gemütlich unter einer von ihren Kaschmirdecken vor einem prasselnden Kaminfeuer, vielleicht sogar zwei oder drei blonde Kinder, die mit einem Golden Retriever auf dem Teppich herumtollten. Noch vor ein paar Jahren hätte es mich bei dieser Vorstellung geschüttelt; jetzt fand ich sie eigentlich gar nicht mehr so übel.
Ich war weiß Gott nicht in der richtigen Verfassung, um Sean solche aufkeimenden Einsichten zu beschreiben – bei den »aufkeimenden Einsichten« wäre ich mit Sicherheit ins Lallen geraten –, aber ich versuchte es, so gut ich konnte. »Okay«, sagte ich. »Okay. Die ganzen anderen Male, die du meinst, das war Kinderkram. Einfach aus Quatsch oder weil ich eine Gratispizza wollte oder die Chance, mit Lara Mulvaney rumzuknutschen. Aber wir sind keine Kinder mehr. Das weiß ich. Das ist mir klar. Ich meine, wir sind noch nicht so ganz erwachsene Erwachsene, aber wir sind auf jeden Fall dicht davor – tja, wem sag ich das? Ich weiß, wir haben dich vorhin ein bisschen auf die Schippe genommen, aber ganz ehrlich, was du mit Audrey hast, das ist großartig. Du wirst bald …« Ich hatte den Faden verloren. Es wurde immer lauter in der Kneipe, und die Akustik verkraftete den Lärm nicht mehr, alle Geräusche verschwammen zu einem einzigen stotternden Dröhnen, das von allen Seiten kam. »Jawohl. Und genau darum ging’s bei dieser Gouger-Sache. Dafür hab ich das gemacht. Mir schweben jetzt große Dinge vor. Es geht mir nicht mehr um die Gratispizza. Es geht um was Reales. Und das ist der Unterschied.«
Ich lehnte mich zurück und sah Sean hoffnungsvoll an.
»Schön«, sagte er nach einem Moment, der sich eine halbe Sekunde zu lang anfühlte. »In Ordnung. Viel Glück dabei, Mann. Ich hoffe, du bekommst, was dir vorschwebt.«
Vielleicht bildete ich es mir nur ein, oder es lag an dem wogenden Krach um uns herum, aber er klang reserviert, fast enttäuscht, nur wieso?
Er schien leider nicht zu begreifen, dass es bei dieser Gouger-Sache tatsächlich darum gegangen war, was zu verändern – je größer der Erfolg der Ausstellung, desto größer meine Chancen bei den großen Firmen, desto eher rückte das Traumhaus für Melissa und mich in erreichbare Nähe und so weiter und so weiter –, aber bevor ich die richtigen Worte fand, um ihm das verständlich zu machen, kam Dec mit der nächsten Runde zurück. »Weißt du, was du bist?«, fragte er mich, als er die Gläser abstellte und dabei wirklich nur ein bisschen Bier auf den Tisch schwappte.
»Er ist ein Schwachkopf«, sagte Sean und warf einen Bierdeckel auf die Pfütze. Seine plötzliche intensive Anteilnahme war verschwunden, er war wieder so gelassen und entspannt wie immer. »Das hatten wir schon.«
»Nein. Ich will’s von ihm wissen. Weißt du, was du bist?«
Dec grinste, doch der Ton hatte sich verändert; er hatte jetzt ein bedenkliches, streitlustiges Funkeln an sich. »Ich bin ein Prinz unter den Menschen«, sagte ich, lehnte mich zurück, Beine gespreizt, und grinste ihn frech an.
»Na bitte.« Er zeigte triumphierend auf mich, als hätte er gerade einen Treffer erzielt. »Genau das meine ich.« Und als ich nicht darauf einging, zog er seinen Stuhl streitlustig näher an den Tisch und fragte: »Wie wäre es mir ergangen, wenn ich im Beruf so eine dämliche Scheißnummer abgezogen hätte?«
»Du wärst hochkant rausgeflogen.«
»Ganz genau. Ich hätte schon längst meine Mum angerufen und gefragt, ob ich bei ihr wohnen darf, bis ich einen neuen Job gefunden hab und wieder Miete zahlen kann. Warum ist das bei dir nicht so?«
Sean seufzte schwer und schüttete ein gutes Drittel von seinem Bier in sich hinein. Wir wussten beide, wie Dec sein konnte, wenn er in dieser Stimmung war: Seine Sticheleien gegen mich würden immer aggressiver werden, eine Spitze nach der anderen, bis er mich auf hundertachtzig hatte oder aber so besoffen war, dass wir ihn in ein Taxi verfrachten und dem Fahrer die Adresse plus Fahrgeld geben mussten.
»Weil ich ein Charmeur bin«, sagte ich. In gewisser Weise stimmte das auch – die meisten Leute mochten mich, und dieser Umstand hatte mir schon oft aus der Klemme geholfen –, aber das war völlig nebensächlich, und ich sagte es bloß, um Dec zu ärgern. »Und du nicht.«
»Nee, nee, nee. Weißt du, warum? Weil du nicht zur Miete wohnst. Deine Eltern haben die Wohnung für dich gekauft.«
»Nein, haben sie nicht. Sie haben bloß die Anzahlung hingeblättert. Die Hypothek zahl ich selbst ab. Und was zum Teufel hat das zu tun mit –«
»Und wenn du wirklich mal knapp dran wärst, würden sie deine Hypothek ein paar Monate lang hinblättern. Hab ich recht?«
»Keine Ahnung. Der Fall ist noch nie eingetreten.«
»Doch, würden sie. Deine Ma und dein Dad sind echt nett.«
»Ich weiß es nicht. Meinetwegen, vielleicht, na und?«
»Und« – Dec zeigte auf mich, lächelte noch immer, ein Lächeln, das freundlich hätte wirken können, wenn ich es nicht besser gewusst hätte –, »und deshalb hat dein Boss dir keinen Tritt in den Hintern gegeben. Weil du nicht verzweifelt warst. Weil du nicht panisch warst. Du hast gewusst, egal wie die Sache ausgeht, du kommst mit einem blauen Auge davon. Und deshalb bist du mit einem blauen Auge davongekommen.«
»Ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, weil ich mich bei Richard entschuldigt habe und ihm erklärt habe, wie ich die Sache wieder in Ordnung bringen kann. Und weil ich gut in meinem Job bin und er mich nicht verlieren will.«
»Genau wie in der Schule.« Dec war voll auf das Gespräch konzentriert: über den Tisch gebeugt, sein Bier vergessen. Sean hatte sein Handy rausgeholt und checkte wischend die neusten Nachrichten. »Zum Beispiel als du und ich Mr McManus das Toupet vom Kopf geklaut haben. Wir beide haben’s gemacht. Wir beide wurden gesehen. Wir beide mussten bei Armitage antanzen. Stimmt’s? Und was haben wir gekriegt?«
Ich verdrehte die Augen. Ich hatte ehrlich keine Ahnung.
»Du erinnerst dich nicht mal mehr dran.«
»Es interessiert mich nicht mehr.«
»Ich wurde suspendiert. Für drei Tage. Du musstest nachsitzen. Einen Nachmittag.«
»Das kann nicht dein Ernst sein.« Ich sah ihn ungläubig an. Allmählich hatte ich die Nase voll. Die Luft entwich aus meinem glänzenden Glücksballon der Erleichterung, und ich fand, nach der Woche, die hinter mir lag, hatte ich das Recht darauf, mich doch wenigstens einen Abend lang daran zu erfreuen. »Das ist vierzehn Jahre her. Bist du etwa heute noch angepisst deswegen?«
Dec wedelte mit einem Finger vor meinem Gesicht, schüttelte den Kopf. »Darum geht’s nicht. Es geht darum, dass du einen kleinen Klaps gekriegt hast und der Junge mit dem Stipendium eine ordentliche Tracht Prügel. Nein, hör mir zu, jetzt rede ich«, als ich mich auf meinem Stuhl nach hinten warf und die Decke anstarrte. »Ich sage ja nicht, dass Armitage das aus Bosheit gemacht hat. Ich sage, dass ich damals panische Angst hatte, von der Schule zu fliegen und in der beschissenen öffentlichen Schule zu landen. Du hingegen hast gewusst, wenn du fliegst, würden deine Eltern dir einfach eine andere gute Schule suchen. Das ist der Unterschied.«
Er wurde laut. Die Brünette verlor das Interesse an mir – zu viel Spannungen in der Luft um mich herum, zu viel Ärger –, da war ich völlig mit ihr einer Meinung. »Also«, sagte Dec. »Was bist du?«
»Ich kapier überhaupt nicht mehr, was du eigentlich von mir willst.«
»Himmelherrgott nochmal«, sagte Sean, ohne von seinem Handy aufzublicken. »Seid ihr bald fertig?«
Dec sagte: »Du bist ein vom Glück gesegnetes kleines Arschloch, das bist du. Mehr nicht. Bloß ein vom Glück gesegnetes kleines Arschloch.«
Ich überlegte noch, wie ich clever kontern sollte, als es mich auf einmal packte, warm und erhebend und unwiderstehlich wie ein thermischer Aufwind: Er hatte recht, er sagte absolut die Wahrheit, und es war nichts, worüber ich mich aufregen sollte, es war pure Freude. Ich holte tief Luft, so tief wie schon seit Tagen nicht mehr, und atmete mit einem prustenden Lachen aus. »Das bin ich«, sagte ich. »Genau das bin ich. Ich bin ein echter Glückspilz.«
Dec beäugte mich, noch nicht fertig, unschlüssig, welche Richtung er als Nächstes einschlagen sollte. »Amen«, sagte Sean, legte das Handy weg und hob sein Glas. »Trinken wir auf vom Glück gesegnete kleine Arschlöcher und auf einfach stinknormale Arschlöcher«, und er neigte sein Glas in Decs Richtung.
Ich fing wieder an zu lachen und stieß mit ihm an, und nach kurzem Zögern lachte Dec am lautesten und stieß sein Glas gegen unsere beiden, und wir kehrten zu der Frage zurück, wo wir unseren Urlaub verbringen sollten.
Aber die Idee, die beiden mit nach Hause zu nehmen, hatte ich abgehakt. Wenn Dec in dieser Stimmung war, wurde er unberechenbar und aggressiv – er hatte nicht die Traute, irgendwas wirklich Katastrophales anzustellen, aber mir war trotzdem nicht danach. Die Dinge fühlten sich ein bisschen heikel an, lose in den Nähten, als sollte man sie nicht zu fest anstoßen. Ich wollte mich auf meinem Sofa ausstrecken und mein Dope rauchen und angenehm kichernd zerfließen, nicht Dec im Auge behalten, während er aufgekratzt in meinem Wohnzimmer Sachen für ein improvisiertes Bowlingspiel zusammensuchte und ich tunlichst nichts anguckte, was zerbrechlich war, damit er nicht auf dumme Gedanken kam. Tief in meinem Inneren mache ich ihm das noch immer zum Vorwurf: Achtundzwanzig ist alt genug, um diese Art von bescheuertem Groll überwunden zu haben, und wenn Dec das geschafft hätte, wären er und Sean mit zu mir nach Hause gekommen und und und.
Danach wird alles wieder unscharf. Das Nächste, woran ich mich einigermaßen klar erinnere, ist, wie ich mich vor dem Pub von den Jungs verabschiede, Sperrstunde, lockere lärmende Grüppchen, die darüber debattieren, wohin sie jetzt gehen sollen, Köpfe über Feuerzeuge gebeugt, Frauen auf wackeligen hohen Absätzen, gelb leuchtende Taxischilder, die vorbeigleiten – »Hör mir mal zu«, sagte Dec mit hyperkonzentrierter trunkener Aufrichtigkeit zu mir, »nein, hör mir mal zu. Scherz beiseite. Ich bin froh, dass die Sache gut für dich gelaufen ist. Ehrlich. Du bist ein guter Mensch. Toby, im Ernst, ich bin überglücklich, dass es –« Er hätte in alle Ewigkeit so weitergemacht, doch Sean hielt ein Taxi an und bugsierte Dec mit einer Hand zwischen den Schulterblättern hinein, und dann nickte er mir zu, winkte kurz und spazierte Richtung Portobello und Audrey davon.
Ich hätte ein Taxi nehmen können, aber es war eine schöne Nacht, ruhig und kühl mit einem weichen, leichten Hauch, der für den Morgen noch mehr Frühling verhieß. Ich war betrunken, aber nicht so sehr, dass ich getorkelt wäre. Meine Wohnung war keine dreißig Gehminuten entfernt. Außerdem hatte ich Hunger. Ich wollte noch was zu essen kaufen, eine Riesenportion von irgendwas Scharfem und Würzigem. Ich knöpfte meinen Mantel zu und stiefelte los.
Ein Feuerschlucker am Ende der Grafton Street, der sein spärliches Publikum zu einem rhythmischen Klatschen anheizte, Betrunkene, die unverständliche Anfeuerungen oder blöde Bemerkungen grölten. Ein Obdachloser in einem blauen Schlafsack,