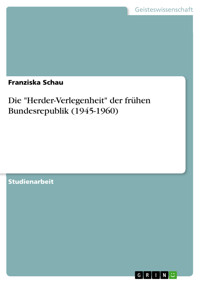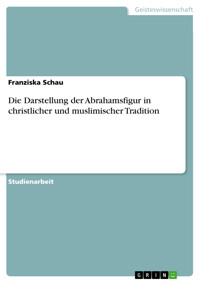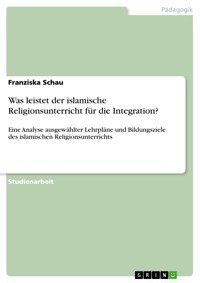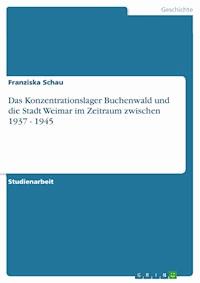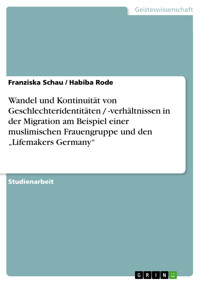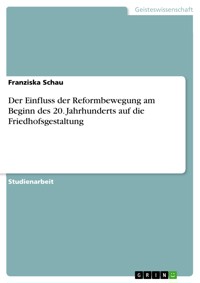
Der Einfluss der Reformbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts auf die Friedhofsgestaltung E-Book
Franziska Schau
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Kulturwissenschaften - Europa, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Institut für Volkskunde / Kulturgeschichte), Veranstaltung: Vom Umgang mit dem Tode. Tradition und Wandel in der Friedhofs- und Bestattungskultur, Sprache: Deutsch, Abstract: „[…] man findet Friedhöfe, die alles andere sind, als Stätten des Todes! […] Die letzte Wohnung des Menschen auf dieser Erde verlangt nach mehr Sinn und Eigenart, nach mehr Ausdruck!“ . Dieses Zitat entstammt einer populären Schrift aus dem Jahr 1926, welches die Ziele der Friedhofreformer widerspiegeln. In dieser Hausarbeit „Der Einfluss der Reformbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts auf die Friedhofsgestaltung“ wird aufgeführt, wie die Friedhofsreformbewegung begann und wie sie sich ausdehnte. Diesbezüglich werden signifikante Vertreter Hans Grässel und Otto Linne vorgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Friedhof, Grabmal und Friedhofsanlagen um 1900
3 Die Entfaltung der Friedhofsreformbewegung
3. 1 Die Grabmalreform
4 Die erste Phase der Friedhofsreformbewegung
4.1 Hans Grässel als Pionier der Friedhofsreformbewegung am Beispiel des Münchener Waldfriedhofes
4.2 Religion, Handwerk und Heimat als Provenienz Grässels
5 Die zweite Phase der Friedhofsreformbewegung – Die funktionale Wende
5.1 Otto Linne als Emissär der funktionalen Wende am Beispiel des Ohlsdorfer Friedhofs in Hamburg
6 Zusammenfassung
1 Einleitung
„[…] man findet Friedhöfe, die alles andere sind, als Stätten des Todes! […] Die letzte Wohnung des Menschen auf dieser Erde verlangt nach mehr Sinn und Eigenart, nach mehr Ausdruck!“[1]. Dieses Zitat entstammt einer populären Schrift aus dem Jahr 1926, welches die Ziele der Friedhofreformer widerspiegeln.
In dieser Hausarbeit „Der Einfluss der Reformbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts auf die Friedhofsgestaltung“ wird aufgeführt, wie die Friedhofsreformbewegung begann und wie sie sich ausdehnte. Diesbezüglich werden signifikante Vertreter Hans Grässel und Otto Linne vorgestellt.
2 Friedhof, Grabmal und Friedhofsanlagen um 1900
Der Friedhof des späten 19. Jahrhunderts besaß circa 30 Jahre lang einen parkähnlichen beziehungsweise landschaftlichen Charakter. Dies entsprach den Prinzipien der damaligen Landschafts- und Gartenarchitektur. Der „Verein deutscher Gartenkünstler“ legte sein Arbeitsfeld seit 1887 auf Friedhöfe; der parkartige Friedhof wurde hoch geschätzt und somit aktiv von der Gesellschaft gefördert. Friedhöfe der damaligen Zeit wurden oft von Gartenkünstlern verwaltet und somit gelang es, dieses parkartige Modell weitläufig durchzusetzen. Des Weiteren versprach dieses Friedhofsmodell einige Vorteile, beispielsweise in ästhetischer Sicht: durch reichhaltige Bepflanzung sollte der Friedhof optisch aufgewertet werden. Der landschaftliche Charakter des Friedhofs sollte tröstend und schmerzlindernd wirken; und als ökonomischer Vorzug wäre zu nennen, dass der Friedhof als öffentlicher Park genutzt werden kann, womit sich die höheren Investitionskosten rentieren würden.
Das Grabmal um 1900 war gekennzeichnet durch „[…] Repräsentationsfreude und Monumentalität[…]“[2]. Als Beispiele sind Großdenkmäler und Plastiken, sowie Familiengrabstätten zu nennen. Durch die Industrialisierung kamen neue Werkstoffe hinzu und die Erschließung neuer Verkehrswege ermöglichte neue Absatzmärkte, wodurch die vielfältigen Materialien überall hin gelangen konnten. Um 1900 herrschte völlige Gestaltungsfreiheit des Grabes; jeder legte Wert auf ein individuelles Grabmal. Dies war der ausschlaggebende Punkt der Friedhofsreformbewegung, da die sepulkrale Kultur der damaligen Zeit stark kritisiert wurde; es sollte eine Einheit geschaffen werden.
Auch die Friedhofsanlagen folgten nach 1900 dem Wandel der gartenkünstlerischen Gestaltungsprinzipien. Ein landschaftlicher Garten galt nicht mehr als Ideal, sondern wurde von einem architektonisch – formalen System verdrängt. Architekten wie beispielsweise „[…] Paul Schultze – Naumburg wurden zu Wegbereitern einer neuen Gartenkunst, die nun unter dem Schlagwort Raumkunst im freien firmierte“[3]. Schultze – Naumburg definierte 1902 die Gartenanlage als eine „architektonische Aufgabe“; der Architekt bevorzugte beispielsweise gerade Wege gegenüber ungeraden Wegen.
Bei der Errichtung neuer zentraler Friedhöfe oder bei Erweiterungen bereits vorhandener Friedhöfe galten nun neue Schlagworte: Sachlichkeit, Nützlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit, Harmonie und Ruhe. Eines der berühmtesten Beispiele hierfür ist der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, welcher durch Otto Linne im Jahr 1920 erweitert wurde. Dieser Parkfriedhof in Hamburg stellt eine strenge Komposition aus regelmäßig aneinander gefügten Grabfeldern dar und entspricht somit den Prinzipien der damaligen Zeit.
3 Die Entfaltung der Friedhofsreformbewegung
Anfang des 20. Jahrhunderts strebte man keine Ästhetisierung der Friedhöfe in Gestalt von künstlich angelegten Begräbnisstätten an, sondern man sucht zunächst im Typus des Waldfriedhofes eine gegenwartsnahe Lösung. Eine vorhandene Baumlandschaft wurde in diesem Fall zu einem Zömeterium[4] umfunktioniert. Die Grabfelder waren in kleine Einzelfriedhöfe unterteilt; dies entsprach dem Naturempfinden der Zeit. Als Beispiel ist der 1907 eröffnete Waldfriedhof in München zu nennen.
Das Modell des Waldfriedhofes gilt alsbald als ineffizient und unübersichtlich; der funktional gestaltete Reformfriedhof löste den Park- beziehungsweise Waldfriedhof in seiner Leitposition ab. Die Friedhofsreformer setzten sich mit der Rolle der Begräbnisstätte, sowie mit der Gestaltung von Grab und Grabmal auseinander. Der Reformfriedhof entsprach den Reformbestrebungen in der Gartenkunst, vor allem durch den sachlich geometrischen Grundriss. Deutlich wurde die Neugestaltung der Friedhöfe auch im Bestattungswesen: Förderung der Feuerbestattung, dies brachte Ersparnisse auf dem Friedhofsgelände. Auch eine Gebührensenkung für ebendies war ein entscheidender Aspekt, dass sich Menschen in Urnen begraben ließen. Man kann also behaupten, dass „Die zunehmende Verbreitung der Feuerbestattung […] sowie die gleichzeitigen sozialreformerischen Bestrebungen gemeinnütziger Sterbekassen […] untrennbar mit der Friedhofsreform im Allgemeinen verbunden und damit Bestandteil ihrer Entwicklung“[5] sind.
3. 1 Die Grabmalreform
Die Grabmalästhetik vorausgegangener Jahrezehnte wurde von den Friedhofsreformern stark kritisiert; beispielsweise bildete sich eine ablehnende Haltung gegenüber Massenware, der uneinheitlichen Gestaltung der Grabmale und der Politur der Oberflächen von Hartgesteinen. Um dieser Problematik zu begegnen, bildete sich bereits 1903 in München die von W. von Grollmann begründete „Wiesbadener Gesellschaft für bildende Kunst“.
Nach der Gründung des „Reichsausschusses für Friedhof und Denkmal e. V.“ wurden 1922 Richtlinien für die Friedhofs- und Grabmalgestaltung herausgegeben. Priorisiert wurden Naturstein, künstlerisches Unikat, ebenso handwerkliche Arbeit.
Vor allem die Stele wurde die angestrebte Grabmalform, „Sie konnte beliebig vervielfältigt und kombiniert werden“[6]. Dieses Grabmal bot die Option der industriellen Herstellung und die handwerkliche Oberflächenbearbeitung hatte einen weiten Raum.
Urnenbestattungen erfreuten sich immenser Beliebtheit und somit entfaltete sich für die Friedhofsreformer ein zusätzliches Feld in der Gestaltung kleinster Grabmale.
4 Die erste Phase der Friedhofsreformbewegung
Innerhalb der Geschichte der Grabmalreform hat die Eröffnung des Münchener Waldfriedhofes 1907 einen hohen Symbolwert. Der Münchener Stadtbaudirektor Hans Grässel sorgte für Grabmalvorschriften, […] die zu einer relativ einheitlichen Gestaltung führten“[7].
Die entscheidenden Schlagwörter der Friedhofsreformbewegung sind „Kunst und Handwerk“; die Reformer forderten deutsche Handwerkskunst auf den Begräbnisstätten, welche aus individuellen und einheimischen Materialien bestehen sollten. Im starken Gegensatz dazu ist zu nennen, dass man der Industrie geradezu feindselig gegenüberstand; von Fabriken für Grabmäler mit ihrer Massenproduktion wandte man sich ab. Des Weiteren bevorzugten die Reformer Einheit statt individueller Vielfalt. Auch der Heimatschutz war ein wichtiges Schlagwort innerhalb der Reformbewegung; man versuchte zu retten, was durch Industrialisierung und Urbanisierung bedroht war; beispielsweise die Pflege regionaler Baukultur.
4.1 Hans Grässel als Pionier der Friedhofsreformbewegung am Beispiel des Münchener Waldfriedhofes
Am 2. Februar 1909 referierte Hans Grässel zum Thema „Friedhofs- und Grabmalreform“ für das Modell des Münchener Waldfriedhofes; er hält die Begräbnisstätten in Deutschland für verbesserungswürdig.
Hans Grässel fasst seine Reformbestrebungen im Sinne von Kulturkritik auf, denn Friedhöfe sind ein Bestandteil der Volkskultur. Wie zum damaligen Zeitpunkt üblich, sah Grässel die Volkskultur und gerade das Zömeterium in der Großstadt vom Verfall bedroht an. Nachfolgend differenziert der Reformer zwischen innerer Kultur und Ausdruckskultur, „[…] eben dem, was sich allgemein kulturell und künstlerisch und dann natürlich auch im architektonischen Schaffen manifestiert“[8]. Auch sollte der Friedhof seinem eigentlichen Sinn und Zweck entsprechen; Grässel verwendet in diesem Fall die Schlagworte „Wahrhaftigkeit“ und „Schlichtheit“. So sollen beispielsweise auf dem Grabstein eines Verstorbenen Charaktereigenschaften und/oder seine Tätigkeiten neben den allgemeinen religiösen Symbolen gebraucht werden. „Wahrhaftigkeit“ im Sinne Grässels bedeutet ebenso religiös motiviertes Brauchtum; wer religiöses Brauchtum vollzieht, sollte um den traditionellen Hintergrund wissen, denn nur so, meint Grässel, ergebe Brauchtum einen Sinn.
Der Friedhofsreformer ist der Überzeugung, dass „[…] allein mit Vorschriften […] gegen die Betätigung von Unverstand und Protzentum vorzugehen“ ist „[…] und allgemeine Interessen dürfen dabei nicht durch die als Wert durchaus anerkannte persönliche Freiheit des Einzelnen geschädigt werden“[9]. Auch setzte Grässel auf die Aufklärung der Bevölkerung, beispielsweise durch Vorträge.
Hans Grässel bezieht sich also im Allgemeinen auf die Würde des Toten und auf die Schönheit der Friedhofsanlagen. Durch Vorschriften und Verbote sollte es ermöglicht werden, eine harmonische Gesamtwirkung der Zömeterien zu erreichen. Auch sind diese sehr publikumsträchtig, daher schien Grässel die Umgestaltung des Münchener Waldfriedhofes eine sehr große Aufgabe. Außerdem stellt der Begriff Ordnung einen wichtigen Punkt dar: zum Beispiel durch Anordnung der Wege oder Grabsteine. Allgemein ist zu sagen, dass Hans Grässel ein sehr zeittypisches Modell eines Friedhofes entworfen hat.
4.2 Religion, Handwerk und Heimat als Provenienz Grässels
Der Friedhofsreformer Hans Grässel selbst war Protestant und Mitglied einer Kirchengemeinde und so liegt nahe, dass er einen persönlichen Bezug zur Religion hatte und seine Friedhofsarchitektur sakral ausrichtete.
Außerdem spricht Grässel jüdische Begräbnisstätten an; diese haben zwei bemerkenswerte Aspekte: einmal, dass Gräber unaufhebbar sind und somit überzeitlich erhalten bleiben; andererseits wirken jüdische Grabmäler schlicht und anmutend, beispielsweise durch Reliefdarstellungen, aber auch durch Beibehaltung israelitischer Elemente.
Hans Grässel orientiert sich also ausschließlich an religiös motivierten Gestaltungsmodellen; dabei sind ihm Ästhetik und innere Werte (wie beispielsweise der Glaube) überaus wichtig.
Würde man nun all diese Wesensmerkmale der Religion auf Friedhöfen kommunalisieren, so wird man zwangsläufig auf gestalterische Grenzen stoßen; somit droht aus der Diversifikation Monotonie zu werden. Grässel spricht dagegen: durch handwerkliche Fähigkeit könne Einseitigkeit vermieden werden. Und somit ist der zweite Leitbegriff Grässels angesprochen. Handwerk könne nur existieren, wenn man sich auf Wurzeln, Originalität und Spezialität besinnt, das heißt individuelle Fertigung einzelner Grabsteine. Hauptsächlich wollte man das heimische Gewerbe vor der Massenindustrie und dem Grabsteinimport schützen; so müssen Grabmäler für einen Münchener Friedhof ebenda produziert werden. Heute ist dieses Modell nicht mehr tragbar, denn im 21. Jahrhundert herrscht eine Welt, welche von Industrie und internationalem Handel dominiert wird.
Der Heimatbegriff ist für Hans Grässel ebenso gravierend, wie die Begriffe Religion und Handwerk. Der Friedhofsreformer entwickelte einen eigenen Terminus der Heimat, in welchem er beispielsweise Kritik an der Großstadt übte, aber „[…] Die Stadt an sich […] verdammt er nicht, sie gehört zum kulturellen Erbe und damit […] zu seinem Heimatbegriff“[10]. Was der Friedhofsreformer eigentlich ansprechen möchte, ist die Entfremdung zwischen Stadt und Land, wie sie auch heute noch anzutreffen ist. Sein Heimatbegriff umfasst ebenso die (Groß)Stadt, aber auch das Ländliche beziehungsweise Dörfliche; doch ist es laut Grässel am wichtigsten, dass man sich innerhalb der Heimat wohlfühlt und sich daran orientiert, was unsere Ahnen geschaffen haben. Heimat nimmt also einen unmittelbaren Bezug zu Historie.
5 Die zweite Phase der Friedhofsreformbewegung – Die funktionale Wende
Nach dem ersten Weltkrieg wurde, aufgrund vieler Kriegstoter, die Gestaltung von Friedhöfen für Gefallene zu einer wichtigen Aufgabe. Gerade diese Soldatenfriedhöfe wurden zum Archetypen der Begräbnisstätte der 1920er Jahre, […] denn sie knüpfte[n] ausdrücklich an die standardisierte Ästhetik der Soldatenfriedhöfe an“[11]. Des Weiteren überwog nun der finanzielle Faktor der Kommunen, denn nach dem verlorenen Weltkrieg wurde das Kostenargument gravierend. Die Friedhofsästhetik bestimmten Kostendenken und Eindeutigkeit; die funktionale Wende wurde eingeläutet.
Die Reformbestrebungen in Hinsicht auf Friedhof und Grabmal wurden 1921 durch die Gründung des „Reichsausschusses für Friedhof und Denkmal e. V.“ institutionalisiert. 1922 wurden vom Reichsausschuss die „Richtlinien für Friedhofs- und Grabmalgestaltung“ herausgegeben. Zu dieser Zeit, so scheint es, existierte auf etlichen städtischen Friedhöfen bürokratische Reglementierung in Hinsicht auf die Grabmalgestaltung.
Auch die Industriefeindlichkeit der Reformer fand ein jähes Ende, denn die Industrialisierung und Mechanisierung nahm ihren Lauf. Außerdem wurden die Gestaltungselemente der Grabmäler der zweckrationalen Ästhetik der damaligen Zeit angepasst, so wurden beispielsweise Wasserflächen oder Hecken geometrisch ausgerichtet. Man kann also behaupten, dass „Ästhetische Prinzipien […] zu einer Funktion des Effizienzdenkens“[12] wurden. Individualität und Kreativität blieben Ausnahmen. Doch gerade durch diese Faktoren, wurde die Disproportionalität zwischen Arm und Reich stetig weniger evident.
Innerhalb der funktionalen Wende sind zwei Elemente sichtbar: einerseits die Kostenersparnis am Grab beziehungsweise Grabmal; andererseits existierte keine Individualität und Kreativität mehr. Insgesamt kann man also behaupten, dass die funktionale Wende
„[…] ein besonders aufschlussreiches Beispiel für die Normierung und Bürokratisierung kommunaler Dienstleistungen“[13] ist.
5.1 Otto Linne als Emissär der funktionalen Wende am Beispiel des Ohlsdorfer Friedhofs in Hamburg
1919 übernahm der Hamburger Gartendirektor Otto Linne das Amt des kommissarischen Friedhofsdirektors; somit konnte auch in Hamburg mit einer Friedhofserweiterung im Sinne der Friedhofsreformbewegung begonnen werden.
Im Jahr 1920 begann das sogenannte „Linneprojekt“ als ein bedeutungsvoller Einschnitt in der Entwicklung des Ohlsdorfer Friedhofs. Zum Beispiel wurde die Aufstellung, Gestaltung und Materialwahl der Grabmale geregelt. Diese Richtlinien ähnelten den Vorgaben, die Hans Grässel für das Modell das Münchener Waldfriedhofes erlassen hatte.
Ein bedeutendes Dekret hierbei ist, dass nur Materialen aus hellen und natürlichen Gesteinsarten, Schmiedeeisen, Holzsorten aus dauerhaftem Bestand, Bronzeguss und gebranntem Terrakotta zugelassen wurden. Kunststein musste „steingerecht“ überarbeitet werden; „Imitationen“ waren gänzlich verboten. So wurde auch die Grabmalgröße von der Größe der Grabstätte an sich abhängig gemacht, sodass kleine Gräber nur mit niedrigen Grabmalen ausgestattet werden durften.
Auch wird immer wieder der Aspekt des Vorzuges von handwerklicher Arbeit gegenüber industrieller Massenware angesprochen; auch das Ziel des individuellen Grabmals ist präsent, „Damit wollte man zu jener besseren Vergangenheit zurückkehren, in der jeder Stein seine Geschichte erzählte“[14]. Des Weiteren wurde eben durch diese Typisierung versucht, ein harmonisches und einheitliches Bild der Grabmäler zu erschaffen.
Vor allem die Formen der Stele, des Pfeilers und des Kissensteins sind sehr markant in den 1920er Jahren. Mit der Stele und dem Pfeiler griff man zurück auf historische Vorbilder des Klassizismus; man handelte im Sinne des „Heimatbegriffes“, wie es auch schon Hans Grässel auf dem Münchener Waldfriedhof darstellte. Die Stele trat hierbei in sehr antagonistischen Varianten auf, zum Beispiel auf Familiengräbern, aber auch als kleines schlichtes Grabmal. Der Pfeiler, ein Entwurf neuer Aschengrabmale in Form eines Pfeilers, sollte dazu dienen, der bisherig gängigen Variante der oberirdischen Aufstellung von Urnen entgegenzuwirken. Urnenhaine wurden durch sogenannte Aschegrabgärten ersetzt, in welchen man die Ossarien beisetzte. Der Kissenstein als kleines Grabmal sollte alle preisgünstigen Grabmale ablösen, welche aus steinernen oder gläsernen Schriftplatten auf unterschiedlichen Sockeln bestanden.
Eine gravierende Aufgabe nebst der Aufstellung der neuen Reformgrabmale spielte die Gestaltung der Grabfelder; man wollte eine Ordnung innerhalb der bisherigen Grabfelder durch gerade geschnittene Hecken bringen. Otto Linne schuf neue Grabmalentwürfe in Form von Stelen oder Kreuzgrabmälern; diese sind mit expressionistischen Symbolen und Reliefs als Emblem der handwerklichen Arbeit ausgeschmückt.
1922 eröffnete der Reformer Otto Linne einen Musterfriedhof, welcher sich neben den oben genannten Flächen befand; die Reformideen wurden dem Publikum anhand kleinerer Grabstätten zugänglich gemacht. Dort findet man Grabfelder, auf denen die Grabmalgrößen von außen nach innen abgestuft werden; in den Mitte befinden sich Liegeplatten. Hecken dienen als Trennung der einzelnen Grabreihen.
Otto Linne erließ also erstmals in der Geschichte strenge Vorschriften für die Gestaltung von Grabmalen. Ihm ist es zu verdanken, „[…] dass sich in Hamburg die Reformbestrebungen in der Friedhofskunst eng mit denen in der Gartenkunst entwickelten, aber auch Rationalisierungsmaßnahmen ihren Niederschlag auf dem Friedhof fanden“[15].
6 Zusammenfassung
Der Friedhof des späten 19. Jahrhunderts besaß einen parkähnlichen oder landschaftlichen Charakter; das Grabmal war geprägt durch Repräsentationsfreude und Monumentalität, es herrschte Gestaltungsfreiheit in jeglicher Hinsicht.
Literatur:
Happe, Barbara: Die Reform der Friedhofs- und Grabmalkultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts – die Typisierung als reformästhetisches und soziales Gestaltungskonzept. In: Claudia Denk und Kohn Ziesemer (Hrsg.): Der bürgerliche Tod. Städtische Bestattungskultur von der Aufklärung bis zum frühen 20. Jahrhundert. Regensburg 2007, S. 24 – 34
Fischer, Norbert: Zwischen Kulturkritik und Funktionalität: Die Friedhofsreform und ihr gesellschaftlicher Kontext in Deutschland 1900 – 1930. In: Kasseler Studien zur Sepulkralkultur. Vom Reichsausschuss Friedhof und Denkmal e.V., Kassel 2002
Krieg, Nina A.: Schon Ordnung ist Schönheit. Hans Grässels Modell Münchner Friedhofarchitektur (1894 – 1929), ein „deutsches Modell“?. München 1990
Leisner, Barbara: Die Einführung von Grabmalrichtlinien und ihre Folgen – noch einmal das Beispiel Friedhof Ohlsdorf in Hamburg. In: Kasseler Studien zur Sepulkralkultur. Vom Reichsausschuss Friedhof und Denkmal e.V. ,Kassel 2002
Schoenfeld, Helmut: Rationalisierung der Friedhöfe. Die Friedhofsreformbewegung von den Anfängen bis in die Zeit des Nationalsozialismus, in: Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (Hrsg.), Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den Gräberstätten der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung. Braunschweig 2003. S 163 – 194