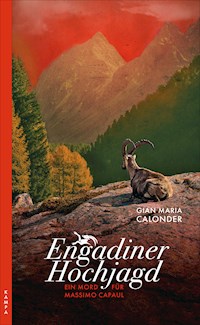14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Jon Salutt
- Sprache: Deutsch
Das Engadiner Dorf Pigna liegt gut versteckt in einem Nebental, das so klein ist, dass es keinen Namen hat. Im Sommer wachsen hier Aprikosen, im Winter legt sich eine dichte Schneedecke über die Häuser. Jon Salutt, von allen Jonin genannt, war sechsunddreißig Jahre lang der Hauswart der kleinen Schule, nun droht ihm die Pensionierung: Der Ort stirbt aus, es kommen keine Kinder nach. Hals über Kopf wird Jonin zum Dorfpolizisten ernannt. Sein erster Einsatz: den alten Laden auf Vordermann bringen. Fünfzig Jahre ist es her, dass dessen Betreiber Anna Tina und Robert von einem Tag auf den anderen verschwanden, seither steht das Haus leer. Nun will Annas Großnichte, die zwanzigjährige Zürcher Studentin Lexi, die vor einer überfordernden Liebe aufs Land flieht, Pignas Dorfladen wiederbeleben. Dass Jonin an seinem ersten Tag als Polizist eine Leiche im Keller des Hauses findet – damit konnte nun wirklich niemand rechnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gian Maria Calonder
Der Engadiner Dorfpolizist
Ein Fall für Jon Salutt
Roman
Kampa
1
Das Engadiner Dorf Pigna liegt gut versteckt in einem Nebental, das so klein ist, dass es keinen Namen hat. Die Einheimischen nennen es Vallada oder Valletta, was Tal oder Tälchen heißt, amtlich heißt es Val da Pigna. Vom Engadin her erreicht man es über eine schmale Passstraße, die allerdings oft geschlossen ist, weil ein Unwetter sie unterspült hat oder Lawinen drohen. Das Tal selbst ist wie eine Obstschale, in die jemand eine umgestülpte Tasse gestellt hat. Die Schale, das sind die Berghänge, an denen im Frühling das Vieh weidet, bevor es höher zieht, auf die umliegenden Alpen. Die umgestülpte Tasse ist der Hügel, auf den vor etwa tausend Jahren das Dorf Pigna gebaut wurde. Pigna heißt Ofen, und vermutlich heißt es so, weil es hier viel wärmer ist als im übrigen Engadin, die Berge schützen das Dorf vor Kälte und speichern im Sommer die Hitze. In den alten, von lose geschichteten Steinmauern umgebenen Gärten stehen Aprikosen- und Pfirsichbäume, sogar Reben. Der Winter ist trotzdem so, wie ein Engadiner Winter sein muss, der Schnee liegt manchmal haushoch. Dann sähe man, wenn man von der Passstraße her käme, von Pigna nur noch dick verschneite Dächer und rauchende Kamine. Allerdings ist der Pass dann auch geschlossen.
Vom Talboden führte viele hundert Jahre nur eine Treppe hinauf ins Dorf, die Straglia heißt, wie in den Häusern das Treppchen hinterm Kachelofen, durch das man hinauf in die Schlafkammer klettern kann. Die Häuser stehen eng aneinandergedrängt wie die Schafe bei Wind, und liegt genug Schnee, kann es sein, dass sich die Decke über den Häusern verbindet und weite Teile des Dorfs wie unter einem großen Dach liegen. Die meisten Häuser sind um die tausend Jahre alt. Nicht alle, denn etwa alle zweihundert Jahre brannte ein Dorfteil ab und wurde wiederaufgebaut. Weil sich das Feuer jeweils von den Dächern her ausbreitete, die damals noch mit Schindeln gedeckt waren, brannte oft nur das halbe Haus ab. Deshalb hat das typische Haus in Pigna Grundmauern aus etwa dem zehnten Jahrhundert – so genau weiß das niemand –, und nach oben wird jeder Stock zweihundert Jahre jünger.
Die Menschen in Pigna lebten wie fast überall im Engadin von der Jagd, von Kühen und Kleinvieh und vom Schmuggel. Und in Pigna ist man eben auch stolz auf sein Obst. Den Anschluss an die Neuzeit hat Pigna auf sympathische Weise verpasst, Touristen verirren sich kaum hierher, und wäre la Valletta nicht das schönste Tal der Welt und Pigna das allerbeste Dorf, wäre es längst ausgestorben. So aber bleibt es besiedelt von einem eisernen Kern von Menschen, die nicht viel zum Leben brauchen und es gern gemütlich nehmen. Denen es nicht zu mühsam wird, jeden Frühling wieder die Steine auf die Mäuerchen um ihre Gärten zu schichten, die im Winter hungrige Hirsche auf Plünderung eingerissen haben. Und die nie im Leben irgendwo anders würden leben wollen. Zumindest in der Theorie.
2
Fast die ganze Nacht hielt Jon Salutt das diffuse Gefühl wach, dass etwas nicht stimmte. Ja, seine Frau Mengia lag nicht neben ihm, aber daran war er inzwischen gewöhnt: Seit sie Enkel hatten, verbrachte sie bald mehr Nächte bei ihnen im Unterland als hier in Pigna. Zwei Mal sah er nach, ob vielleicht eine der Katzen krank war. Auch ein Kontrollgang durch die Schule brachte nichts, deren Abwart er seit sechsunddreißig Jahren war und in der sie wohnten, genauer in einem kleinen Anbau, der im Winter kaum zu heizen war. Jetzt allerdings war Ende Juni, eine Hitzewelle beherrschte das Land, in anderen Jahren badeten die Kinder tagsüber im weit ausladenden, ovalförmigen Dorfbrunnen. Dieses Jahr nicht. Die letzten Schüler hatten gerade abgeschlossen, und Nachwuchs war nicht in Sicht. Das kam immer wieder vor, dann schloss die Schule für ein paar Jahre, und die Lehrerin und der Hausmeister widmeten sich anderen Aufgaben. Auch Jon Salutt – oder Jonin, Hänschen, wie ihn alle nannten – hatte viel zu tun, er war nebenbei Leichenwäscher und Totengräber und half im Winter bei der Schneeräumung. Allerdings war der Schulwartdienst die einzige geregelte Anstellung gewesen, und weil dem Arbeitsamt ein fast Sechzigjähriger mit Wohnort in Pigna als hoffnungslos unvermittelbar galt, sah er seiner vorzeitigen Pensionierung entgegen. Nur als Schulwart wohlgemerkt.
Ob es das war, was ihn wach hielt? Während er in der Position »toter Mann« dalag – der einzigen Position, die er noch erinnerte von einem Videokurs in Yoga, den er mit Mengia absolviert hatte –, ging er in sich: Ängstigte ihn womöglich das Rentnerleben? Aber da war nichts weiter als die sanfte Sorge, ob Mengia ihn zwingen würde, andauernd mit zu den Enkeln nach Aarau zu fahren. Die Enkel waren laut, Aarau war laut, und Mengia selber war, solange sie dort war, kaum wiederzuerkennen.
Vom Bett aus sah er zu, wie der große orangefarbene Mond über dem Piz Dora seine Farbe verlor und die Amsel in der Birke auf dem Pausenplatz ihr Morgengezwitscher begann, und endlich begriff er: Es waren die Kuhglocken, die fehlten! Das unablässige Bimmeln der weidenden Kühe an den Berghängen, die das Dorf wie eine weit ausladende Milchschüssel umgaben. Tag und Nacht waren sie zu hören gewesen, selbst wenn man sie nicht mehr sah, weil sie zwischen Lärchen, Fichten und Arven verschwanden. Das Kuhgeläut, das so unaufdringlich wie der Duft des Flieders und das Rauschen des Schmelzwassers in den steilen Bachbetten die Talluft sättigte und das der Inbegriff des Frühlings war. Das hieß, die Kühe waren auf die Alp gezogen, die Bauern hatten Zeit für die erste Mahd, und damit war der Frühling vorbei. Die nächsten Tage würde man vor allem das Surren der Mähdrescher und das Rattern der Traktoren hören, welche die schweren Heuballen auf die Höfe fuhren. Das wogende Meer von Rotklee, Margeriten, Schlangenknöterich, Vergissmeinnicht, Wiesenakelei und was nicht allem würde kurz einer stumpfen, farblosen Matte weichen, die sich aber gleich wieder wandelte, wenn zartgrün neues Gras spross.
Ja, auch die Sommerzeit in Pigna war herrlich, doch das änderte nichts daran, dass Jon Salutt der Abschied von den Kühen schmerzte, das ging ihm jedes Jahr so. Dafür hörte er jetzt das türkische Taubenpärchen gurren, es nistete irgendwo in einer der riesigen Fichten am Dorfrand. Irgendwo schnarrte ein Neuntöter. Und schon war es halb sechs. Zeit, aufzustehen.
Jonin duschte und rasierte sich. Nicht mehr nass, sondern elektrisch, seit Mengia beschlossen hatte, dass er mit Dreitagebart verwegener aussah. Sich selbst hatte sie einen praktischen Kurzhaarschnitt zugelegt und tönte das Haar im Farbton »Glorious Silver«. Er fand das etwas sonderbar, denn zugleich hatte sie noch einen hüpfenden, leichten Gang, der wirkte, als wäre sie das Mädchen in sich nie ganz losgeworden. Aber ihr war wohl so, und dagegen gab es nichts zu sagen.
Die übliche Schüssel Haferflocken mit warmer Milch aß er heute im Stehen, oder besser Gehen, denn er versorgte dabei noch die Katzen, die Mengia auf die Namen Hercule und Poirot getauft hatte. Sie waren ihnen vor ein paar Wochen zugelaufen, jämmerlich maunzend und ausgehungert, offen-bar konnte so eine Siamkatze sich in freier Wildbahn schlecht behaupten. Jonin hatte sie gefüttert, die Zecken abgelesen und einen Katzenbaum gezimmert, auf dem sie nun den ganzen Tag saßen und aus dem Fenster sahen. Er hatte sie fotografiert und ein Inserat ins Internet gesetzt: »Wer vermisst zwei Siamkatzen?« Doch bisher wollte sie noch niemand abholen.
Das mulmige Gefühl aus der Nacht verließ ihn auch nach dem Aufstehen nicht. Vielleicht waren es doch nicht nur die Kühe. Er machte seinen vielleicht letzten Kontrollgang durch die Schule, entleerte die Kaffeemaschine und steckte zuerst sie aus, dann auch den Drucker und im Schulzimmer die Hellraumprojektoren. Endlich schloss er – nicht ohne Seufzer – den Sicherungskasten unter der Treppe auf und schaltete die automatische Uhr aus, welche die Schulglocke steuerte. Sechsunddreißig Jahre, dachte er und fühlte einen kleinen Stich.
Dann musste er sich schon fast beeilen, um halb neun erwartete ihn Gian Perl, der Gemeindepräsident von Pigna. Nachts hatte es kurz geregnet, der Geruch schwerer, feuchter Erde entströmte den Ritzen im holprigen Pflaster der Giassa Maistra, und der Wind trug den Duft frisch geschnittenen Heus mit sich. Vor Jon Salutts ausladenden Schritten floh eine junge Kröte in einen Brunnenschacht, und im honigfarbenen Licht der Morgensonne flatterten zwei Zitronenfalter um den Hagebuttenstrauch vor der Bäckerei. Er vermisste den Geruch von warmem Brot, aber es war Montag, da hatte sie geschlossen.
Das Gemeindehaus war eines der trutzigsten Gebäude im Dorf, schief und krumm, mit meterdicken Grundmauern, winzigen, tief in ihre Höhlen zurückgezogenen Fenstern und einer Fassade mit zahllosen Schichten Putz und Malerei, die größtenteils wieder abgeblättert waren, sodass das Haus einer großen Cremeschnitte glich, über die sich eine wilde Horde Kinder hergemacht hat. Besonders liebte Jon Salutt die fünf Treppenstufen, die von zahllosen Füßen mit den Jahrhunderten ganz schief und glatt geschliffen waren. Als kleiner Junge war es ihm ein Spaß gewesen, eine um die andere auf dem Hintern hinabzurutschen.
Gerade wollte er die schwere geschnitzte Tür aufstoßen, als Mengia anrief. Er setzte sich auf die oberste Stufe und nahm ab. Er freute sich darauf, ihr von der schlaflosen Nacht zu erzählen, vom Abschied von der Schule und seinem Spaziergang durchs Dorf. Doch wie immer, wenn sie in Aarau und um die Enkel herum war, hatte sie es eilig.
»Ich rufe nur an, damit du die Katzen nicht vergisst.«
Das verwirrte ihn.
»Warum sollte ich sie vergessen? Ich habe sie noch nie …«
»Dann bin ich beruhigt. Ich weiß ja nicht, was du so treibst, wenn ich nicht da bin. Und ich möchte nicht, dass jemand kommt, um sie abzuholen, und sie liegen tot unterm Katzenbaum.«
Er überlegte noch, was er darauf sagen konnte, als sie fortfuhr:
»Viel wichtiger: Elia hat sein Laufrad zerdeppert. Extra. Danach hat es ihm furchtbar leidgetan, er hat geheult – du weißt wie: wie eine Sirene! –, bis ich ihm versprochen habe, dass du es reparierst. Daraufhin hat Sophie noch lauter geheult, weil sie nichts kaputt gemacht hat und doch auch will, dass du ihr etwas reparierst. Also habe ich versprochen, dass du ein Regal an ihr Hochbett machst, so eine Art Nachttisch. Das sage ich dir, damit du das Holz und die nötigen Werkzeuge gleich mitbringst. Es ist sowieso besser, wenn du mit dem Auto kommst, der Zug war wieder entsetzlich voll! Wann kannst du hier sein?«
»Ich weiß nicht«, stotterte er, »ich habe jedenfalls noch den Termin auf der Gemeinde.«
»Wann ist der?«
»Eigentlich genau jetzt. Ich sitze gerade vor dem Gemeindehaus, auf einer dieser abgewetzten Stufen, erinnerst du dich?«
Das Letzte überhörte sie.
»Die werden dich nur verabschieden wollen, so was dauert zehn Minuten. Wenn sie eine Flasche Sekt aufmachen, vielleicht fünfzehn. Dann sage ich also den Kindern, du bist zum Mittagessen hier.«
»Nein, warte. Ich muss noch jemanden finden, der morgen die Katzen füttert.«
»Sonst fährst du eben heute Abend wieder zurück.«
Das würde heißen, er fuhr heute noch sechs Stunden Auto.
»Ja, oder besser, ich fülle vor der Abfahrt noch mal die Schälchen, dann brauche ich erst morgen zurückzufahren.«
»Das wäre nicht tiergerecht.«
Jonin seufzte.
»Wieso bringen wir Hercule und Poirot nicht ins Tierheim? Das wäre das Einfachste.«
»Weil du im Inserat geschrieben hast, man kann sie bei uns abholen. Das wäre nicht anständig.«
»Und wenn niemand kommt?«
»Keine Bange, solche Siamkatzen kosten eine Stange Geld. Die kommen.«
»Ja, aber wenn nicht?«
»Sag mal, bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? So eine Stubenkatze macht doch keine Arbeit!«
»Es sind zwei«, sagte er. »Aber ich glaube, das ist gar nicht das Problem.«
»Sondern?«
»Ich fühle mich überrollt. Du bist ganz schön in Fahrt.«
Mengia stutzte, dann sagt sie leiser: »Mein altes Problem, was? Ich lasse mich jedes Mal von den Kindern anstecken. Entschuldige.«
»Schon gut.«
»Ich liebe dich.«
»Ja, ich dich auch.«
»Also dann bis Mittag«, sagte sie noch und legte auf.
Jonin war sich nicht mehr so sicher, ob er pensioniert werden wollte. Er stand auf, klopfte den Staub von den Hosen und betrat das Gemeindehaus. Im Flur war es finster und kalt. Es würde Herbst werden, bis die Sommerhitze die dicken Mauern durchdrungen hatte.
»Bist du das, Jonin? Komm hoch.«
Gian erwartete ihn im Sälchen des Gemeindehauses, einer Arvenstube mit Kassettendecke und Kachelofen. An den Wänden hingen abwechselnd Hirschgeweihe und Familienwappen, eine Pendeluhr tickte, auf ihrem Zifferblatt stand in verschlungener Schrift:
Jeux Olympiques d’Hiver, St. Moritz, 1928.
Der Saal war leer bis auf einen Konferenztisch mit zwölf Stühlen. An fast jedem Platz lagen, schön geordnet, Papiere und kleine Stapel Klarsichtmäppchen. Gian Perl saß in einem der Stühle, las, verschob ein Papier von einem Mäppchen in ein anderes, dann wechselte er zum nächsten Platz.
»Bin gleich bei dir«, murmelte er und überflog das nächste Dokument.
Jon Salutt dachte sich, dass Gians Erscheinung so ziemlich das Gegenteil der gedrungenen, wettergegerbten Gestalt war, die ihm heute Morgen beim Rasieren aus dem Spiegel entgegengesehen hatte. Gian war lang aufgeschossen, mit zarter, bronzefarbener Haut, glatt rasiert. Obwohl er Glatze trug, wirkte er gute zehn Jahre jünger, dabei waren sie »Jahrgänger« – neun Jahre lang hatten sie zusammen die Schulbank gedrückt. Gleich danach hatten sich ihre Wege jedoch geteilt, Gian hatte studiert, war Architekt geworden und hatte sich eine Villa in Celerina gebaut. Er trug Maßanzüge und fuhr einen Mercedes Offroader. Trotz alldem fühlte Jon sich ihm verbunden wie nur wenigen Menschen.
Endlich schob Gian die kleine, runde Drahtbrille in die Brusttasche, stand auf und gab Jon die Hand.
»Jonin«, sagte er fast zärtlich.
Etwas linkisch standen die beiden Männer voreinander – der Arbeiter im ausgewaschenen Blaumann und der Architekt im tadellos sitzenden cognacfarbenen Cordsamt-Anzug und flaschengrüner Krawatte –, dann zeigte Gian auf den Tisch.
»Das ist das Reich des Gemeindepräsidenten. Jeder Platz steht für ein laufendes Geschäft. Sonntags gegen Abend komme ich aus Celerina, sehe im Haus meiner Eltern nach dem Rechten, mähe den Rasen und so. Sie werden das Heim nie mehr verlassen, aber sie wollen wenigstens die Phantasie aufrechterhalten, und ich helfe ihnen dabei. Am Montag früh erledige ich hier das Präsidiale, irgendwer muss das ja tun. Es ist Corsin, der Gemeindeschreiber, der mir die Geschäfte immer so schön vorbereitet.«
»Und welches der Häufchen bin ich?«
Gian tippte eine Stuhllehne an, vor der nur ein schmales Heft lag.
Jonin las:
»Leggia da Pulizia Cumünala. Gesetz Gemeindepolizei.
Nein, das ist nicht meines. Ich bin hier, um die Übergabe zu regeln. Die Schule ist geschlossen, ich habe dort nichts mehr zu tun. Ich gehe in Rente. Gian, ich erwarte von dir keine Medaille oder so, aber vielleicht doch ein Dankeschön für sechsunddreißig Jahre solide Arbeit? Außerdem muss noch geregelt werden, wann Mengia und ich die Dienstwohnung verlassen.«
Er konnte nicht verbergen, dass er angespannt war.
Doch Gian lachte nur und zeigte seine strahlend weißen Zähne, dann schlug er Jonin auf die Schulter.
»Weiß ich doch alles, meis char. Es ist nur so, dass Pigna sich einen weiteren Rentner nicht leisten kann. Dafür brauchen wir dringend einen Dorfpolizisten.«
»Einen was? Pigna hatte noch nie einen Polizisten. Und warum so plötzlich?«
»Sieh es von der guten Seite. Du bleibst in Schuss, sparst dir die Rente, und ihr könnt in der Hauswartwohnung bleiben. Zumindest vorläufig. Es gibt für die Schule erst vage Pläne.«
Jonins Augen glänzten.
»Heißt das, ich darf auch die Werkstatt weiter benutzen?«
»So gefällst du mir. Meinetwegen. Dafür hast du weiterhin ein Auge auf die Schule.«
Jonin blätterte das Polizeigesetz durch und musste lachen.
»Sonntags ist Rasenmähen verboten. Soll ich dich jetzt verhaften?«
»Erst, wenn du mich in flagranti erwischst.«
»Und wo sperre ich dich ein?«
»Gute Frage. Vielleicht in die Besenkammer in der Schule? Da haben wir früher oft gesessen.«
»Du? Du warst doch einer der Braven.«
Gian wiegte den Kopf.
»Ich wurde nur nicht oft erwischt. Ich war der mit dem Sekundenkleber. Also, schlägst du ein?«
Jonin hatte nicht übel Lust, trotzdem zögerte er.
»Gibt es keine anderen Kandidaten?«
»Wir dachten erst an einen jungen Polizeikadetten, der in Samedan den Dienst quittiert hat, einen gewissen Capaul.«
»Massimo Capaul? Von dem habe ich gelesen. Er hatte irgendeinen Wirbel veranstaltet.«
»Kann man wohl sagen. Egal, jedenfalls will er nicht. Nein, das ist falsch ausgedrückt, er hat uns einfach nie geantwortet. Und inzwischen bist du gewählt, herzlichen Glückwunsch. Irgendwann trinken wir drauf. Aber wie du siehst, liegt hier noch viel Arbeit.«
Jonin nahm Gians Hand.
Dann fragte er: »Wann beginne ich?«
»Sofort. Du kennst noch den alten Dorfladen?«
Jonin war in seiner Kindheit jeden Tag in dem Laden gewesen, der in derselben Häuserreihe lag wie die Bäckerei. Inzwischen war die Fassade verwittert, einige Fensterläden hingen schief, das Schild Butia war vor ein paar Jahren abgefallen und lehnte lose an der Haustür, dahinter sammelten sich Laub und Abfall, die der Wind durch die Gasse trieb.
»Zugegeben, dort müsste man für Ordnung sorgen. Aber hat das nicht noch ein paar Tage Zeit? Mengia erwartet mich in Aarau. Und das Haus sieht doch schon ewig so aus.«
»Seit fünfzig Jahren steht es still. Erinnerst du, wie Duonna Anna Tina uns das Glas mit den grün-rot-weiß gestreiften Bonbons hingehalten hat? Als Sechsjähriger war das für mich der Inbegriff von Wollust.«
Jonin nickte.
»Und sie roch so gut nach frischer Wäsche und Kaffeebohnen. Warum ging der Laden überhaupt zu? In meiner Erinnerung war er immer voll.«
»Das hätte ich auch gern herausgefunden. Ich weiß nur, Anna Tina und ihr Mann Robert sind über Nacht verschwunden. Danach gab es wohl Gerüchte, aber weil niemand Anzeige erstattet hat, ist die Sache versandet. Das ist jedenfalls, was man so hört. Vor zwei Monaten ruft mich plötzlich ein Nachlassverwalter an. Anna Tina war nach Genf gezogen, ist dort gestorben und hat das Haus testamentarisch jenem Verwandten bestimmt, der bereit ist, hier zu wohnen und es im damaligen Sinn wiederzubeleben.«
»Den Laden wieder aufzumachen?«
»So muss man das wohl verstehen. Natürlich fällt es nur einem Idioten ein, in Zeiten des Online-Shopping in einem verlassenen Bergkaff einen Laden zu eröffnen. Deshalb hat der Nachlassverwalter auch niemanden gefunden. Er sagt, er hat Verwandte bis ins achte oder neunte Glied angeschrieben. Wir haben schon befürchtet, der Kasten fällt an die Gemeinde, und wir sitzen dann auf den Kosten.«
Jonin nickte.
»So weit komme ich mit. Aber was habe ich damit zu tun?«
»Gestern hat sich dann doch eine Interessentin gemeldet, Alexandra Siber, eine Großnichte von Anna Tina. Du sollst sie durchs Haus führen. Und wenn es irgend geht, sorge dafür, dass sie es übernimmt und großzügig investiert.«
»Warum kann das nicht Corsin machen?«
»Corsin tut schon sehr vieles, was eigentlich nicht in seinen Kompetenzbereich gehört, dabei ist er, im Unterschied zu dir, tatsächlich im Pensionsalter. Seine Hüfte wird immer schlimmer, er kann kaum noch gehen. Dazu kommt, dass die Kantonspolizei darauf drängt, dass die Bergdörfer sich selbst regeln, sie ist völlig überlastet. Für die Dorfbevölkerung ist es ja auch netter, sie kennen ihren Polizisten. Und Fremde finden vor Ort eine vertrauenswürdige Ansprechperson.«
»Welche Fremden?«
Tatsächlich verirrte sich kaum je ein Tourist nach Pigna.
»Das muss ja nicht so bleiben, den einen oder anderen Pfeil habe ich schon noch im Köcher, wenn es darum geht, Pigna zu retten. Also: zwei Uhr vor dem Dorfladen, Alexandra Siber. Alles klar?«
Jonin nickte.
»Den Schlüssel bräuchte ich noch.«
»Der steckt von innen, es ist nicht abgeschlossen.«
Zum Abschied überreichte Gian ihm eine Plastiktüte.
»Da drin sind Vertrag, Ausweis und Kostüm. Kleiner Scherz, Uniform. Wenn etwas davon nicht passt, wende dich an Corsin, er hat die Sachen besorgt.«
Er klappte die Brille auf und setzte sich wieder an den großen Tisch. »Ach ja, diese verdammten Jäger«, seufzte er, während er sich über ein Papier beugte, »das neue Jagdhüttengesetz. Wir wollen endlich mit dieser Mauschelei und Schieberei aufräumen. Aber ich sage dir, da wird noch Blut kochen.«
»So schlimm?«, fragte Jonin, um nicht zu schweigen, aber Gian war schon ganz in die Lektüre vertieft.
Jonin kehrte auf die Straße zurück und wählte Mengias Nummer.
»Es ist verrückt, du glaubst es nicht. Ich bin der neue …«
»Gut, dass du anrufst, Liebling«, unterbrach sie ihn.
Er hörte im Hintergrund die Kinder toben.
»Sophie will jetzt doch kein Regal, sondern lieber einen Prinzessinnenthron. Er soll rosafarben sein, Rüschen haben und goldene Füße. Kriegst du das auf die Schnelle hin? Oder bist du schon unterwegs?«
»Nein, bin ich nicht, und ich schaffe es auch frühestens auf den Abend. Mengia, du wirst es nicht glauben, ich …«
»Auf den Abend?! Was glaubst du, was das für ein Geschrei geben wird?«
»Möglich, aber ich muss erst jemandem den alten Dorfladen zeigen. Gian hat mich darum gebeten. Und er ist immerhin Gemeindepräsident.«
»Den alten Dorfladen, die Lotterbude in der Giassa Maistra? Diese Mördergruft? Und das soll wichtiger sein als deine Enkelkinder?«
»In diesem Fall schon. Aber was meinst du mit Mördergruft?«
Noch während er die Frage aussprach, rutschte er auf einer der blank gewetzten Treppenstufen aus, das Handy entglitt ihm, und bis er es wiederhatte, war die Verbindung unterbrochen.
Er schickte Mengia eine SMS:
Kann leider erst abends kommen, habe Job für die Gemeinde.
Mehr wollte er nicht verraten.
3
Als Jonin das Haus betrat, war er aufgeregt wie bei einem Rendezvous. Ein Laden, der seit fünfzig Jahren verlassen war …
Der erste Eindruck war dann aber eher nüchtern. Neben dem Eingang stapelten sich Zeitschriftenbündel. Die Regale waren fast komplett ausgeräumt, nur ein paar Konservendosen und Tuben standen noch darin, dazu Reinigungsmittel wie Schmierseife und Scheuersand, Kochgeschirr und einiges für Stall und Vieh. Am Boden fand er Mäuseköttel und Marderdreck und über allem dicke Schichten von Staub. Hier war der Hauswart gefragt. Aber hatte er genügend Zeit? Nachdem er vergeblich einige Lichtschalter betätigt und die Sicherungen überprüft hatte, rief er beim Elektriker an.
»Armin, jemand interessiert sich für den alten Dorfladen. Bevor ich ihn zeigen kann, muss ich aber putzen. Dafür brauche ich Strom. Kannst du ihn mir anstellen?«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.«
Jonin ging auf die Straße hinaus, um die Hausnummer abzulesen.
»Giassa Maistra 7, direkt links neben der Bäckerei.«
»Der alte Kasten? Lässt sich wohl schon machen, außer es hat jemand am Sicherungsbrett rumgebastelt. Wer haftet denn, wenn es einen Kurzschluss gibt und die Bude abbrennt? Und an wen geht denn die Rechnung?«
»An die Gemeinde. Ich bin jetzt Dorfpolizist.«
»Seit wann haben wir denn so was?«
»Seit heute.«
Jonin musste selber lachen, als er das sagte, und kaum hatte er aufgelegt, zog er sich im Hinterzimmer um. Corsin schien ein gutes Auge zu haben, alles passte. Dann machte er eine Liste, was er für seine Putzaktion brauchte, und ging in die Schule, um alles zu holen. Als er eine halbe Stunde später zurückkam, war Armin schon da gewesen: Das Licht brannte, eine Kühltruhe rumpelte. Jonin steckte sie aus. Das Wasser war natürlich auch abgedreht, er füllte den Eimer am Brunnen.
Als er mit dem Nasssauger die schönen, gebogenen Schaufensterscheiben reinigte, klopfte Elvira ans Glas. Sie war die Mutter des Bäckers und wohnte in der Dachwohnung über der Bäckerei. Sie zog einen kleinen Sonntagszopf aus der Schürzentasche, hielt ihn an die Scheibe und rief:
»Hier, nimm, bevor er verdirbt.«
Er trat zu ihr hinaus.
Sie musterte ihn. »Hast du etwa das Haus gekauft?«
»Oh nein. Da.«
Er drehte sich um, damit sie die Aufschrift auf seinem Rücken lesen konnte: Pulizia Cumünala.
»Heute kommt die Erbin, vielleicht übernimmt sie es.«
Vor Schreck hielt Elvira die Hände vor den Mund. Sie waren winzig und so runzlig wie ihr Gesicht.
»Die Erbin dieses Mörders? Sie darf das Haus nicht annehmen, das bringt Unglück.«
»Wer hat denn hier wen umgebracht?«
»Na, Robert hat Anna Tina umgebracht, weißt du das nicht? Sie ist fremdgegangen, ich glaube, mit dem Förster. Da hat er sie getötet und ist abgehauen. Es heißt, nach Amerika.«
»Ach ja?«
Jonin biss ins Zopfbrot.
»Und was, wenn ich dir sage, dass die Frau, die heute kommt, das Haus von Anna Tina geerbt hat? Dass Anna Tina jetzt erst gestorben ist?«
Elvira starrte ihn an. Dann fragte sie:
»Schmeckt er noch? Er ist von gestern.«
Er nickte kauend, der Zopf war zu trocken, als dass er hätte sprechen können. Er ging zum Brunnen und trank, danach fragte er:
»Und warum der Förster?«
»Weil er damals der Fescheste weit und breit war. Und Robert war ja selber nicht ohne. Anna Tina wäre bestimmt nicht mit jedem gegangen.«
»Wieso glaubst du überhaupt, dass sie fremdgegangen ist?«
»Na, hör mal! Weil sie klammheimlich weg sind. Alle beide, über Nacht. Man gibt doch nicht mir nichts, dir nichts einen gut laufenden Laden auf. Ja, wenn sie ihn verkauft hätten! Aber einfach so verschwinden?«
»Klingt logisch. Ich muss jetzt wieder putzen.«
Elvira folgte ihm in den Laden und sah sich um, aber er hatte keine Zeit, sich um sie zu kümmern. Irgendwann verschwand sie wieder.
Eine Viertelstunde später stand ihr Sohn Men im Laden, der Bäcker, ein vierzigjähriger, breitschultriger Mann mit rotem Gesicht.
»Schmeckt es?«, fragte er, als er den angebissenen Zopf auf der Ladentheke liegen sah.
Jonin hatte ihn ganz vergessen.
»In der Not frisst der Teufel Fliegen.«
Er biss nochmals ab.
»Etwas trocken.«
»Die Hefe von heute ist nicht mehr, was sie mal war. Früher hielt der Zopf drei Tage, heute bei heißem Wetter vielleicht einen halben. Und wozu will die Frau, die heute kommt, den Laden?«
Er hatte Jonin den Zopf aus der Hand genommen, zerpflückte ihn und zerrieb ein Stück zwischen den Fingern.
Jonin wartete, bis er damit fertig war, dann stellte er den Sauger an und saugte die Krümel auf.
»Ich weiß nicht, ob sie ihn überhaupt will. Aber falls ja, dann werde ich sie fragen.«
»Tu das. Wenn sie Backwaren anbieten will, soll sie vorher mit uns reden. Mutter sagt, früher gab es deswegen Streit. Wir sind gern bereit, die Milchprodukte wieder aus dem Sortiment zu streichen, aber Konkurrenz in Backwaren möchten wir lieber nicht.«
Danach ging er wieder. Den Rest vom Brot nahm er mit.
»Was tust du mit meinem Zopf?«
»Den kriegen die Hühner. Komm morgen in die Bäckerei, dann kriegst du Ersatz.«
Kurz vor zwei Uhr gab Jonin es auf, den Laden schön machen zu wollen, ging hinaus auf die Straße und rief Mengia an.
»Hast du jetzt etwas Zeit für mich?«
»Du hast doch keine«, sagte sie mit dezenter Spitze.
»Für dich schon, nur nicht für unsere Enkel. Hör zu, die Gemeinde kann es sich nicht leisten, mich in Rente zu schicken. Stattdessen hat Gian mir eine neue Stelle angeboten. Nein, nicht angeboten, verordnet. Ich bin jetzt Dorfpolizist. Das ist doch schön.«
Mengia räusperte sich, dann sagte sie freundlich: »Erklär mir bitte, was du daran Schönes siehst.«
»Ganz viel, mal abgesehen davon, dass wir nicht umzuziehen brauchen und ich auch die Schulwerkstatt weiter benutzen kann. Sonst wäre es mit dem Reparaturservice für Elia und Sophie sowieso vorbei. Vor allem tue ich als Polizist etwas Gutes.«
»Ist es denn nichts Gutes, wenn du mit mir unsere Enkel besuchst? Wenn du ihnen Dinge bastelst?«
»Doch.«
»Und was ist besser daran, Polizist zu sein?«
»Ganz ehrlich?«
»Ich bitte darum.«
»Das Beste ist, dass ich in Pigna bin. Das Unterland tut mir nicht gut.«
»Nicht einmal, wenn ich dort bin?«
Er lachte.
»Mit dir hier zu sein, ist das Beste. Ohne dich in Aarau zu sein, wäre das Schlimmste. Ohne dich hier zu sein, ist auch nicht perfekt …«
»Aber besser, als mit mir in Aarau zu sein?«
»Ja.«
»Danke für die ehrliche Antwort.«