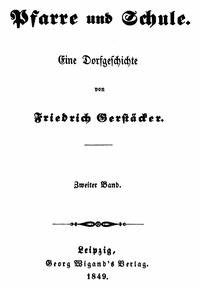0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Ähnliche
Der Erbe.
RomanvonFriedrich Gerstäcker.
Die Uebersetzung dieses Werkes in fremde Sprachen wird vorbehalten.
Erster Band.
Jena,Hermann Costenoble. 1867.
Inhaltsverzeichniß.
Seite
1.
Beim Frühstück
7
2.
Die Bewohner von Schloß Wendelsheim
30
3.
Ein unbequemer Besuch
56
4.
Die elende Familie
79
5.
Beim Schlosser Baumann
112
6.
Der alte Salomon
133
7.
Rebekka
159
8.
Der Familienball
182
9.
Am andern Morgen
212
10.
Neue Spuren
237
11.
Die beiden Verbündeten
266
12.
Frau Müller
287
13.
Vater und Sohn
322
1. Beim Frühstück.
»Mama, dieser Lieutenant von Wendelsheim tanzt wirklich entzückend,« sagte Ottilie, als sie Morgens um zehn Uhr in einem allerliebsten Negligé zur Mutter in's Zimmer trat, wo das Kaffeeservice noch auf dem Tische stand. »Ich kann Dir versichern, man fliegt ordentlich mit ihm über den Boden hin und wird gar nicht einmal müde.«
»Nun, mein Kind,« erwiederte die Mutter, »ich kann Dir versichern, daß ich wenigstens müde geworden bin.«
»Aber Du hast gar nicht getanzt, Mütterchen.«
»Das fehlte auch noch,« stöhnte die Frau; »das Herumsitzen ist so schon arg genug – und nun auch noch diese schreckliche Räthin Frühbach neben mir! Ich sage Dir, ich habe meinem Schöpfer gedankt, als es drei Uhr schlug und wir mit Ehren fort konnten.«
»Arme Mama – und ich habe mich so gut amüsirt!«
»Junges Blut,« nickte die Mutter; »aber trink' Deinen Kaffee, Kind, denn er steht schon eine ganze Weile und wird sonst kalt.«
Ottilie hatte sich neben sie auf das Sopha gesetzt und trank; aber der kleine Fuß klopfte unter dem Tische noch immer leise den Tact eines der erst vor wenigen Stunden beendeten Tänze – ihre Gedanken waren noch entschieden bei dem Balle! Und wer hätte es ihr verdenken wollen? War sie doch kaum zwanzig Jahr alt, in der Blüthe ihrer Jugend, und der Blick, der unter den langen Wimpern so glücklich hervorleuchtete, sah nur Licht und Freude, denn kein dunkler Tag in ihrem jungen Leben warf seinen Schatten auf der Zukunft Bahn.
Ottilie war die Tochter des Staatsanwalts Witte, eines seiner Tüchtigkeit sowohl als Rechtlichkeit wegen allgemein geachteten Mannes, und das einzige, also auch das verzogene Kind im Hause. Von Herzen lieb und gut, hatte ihr Charakter dadurch aber doch etwas Eigenwilliges bekommen, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn sich der fast übermäßig beschäftigte Vater hätte mehr um ihre Erziehung bekümmern können. Leider konnte er das nicht, und sie wurde einzig und allein der Mutter überlassen, die freilich nicht recht dazu paßte, ein junges Mädchen heranzubilden.
Die Frau Staatsanwalt Witte war, wie ihr Niemand absprechen konnte, eine brave und tüchtige Frau, und als sie vor langen Jahren ihren Mann heirathete und Beide sich fast ohne Vermögen kümmerlich durch das Leben arbeiten mußten, da hatte sie bewiesen, daß sie eine tüchtige Hausfrau sei, und mit den bescheidensten Ansprüchen gesorgt und geschafft und immer den Kopf oben behalten. Solchen gedrückten Verhältnissen war sie auch gewachsen gewesen, und Witte hätte sich dafür keine bessere Frau wünschen können. Als er aber in seinem Berufe einen Namen bekam und viel Geld verdiente, ja, später sogar Staatsanwalt wurde und sie weit mehr einnahmen, als sie gebrauchten, da fiel sie in einen Fehler, in den nur zu viele Frauen fallen – sie wurde auf ihren Mann stolz und beschränkte das nicht allein, wie es passend gewesen wäre, auf die eigene Familie, sondern suchte es der Stadt zu zeigen.
Von da an zog der Luxus in ihr Haus ein, und wenn Witte auch selber viel zu vernünftig war, sie weiter gehen zu lassen, als er für gut fand, behielt sie doch in vielen Dingen – des Hausfriedens wegen – ihren Willen und arbeitete sich mit den Jahren endlich in ein solches Gefühl ihrer Würde hinein, daß Witte selbst oft und bedenklich darüber den Kopf schüttelte.
In diesem »Bewußtsein ihrer Stellung« wurde Ottilie erzogen, und leider bekam sie von der eigenen Mutter öfter als gut zu hören, wie hübsch sie sei – und wie vornehm, und daß sie sich mit gutem Gewissen zu den ersten Familien der Stadt, der sogenannten »Crême« der Gesellschaft, zählen dürften.
Dadurch wurden viele Verbindungen mit früher befreundet gewesenen, aber ärmeren Familien abgebrochen und an deren Statt eine nähere Bekanntschaft mit dem Adel gesucht, von dem Witte selber gar nichts wissen wollte, aber die Frau Staatsanwalt desto mehr; und wenn sie auch vielleicht nichts Derartiges äußerte, so war sie doch jedenfalls im Herzen fest entschlossen, ihre Ottilie – komme was wolle – dermaleinst als »Frau Baronin« einhergehen zu sehen. Dann, wie sie oft im Stillen seufzte, »wollte sie gern sterben.«
Daß Ottilie selber gegen solche Andeutungen nicht gleichgültig blieb, läßt sich denken. Das Samenkorn hatte jedenfalls Wurzel geschlagen, und es war nun jetzt die Frage, wie es gepflegt und genährt werden würde.
»Wo ist denn der Vater?« fragte Ottilie endlich. »Hat er schon getrunken?«
»O, schon seit einer vollen Stunde,« sagte die Mutter; »aber er wurde mitten darin abberufen.«
»Der arme Papa, nicht einmal seinen Kaffee lassen sie ihn ruhig trinken! Wer ist denn bei ihm?«
»Ich weiß es nicht; ich glaube, es war in Sachen einer Scheidungsklage. Es ist erstaunlich, wie das jetzt überhand nimmt. Denke Dir nur, Herr von Löser läßt sich auch von seiner Frau scheiden.«
Ottilie war recht nachdenklich geworden und sah eine ganze Weile still vor sich nieder. Endlich sagte sie: »Es ist doch sonderbar und eigentlich recht traurig, daß Leute, die geschworen haben, in Freude und Leid treu bei einander auszuhalten, auf einmal so andern Sinnes werden und sich so unglücklich mit einander fühlen können. Ich bin gar nicht im Stande, mich da hineinzudenken.«
»Gewiß ist es traurig,« sagte die Mutter achselzuckend, »aber auch nur wieder ein Zeichen, wie leichtsinnig und unüberlegt viele Verbindungen für das ganze Leben geschlossen werden. Ein junges Mädchen sollte nie vor dem achtundzwanzigsten Jahr heirathen.«
»Aber, Mama,« lachte Ottilie, »dann ist sie ja kein junges Mädchen mehr, sondern eine alte Jungfer, und die bleiben regelmäßig sitzen. Wie alt warst Du denn, als Du den Vater nahmst?«
»Was Du davon verstehst, Kind!« sagte die Mutter ausweichend. »Freilich sind die Männer selbst daran schuld, denn sie sollten vernünftiger sein, als solchen jungen Dingern ihre faden Schmeicheleien vorzuschwatzen, wie es der Herr Referendarius Blaufuß etwa macht; Referendarius – er kann ein Greis sein, ehe er Assessor wird. Das ist die erste Giftsaat, und nachher verlangen sie, daß ein junges Geschöpf, das dumm und unerfahren genug war, um all' den Unsinn zu glauben, auch gleich nach der Hochzeit all' die schönen Sachen vergessen und eine tüchtige, nüchterne Hausfrau werden soll. Da war Dein Vater anders.«
»Wie war denn der, Mama?« fragte Ottilie schelmisch.
»Ja, das möchte ich auch wissen,« sagte der Staatsanwalt, welcher in diesem Augenblick in der Thür erschien und die letzten Worte gehört haben mußte. »Von was sprecht Ihr denn eigentlich?«
»Guten Morgen, Papa,« rief Ottilie, ihm entgegenspringend. »Wir sprachen gerade von nichts Besonderem, ich und die Mama – nur vom Heirathen.«
»Vom Heirathen?« rief der Vater erstaunt aus, indem er seiner Tochter die Backe zum Kuß hinhielt – »Blödsinn! Du solltest doch gescheidter sein, Therese, als solche Morgengespräche mit dem Kind zu führen. Sie kann noch nicht einmal eine Suppe kochen.«
»Hör' einmal, Dietrich,« sagte die Mutter gereizt, »ich denke, ich weiß selber gut genug, über was ich mit dem Kind zu sprechen habe, und brauche Deine Ermahnungen und Rathschläge nicht. Ich setzte ihr eben den Ernst der Angelegenheit auseinander, und dagegen wirst Du hoffentlich nichts einzuwenden haben.«
»Ja, Papa,« lächelte Ottilie, »und dann wurde der Vorschlag gemacht, daß sich ein junges Mädchen erst mit achtundzwanzig Jahren verheirathen dürfe, und auch darüber abgestimmt; aber der Antrag blieb unentschieden, denn die Stimmen waren getheilt.«
»Da hörst Du,« sagte der Staatsanwalt, indem er über die Brille weg nach seiner Frau hinüber sah, »wie die Mamsell den Ernst der Angelegenheit aufgefaßt hat – à propos, ist noch eine Tasse Kaffee für mich da?«
»Gewiß, Papa, die Menge.«
»Schön – na und wie hast Du dich gestern amüsirt, Tilchen? Wie war der Ball?«
»Ach, himmlisch, Papa,« rief das junge Mädchen, bei dem Capitel rasch alles Andere vergessend; »es war wundervoll, und ich werde den Abend in meinem ganzen Leben nicht vergessen!«
»In der That? Also das heißt, Du hast ununterbrochen getanzt und nicht ein einziges Mal – geschimmelt – nicht wahr, so nennt Ihr das?«
»Nicht ein einziges Mal,« bestätigte ernsthaft Ottilie; »ich habe alle Tänze getanzt, die Extratouren noch gar nicht gerechnet, und freue mich jetzt nur auf unsern Ball. Nicht wahr, Papa, bei dem bleibt es doch noch?«
Der Staatsanwalt stöhnte recht schmerzlich, denn er wußte, was ihm da bevorstand; seine Frau aber sagte würdevoll:
»Das ist ja schon Alles abgemacht und versteht sich von selbst. Wo wir die vielen Einladungen erhalten haben, müssen wir uns ja einmal revanchiren.«
»Auch dieser Kelch wird vorübergehen,« nickte der Vater.
»Ach, Dietrich,« sagte die Frau, »thu' nur nicht so; Du amüsirst Dich gewöhnlich dabei am besten von Allen, und gestern hast Du auch den ganzen Abend Whist gespielt.«
»Wenn Du das ein Amüsement nennst, mit dem Rath Frühbach Whist zu spielen, so hast Du Recht. Der Mensch hat keine Idee vom Spiel und thut dabei den Mund den ganzen Abend nicht zu.«
»Und die Mama hat sich indessen so gut mit der Frau Räthin unterhalten,« lächelte Ottilie schelmisch.
»Allerdings nicht so gut, wie Du Dich mit Deinem Lieutenant,« rief die Mutter, »spotte auch noch, daß ich Dir zu Liebe da geblieben bin!«
»Nicht böse, Mütterchen, nicht böse, es war ja gar nicht so gemeint!«
»Mit was für einem Lieutenant?« fragte der Vater.
»Ach, mit Herrn von Wendelsheim, Papa; er tanzt so wundervoll, Du kennst ja doch den Lieutenant von Wendelsheim?«
»Sollte es denken,« sagte der Vater und nickte dabei still vor sich hin; »aber das ist so in der Welt: die fadesten Menschen haben es gewöhnlich am besten in den Füßen.«
»Aber er ist gewiß nicht fade, Papa; er spricht so interessant und versteht Alles so aus dem Grunde.«
»So?« sagte der Vater und sah dabei seine Tochter scharf an. »In der That? und über was hat er mit Dir gesprochen, wenn ich fragen darf?«
»Ih nun,« erwiederte Ottilie und wurde in dem Augenblick wirklich feuerroth, »eigentlich über Alles. Ueber Concert und Theater, über die jetzigen Moden – über....«
»Pferde,« ergänzte der Staatsanwalt trocken.
»Er hat mir allerdings von dem wilden, prachtvollen Fuchs erzählt, den er jetzt reitet.«
»Und was er kostet....«
»Zweihundert Louisd'or.«
»Na ja, so ungefähr meine Gedanken.«
»Aber es soll ein prachtvolles Pferd sein!« rief das junge Mädchen.
»Nein, ich meine nicht das Pferd, ich meine den Reiter,« sagte der Vater; »aber laß gut sein. Er ist eben nicht anders, wie die meisten Uebrigen, und zu einem Abend auf dem Ball mag er ausreichen. Doch ging da nicht eben draußen die Thür?«
In dem Augenblick klopfte es an.
»Herein!«
»Bitte underthänigst um Escüse, wenn ich etwa stören sollte!« sagte eine etwas scharfe Stimme, und ein Kopf mit rothen Haaren erschien – etwa in der Nähe des Schlosses – in der Thür.
»Ah, der Schuhmacher!« rief Ottilie, während ein muthwilliges Lächeln über ihre Züge blitzte. »Kommen Sie herein, Meister Heßberger; Papa ist gerade hier.«
»Mich allergehorsamst zu bedanken,« sagte der Höfliche, indem er, wie er schon vor der Thür gestanden hatte, in's Zimmer trat. »Gelobt sei Jesus Christus – wünsche allerseits einen vergnügten Morgen!« Dabei blitzten die kleinen, hellgrauen Augen rasch durch das Zimmer, um zu sehen, wer sich hier befand, und auf den Spitzen der Zehen trat er dann weiter in die Stube hinein.
Schuhmachermeister Heßberger war in der That ein wunderlicher Bursche und hatte seine Eigenthümlichkeiten. Von kleiner, untersetzter Gestalt, machte er bei seinem ersten Erscheinen fast stets den Eindruck, als ob ihm der Kopf, den er trug, gar nicht gehöre und er ihn nur aus Versehen heute Morgen aufgesetzt habe. Der Körper war dünn und schmächtig, das Gesicht aber, mit einem tüchtigen Unterkinn daran, sah fett und glänzend aus, mit breitem Mund und etwas aufgestülpter Nase. Das Haar trug er glatt angekämmt à la Napoleon I., nur daß es feuerroth war, und in den Ohren kleine goldene Ringe. Die kaum sichtbaren Augenbrauen waren dabei immer in die Höhe gezogen, und kein Mensch hatte ihn außerdem im Leben lachen sehen. Die Mundwinkel gingen ihm stets nach unten, und er machte permanent ein Gesicht, als ob er auf der Erde innig betrübt wäre und nur zum Troste gen Himmel und nach oben blicke. Er stand auch in der That im »Geruche der Frömmigkeit« und würde nie an einem Sonn- oder Feiertage die Kirche versäumt haben, wo er sich dann jedesmal durch seine gellende Stimme auszeichnete.
Er arbeitete übrigens schon seit längeren Jahren für Witte's Familie, und der Staatsanwalt war eigentlich nicht besonders mit ihm zufrieden und würde schon lange einen andern Schuhmacher angenommen haben; Ottilie bat aber immer für ihn, denn sie amüsirte sich so vortrefflich über sein komisches Wesen und seine geschraubten Redensarten. »Entschuldigen Sie, Herr Geheimer Staatsanwalt,« sagte auch der Mann jetzt, indem er mit der ernsthaftesten Miene und einer Verbeugung einen Schritt vortrat, »daß ich Ihnen im Neklischeh treffe; aber Sie haben mich rufen lassen, und ich wünschte jetzt den Grund meines Daseins zu wissen.«
»Ich habe Sie rufen lassen?«
»Ich war's, Papa,« lachte Ottilie; »Herr Heßberger sollte mir ein Paar starke Schuhe anmessen, und da er mir die letzten ein wenig zu eng gemacht hat, wollte ich gern, daß er noch einmal Maß nähme.«
»Mit Plesir, mein Fräulein,« sagte Meister Heßberger, indem er in die Tasche griff und sein hölzernes Maß herausholte: »wenn Sie sich nur gefälligst blasiren wollen, werde ich Ihnen das gleich besorgen.«
»Aber nicht wieder über den Spann so eng, Meister,« sagte das junge Mädchen, indem es ihm den kleinen Fuß hinhielt: »die letzten Schuhe haben mir hierherüber wirklich Streifen gedrückt.«
»Soll nicht wieder vorfallen, meine Gnädigste, soll gewiß nicht wieder vorfallen,« versicherte Heßberger. »Also dicke Schuhe wollen Sie haben. Vielleicht mit guten Pertsche-Sohlen?«
»Wie Sie es machen wollen. Aber ich fürchte, die Guttapercha-Sohlen lösen sich ab.«
»Können sie nicht – können sie bosetief nicht; denn sie werden an den Rändern so hermöglichst verschlossen, daß gar keine Luft zudringen darf.«
»Dann nehmen Sie aber nur besseres Oberleder,« sagte die Frau Staatsanwalt, »als zu den letzten Stiefeln meines Mannes; denn schon nach den ersten vierzehn Tagen ging das entzwei, und eigentlich sollte es doch länger halten, als die Sohlen.«
»Bei mir nicht, Frau Geheime Staatsanwalt, bei mir nicht,« sagte Heßberger; »denn ich arbeite meine Sohlen so, daß sie gar nicht zerreißen können.«
»Sie sind unverbesserlich, Heßberger,« lachte Witte.
»Danke ergebenst,« sagte der Meister, indem er wieder aufstand und das Maß in die Tasche schob. »Und wünschen Sie vielleicht Frangsemangs oben drum herum?«
»Nein, Meister, ganz einfach, und oben um den Knöchel auch nicht zu weit; ich glaube, das haben Sie noch gar nicht gemessen.«
»Ist auch nicht nöthig, das sagt mir schon der Instinct, mit Respect zu melden; aber was ich noch fragen wollte: die Schnürbänder doch wieder horizonticulär über den Fuß weg?«
»Ganz wie die vorigen.«
»Sehr schön. Und der Herr Geheime Staatsanwalt haben nichts auf dem Herzen?«
»Nichts weiter, Heßberger, als daß Sie den Unsinn mit »Geheimer« lassen. Wenn ich geheimer Staatsanwalt wäre, könnten Sie es doch nicht wissen.«
»Bitte um Escüse, Herr Ge–, Herr Staatsanwalt,« sagte Heßberger. »Wie der Herr Rath Blumfeder, der bei mir im Hause unten wohnt, geheimer wurde, ließ er es den Augenblick in die Zeitungen setzen.«
Der Staatsanwalt lachte.
»Also Sie befehlen nichts weiter?«
»Für heute nichts; und vergessen Sie nicht, wieder die quittirte Rechnung beizulegen, wenn Sie die Stiefel schicken. Sie wissen, daß ich keine Schulden haben will.«
»Sollen bedient werden, Herr Geheimer Staatsanwalt, sollen pünktlich bedient werden. Habe indessen die Ehre, mich gehorsamst zu empfehlen!« Und damit drückte er sich wieder mit einem tiefen Bückling zur Thür hinaus.
»Das ist ein zu komischer Kauz,« lachte Ottilie, als er die Thür geschlossen hatte; »und er braucht immer so drollige Ausdrücke. Wenn man nur Alles behalten könnte, was er sagt.«
»Ein ganz durchtriebener Halunke ist er, darauf möchte ich meinen Hals verwetten,« sagte der Vater; »und faustdick hat er es dabei hinter den Ohren.«
»Ich würde ihn eher für dumm, als durchtrieben halten,« meinte Frau Witte.
»Den verkaufe nur nicht für dumm,« nickte ihr Mann; »umsonst liegt der nicht jeden Sonntag in der Kirche.«
»Aber daraus willst Du ihm doch keinen Vorwurf machen? Es wäre besser für Dich, wenn Du häufiger gingest.«
»Ich kann die Heuchler nicht leiden,« sagte der Staatsanwalt, »und daß sich der Schuhmacher nur fromm stellt, davon bin ich fest überzeugt.«
»Und was sollte er dabei haben?«
»Wer weiß es. Seine Frau betreibt hier ein sehr einträgliches Geschäft mit Kartenlegen, Krankheiten besprechen und anderem Unsinn – wer kann sagen, wie er sie dabei unterstützt? Die Polizei hat dem würdigen Paare nur noch nicht beikommen können; aber aus den Augen werden sie nicht gelassen.«
»Und Ihr thut ihm gewiß unrecht. Er ist so komisch, und wenn er sagt: Herr Geheimer Staatsanwalt...«
»Das ist eine ganz gemeine Schmeichelei,« erwiederte ärgerlich der Vater, »wie es überhaupt eine Menge von Menschen an sich haben, Leuten, mit denen sie verkehren, und besonders solchen, von denen sie etwas erhoffen, einen höheren Titel beizulegen, als sie wirklich besitzen. Und doch giebt es Schwachköpfe, die sich dadurch geehrt fühlen.«
»Du bist wirklich zu hart mit dem armen Heßberger, Papa.«
»Glaube aber nicht, daß ich ihm unrecht thue – hol' ihn der Henker! Ich, für meinen Theil, würde dem Burschen nie über den Weg trauen. Aber weshalb ich eigentlich herüberkam: Ihr kennt doch Alle den Schlosser Baumann, unsern früheren Nachbar? Du hast ja als kleines Mädchen auch immer mit den Baumann'schen Kindern gespielt, und sein ältester Sohn kommt manchmal hier in's Haus.«
»Ja, gewiß, Vater,« sagte Ottilie; »er ist Werkführer beim Mechanikus Obrich drüben.«
»Wie viel Kinder hat der Baumann?«
»Ich weiß es nicht, Vater, ich glaube aber vier.«
»Keine Tochter?«
»Doch, eine Tochter und, wenn ich nicht irre, drei Söhne.«
»Und wie alt ist die Tochter?«
»Sie kann kaum über fünf oder sechs Jahre alt sein.«
»Also keine ältere Tochter?«
»Ich weiß es nicht. Weshalb, Papa?«
»Ach, es war nur so eine Frage; aber schicke doch einmal nachher die Jette hinüber und laß ihn bitten, zu mir zu kommen. Ich möchte mir einen neuen Schlüssel zu meinem Schreibtisch machen lassen, denn den alten muß ich verkramt haben; ich kann ihn nirgends mehr finden.«
»Ja, und ein anderes Schloß an unsern Vorsaal auch, Dietrich,« sagte die Frau; »denn seit mir der Schlüssel damals weggekommen ist, fehlt mir alle Augenblicke etwas. Denke Dir nur, zwei von unseren schweren Eßlöffeln sind fort – ich wollte Dir eigentlich gar nichts davon sagen.«
»Ach, die werden sich schon wiederfinden; gestohlen können sie doch nicht gut sein.«
»Aber ich weiß nicht, wo; alle Kisten und Kasten habe ich schon umgedreht, alle Winkel und Ecken durchsucht.«
»Nun gut, schicke nur einmal hinüber zu dem Meister und laß ihm sagen, es wäre mir angenehm, wenn er selber kommen könnte; ich hätte etwas für ihn zu thun.«
»Aber unser Schlosser ist eigentlich Weller nebenan.«
»Baumann soll sehr geschickt sein, und mein Schloß ist etwas complicirt. Wie alt kann sein Sohn, der Mechanikus, etwa sein?«
»Ich weiß es nicht, Papa; vielleicht fünf- oder sechsundzwanzig Jahre. Er trägt einen vollen Bart, da kann man es nie so genau sehen.«
»Hm,« sagte der Vater und nickte still und nachdenkend vor sich hin, »das ist doch ein recht ordentlicher Mensch und der alte Baumann ein braver und durchaus rechtlicher Mann.«
»Ich habe wenigstens noch nie das Gegentheil gehört,« sagte Frau Witte; »aber er ist entsetzlich roh. Doch paßt das wohl zu seinem Geschäft, und so weit wir mit den Leuten in Berührung kommen, läßt man es sich schon gefallen. Höchstens daß sein Sohn einmal eine Arbeit herüberbringt.«
»Ich denke, unser Schlosser ist Weller?«
»Nein, vom Mechanikus drüben.«
»Und was habt Ihr für Arbeiten beim Mechanikus?«
»Du lieber Himmel, Papa,« sagte Ottilie ernsthaft, »in einer Wirthschaft fällt immer Allerlei vor. Bald ist einmal eine Lorgnette zerbrochen oder ein Opernglas muß nachgesehen werden; neulich war erst das Thermometer schadhaft geworden. Und der junge Baumann ist darin wirklich außerordentlich aufmerksam und so gefällig; man kann es sich gar nicht bequemer wünschen.«
»So?« sagte der Vater, dem jedenfalls andere Dinge im Kopf herumgingen. »Aber ich habe zu thun, und wenn ich Euch rathen soll, so macht Ihr auch Eure Toilette; denn es ist spät geworden und könnten doch einige Ballbesuche kommen, mit denen ich wenigstens verschont bleiben möchte. Vergiß nur nicht, nach dem Schlosser zu schicken.«
Der Vater ging in sein Zimmer hinüber, und die Mutter hatte sich noch behaglich in die Sophaecke gedrückt, um vorher in aller Ruhe das Morgenblatt zu lesen. Ottilie schickte, dem Auftrage des Vaters folgend, das Mädchen fort und schritt dann eben über den Vorplatz hinüber ihrem eigenen Zimmer zu, als es klingelte. Sie öffnete selber, denn ein Besuch konnte es noch nicht sein.
»Ah, Herr Baumann,« sagte sie, halb erröthend, als sie den Außenstehenden erkannte und wußte, daß sie eben erst über ihn gesprochen.
»Fräulein Witte,« erwiederte der junge Mann, der in seiner Arbeitstracht an der Treppe stand, »ich habe mir erlaubt, Ihnen das Lorgnon selber hinüber zu tragen, da ich glaubte, daß Sie es vielleicht brauchen würden. Ich hoffe, es soll jetzt besser halten, als früher; ich habe es selber reparirt. Den Thermometer werde ich Ihnen auch bald bringen.«
»Ich danke Ihnen sehr, Herr Baumann,« sagte Ottilie und wurde noch verlegener, denn der junge Mann sah sie mit einem so eigenthümlichen Blick an. »Und was – was habe ich Ihnen dafür zu zahlen?«
Wie Purpur zuckte es über das offene Gesicht des jungen Handwerkers und er zögerte mit der Antwort.
»Ich hoffe,« sagte er endlich, »Sie werden die Kleinigkeit nicht erwähnen; es war eine Feierabends-Arbeit.«
»Aber das kann ich nicht annehmen,« stotterte Ottilie; »bitte, sagen Sie mir, was ich schuldig bin.«
»Nun denn, wenn Sie es nicht anders wollen – einen Groschen.«
»Einen Groschen? Die ganze Schale war zerbrochen!«
»Mein Fräulein, ich muß selber am besten wissen, was meine Arbeit werth ist. Ich habe nicht mehr verdient und kann also auch nicht mehr dafür nehmen.«
»Aber ich kann doch nicht wagen, Ihnen einen Groschen...«
»Sie wollten mich ja absolut bezahlen, Fräulein; ich bitte also deshalb um einen Groschen.«
Ottilie war jetzt noch viel verlegener geworden, als vorher; aber sie konnte nun auch nicht mehr zurück. Sie wußte wenigstens im Augenblick nicht, wie sie sich helfen sollte, griff deshalb in die Tasche und gab dem jungen Mann den Groschen, den er lächelnd und mit leisem Danke nahm.
»Den werde ich mir zum Andenken aufheben, Fräulein Ottilie,« sagte er dabei, drehte sich ab und sprang die Treppe wieder hinunter.
2. Die Bewohner von Schloß Wendelsheim.
Draußen vor Alburg, kaum eine halbe Stunde Weges von der Stadt entfernt, lag das Rittergut des Freiherrn von Wendelsheim in einem reizenden, von prachtvollen Buchen und Linden bewachsenen Thale. Das alte Stammschloß der Familie, die sogenannte Wendelsburg, stand allerdings auf dem nächsten Felsenhügel, oder hatte vielmehr dort in früheren Jahrhunderten gestanden, denn ihr Glanz war lange gesunken, und nur aus leeren Fensterhöhlen starrte sie jetzt in ihren Trümmern melancholisch und unheimlich auf das freundliche Landschaftsbild zu ihren Füßen nieder.
So stand die alte Wendelsburg aber schon lange. Ein Raubritter sollte dort zuletzt gehaust und dermaßen gewirthschaftet haben, daß es der Landesherr zuletzt nicht mehr mit ansehen konnte und durfte und seine Mannen gegen das Diebesnest sandte. Die stürmten es denn auch und räumten gründlich auf. Was aus dem Herrn der Burg wurde, weiß man nicht; vielleicht fiel er in der Vertheidigung des Schlosses, vielleicht zog er mit den Kreuzfahrern in das gelobte Land. Die Burg aber ward zerstört; die einzelnen, von den Mauern niedergeschleuderten Steinbrocken lagen noch jetzt hier und da am Bergeshange in Schlucht und Ravine, und nur die leeren Mauern der Wohngebäude blieben stehen und fast ein Jahrhundert lang unbenutzt.
Endlich ließen sich wieder Abkömmlinge jenes alten Geschlechts, die sich mit den Reichsfürsten ausgesöhnt haben mochten, dort nieder; aber nicht in der alten Burg selber, die ihnen doch wohl zu steil und unbequem liegen mochte. Auf dem schmalen Felsenkamm hätte auch nicht einmal ein Garten Platz gefunden, während das Thal selber wie gemacht zu einer herrschaftlichen Wohnung schien. Dort bauten sich denn auch die Herren von Wendelsheim an – großartig, wie sich nicht läugnen läßt, denn einige Zweige der Familie waren enorm reich –, mit weiten Gehöften, Stallungen und einem palastartigen Wohngebäude. Auch ein herrlicher Park, gefüllt mit edlem Wild, umschloß das Ganze, und ein Fürst hätte sich dort behaglich fühlen können.
Ob nun aber schon der erste Erbauer durch die vielleicht zu großartigen Anlagen in Schulden gerieth oder ob seine späteren Nachkömmlinge das vorhandene Vermögen etwas scharf in Angriff nahmen, kurz, die Wendelsheim, die von je her sehr viel Geld verbraucht, gingen in den auf einander folgenden Geschlechtern zurück und schienen genöthigt zu werden, sich mehr und mehr einzuschränken.
Wenn noch im vorigen Jahrhundert ein wahrer Troß von Dienern die inneren Räume des großen Schlosses belebt hatte, wenn lustige Cavalcaden von Herren und Damen draußen im Park dem edlen Waidwerk oblagen und manchen braven Hirsch zu Tode hetzten, wonach dann bis spät in die Nacht dauernde Gelage das Siegeswerk feierten, so wurden derlei Dinge jetzt wohl auch noch ausgeführt, aber nur en miniature. Der alte Freiherr setzte sich, von einem einzigen Reitknecht und dem Revierförster zu Fuße begleitet, auf einen alten Klepper, der das Schießen gut vertragen konnte, und ritt pirschen, und Abends trank er dann, wenn auch gerade keinen Humpen, so doch eine halbe Flasche Landwein, und legte sich früh schlafen. Er konnte das lange Aufsitzen nicht mehr vertragen.
Auch mit dem Schlosse selber war eine sichtbare Veränderung vorgegangen, und zwar nicht zum Besseren. Die großen Räumlichkeiten wurden nicht mehr gebraucht, zwei Drittel der Stallungen standen schon ohnedies leer, und das eigentliche, drei Etagen umfassende Schloß, das sonst wohl manchmal bis unter den Giebel von Gästen und ihrer Dienerschaft angefüllt gewesen, zeigte den Zahn der Zeit in nur zu deutlichen Spuren. Es hätte auch in der That viel Geld und eine weit größere Dienerschaft, als sie die jetzigen Besitzer hielten, erfordert, um die Gebäude alle in Stand zu halten – und wozu? Die erste Etage mit den unteren Räumen für Küche und andere häusliche Zwecke genügte vollkommen und stand noch in zwar verblichener, aber doch alter Pracht. Von den übrigen Gemächern wurden aber nur wenige dann und wann zu Fremdenzimmern benutzt, und die beiden Flügel blieben ganz leer; ja, zerbrochene und mit Spinngeweben überzogene Fensterscheiben zeigten sogar, daß sie gar nicht mehr betreten wurden. Nur die oberen Etagen waren zu Kornböden eingerichtet worden, und dazu besaß der Verwalter den Schlüssel. Die Herrschaft kam nie mehr hinüber, den alten Freiherrn ausgenommen, der manchmal dort hinaufstieg, um den Kopf zu schütteln, daß die aufgeschichteten Getreidehaufen in ihrer Quantität die Summe nicht repräsentirten, die er nothwendig dafür brauchte.
Trotz alledem wurde die äußere Form eines vornehmen Haushalts nach besten Kräften aufrecht erhalten. Der Freiherr von Wendelsheim war allerdings zugleich Kammerherr des Königs und als solcher, wenn auch im Sommer selten in Anspruch genommen, doch verpflichtet, den Winter in der Residenz zuzubringen. Dort machte er aber kein eigenes Haus, sondern begnügte sich mit seiner Dienstwohnung im Palais, während daheim auf Schloß Wendelsheim seine unverehelicht gebliebene Schwester Aurelia die Oberleitung der ganzen Wirthschaft mit eisernem Scepter führte.
Der Freiherr hatte zwei Söhne, von denen der älteste – jetzt fast vierundzwanzig Jahre alt – Lieutenant war, während der jüngste – ein zarter Knabe von kaum etwas mehr als siebenzehn Jahren – seines sehr leidenden Körpers wegen in den letzten Jahren sogar seine Studien hatte unterbrechen müssen und hier auf dem Schlosse, in der milden und freien Luft, nur seiner Gesundheit lebte.
Aber es war eigentlich ein trauriges Leben auf Schloß Wendelsheim, und besonders seit die Freifrau einige Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes gestorben, schien es, als ob der Frohsinn die alten Mauern gründlich verlassen habe und nur noch bei dem Freiherrn und dessen Schwester das Bewußtsein ihres Ranges und Standes mit Stolz und Härte genug zurückgeblieben wäre, um eine dreifache Anzahl von Dienstleuten, als sich jetzt im Schlosse befand, mürrisch zu erhalten und unbehaglich zu machen.
Wenn aber auch die Vermögensverhältnisse des Freiherrn jetzt ziemlich gedrückter Art waren und er bedeutende Schulden machen mußte, um nur standesgemäß leben zu können, so bekam er trotzdem überall geborgt und wußte auch, daß sich sogar in allernächster Zeit seine Vermögensverhältnisse, oder die des Hauses wenigstens, glänzend verbessern, ja wie ein Phönix aus der Asche erstehen würden.
Mit dem Geburtstage seines ältesten Sohnes, des Lieutenants nämlich, der in kaum zwei Monaten fiel, wurde eine außerordentlich bedeutende Erbschaft für diesen fällig, die eigens dazu bestimmt worden, den alten Glanz des Hauses Wendelsheim wieder neu zu beleben.
Der letzte Abkömmling einer der Hauptlinien hatte diese Erbschaft ausgesetzt, aber mit einer eigenthümlichen Nebenbestimmung.
Beide Vettern, jener alte General von Wendelsheim und unser alte Freiherr, hatten eigentlich nie in gutem Vernehmen mitsammen gestanden, ja, sich sogar gründlich gehaßt, und dieser Gefühle auch nie groß Hehl gehabt. Bruno von Wendelsheim aber, wie der General hieß, war, bei einem enormen Reichthum, unvermählt geblieben, ja, sogar ein Weiberhasser, und hing nur mit all' der zähen Liebe und Verehrung, deren er fähig war, an seinem alten Stammbaum, an dem Glanze und Ruhme derer von Wendelsheim, und doch drohte das ganze Geschlecht auszusterben, denn unser Freiherr war damals der Letzte des Namens und, obgleich er schon fünf Jahre vermählt, noch ohne Lebenserben.
Da bezwang der alte General auf seinem Sterbebette den Haß, den er gegen die Person des Vetters vielleicht gefühlt, und nur noch in ihm den alleinigen Träger des Namens sehend, setzte er wenige Tage vor seinem Tode ein Testament zu dessen Gunsten auf.
Er wußte, in welch' zerrütteten Vermögensverhältnissen sich jener Zweig der Familie schon damals befand, und wenn ihm auch nichts daran lag, dem Vetter selber aus der Verlegenheit zu helfen, sollten doch die Erben des Namens wenigstens nicht mit einer solchen Misère zu kämpfen haben. Das Testament lautete aber vorsichtiger Weise nur auf einen männlichen Erben des Hauses Wendelsheim, der aber auch erst wenn er das vierundzwanzigste Jahr erreicht hätte, die damals für ihn verzinslich angelegte Summe von zweihunderttausend Thalern ausgezahlt erhalten solle.
Bekam der Baron von Wendelsheim mehrere Söhne, so blieb dieses Capital trotzdem nur für den ältesten bestimmt und ging erst nach dessen Tode, wenn er ohne Söhne starb, auf den zweiten über. Bekam der Baron dagegen keine Kinder, oder nur Mädchen, so sollte er nicht einen Pfennig von der Summe erhalten, denn diese konnten den alten Namen nicht fortpflanzen. Fünfzigtausend Thaler waren in diesem Falle einem sehr weitläufigen Verwandten und damals sehr lockern Officier, einem Herrn von Halsen, ausgesetzt, und mit dem Rest, von dem indessen Zins zu Zins geschlagen wurde, sollte ein Stift für adelige Fräuleins gegründet werden. Bekam der Freiherr dagegen Knaben, so sollte er schon in so fern früher eine theilweise Nutznießung der Zinsen haben, als er vom zwölften Jahre des Erstgeborenen an jährlich für dessen Erziehung zweitausend Thaler erheben konnte.
Freiherr von Wendelsheim wurde nach dem Tode seines Vetters mit dem Inhalt dieses Testaments bekannt gemacht und allerdings sehr freudig überrascht. Mit um so größerer Angst sah er aber nun auch dem Zeitpunkt entgegen, der seine frohesten Hoffnungen verwirklichen sollte und einzutreten versprach: nämlich die Geburt eines Kindes. Aber Alles hing natürlich davon ab, daß es ein Knabe sei, denn bei der Geburt einer Tochter änderte sich in seinen Vermögensumständen nichts; er blieb nach wie vor auf seine eigenen, sehr reducirten Mittel angewiesen und ihm schließlich, wenn kein Sohn nachkam, nichts weiter übrig, als die Tochter in das nämliche Stift zu thun, das sein Vetter mit dem ihm entzogenen Gelde gegründet haben wollte.
Damals soll er sich auch in einer furchtbaren Aufregung befunden haben und halbe Nächte nicht vom Pferde gekommen sein. Aber er hatte sich umsonst geängstigt. Die so heiß ersehnte und gefürchtete Stunde brach endlich an, und lauter Jubel weckte plötzlich mitten in der Nacht die Dienerschaft, denn der erwartete Erbe, ein prächtiger, dicker Junge, war erschienen und schrie lustig in die ihm noch fremde Welt hinein.
Das war ein Jubel im Hause: der Champagner floß und die Dienerschaft bekränzte am folgenden Morgen das ganze herrschaftliche Schloß mit grünen Guirlanden und Blumen. Ja, der Schulmeister aus dem Dorfe Wendelsheim rückte sogar mit der ganzen Schuljugend hinauf auf's Schloß, ließ die Jungen einen Choral absingen, als ob sie eine Leiche zu Grabe trügen, und zog sich dann wieder, Taschen und Hut voll von noch dampfenden, warmen Kuchen gestopft, in die Stille des Privatlebens zurück.
Der Knabe wuchs und gedieh. Es war anfangs ein bildhübsches Kind gewesen, aber er entwickelte sich später etwas derber und knochiger, wie man das ja wohl häufig bei auffallend hübschen Kindern hat, daß sie nicht immer halten, was sie versprechen. Die Eltern aber hingen mit größerer Liebe an dem Knaben, als sich die Hoffnung, einen zweiten Sohn und Erben zu erhalten, immer weiter hinausschob.
Daß dabei im Publikum, mit der eigenthümlichen Erbschaft zusammenhangend, anfangs ganz sonderbare Gerüchte auftauchten, läßt sich denken. Auf die Aussagen verschiedener Leute im Schlosse fußend, wurde behauptet, mit dem Erben sei nicht Alles so recht und richtig zugegangen. Es wäre eigentlich ein Mädchen gewesen, und der alte Baron hätte dafür gesorgt, daß er sich die Erbschaft trotzdem sicherte. Aber es war in all' den Gerüchten keine feste Basis, und das Meiste beschränkte sich nur auf Hörensagen. Der Verdacht war allerdings da; man traute dem Baron etwas Aehnliches zu, aber die Beweise fehlten, und wie sich diese Gerüchte ein paar Monate gehalten und das stehende Thema aller Kaffeegesellschaften gebildet hatten, verschwanden sie, wie sie gekommen. Zuletzt sprach kein Mensch mehr davon, und als sechs und ein halb Jahr später die Baronin noch einem zweiten Knaben das Leben gab, zerfielen die auf jenes Gerücht gegründeten Suppositionen überhaupt in Nichts.
Leider kränkelte von da ab die Baronin selber unaufhörlich, und wenn es auch manchmal schien, als ob sie wieder hergestellt werden könne, war das nur immer ein Aufflackern der Lebenskräfte. Benno hatte noch nicht sein viertes Jahr erreicht, als sie ihrer unheilbaren Krankheit erlag.
Nun ist es allerdings ein sehr natürlich Ding, daß Eltern nur zu sehr geneigt sind, das jüngste Kind etwas zu verwöhnen und ihm anscheinend ihre ganze Liebe zuzuwenden. Das Kleinste ist ja auch immer das Niedlichste und erfordert die meiste Sorge und Pflege, und wir geben uns am liebsten und häufigsten mit ihm ab. Auffallend war aber doch, wie der Vater von dem Augenblick an, wo er seinen jüngsten Sohn auf dem Arm schaukelte, den Erstgeborenen vernachlässigte und sich fast gar nicht um dessen Erziehung kümmerte. Das jüngste und allerdings sehr zarte Kind ließ er fast nicht aus den Augen und wachte mit ordentlich mütterlicher Sorgfalt über ihn. Der Aelteste dagegen mochte thun, was er eben wollte, er ließ ihm ganz seinen eigenen Weg. Bruno wuchs demnach ganz allein, seinen eben nicht glänzenden Anlagen überlassen, ziemlich wild und ungehindert auf. Zur Musik zeigte er entschiedenes Talent, zu weiter nichts, und als die Frage endlich an den Vater herantrat, was einmal aus ihm werden sollte, wurde er in die große Versorgungsanstalt für adelige Kinder, in ein Cadettenhaus gesteckt.
Benno, der zweite Sohn, wuchs indessen ebenfalls heran; aber es war in der That nur ein Angstkind und sein kleiner Körper so empfänglich für die geringsten Einflüsse, daß es fast keine gesunde Stunde hatte. Ob man es vielleicht mit allzu großer Pflege versehen, läßt sich nicht sagen; aber während Bruno draußen in Wind und Wetter herumtollte, wenn er einmal nach Hause kam, des Vaters wildeste Pferde ritt, oder Nächte durch draußen im Wald auf dem Anstande lag, mußte Benno wie ein rohes Ei vor jedem rauhen Luftzug gehütet werden.
Merkwürdig stach außerdem Benno's zarter, von lichtblauen Adern durchzogener Teint, das bleiche Antlitz mit den großen, dunklen Augen und den wirklich edlen Zügen gegen das kräftige, sonnverbrannte Gesicht des Bruders ab, der außerdem noch blaue Augen und eine etwas stumpfe Nase hatte. Die beiden Brüder sahen sich überhaupt gar nicht ähnlich, wenn sie sich auch herzlich lieb hatten, und waren auch in ihren Neigungen ganz verschieden.
Bruno fand weniger Freude am Soldatenstande als an der Oekonomie, für welche er schon von früher Jugend an eine Vorliebe zeigte. Benno dagegen, vielleicht auch durch seinen kränklichen Körper darauf angewiesen, warf sich mit größter Liebe auf die Wissenschaften, und darunter besonders auf physikalische und mathematische Werke. Er schien auch dabei nur eine Leidenschaft seines Großvaters geerbt zu haben, der sich ebenfalls mit der Mathematik viel beschäftigt und eine Masse von ihm benutzter Instrumente noch hinterlassen hatte.
So wuchsen die Brüder heran, und der Zeitpunkt war schon auf wenige Monate, ja, fast auf Wochen nahe gerückt, wo Bruno, als der älteste Sohn oder Erstgeborene, die indessen durch Zins und Zinseszins bedeutend angewachsene Erbschaft erheben sollte. Es schien ja auch allen Bedingungen genügt, und Vater wie Sohn wünschten den Tag sehnlichst herbei, denn beide hatten nicht gering auf ihn gesündigt. Du lieber Gott, wie viel Geld braucht denn nicht allein ein adeliger Lieutenant, wenn er auf der Welt nichts weiter zu thun, als einen alten Namen zu repräsentiren hat!
Benno's Zustand verschlimmerte sich dagegen mit jedem Tage, und wenn man gehofft hatte, daß er in einem mehr reiferen Alter die Kränklichkeitskeime abschütteln würde, so zeigte sich leider nur zu bald das Gegentheil. Der Arzt hatte die Krankheit für einen Herzfehler erklärt, und sie schien, anstatt sich zu heben, einen immer drohenderen Charakter anzunehmen.