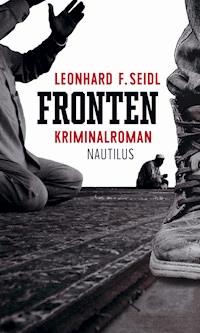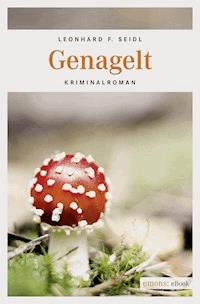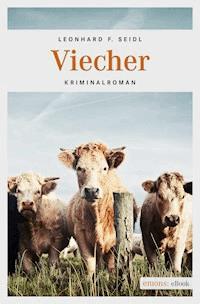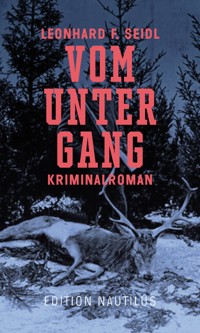9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Volk Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1967, Rothenburg ob der Tauber fiebert dem Besuch des Schahs von Persien und von Farah Diba, seiner Kaiserin auf dem Pfauenthron, entgegen. Was keiner weiß: Auch Bartholomäus König, seines Zeichens Schuldirektor mit schauspielerischer Hochbegabung und tief sitzender Abneigung gegen jede Ordnung und Autorität, kann es kaum erwarten, die Bühne zu betreten. Am großen Tag hält ein umjubelter Schah seine Rede auf dem Balkon des mittelalterlichen Rathauses – während ein zweiter Mann in der geschlossenen Psychiatrie im Bezirkskrankenhaus Ansbach tobt und im Wechsel Flüche auf Farsi und Englisch ausstößt. Um zu erzählen, wie es dazu kam, muss unser Held Bartholomäus etwas weiter ausholen, genau genommen bis zu seiner abenteuerlichen Geburt am 26. Oktober des Jahres 1919 - mit dem hochwohlgeborenen Schah teilt sich König seitdem nicht nur den Geburtstag. Doch bis sie sich gegenüberstehen, müssen fast 50 furiose, an Merkwürdigkeiten nicht arme Jahre vergehen ... „Der falsche Schah“ ist ein bayerischer Schelmenroman, eine augenzwinkernde Parabel über Schein und Sein und die Kraft der Suggestion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
LEONHARD F. SEIDL
DERFALSCHESCHAH
VOLK VERLAG MÜNCHEN
Dieser Roman entstand im Rahmen des Literaturstipendiums des Mittelalterlichen Kriminalmuseums, Rothenburg o. d. T. 2020. Der Autor dankt der Stiftung mittelalterliches Kriminalmuseum, Rothenburg o. d. T. und der Bildungsstätte Wildbad für die Verleihung des Stipendiums.
Coverabbildung: iStock/Wikimedia Commons
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2020 Volk Verlag München
Neumarkter Straße 23; 81673 München
Tel. 089 / 420 79 69 80; Fax: 089 / 420 79 69 86
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
ISBN 978-3-86222-379-4
www.volkverlag.de
Inhalt
Auf dem Höhepunkt der Macht
Die Geburt des Kaisers
Der tiefe Fall
Der Einmarsch des Kaisers
Auf zur Folterkammer
Ausrufung des Kaisers
Im Folterkeller
Ernennung zum Oberst
Schreckung der Eisernen Jungfrau
Erdbeben
Territio verbalis – das Erschrecken
Am deutschen Busen der Natur
Ziemliche Tortur
Dem Adi sein Apfel
Auf dem Folterstuhl
Iranische Arier
Scharfe Tortur
Adi, der Prophet
Eingesackt
Krönung und Nachwuchs
Gerädert
Die Nazen sind zurück!
Farah und der Keuschheitsgürtel
Regenbogen über Rothenburg
Gebratenes Menschenfleisch
Salon Soraya
Der Armesünderlöffel
Die Märchenhochzeit
Auf glühenden Kohlen
Schein und Sein
Knackender Kiefer
Farah kommt!
Der Schwedentrunk
Alles für den Schah!
Aufgehängt
Auf dem Höhepunkt der Macht
Die Schandmaske
Dank
Für meine Klausi-Oma mit der Farah Diba-Frisur
„Er wird euch irreführen und Versprechungen machen,aber lasst euch nicht täuschen.“
Ryszard Kapuscinski, Schah-in-schah
Auf dem Höhepunkt der Macht
„Der Schah ist eine besonders gefährdete Person“, hast du die letzten Wochen überall in Rothenburg ob der Tauber gehört. Daran muss jetzt auch der Bartholomäus König denken, wie er in seinem feschen Anzug unter den Altanen des mittelalterlichen Rathauses steht, die nicht weniger fesche Farah Diba neben sich. Die Frau, von der sogar seine Mutter träumt, die letztlich der Grund ist, also seine Mutter, warum er jetzt da steht, an der Stelle vom Schah.
Der Schäfertanz auf dem Marktplatz ist vorbei, der Oberschäfer tritt nach vorn. „Den kaiserlichen Majestäten zur Ehre sind wir angetreten und danken für die Huld und Gnad zum Ruhme unserer Vaterstadt. Ein Hoch dem alten Schäferstand. Ein Hoch dem ganzen deutschen Land. Ein Hoch den edlen Gästen. All stimmt ein und ruft mit lautem Schall: Sie leben hoch!“ Tusch.
„Hoch!“, jubeln die Rothenburger. Tusch. „Hoch!“ Tusch. „Hoch!“
Und dann ist der Schah dran. Der Dolmetscher neben ihm ahnt nicht im Geringsten, was ihm blüht. Kann also nicht einmal froh sein, noch einen kurzen Moment verschnaufen zu dürfen. Weil, der König sagt laut und deutlich „Grüß Gott!“, hebt dabei die Hand und winkt. Die Menschenmassen zu seinen Füßen jubeln: sein Vater, seine Mutter, die Rothenburgerinnen und Rothenburger, Alte, Kinder, sogar die Kranken haben sich rausgeschleppt. Manche verlieren die ein oder andere Träne, was im Regen völlig untergeht. Seine Tochter, die Aurelia, ist schon abgeführt worden von der Polizei, sitzt im Bully mit dem Blaulicht auf dem Dach.
Der Schah erhebt erneut seine Stimme: „Labe eâr chere fotlan mamnunam …“
Zuerst werden die Backen vom Dolmetscher rosig, dann der ganze Schädel fuchsrot, was auch die Schweißperlen nicht vereiteln können. Stille auf dem Marktplatz, die Rothenburger warten gespannt, was ihnen der Schah zu sagen hat, auf die Worte des rotkopferten Dolmetschers. Der schaut zum Schah, würd ihn am liebsten fragen, was er da eigentlich gesagt hat. Aber dem Schah sein gestrenger Blick, den er nur allzu gut kennt, hindert ihn daran, diesen Blödsinn zu machen, obwohl ja eigentlich der Schah, vulgo König, derjenige ist, der gerade Blödsinn macht.
In der geschlossenen Psychiatrie im Bezirkskrankenhaus (BKH) Ansbach tobt derweil ein Mann, der wie der König ausschaut, im Wechsel Flüche auf Farsi und Englisch ausstößt und behauptet, der Schah von Persien zu sein.
Die Geburt des Kaisers
Später fragte sich Bartholomäus König oft, ab wann seine Eltern wussten, dass er am selben Tag wie der Schah von Persien zur Welt gekommen war: am 26. Oktober 1919. Denn ihre Anspielungen waren auffällig zahlreich gewesen. So wurde davon gesprochen, dass er jetzt dort hingehe, wo selbst der Kaiser zu Fuß hingeht. Das mag eine geläufige Redewendung und eine Ermunterung der Mutter gewesen sein, in Erwartung einer baldigen Zukunft ohne Windel. Und sie wollte dadurch sicherlich auch erklären, warum er zu Fuß aufs Klosett gehen musste und sich nicht von ihr tragen lassen durfte, auch wenn er noch so sehr belferte. Vor allem aber wird es daran gelegen haben, dass sich Mutter König die Kleider nicht dreckig machen wollte. Denn Dreck war für sie gleichbedeutend mit Unordnung. Selbst ein Halbblinder konnte es beobachten, wie sich ihre Gesichtszüge verkrampften, entdeckte sie Unordnung, wie körperlich schmerzhaft so ein Anblick für sie war.
Wenn seine Mutter ihn auf den Thron setzte, wie sie sagte, war er schon ein wenig verwundert darüber, dass er außerhalb des Throns nicht walten durfte wie ein König. Selbst wenn er es so nicht ausdrücken konnte mit seinen zwei Jahren, es war eher ein Verlangen nach mehr, nach Verwirklichung, nach Freiheit. Darum versuchte er, an seiner Wirkung als König zu arbeiten. So, wie er es in den Geschichten gehört hatte, die ihm seine Großmutter von den Königen aus dem Morgenland erzählt hatte. Noch dazu hatte die Oma gesagt, dass derjenige, der auf dem Thron sitze, „gerade regiert“. Und dass er regieren würde, hatte sich der König angesichts der Mutter und ihres Regimes von Anfang an gewünscht. Auch wenn er es wieder nicht so formuliert hätte. Also bastelte er sich aus dem Zeitungspapier, das als Klopapier diente und von dem er immer einen schwarzen Hintern bekam, eine Krone. Samt eines Zepters: Dafür rollte er die Zeitung zusammen, denn eine Klobürste gab es damals noch nicht.
Die Mutter beeindruckte er damit nur wenig. Und das, obwohl der Bartholomäus extra aufrecht auf dem Töpfchen saß und mit stolz geschwellter Brust, das Zepter schwingend, eine vollmundige Rede an sein Volk hielt: „Sieliewale, Sieliewewe, Tschagapeng bilabung sufschuwa, lieck!“
Aber anstatt sich an der Phonomonologie des zwei Jahre alten Hosenscheißerherrschers zu erfreuen, warf Mutter König Krone und Zepter in den lodernden Ofen und Bartholomäus in sein Zimmer. Wie gesagt, er spürte die Unterdrückung, so, wie er spürte, dass er auf den Thron musste, weil er es einmal zu lange unterdrückt hatte und dann war die Sauerei und damit die Unordnung und damit die Unruhe bei der Mutter und auch der blaue Popo beim Bartholomäus groß, sodass er sich gar nicht mehr wie ein Bartholomäus fühlte, sondern mehr wie der König. Sofern ich mich richtig erinnere. Denn das liegt mittlerweile knapp hundert Jahre zurück und so ein Gehirn verstaubt ja auch ein wenig über die Jahrzehnte, von den ganzen Dingen, die darin herumstehen, und den Menschen, Tieren und Pflanzen, die sich darin herumtreiben.
So schön wie der Schah von Persien, der Mohammad Reza Pahlavi, hat es der Bartholomäus König also nicht gehabt, wie er auf die Welt gekommen ist. Wobei, um das zu verifizieren, müsste man den Auslandskorrespondenten von Persien fragen, wie der Iran damals noch geheißen hat. Und ob ich den gleich erreiche, kann ich nicht versprechen. Darum erzähle ich jetzt lieber von der Geburt vom König, der damals noch nicht einmal Bartholomäus genannt wurde.
Wir schreiben das Jahr 1919. Es brodelt in und um München. Der große Krieg ist vorbei, der Kaiser hat Reißaus genommen in die Niederlande und nicht wenige Mannsbilder sind auf dem Schlachtfeld geblieben. Und die Weiberleut waren froh, wenn s’ überhaupt einen gekriegt haben, damit sie sich beim Tanzen nicht einen Antänzer kaufen haben müssen. Aber dafür hätte die Mutter vom König eh keine Zeit gehabt, weil sie ja hochgradigst schwanger war, mit einem Bauch, der sie sakrisch genervt hat; weil: Unordnung im Bauch, im Gedärm, in ihrem Kopf sowieso, dieses Mal nicht nur wegen der Unordnung außerhalb, sondern wegen den Hormonen.
Die König ist also gerade in den Schwammerln unterwegs, die nach einem kräftigen Herbstguss am Morgen des 26. Oktobers aus dem saftig-würzigen Waldboden sprießen, zwischen Tannennadeln, Laub und Ameisen. Im Korb liegen Maroni, Eierschwammerl und ein paar Steinpilze, obwohl sie sich mit dem Bücken schon arg schwertut. Das Wasser läuft ihr gerade im Mund zusammen bei dem Gedanken an die Knödl mit Rahmschwammerl, da spürt sie es: Der Bartholomäus macht einen Purzelbaum. Der erste in seinem Leben. Sie schnauft ganz arg und überlegt, was sie machen soll. Sie stellt den Korb mit den Schwammerln auf den Boden und langt sich an den Bauch. Da trifft sie ein Tropfen am Hirn und es zwickt: Der Bartholomäus hat in die Fruchtblase gebissen. Das Wasser, in das er gerade noch hineingepieselt hat, rauscht hinaus wie das Wasser in der nahen Isar Richtung Bad Tölz. Als wollt die Mutter diese Sauerei sofort aus sich heraus haben.
Die König spürt, wie es nass wird in der Unterwäsch und furchtbar laut in ihrem Kopf. Sie weiß, jetzt ist gleich der Moment der Niederkunft gekommen. Sie versucht zu überlegen, was ihr gar nicht so leicht fällt, weil es ja so laut ist zwischen ihren Schläfen. Was noch verstärkt wird durch die harten Tropfen, die jetzt in immer größerer Zahl durch die gelbbraunen Blätter jagen und auf ihrem Kopf einschlagen. Donk! Donk! Donk! Sie kommt sich vor wie ein Fassl, das gerade angezapft wurde; nur von innen und nicht von außen. Da fällt ihr das Glashaus ein.
Vor einer halben Stunde ist sie vorbeigelaufen an dem Glashaus, von dem sie schon bei der Kramerin und in der Kirch gehört hat. Ja, die Leut reden eigentlich seit Tagen von nix anderem mehr. Von den drei Staderern, den Brüdern Peter, Franz und Ottmar Ostermayr, die sich da, im Wald, südlich von München, eine Halle aus Glas ins Nirgendwo stellen. „Glashaus“, sagen die Leut. Und weiter: „Die Bildl für das Kintopp festzuhalten, das geht nicht ohne Licht.“ So wie es heut in den Bavaria Filmstudios einen Scheinwerfer braucht, um einen Film zu drehen, so haben die damals das Tageslicht gebraucht.
Der König ihre Unterleibsschmerzen werden immer heftiger, sie schnauft, so wie man es aus den Filmen kennt, die es damals noch gar nicht gegeben hat. Trotzdem schafft sie es, samt Korb und Bartholomäus, bis zum Glashaus. Schon von Weitem hört sie es klopfen, hört Pferdl schnauben, Männer schreien. Dann sieht sie das Stahlgerippe, in dem schon einzelne Fensterscheiben befestigt sind. Darin: riesige Pfannen, Stangen, Tische. Drum herum: Anhänger, Zelte und Rösser, die die in Decken eingepackten Glasscheiben auf dem Anhänger ziehen und denen genauso heiß ist wie dem Fuhrknecht, den immer die Sorge umtreibt, die Gläser könnten zu Bruch gehen. Dieser Fuhrknecht ist dann auch der erste, der ihr zur Hilfe eilt und fragt: „Was hast denn?“
Seine Frau, die Else, die gerade die Brotzeit vorbeigebracht hat, streicht sich über ihre weiße Schürze, sagt: „Pack ma’s!“ Und dann kümmert sie sich auch schon um ihre Geschlechtsgenossin.
Ich glaub, das kann ich so sagen, auch wenn die König nicht mit den Roten sympathisiert hat. Die Frau vom Fuhrknecht nämlich schon. Die hat das ganz pfundig gefunden, was die im April in München gemacht, wie die die Herrschaft an sich gerissen haben, obwohl manche von denen sagen, dass sie gar keine Herrschaft haben wollen, weil sie ja Anarchisten sind. Wie der langhaarige, bartige Erich Mühsam zum Beispiel. Aber ich schweife ab, was kein Wunder ist, weil auch mein Puls steigt angesichts der Niederkunft von der König.
Die Else hat also noch eine andere Frau gerufen, saubere Handtücher gepackt, die andere instruiert, dass sie heißes Wasser holen soll, kennt man ja alles … Dann hat sie die König schon auf eine Decke am Boden gelegt.
Und noch bevor das heiße Wasser da war, war der Bartholomäus da. Lange noch, bevor dort, im Glashaus, wo er das Licht der Welt erblickte, der erste Stummfilm Der Ochsenkrieg nach dem Roman vom Ludwig Ganghofer gedreht worden ist.
Jetzt aber warten alle darauf, dass der Bartholomäus schreit, wie die Else ihn in den Armen hält. Aber er schreit nicht, sondern schaut die Else an. Die Else schunkelt und schaukelt das runzligrote Menschenkind, aber es will einfach nicht schreien. Irgendwann wird es ihr zu blöd und sie streckt ihm die Zunge raus: „Bähhhhhh!“ Da dauert es keine Sekunde und auch der Bartholomäus streckt die Zunge raus und macht ein, zugegebenermaßen verwaschenes: „Bähhhhhh!“
Die Else zuckt zusammen, lässt ihn fast fallen. Die Dienstmädchenhaube mit den Rüschen fällt ihr vom Kopf. Die Gänsehaut auf ihren kräftigen Unterarmen stoppt das verwunschene Baby wie Schmirgelpapier. Und die Haube landet auf seinem nackerten Schädel, der damals schon schmaler war als der von den meisten anderen Babys. Die Haube sieht auf dem Bartholomäus seinem Kopf aus wie eine Krone. Und für einen Moment huscht ein siegessicheres Grinsen über seine kleine Goschen.
Aber wie die Else die Krone wieder auf ihren Kopf setzt, wird sein Gesicht ganz blau; erst die Lippen, dann das ganze Gfrieß. Die Else schaut ihre Helferin an, die Helferin die Mutter, dann alle drei das Kind: Und das reißt das Maul auf und plärrt. Was die Umstehenden fälschlicherweise als normal interpretieren und jetzt auch erleichtert lächeln.
Die Else gibt das unheimliche Buberl trotzdem lieber seiner Mutter, die immer noch ganz malad im Glashaus auf der Decke liegt. Und der Fuhrknecht sagt: „Ja, so genga die Gang.“
Womit er schon ganz schön viel über die Zukunft vom Bartholomäus vohergesagt hat. Weil, die Geburt hat schon gezeigt, wo es einmal mit ihm hingehen wird, aber das wirst du später sehen.
Der tiefe Fall
Das Klatschen und Jubeln der Rothenburger Bürger war noch nicht verstummt, da hat der König gespürt, dass hinter ihm was vor sich geht. Der Dolmetscher, der seine Aufgabe wirklich bravourös gemeistert und zum Gelingen von Königs Lebenshöhepunkt beigetragen hat, ist mit seinem granatapfelroten Schädel neben ihm gestanden und hat sich mit dem Taschentuch über die Stirn getupft; eigentlich hätt er einen Putzlappen gebraucht. Aber, wie bitte, hätte das ausgeschaut beim Dolmetscher vom Schah Mohammad Reza Pahlavi?
Dann hat der König die Hand von der Farah Diba genommen. Es ist ein Raunen durch die Menge auf dem Marktplatz gegangen. Und ein freudiges, romantisches Seufzen ist herausgestochen: die Stimme seiner Mutter. Sie anzuschauen, dazu ist er nicht mehr gekommen, weil ihn die Farah Diba aus ihren dattelbraunen Augen angeschaut hat. Weil sie natürlich überrascht war, dass der Schah, der sonst immer so darauf bedacht war, Contenance zu bewahren, ihr in aller Öffentlichkeit die Hand gibt, Zuneigung oder sogar Zärtlichkeit zeigt. Das Streicheln vom König seinem Daumen über ihren Handrücken war fraglos zärtlich und hat sie an die letzte Nacht im Hotel Eisenhut erinnert. Und König, als könne er Gedanken lesen, hat durch seine Sonnenbrille zurückgeschaut und das Gefühl gehabt, dass sein Kopf mit seinem Herz mitbumpert. Weil der so voller Bilder war: vom Bett mit dem Engel über dem Kopf. An dem er sich angehauen hat. Von der Anna, die extra nicht auf den Marktplatz gekommen ist, um ihn nicht abzulenken. Dann wieder von Farah Diba im Nachthemd. Dann wieder von Anna, die ein so unglaublicher Mensch ist. Die ihn so liebt, dass sie gesagt hat: „Wenn du das machen musst, dann mach das.“ Einfach unglaublich. Weil, es ist ja nicht nur die Nacht mit der Farah. Es ist so viel mehr. Nämlich, das, was jetzt noch kommen wird, von dem beide gewusst haben, dass es kommen wird, aber keiner von beiden drüber geredet hat.
Dem König sein Kopf war wie ein Kinoprojektor, auf dem eine Filmrolle durchdreht, weswegen man auf der Leinwand ganz viele Bilder auf einmal sieht und deswegen keines so richtig.
Die Filmvorführung gestoppt haben die zwei Perser im Anzug hinter ihm. Mit Sonnenbrillen, obwohl an dem Tag gar keine Sonne geschienen hat. Jeder von denen hat einen Arm vom König gepackt, und zwar so, dass man es vom Marktplatz aus nicht gesehen hat. „Let’s go“, haben sie geflüstert, weil sie ja nicht gewusst haben, dass der König auch Farsi kann.
Der König streichelt der Farah Diba noch einmal über ihre Hand, über die Samthandschuhe, flüstert ihr was ins Ohr, was ich dir jetzt nicht verraten werd, ihm aber später noch helfen wird. Und dann geht er mit ihnen.
Wenn du jetzt aber glaubst, die bringen ihn gleich auf die Polizeiwache, dann täuscht du dich gewaltig. Weil, zum einen sind sie sich ja nicht sicher, ob es wirklich der falsche Schah ist, weil er ja genauso ausschaut wie der Reza Pahlawi. Und die Farah Diba so intim mit ihm ist und sie in der Nacht im Eisenhut noch intimer miteinander waren, was die SAVAK-Geheimdienstler sogar mitbekommen haben. Und zum anderen haben die Geheimdienstler schon zuhause im Iran die Leut nicht auf die Polizeiwache gebracht, um dann mit ihnen das zu tun, was sie jetzt mit dem König vorhaben. Weil, obwohl es im Iran alle gewusst haben, hat es keiner wissen dürfen. So ein bisserl wie bei den Nazis.
Die beiden Geheimagenten geleiten den König also, noch wie einen Kaiser, ins Rathausinnere. Durch eine Holztür in das kühle Treppenhaus. Worin der König sich vorgekommen ist wie in einem Schneckenhaus. Als würde er nach oben geschraubt werden und gleichzeitig immer tiefer ins Innere vordringen. Aber eigentlich war es andersrum. Er ist aus dem Inneren der Macht wieder nach außen befördert worden, zurück zum „normalen“ Menschen. Der jetzt dazu gebracht werden sollte, zu sagen, warum er das gemacht hat. Ob er für die Amis arbeitet oder für die Russen. Damals war das ja alles noch ganz brisant; der Kalte Krieg. Da hat der eine Angst gehabt, dass der andere die Atombombe zündet und riesige Schwammerl wachsen, nicht nur im Wald von Grünwald oder im feuchten Taubertal an den Bäumen inmitten vom Moos.
Neben den grauen, steinernen Treppenstufen hat sich ein ebenso steinernes Treppengeländer – abgerundet, ein Handschmeichler – nach oben geschoben. Die Agenten, die den König immer wieder ein bisserl geschubst haben, haben wunderbar in dieses Steinambiente gepasst. Und einmal, wie er fast gestolpert wär, weil ihm einer der beiden Büffel einen zu harten Stoß gegeben hatte, hat der König nach oben geschaut und sternförmige Verflechtungen mit Wappen an den Enden gesehen.
Hinter der wuchtigen Holztür geht der König in den nächsten Raum, die Agenten machen ihm, gewohnheitsmäßig, die Tür auf. Worauf er sich schon wieder besser fühlt. Trotzdem wartet er jeden Moment darauf, dass hinter dieser Tür was auf ihn wartet, aber da wartet nix und keiner. Deswegen versucht er es mit der bewährten kindlichen Geisteshaltung, er ist ein Entdecker, weil er ja noch nie auf dem Rothenburger Rathaus war, weil er weiß, dass er seine ganze Kraft, seinen ganzen Mut noch braucht, zusammennehmen muss, weil ihn die zwei wahrscheinlich noch auseinandernehmen werden und das nicht nur im sprichwörtlichen Sinne.
Die Türen knarzen wie in einem Horrorfilm. Es geht an wuchtigen Deckenbalken vorbei, mit kantigen Nägeln, die in Rothenburg nix Bsonders sind. Das Licht wird immer weniger. Das Schildl „Bitte nicht rauchen!“ kann er gerade noch lesen. „No Smoking!“ steht direkt drunter, in schöner, geschwungener Schrift, dass es für jeden Lehrer, außer für den König, eine Freude gewesen wäre – aber schon viel unfreundlicher. Vielleicht kriegt der König deswegen auf einmal Lust, eine zu rauchen, obwohl es ihm bis jetzt nie richtig geschmeckt hat. Als wollte er das ungute Gefühl mit einem unguten Geschmack in Rauch aufgehen lassen.
Dann geht’s leicht bergab und wieder rauf, ins Gebälk. Der Agent hinter ihm schnauft, hat vielleicht zu viel geraucht. Die Treppe wird enger. Die Steinwand gröber. Die Decke kommt näher. Wird schief. Der König muss an seine widerständische Tochter Aurelia denken. Bei dem Gedanken, dass sie gegen ihn protestiert hat, muss er schmunzeln. Ob sie schon in einer Zelle sitzt? Sein kleines Widerstandsgewächs. Ein stolzes Lächeln vertreibt die ungute Vorahnung.
Die nächste Tür ist mit Eisenstreben beschlagen. Der Putz quillt zwischen den groben Steinen heraus. Lebt. Nein, doch kalt und tot.
Und dann wird es endlich heller. Ein Fenster. Die Dächer. Die Häuser. Die schmalen Gassen. Die er kennt. Grün, mit lachendem Fenstergesicht. Weiß, von Fachwerk durchzogen, mit tausend Augen im roten Dach. Obwohl das Fenster fast blind ist von der Sonne, von Wind und Wetter. Blendung als Strafe, wenn man nicht gespurt hat. Wie im Frühmittelalter, ja, in unsere Breiten, mit einem rotglühenden Stückerl Eisen, das so nah an die Netzhaut gehalten worden ist, dass sie zerstört wurde und die Augenflüssigkeit ausgetrocknet ist. Ein Blick wie eine getrocknete Goji-Beere, die sich manche heut als Superfood ins Essen tun.
Bevor der König weiter drüber nachdenken hätt können – wenn er die Goji-Beeren damals schon gekannt hätt –, wie es sich anfühlt, eine Superbeere im Auge statt im Müsli zu haben, ist es die nächste Holztreppe raufgegangen, die noch enger war. Er hat also stattdessen darüber nachgedacht, dass im Byzantinischen Reich einmal geblendet worden ist, um die Kaisernachfolge zu verhindern, und hat sich gedacht: Passt!
Und hat sich den Schädel angehauen, dass für einen Moment gar nix mehr gepasst hat, weil die Tür, durch die sie ihn geschoben haben, so winzig war, der Schmerz und sein Schädel aber so groß und hoch und voller Bilder. Dann wieder ein Fenster. Nicht ganz so blind. Dahinter: rote Häuserdächer, verwitterte Schindeln. – Die Anna hat mal gesagt „Bunt schauen die alten Dächer aus“ und der König hat geantwortet: „Nein!“
Und dann war’s auch wieder gut, weil: Blick ins dunkelgrüne Taubertal. Treppauf, treppauf. Zwischen Latten, Balken und gekalkter Wand, noch ein Fenster, enger, höher, schmaler. Gitter vor dem winzigen Loch ins Freie, voller Taubenschiss. Die Stadtmauer, das Kirchdach, das Kreuz. Ein zweigeteiltes Fenster: das Hotel Eisenhut, Farah Diba, die letzte Nacht, Herrngasse, der Herrnbrunnen, der Burgturm, das Stadttor.
Die nächste Treppe erinnert an eine Speichertreppe, die man zuvor runterlassen muss. Das Letzte, was er sieht, bevor er raufsteigt, ist das gemalte Holzschild, das ausschaut wie eine Todesanzeige und auf dem, natürlich in Frakturschrift, steht: „Für Unfälle wird nicht gehaftet.“ An zwei kalten Eisengriffen zieht er sich am Ende der Leiter nach oben, saugt die tiefe Luft frisch ein. Er saugt die tiefe Luft frisch ein …? Aber hoppla! War dein Hirn grad genauso faul und hat das Überlesen? Lassen wir es mal so stehen, im Angesicht der verdrehten und brenzligen Situation.
Auf alle Fälle steht der König jetzt noch höher als er vorhin gestanden hat, bei seiner Rede. Was gar nicht so hoch war, weil er ja aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Balkon des Rathauses gestanden hat, sondern unter den Altanen, wir einfachen Leut würden sagen: unter dem Balkon.
Er steht also da oben. Schaut hinunter auf die Leut, die ihm gerade noch zugejubelt haben. 220 Stufen später sehen deren Köpf aus wie Stecknadeln auf einem Stecknadelkissen; nur nicht so bunt. Oder wie Ameisen auf einem Haufen. Immer am Umeinanderwuseln, am Arbeiten und am Ratschen. Wenn’s um die Königin geht, um den Nachwuchs, dann kennen sie gar nix. Ein bisserl wie eine kollektive Helikoptermutter.
Ja, die Ameisen: Kurz bevor sie sterben, ziehen sie sich aus ihrem Haufen zurück und verenden jammerseelenallein, um die anderen nicht anzustecken. Das Kollektiv bedeutet alles, der einzelne nur dann etwas, wenn er was zum Kollektiv beiträgt. Da wird dem König bewusst, wie wenig der Einzelne auch da unten im Grunde doch zählt. Außer, er ist von Rang und Namen – wie er gerade, als Schah. Jetzt, wo ihn nicht mehr tausend Augen ehrerbietig anschauen, erlaubt er sich sogar ein kurzes Lächeln. Mal schauen, was ihm blüht, weil er gegen dieses ungeschriebene Gesetz verstoßen hat.
„Ganz schön hoch“, sagt der kleinere der zwei iranischen Geheimagenten wie nebenbei. Und schaut dabei durch seine Sonnenbrille nach oben, zum größeren. Wie ein Kind, das um Aufmerksamkeit heischt, zu seinem Vater. Vielleicht will er ja aufsteigen und Ober-Geheimdienstrat werden. Natürlich meint er mit „Ganz schön hoch“ den König. Oder? Obwohl der Kollege mit dem spitzen Kinn jetzt nickt. Und „Allerdings“ sagt. In welcher Sprache, das überlasse ich gerne deiner Fantasie, weil der König, der kann ja Deutsch, Englisch und Farsi, und ich weiß jetzt nicht, was du alles kannst. Und wenn ich dir jetzt da hinschreibe, was der SAVAK-Agent auf Farsi sagt, dann verstehst du das vielleicht nicht. Also bleiben wir mal beim Deutsch und beim Du, weil: persönlicher. Was wir jetzt schon alles zusammen erlebt haben und noch erleben werden, da kann man sich eigentlich gar nicht mehr siezen, oder?
„Eure Majestät befinden es vermutlich ebenfalls als hoch?“, sagt der Größere.
Der König antwortet darauf „Die Höhe ist eine Frage der Größe“ und versucht, nicht mehr nach unten zu schauen, auf das sechzig Meter entfernte, steinharte Kopfsteinpflaster.
Der Einmarsch des Kaisers
Der Schah und König lebten sozusagen nebeneinander her, auf zwei Kontinenten. Der eine in Asien, in einem Land, das damals noch Persien hieß und vor allem wegen des Öls interessant war für die Politiker im Westen. Der andere in Deutschland mit einem Vater, vulgo Hieronimus König, den sein Kübelwagen im Ersten Weltkrieg sogar bis nach Riga zur Antra kutschiert hatte. Ein fesches lettisches Mädel, die Haare so braun wie der Boden im Wald von Grünwald. Sachen hat der König mit ihr erlebt – aber auch mit ihrem Bruder, weshalb er zwei Wochen später noch nicht richtig hatschen hat können. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Der Vater war also genau da gewesen, wo der Lügenbaron Münchhausen einige Jahre gelebt hat, was wir als wegweisendes Indiz für die Lebensgeschichte vom Bartholomäus König werten könnten, aber derselbe würde uns da vehement widersprechen, wenn er könnte, weil er sich nie als Lügner empfunden hat. Außer vielleicht, wenn man Lügen als eine Kunst begreifen tät.
Würde man hier schon zum zweiten großen Weltkrieg oder in dessen nähere Umgebung vorspulen, dann bekämen wir nochmal eine höchst interessante Lage, weil der Vater vom Schah den Hitler ganz pfundig gefunden hat, was die Engländer und Russen weniger pfundig gefunden haben. Da sind wir, bis auf leider wieder mehr werdende, unverbesserliche Ausnahmen, heute schon auf der Seite der Engländer und Russen. Ganz im Gegensatz zum Vater vom König. Aber dazu später mehr, bevor ich euch zu sehr verwirre. Weil, so eine Geschichte ist ja wie ein Vier-Gänge-Menü: Aperitif, Vorspeise, Hauptspeise, die auch der Höhepunkt ist, und die Nachspeise, auf die manchmal noch der Schnaps folgt. Und der Höhepunkt wird sich in der Nacht im Schlafzimmer von der dritten Frau vom Schah abspielen, der berühmten Farah Diba, im Hotel Eisenhut in Rothenburg ob der Tauber, an die sie übrigens heute noch zurückdenkt. Obwohl oder gerade weil der König und nicht der Schah bei ihr genächtigt hat.
Auf alle Fälle ist der Vater vom Schah 1921 mit seiner Kosakenhorde in Teheran einmarschiert. Und wie durch Zufall, aber an Zufälle glaubte der Bartholomäus auch damals, als zweijähriger Bub, nicht, hat er sich genau am selben Tag Vaters Stahlhelm aus dem Ersten Weltkrieg aufgesetzt. Und kaum hat er ihn aufgehabt, hat er die Hendlbrust rausgestreckt – er war nämlich unterwegs, wie ihn Mutter Natur geschaffen hat – und hat die spindeldürren Haxen in die Luft gestochen, wie es sich gehört. Wo er das wieder hergehabt hat, frag mich nicht, vielleicht aus seinen deutschen Genen.
Er marschiert also wie eine Eins durch das Wohnzimmer – gut, bis auf dass der Helm ihn eher zu einem Deserteur als zu einem Soldaten gemacht hat, weil der immer verrutscht ist und ihm die Sicht auf die Frontlinie, also die imaginierte, verdeckt hat. Und da hat er gespürt, der Klein-König, dass ihm was fehlt. Und zwar die Waffe. Weil: Ein Soldat braucht eine Waffe, sonst ist er ja kein Soldat. Also hat er sich den Holzschemel vor den Schrank geschoben und sich die Luger vom Vati, die der immer noch geölt hat – vielleicht hat er geahnt, dass wieder ein Krieg kommen wird –, geschnappt und schon hat das Marschieren noch besser hingehauen, dass sogar der Kaiser in seinem niederländischen Exil gesagt hätte: Servus! Bloß hat das damals keinen mehr interessiert, ob der Wilhelm Servus sagt oder nicht, weil der davor schon so viel Schmarrn erzählt hatte.
Der König-Stempf marschiert so durchs Wohnzimmer mit der Luger in der Hand. Schwungvoll, zackig. Da löst sich ein Schuss und trifft den Kaiser zwischen die Augen.
Ihr fragt euch jetzt sicher, wie das gehen kann, wenn der Kaiser doch in den Niederlanden im Exil saß. Es war nämlich so: Der Vater vom König war immer noch ein Kaisertreuer, weswegen er auch so gegen die Roten gehetzt hat, weil die nach seiner Meinung ja Schuld waren am verlorenen Krieg. Außerdem hat er sich nie wieder so gut gefühlt wie damals im Krieg. So kurz vor dem Sterben, da fühlt man sich eben so richtig lebendig. Nicht einmal im Bett mit der Mutti hat er sich so vital gefühlt, obwohl der Orgasmus ja im Französischen auch „der kleine Tod“ genannt wird. Daran hat die Mutti wiederum nicht einmal denken wollen und weil der Vati sowieso einen Brass auf die Franzosen gehabt hat seit dem Krieg, hätt sie es schon dreimal nicht aussprechen dürfen, weil: sonst hätt es Krieg gegeben im Schlafzimmer. Tja. Wie es der Exil-Kaiser mit französischen Lehnwörtern gehalten hat, ist mir nicht bekannt, auf jeden Fall hat der König-Vater immer noch ein Bild von seinem vergötterten Wilhelm in der Stube hängen gehabt.
Der Bartholomäus ist vom Schuss dermaßen erschrocken, dass er es auf einmal ganz pressant – auch so ein sprachliches Überbleibsel der Franzosen auf bayerischem Hoheitsgebiet – gehabt und sich gedacht hat, wenn er jetzt nicht gleich aufs Töpfchen geht, dann gibt’s eine Sturzflut. Und nachdem die Mutter den Boden gewohnheitsmäßig zweimal wöchentlich gebohnert hat, wär diese Flut nicht ganz so schnell aufgesaugt worden – was der Bartholomäus natürlich nicht gedacht hat, weil er zwar schon ein gescheites Bürscherl war, aber so gescheit auch wieder nicht. Es war wieder einmal mehr so ein Gefühl, wie wenn er eben dringend … Also hat er sich den Stahlhelm vom Vati geschnappt, vor sich hingestellt und hineingepieselt und schon ist es ihm wieder besser gegangen, auch wenn das komische Gefühl dadurch nicht ganz weggegangen ist.
Der letzte Tropfen ist gerade so in den Stahlhelm hineingetröpfelt, da hört er die Schritte vom Vati, draußen vor der Tür. Er rennt davon, in sein Kinderzimmer, hört: „Ja, was is denn da los!“ Und ein Platschen.
Das war das erste und das letzte Mal, dass der König Senior den Boden gewichst hat, sofern man das in dem Fall überhaupt sagen kann, weil so emanzipiert waren die Mannsbilder damals noch nicht und der Vati vom Bartholomäus schon dreimal nicht. Der hat seinen Spross lieber angeplärrt: „Du Esel! Was hast du dir dabei gedacht?“
Auf zur Folterkammer
Der Regen drischt am Feuerkessel hinter dem Marktplatz auf den König ein. Trotzdem zeigt er Haltung und stolpert nicht über das Kopfsteinpflaster. Schreitet bergab durch das enge Rosmaringässchen, in dem er auf einmal einen unbändigen Hunger auf Kartoffeln kriegt; mit Rosmarin. Wie sie seine Mutter kocht, wie keine andere – wo ihn seine Mutter beim Essen schimpft und straft wie keine andere. Wenn auch nur der kleinste Rosmarinzweig neben dem Teller oder gar auf dem Boden landet … Wär er ohne sie jetzt da? Vorwärtsgetrieben von zwei iranischen SAVAK-Geheimagenten, die nicht wissen, ob sie ihn wie einen Betrüger oder ihren verehrten Schah von Persien behandeln sollen. Berüchtigt wegen ihrer Foltermethoden. Die selbst ihr royaler Dienstherr offiziell nicht kennt, damit er nicht dafür belangt werden kann.
Und das ist jetzt der gravierende Unterschied zwischen dem Schah und dem König. Der König kennt die Foltermethoden, wissentlich, und das würde er auch jederzeit zugeben. Ob das in der Situation, in der er steckt, einen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber du vielleicht.
Stumm stolpern sie hinter ihm her, die Agenten, über das bucklige Kopfsteinpflaster, weil sie es eben nicht so gut kennen wie der König. Was ihm sehr zupasskommt, weil ein Schah nicht zu stolpern hat. Er bleibt sogar einmal kurz stehen, während sie die Mauer aus grauem Stein passieren, aus der sich nur manchmal ein grünes Pflanzerl den Weg in die Freiheit bahnt, dreht sich um, nimmt die Sonnenbrille ab und sagt mit tiefer Stimme: „Bewahren Sie Contenance, meine Herren, wir sind hier zu Gast.“
Die Steinfassaden der Häuser verengen das Gässchen, als würden sich weitere Wolken vor die Sonne schieben. Die Tropfen schlagen trotzdem noch auf den König ein, dem der Regen das Genick entlang unter Anzug, Hemd und Unterhemd läuft. Seine Schultern werden nass und schwer. Er hat das Gefühl, von den Fassaden erdrückt zu werden. Nur der Rundbogen der Tür des roten Fachwerkhauses und die steinern umrahmten Fenster lassen ihn stellenweise aufatmen. An diesem Nachmittag mit abnehmendem Licht weisen die iranischen Agenten dem König den Weg nach rechts in die Kirchgasse, schon ein bisserl vorsichtiger nach der Rüge vom Chef. Genau in dem Moment biegt auch ein junger Schutzmann ums Eck. Und zwar exakt der, der ihn gestern Abend vorm Hotel Eisenhut abgeklopft und durchsucht hat, bevor er zur Farah Diba rein ist. Der Schandi ist einen Kopf kürzer, also ungefähr so groß wie der kleinere der zwei Agenten, schießt ums Eck und rennt mit seinem kantigen Schädel genau in dem König seinen Krawattenknoten. Und zuckt dermaßen zusammen, dass der König meint: Jetzt fällt er gleich um. Der Schutzmann sagt aber dann nur mechanisch: „Grüß Gott.“ Und lässt den König stehen.
In der Kirchgasse weitet sich die Straße. Die Jakobskirche vor ihnen. Der Blick durch das Tor stadtauswärts: der graue Himmel. Vögel. Freiheit! Eine letzte Möglichkeit zur Flucht. Um des Überlebens willen.
Als hätt der Größere dem König seine Gedanken geahnt, packt er ihn unauffällig am Arm, schiebt ihn weiter. Über die Straße. Sein Griff: eisern. Der Applaus der Rothenburger: vergangen. Gestern, beschirmt vom Bürgermeister Ledertheil. Farah Diba neben ihm. In der weltbekannten Kirche hat Dekan Kirchenrat Kelber den berühmten Riemenschneider Heilig-Blut-Altar erklärt. Ja, Blut wird fließen. Auch heute: Königs Blut. Ob die Abendmahlszene aus einem Holz geschnitzt sei, hat Farah Diba wissen wollen. Oh, Farah.
In der abschüssigen Klostergasse legen die Agenten einen Zahn zu. Der Große vor dem König, der Stempf hinter ihm. Auf dem rechten Gehweg, wie es sich gehört, nur nicht auffallen. Die wenigen Passanten, die ihnen im Regenwetter entgegenkommen, verstecken sich unter ihrem Schirm.
Wenn der König nach dem winzigen Birnbaum, der dort drüben am Haus sprießt, jetzt rechts abbiegen würde, wäre er in wenigen Minuten zuhause, bei seiner Anna. Tät erfahren, ob Aurelia wieder frei oder ob ein Anwalt informiert worden ist. Es geht bergab, das Regenwasser fließt mit. Die riesige, hohe Mauer vom Klostergarten neben ihnen.
Eine schwarze Katze huscht über der Straße, der Große kickt nach ihr wie nach einem Ball, dass sie laut „Zzzzzzzsccccht“, zwei Meter vor ihm im Dreck landet, sich aufrappelt und davonrennt.