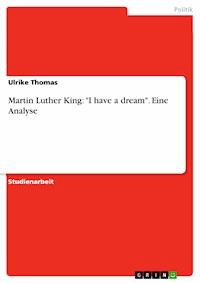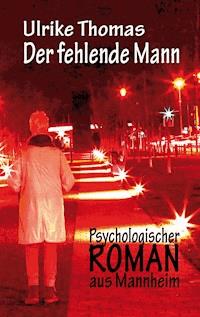
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In detektivischer Kleinarbeit versucht Psychotherapeutin Monika Klein das mysteriöse Verschwinden Jacob Rinnsteins aufzuklären, ein älterer Mann, der sich als Kunstsammler und spendabler Gönner in Mannheim einen Namen gemacht hat. Die Stadt, die ihrerseits alles daran setzt, sich einen Ruf als Kulturhauptstadt aufzubauen, beeilt sich seinen Forderungen nach Neubau einer Ausstellungshalle für die wertvollen Exponate nachzukommen. Während Luise Rinnstein, die Frau des Verschwundenen, der Verzweiflung nahe ist, gerät die langjährige Beziehung der Psychotherapeutin aus den Fugen, nachdem Lebensgefährte Albert sich einer Kundin nicht nur geschäftlich widmet. Das Fehlen der Männer spitzt sich zu. Die Erzählung rankt sich um Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Geschlechterrollen, das Alleinsein als Single oder zu zweit und die unterschiedlichen Versuche, damit zurecht zu kommen. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Frauen aus zwei Generationen, die über 80jährige Luise Rinnstein und die über 50jährige Therapeutin Monika Klein. Fast beiläufig wird ein kritisch-ironischer Blick auf die Kommunalpolitik geworfen und das in der medialen Darstellung oft schräge Bild der psychotherapeutischen Arbeit zurechtgerückt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
In detektivischer Kleinarbeit versucht Psychotherapeutin Monika Klein das mysteriöse Verschwinden Jacob Rinnsteins aufzuklären, ein älterer Mann, der sich als Kunstsammler und spendabler Gönner in Mannheim einen Namen gemacht hat. Die Stadt, die ihrerseits alles daran setzt, sich einen Ruf als Kulturhauptstadt aufzubauen, beeilt sich seinen Forderungen nach Neubau einer Ausstellungshalle für die wertvollen Exponate nachzukommen. Während Luise Rinnstein, die Frau des Verschwundenen, der Verzweiflung nahe ist, gerät die langjährige Beziehung der Psychotherapeutin aus den Fugen, nachdem Lebensgefährte Albert sich einer Kundin nicht nur geschäftlich widmet. Das Fehlen der Männer spitzt sich zu.
Die Erzählung rankt sich um Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Geschlechterrollen, das Alleinsein als Single oder zu zweit und die unterschiedlichen Versuche damit zurecht zu kommen.
Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Frauen aus zwei Generationen, die über 80jährige Luise Rinnstein und die über 50jährige Therapeutin Monika Klein. Fast beiläufig wird ein kritisch-ironischer Blick auf die Kommunalpolitik geworfen und das in der medialen Darstellung oft schräge Bild der psychotherapeutischen Arbeit zurechtgerückt.
Die Autorin
Ulrike Thomas, 1956 geboren, wuchs in Frankenthal/Pfalz auf. Seit 1997 arbeitet die promovierte Diplom-Psychologin als Psychotherapeutin in eigener Praxis in Mannheim. Die Mannheimer Kommunalpolitik kennt sie aus ihrer Zeit als Stadträtin genau. Mit der Erziehung zu stereotypen Geschlechterrollen und ihren Folgen im Lebenslauf hat die Autorin sich auch in ihren politischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten beschäftigt. Ihr erster Roman »Der Schöne und das Biest« erschien 2013.
Für alle Liebenden und die, die es werden wollen.
Wieso hatte niemand sein Fehlen bemerkt?
Funktionierte die Anonymität
der Großstadt so perfekt?
Die Vorstellung erschreckte mich.
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Teil II
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Nachwort
Jetzt ist aber wirklich Schluss.
TEIL I
1
Es war diese verdammte Vorweihnachtszeit. Wie jedes Jahr rollte eine Unglückswelle auf mich zu und ich hatte alle Mühe, meine Klientel und mich vor dem Ertrinken zu bewahren. Unter überbordendem Dekokitsch taten sich Abgründe auf, der künstliche Lichterglanz warf dunkle Schatten. In dieser Zeit des allgemeinen Konsumrauschs zeigte sich die Kluft zwischen denen, die sich jeden Unsinn leisten konnten, und jenen, deren finanzielle Mittel kaum für das Notwendige reichten, dramatisch. Labile Menschen, die sich den Rest des Jahres gerade so auf den Füßen hielten, verloren im omnipräsenten Gedudel der Weihnachtsmusik ihren Halt. Schwelende Konflikte eskalierten. Zwischen all den Vorboten des Fests der Liebe fühlten Singles ihre Einsamkeit schmerzhafter denn je, Menschen in unbefriedigenden Beziehungen ebenso. Nicht nur die Kassen des Einzelhandels klingelten süßer, auch mein Geschäft boomte.
Nach fast zwanzig Jahren in der Branche war mir nichts Menschliches fremd und ich hätte einen Eid darauf geschworen, dass mich kaum noch etwas überraschen könnte, bis ich Luise kennenlernte und diese merkwürdige Geschichte begann – an einem Freitagnachmittag Mitte November.
Eine anstrengende Arbeitswoche näherte sich ihrem Ende. Müde und ausgelaugt versuchte ich mir die letzten Zeilen des Berichtes, den ich unbedingt noch heute eintüten wollte, abzuringen. Kein Mensch macht sich eine Vorstellung davon, mit wie viel Bürokratie die Arbeit einer Psychotherapeutin – speziell in der Fachrichtung Verhaltenstherapie – verbunden ist. Als echte ›Strafarbeiten‹ gelten die ›Berichte an den Gutachter‹, die bei Therapieverlängerungen fällig werden. Es soll Kolleginnen und Kollegen geben, die Ghostwritern viel Geld dafür bezahlen, jedenfalls erheblich mehr als sie selbst erhalten, um sich diese lästige Pflicht vom Hals zu schaffen. Manche weigern sich kategorisch Verlängerungsanträge zu stellen und überlassen ihr Klientel nach einer Kurzzeittherapie sich selbst. Der eine oder die andere soll gar entnervt den Beruf an den Nagel gehängt haben, wegen dieser Zumutungen. Faktisch ist diese Vorschrift die Rache der Ärztelobby, weil es unseren Berufsvertretungen in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen gelungen war, Politik und Krankenkassen von der Wirksamkeit unserer Arbeit zu überzeugen und wir so in das Hoheitsgebiet der Weißkittel eingedrungen sind. Jedenfalls war ich gerade dabei ein solches Machwerk abzuschließen, als das Telefon sich bemerkbar machte. Der Anrufbeantworter blinkte rot. Genervt nahm ich den Hörer ab.
»Klein«, brummte ich ins Telefon. Am anderen Ende meldete sich mit brüchiger Stimme eine Frau.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Rinnstein, ich bräuchte dringend ein Gespräch.«
»Worum geht es?«, erwiderte ich nicht besonders freundlich, warum mussten die Leute auch stets außerhalb meiner Telefonsprechstunden anrufen.
»Das möchte ich Ihnen am Telefon nicht sagen, es handelt sich um eine komplizierte und sehr persönliche Sache, bei der ich Ihre Hilfe brauche.«
»Es tut mir leid, aber meine Praxis ist ausgebucht, ich muss sie auf das nächste Quartal vertrösten. Sie können es gerne im Januar nochmal versuchen. Wie sind Sie denn auf meine Praxis gekommen?«
»Ich habe ihre Telefonnummer von einer Freundin, die bei Ihnen Patientin und sehr zufrieden war.«
»Wie heißt Ihre Freundin?«
»Emma Schweitzer, sie hat mir gesagt, ich soll mich unbedingt Ihnen anvertrauen.«
Ich erinnerte mich. Das musste mindestens zehn Jahre her sein. Die Frau war circa 70 Jahre alt gewesen und hatte sich an mich gewandt, weil sie nach dem Tod ihres Mannes, den sie jahrelang gepflegt hatte, in ein tiefes Loch gefallen war. Der Mann war nach einem Schlaganfall körperlich und geistig schwer behindert und seine Frau hatte schier Unmögliches geleistet, um ihn vor dem Pflegeheim zu bewahren. Ihr gesamter Alltag hatte sich um ihn und seine Bedürfnisse gedreht. Mit seinem Tod hatte Frau Schweitzer nicht nur ihren Mann, sondern auch ihre Lebensaufgabe verloren. Es war ein mühsamer Lernprozess für sie gewesen, eigene Bedürfnisse zu entwickeln und sich um sich selbst zu kümmern.
Gut, das war die Eintrittskarte für Frau Rinnstein. Irgendwann hatte ich mit mir die Abmachung getroffen, alle Hilfesuchenden, die auf Empfehlung kamen, wenn irgend möglich aufzunehmen, schließlich lebte ich von Mund-zu-Mund-Propaganda.
»Nächste Woche habe ich leider überhaupt keine Termine mehr frei, aber ich kann Ihnen anbieten, in einer Stunde vorbeikommen, so lange habe ich hier noch zu tun.«
»Oh, da habe ich ja riesiges Glück gehabt. Herzlichen Dank, ich bin um 18 Uhr bei Ihnen.«
2
Knapp eine Stunde später läutete es an der Tür. Vor mir stand eine zierliche alte Frau.
»Guten Abend, mein Name ist Klein, Sie sind sicher Frau Rinnstein?«, begrüßte ich sie.
Offensichtlich erleichtert über meine freundlichen Worte lächelte sie mich an und nickte. »Ja, mein Name ist Luise Rinnstein, ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass Sie mir so kurzfristig einen Termin gegeben haben. Ich habe mich ganz arg beeilt, um nicht zu spät zu kommen.«
Ich bat sie um ihre Krankenkassenkarte und schaltete Computer und Lesegerät wieder ein. »Oder sind Sie privat versichert?«
»Oh, Entschuldigung, ich komme nicht als Patientin zu ihnen, ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Sie sind die Einzige, die mir eingefallen ist, weil Sie doch auch meiner Freundin geholfen haben und sich für Frauen einsetzen. Bei der Polizei war ich auch schon, aber die konnten nichts für mich tun, ich glaube, die wollten auch nicht. Die haben sicher gedacht, die Alte spinnt und mich nicht ernst genommen, dabei ist doch alles wahr und ich kann es mir selbst nicht erklären«.
»Gut dann setzen wir uns, und Sie erzählen mir, was sie sich nicht erklären können.«
»Ich habe meinen Mann verloren.«
»Oh, das tut mir leid, wie lange ist er schon tot?«, versuchte ich anteilnehmend zu wirken.
»Mein Mann ist nicht tot, er ist wie vom Erdboden verschwunden«, sie stockte, »und zwar am Samstag letzte Woche. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich bin verzweifelt, weiß nicht, was ich tun soll. Bitte helfen Sie mir«, sagte sie flehend.
»Was heißt verschwunden? Ist er verreist, wollte er jemanden besuchen, die Kinder, Bekannte oder Freunde?«
»Nein, nein, er hat bzw. wir haben keine Kinder. Unser Kind war unser Schuhgeschäft. Vielleicht kennen Sie es noch, Schuh Lauer, später Rinnstein in Ludwigshafen? Ja, wir waren immer zu zweit, wir haben keine anderen Menschen gebraucht, wir waren uns genug.«
Sie fand noch weitere Argumente für das Alleinsein zu zweit, offenbar glaubte sie, sich für die Kinderlosigkeit rechtfertigen zu müssen. Nein, das Geschäft kannte ich nicht, aber ich versicherte ihr, dass ich sie verstehen könne und es schön fände, dass sie so eine harmonische Beziehung mit ihrem Gatten habe, worauf sie ihre Rechtfertigungsversuche einstellte. Allerdings war mir völlig unklar, was überhaupt passiert war, so dass ich nochmals fragen musste, wo und wie das mysteriöse Verschwinden ihrer besseren Hälfte stattgefunden hatte.
Darauf erzählte sie mir detailliert von einem ausgedehnten Spaziergang am letzten Samstag, zunächst durch den Luisenpark mit Kaffeepause im Seerestaurant, er hätte ja Kuchen so gerne gegessen, am liebsten die ganz fetten mit Sahne oder Buttercreme, die er aber in letzter Zeit nicht mehr so gut vertragen habe; schließlich seien sie im Planetarium gelandet, wo sie während der Vorführung eingeschlafen und als sie wieder aufgewacht sei, wäre er weg gewesen. Sie habe im Vorraum und auf der Toilette nach ihm gesucht, Leute gefragt, auch vor dem Planetarium sich umgeschaut, aber draußen sei es dunkel gewesen, es sei schließlich Winter, so dass sie sich auf den Heimweg gemacht habe, in der Hoffnung, dass er zu Hause auf sie warten und über sie lachen würde, weil sie auf seinen Streich reingefallen sei.
Sie hielt inne in ihrem Vortrag, sah mich fragend an.
»Und was haben sie dann gemacht?«, beendete ich das Schweigen.
»Ich setzte mich an unseren Esstisch und wartete, stundenlang. Das kannte ich nicht, dass er ohne Absprache alleine weg ging. Ich spielte gedanklich alles Mögliche durch und versuchte irgendeine Erklärung zu finden. Ich hatte schreckliche Angst, mein Leben erschien mir plötzlich so sinnlos und leer ohne ihn. Er war schließlich immer für mich da gewesen, hatte mich nie im Stich gelassen. Alles haben wir gemeinsam gemacht.
Die alte Dame schwieg, blickte mich traurig und fragend an.
Ich konnte versuchen, das Informationsknäuel zu entwirren, die Dinge in eine sinnvolle zeitliche Reihenfolge zu bringen und Hintergründe zu erfahren. Hatte sie sich die Geschichte ausgedacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen? War ihr Mann vor ihr geflüchtet, um seine Ruhe zu haben? War die Ehe der beiden wirklich so gut wie sie es darstellte? Sollte er gar gekidnappt worden sein? Der Gedanke kam mir so absurd vor, dass ich ihn umgehend fallen ließ. Wer sollte einen alten Mann entführen? Vom Äußeren der Frau tippte ich auf eine mittlere Rente, die keinen Anlass für eine Lösegeldforderung bieten konnte.
Im übrigen sollte ich endlich in Erfahrung bringen, welchen Part Luise Rinnstein mir bei der Sache zugedacht hatte, schließlich war ich weder Polizistin noch Privatdetektivin. Genau das fragte ich sie dann auch.
»Ich glaube, Sie könnten eine Menge für mich tun, als Psychotherapeutin können Sie bestätigen, dass ich nicht verrückt bin. Wenn Sie zur Polizei gehen, wird ihnen dort geglaubt werden«. Ihnen wird man nicht unterstellen, dass Sie verkalkt oder nicht zurechnungsfähig sind. Sie sind meine einzige Hoffnung, bitte helfen Sie mir«, flehte Sie mich an.
Ich überlegte. Einerseits erschien die Geschichte nicht uninteressant, andererseits war klar, dass ich die Gute nicht mehr los werden würde, wenn ich ihr einmal die Hand gereicht hätte. Solche Leute klammerten. Aber Luise Rinnstein hatte mit ihrer zwar etwas aufdringlichen aber netten Art mein rudimentär ausgeprägtes Helfersyndrom getroffen. Ich beschloss, mich der Sache anzunehmen. Warum nicht mal Detektivin spielen, wo ich doch Krimis liebte und schon als Kind von Verbrecherjagd geträumt hatte. Sicher ließe sich das Ganze schnell aufklären.
»Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, dazu müssen Sie mir allerdings einige Fragen beantworten.«
»Oh, ich danke Ihnen«, unterbrach sie mich »ich wusste, dass ich Ihnen vertrauen kann.«
»Na, nun machen Sie sich mal nicht zu viel Hoffnungen«, reagierte ich fast verlegen, »lassen Sie uns lieber gemeinsam überlegen, wie wir Licht ins Dunkel bringen können. Haben Sie irgendeine Idee, wo ihr Mann vom Planetarium aus hingegangen sein könnte?«
»Nein, er geht nicht in die Wirtschaft, wenn Sie das meinen", antwortete Sie fast schon beleidigt. »Er hat so gut wie nie Alkohol getrunken, höchstens ein Glas Wein an Feiertagen oder wenn Besuch da war – was selten der Fall war – ein Glas Sekt. Ich habe ihn niemals betrunken erlebt; es war ihm stets sehr wichtig nicht die Kontrolle zu verlieren«, ereiferte sie sich.
»Was halten Sie von einem Bierchen?«
»Ja, ab und zu schmeckt es mir, wenn ich in Gesellschaft bin.«
»Gut, dann setzen wir unser Gespräch in einer Kneipe fort, ich muss hier raus!«
Wir gingen ein paar Schritte und kehrten in der Pizzeria um die Ecke ein. Ich hatte Durst, ich hatte Hunger.
Mein Weizenbier kam sofort, meine Pizza bald, Salvatore, der Wirt kannte mich. Während ich aß und trank, nippte mein Gegenüber an einer kleinen Weinschorle. Die wenigen Worte, die wir während dessen wechselten, waren Belanglosigkeiten. Nachdem ich gestärkt war, versuchte ich, mich an die Frau heranzutasten. Freiwillig würde sie keine Disharmonien ihrer Ehe schildern, das hatten mir ihre glühenden Plädoyers für die traute Zweisamkeit deutlich vermittelt.
»Hatte er gesundheitliche Probleme, könnte es sein, dass ihm plötzlich schlecht geworden ist und er irgendwo draußen zusammengebrochen ist?«
»Ausschließen kann ich das nicht, aber er war kerngesund für sein Alter, immerhin 87 Jahre. Er war auch nicht senil, falls Sie das vermuten, er war vollständig in Ordnung im Kopf. Glauben Sie mir, es gibt keine normale Erklärung für sein Verschwinden. Es muss etwas Furchtbares passiert sein, vielleicht ist er verletzt worden, liegt irgendwo und kann sich nicht helfen oder er ist tot.«
Sie sank in sich zusammen und starrte vor sich hin.
Es war sinnlos, an diesem Punkt weiter zu fragen. Ich schlug ihr vor, sie am Sonntag zu besuchen, trank mein Bier aus und wollte bezahlen. Sie bestand jedoch darauf, mich einzuladen, was ich akzeptierte. Sie ließ sich vom Ober ein Taxi bestellen, nannte mir ihre Adresse, bedankte sich für mein Entgegenkommen, nahm den Mantel vom Haken, verabschiedete sich und ging nach draußen.
Ich konnte den Impuls zu sagen »vielleicht wartet Ihr Mann zuhause schon auf Sie«, gerade noch unterdrücken und ließ sie gehen. Sie war sich sicher, dass er nicht zuhause warten würde, das spürte ich. Ich bestellte mir noch ein Bier.
3
Sonntagmorgen.
Ich erwachte vom geräuschvollen Hantieren meines Lebensgefährten mit Geschirr. Vermutlich wollte er mir auf diese Art mitteilen, dass ein neuer Tag angebrochen war. Ich stand auf, trottete in die Küche, drückte meinem Herzbuben einen Kuss auf die Backe, nahm mir einen Becher Kaffee und die Sonntagszeitung und begab mich ins warme Bett zurück.
Albert und ich kannten uns eine Ewigkeit, genaugenommen seit über dreißig Jahren. Wir teilten uns die geräumige Dreizimmerwohnung ohne uns einzuengen. Die kleineren Zimmer fungierten als individuelle Rückzugsräume, das größere dritte war Fernseh-, Gäste- und Zimmer für alle Fälle. Die gut geschnittene Küche mit ihrem großen runden Tisch war Treffpunkt. Über die Jahre hatten wir unsere Rituale entwickelt und gefestigt. Aufgrund unterschiedlicher Lebensrhythmen sahen wir uns tagsüber wenig, wenn es unsere Termine zuließen, aßen wir abends zusammen, was allerdings selten der Fall war. Samstags frühstückten wir gemeinsam, das war Gesetz, danach fuhren wir per Fahrrad auf den Markt, schlenderten gemütlich durch die Stadt, amüsierten uns über unsere Mitmenschen und andere Kuriositäten, bevor wir unsere eingekauften Schätze nach Hause transportierten. Den Rest des Tages verbrachten wir mit Aufräumen, Ausruhen, Essen vorbereiten, pflegten Hobbies oder soziale Kontakte.
Für mich war der Samstag der schönste und entspannendste Tag der Woche.
Albert war freischaffender Künstler. Als diplomierter Grafikdesigner hatte er den Einstieg in die lukrative Werbebranche verpasst, zumal er nicht der Typ dafür war, sich später zum Webdesigner fortgebildet und hangelte sich so von Auftrag zu Auftrag. Manchmal hatte er viel, meist weniger zu tun. Wegen der unregelmäßigen und schwer planbaren Einkommenssituation hatte Albert nicht den Mut, sich ein Büro zu mieten. Dadurch war sein Arbeitsplatz zuhause, teils in seinem, teils im gemeinsamen Arbeitszimmer. Auch wenn mich seine Arbeitsunterlagen selten störten, da er sehr darauf bedacht war, unser drittes Zimmer nur sporadisch dafür zu nutzen und ordentlich aufzuräumen, empfand ich diesen Zustand aus seiner Perspektive äußerst unbefriedigend.
Da Albert zuhause arbeitete und insgesamt mehr Freizeit hatte als ich, versorgte er unseren gemeinsamen Haushalt. Dafür bezahlte ich den Großteil unserer Lebenshaltungskosten. Für die Ordnung in meinem Zimmer war ich selbst zuständig, ansonsten war ich von der Hausarbeit befreit. Da ich – wenn ich Zeit dazu hatte – gerne kochte, trug ich diesbezüglich meinen Teil bei.
Unser Zusammenleben funktionierte gut, über die Jahre und in unzähligen Diskussionen hatten wir uns zusammengerauft und eine Lebensform entwickelt, die uns genügend eigene Freiräume ließ und gleichzeitig die Pflege der Beziehung ebenso berücksichtigte wie die Pflege unseres zum erheblichen Teil gemeinsamen Freundeskreises. Wir gingen offen miteinander um und versuchten, Konflikte im ehrlichen Gespräch zu lösen.
Einen Nebenverdienst hatte Albert durch seine Funktion als Stadtrat im Mannheimer Gemeinderat. Dafür erhielt er eine monatliche Aufwandsentschädigung. Allerdings kostete ihn dieses ›Ehrenamt‹ oft mehr Zeit als seine hauptberufliche Tätigkeit. Mehrmals in der Woche hatte er Ausschuss- oder Aufsichtsratssitzungen, dazu kamen die regelmäßigen Fraktionstreffen und Repräsentationsverpflichtungen. Da diese Termine meist abends stattfanden, konnten wir uns nicht auf die Nerven fallen, da wir uns unter der Woche wenig begegneten.
Schon gestern hatte ich Albert von meiner neuen Aufgabe berichtet, da Luise Rinnstein keine Patientin war, musste ich auch keine Schweigepflicht einhalten.
Witzigerweise erinnerte sich Albert dunkel an die Rinnsteins.
»Als wir noch Kinder waren, haben meine Eltern unsere Schuhe oft bei Rinnsteins gekauft. Der Laden war bekannt für eine bestimmte Marke, die nicht besonders schick, aber solide war, worauf vor allem mein Vater großen Wert legte. Das ist aber schon über vierzig Jahre her und ich kann mir die beiden optisch nicht mehr im Detail ins Gedächtnis rufen.«
Albert war gebürtiger Frankenthaler und die Pfälzer hatten damals die Angewohnheit in Ludwigshafen Schuhe und in Mannheim Kleider zu kaufen. Ich selbst kam ursprünglich aus einem Kaff bei Heidelberg und unsereins verirrte sich höchstens in den Pfälzerwald oder auf die Weinfeste, was uns seit es die Hochstraßen gab mühelos gelang ohne mit der Schwesterstadt in Berührung zu kommen.
Albert fand die Geschichte genauso merkwürdig wie ich, googelte die Rinnsteins auch gleich, jedoch ohne Ergebnis. Vermutlich hatten die beiden alten Leute die Segnungen des Internets noch nie benutzt und tauchten somit dort auch nicht auf. Allerdings glaubte mein Mitbewohner dem Namen Jacob Rinnstein später nochmal begegnet zu sein, er wisse aber beim besten Willen nicht mehr wo und wann. Ich selbst habe – Namen sind Schall und Rauch – ein so miserables Namensgedächtnis, und zwar – um allen Vorurteilen über das Älterwerden den Wind aus den Segeln zu nehmen – schon seit meiner Schulzeit, dass ich mich gar nicht mehr bemühe, meinen Speicher nach solchen Daten abzufragen. Der Name Rinnstein war mir – soweit würde ich trotz meiner Gedächtnislücken gehen – in meinem ganzen über 50jährigen Leben noch nie begegnet.
Zwanzig vor zwei, ich musste los.
Ich rannte die drei Stockwerke runter, zur Haustür raus, allerdings nicht ohne den Blick prüfend auf das Pflaster zu richten – die Neckarstadt war bekannt für die Tretminen, die die zahllosen Hunde bzw. deren Herrchen und Frauchen ungleichmäßig verstreut auf den Gehwegen hinterließen.
Mit dem Fahrrad waren es knappe zehn Minuten bis in die Oststadt, dem teuersten Viertel Mannheims. Zwanzig Euro pro Quadratmeter Wohnraum waren hier keine Seltenheit, obwohl die Ausstattung der alten Villen selten auf dem neuesten Stand war. Verdienen und verdienen lassen war die Devise. Wer hier wohnte, wohnte entweder schon ewig hier, hatte geerbt oder konnte es sich leisten.
Ich hielt vor einem massiven alten Haus in der Kolpingstraße, parkte mein Fahrrad an einer Laterne und klingelte bei »Jacob Rinnstein«.
Es summte, und ich trat durch die schwere Eichentür in ein äußerst repräsentatives Treppenhaus, auf dem Boden wunderschöne alte Fliesen, Holztäfelung an den Wänden und der typische Geruch alter Häuser. Ein reich verziertes schmiedeeisernes Geländer geleitete mich in das zweite Obergeschoss, vorbei an einer Gemeinschaftsarztpraxis im Erdgeschoss und einer Rechtsanwaltskanzlei im ersten Stock. Die Wohnung der Rinnsteins war die einzige in diesem Haus. Luise Rinnstein erwartete mich an der Eingangstür und führte mich durch eine großzügige Diele in ihren mit alten Möbeln geschmackvoll eingerichteten ›Salon‹. Der Raum umfasste gut und gerne vierzig Quadratmeter, grober Stuck zierte die hohe Decke – nicht mein Geschmack –, auf dem sehr gepflegten Parkett lagen Orientteppiche und an den Wänden hingen opulent gerahmte Kunstwerke, die verdächtig nach Originalen aussahen. Die Attraktion des Zimmers war zweifellos der geräumige Erker, in dem sich, begrenzt von zwei riesigen Schusterpalmen, ein massiver Holztisch mit sechs Stühlen befand. Dort bat mich meine Gastgeberin, Platz zu nehmen. Während sie sich für einen Moment entschuldigte, bewunderte ich die Aussicht auf den Luisenpark. Knorrige alte Laubbäume, die im Sommer für sattes Grün sorgten, davor allerdings zwischen den Unmengen von Absperrpfosten zum Teil abenteuerlich geparkte Autos und reichlich Verkehr. Durch die zwar stilvollen, aber einfach verglasten Fenster drang der Autolärm kaum gedämpft herein.
Luise Rinnstein erschien mit einem großen Tablett, auf dem ein dekorativer Teller mit Gebäck und passende Kaffeetassen standen. Einen Gegensatz dazu bildete die moderne Thermoskanne.
»Lieber heißen Kaffee in einer Thermoskanne, als kalter in Porzellan«, fing die ältere Dame meinen Blick auf.
Sie hatte Sinn für das Praktische.
»Wieso steht nur Jacob Rinnstein an Ihrer Tür?«, konnte ich mir die Frage nicht verkneifen.
»Oh, es war früher so üblich, nur den Vornamen des Mannes anzugeben und nicht den der Frau. Mein Mann ist recht konservativ, wissen Sie?«
»Ist es für Sie nicht irgendwie demütigend hinter dem Namen Ihres Mannes zu verschwinden?«, musste ich nachhaken, da ich solche Konventionen, die weibliche Existenz verleugneten, verabscheute.
»Ich weiß, was Sie meinen, aber es war mir nie so wichtig, schließlich ist Rinnstein ja auch nicht mein Name, sondern der meines Mannes, ich hieß vor meiner Heirat Lauer, also würden mich Freundinnen aus meiner Jugend, die nicht wissen, wen ich geheiratet habe, auch unter Luise Rinnstein nicht vermuten, da kommt es auf den Jacob auch nicht mehr an.«
Da hatte sie nicht unrecht. Aber ich sollte zum Anlass meines Besuches kommen.
»Haben Sie ein Foto Ihres Mannes? Wenn ich ihn suchen soll, wäre es hilfreich, zu wissen, wie er aussieht.«
»Ich glaube nicht, zumindest kein sehr neues. Wir haben keinen Photoapparat und uns lieber Ansichtskarten gekauft, wenn wir in Urlaub waren, die Bilder waren so mit Sicherheit viel schöner, als wenn wir sie selbst gemacht hätten. Aber ich schaue demnächst mal auf dem Dachboden nach, dort haben wir unsere alten Unterlagen verstaut.«
»Vielleicht ein Passfoto?«
»Ja natürlich, aber das ist im Ausweis, und den hat er immer bei sich.«
»Hat er eventuell seinen Führerschein dagelassen?«
»Mein Mann hat keinen Führerschein, wir besitzen kein Auto. Wir sind bisher überall hingekommen, haben fast die ganze Welt gesehen auch ohne Auto.«
»Sie sind viel gereist?«
»Oh ja, seit mein Mann 65 war – da haben wir den Laden aufgegeben –, waren wir mehrere Monate im Jahr unterwegs. Wir haben viel von der Welt gesehen, die USA fehlen uns noch. Wir sind nicht neugierig, andere Länder und Kulturen interessieren uns aber sehr.«
Das Ehepaar Rinnstein schien nicht gerade am Hungertuch zu nagen, große Wohnung in teurer Gegend, mehrmonatige Reisen im Jahr ...
Sie erriet meine Gedanken: »Nicht, dass Sie denken, wir seien reiche Leute. So ist das nicht. Unser Schuhgeschäft in der Ludwigshafener Innenstadt ging gut und wir hatten kaum Zeit, das verdiente Geld auszugeben. Wir haben keine Kinder, keine geldgierigen Verwandten, wir haben kein Haus gebaut, sondern immer in Miete gewohnt, wir haben kein Auto und wenig technischen Schnickschnack, so dass sich nach und nach ein bescheidenes Vermögen angesammelt hat, das wir im Ruhestand, als wir endlich Zeit dafür hatten, auch ausgeben wollten, bevor es dem Staat zufallen würde.«
Klang durch und durch vernünftig.
»Ein bisschen mehr müsste ich schon über Ihren Mann wissen, Frau Rinnstein. Wie sieht er aus, hat er irgendwelche Angewohnheiten, hat er Hobbies, Freunde, Bekannte, wo geht er am liebsten hin ...?«