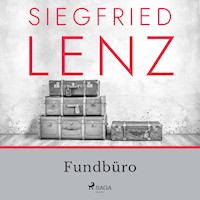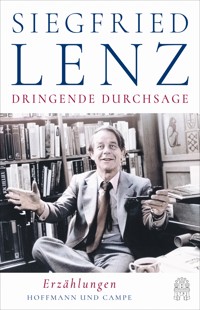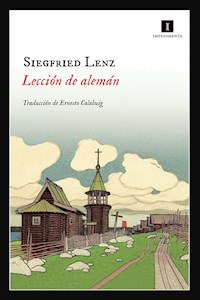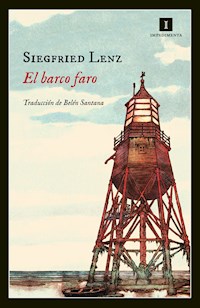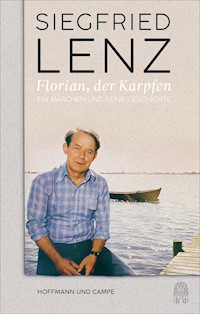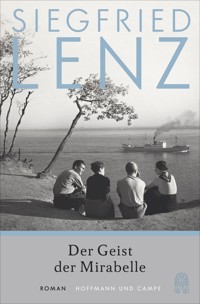
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Bollerup, einem Dorf an der Ostsee, heißen nur wenige Leute anders als Feddersen. Um sich gelegentlich voneinander zu unterscheiden, haben sich die Einwohner Zusatznamen gegeben: die Kneifzange zum Beispiel, der Schinken-Peter, der Dorsch oder die Schildkröte. Man sieht, Bollerup hat seine Eigenheiten. Zu ihnen gehört zweifellos auch der selbstgebrannte Mirabellengeist. Er produziert seltsame, krummwüchsige Gedanken, aber auch erstaunliche Einfälle, er prägt sogar Charaktere. Und von ihnen erzählt Siegfried Lenz in diesen zwölf Geschichten und knüpft damit an seine berühmten Erzählungen aus Suleyken an. Diese E-Book-Ausgabe von "Der Geist der Mirabelle" wird durch zusätzliches Material zu Leben und Werk Siegfried Lenz' ergänzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Siegfried Lenz
Der Geist der Mirabelle
Geschichten aus Bollerup
Literatur
Hoffmann und Campe Verlag
Vorwort
Bollerup ist kein vergessenes Dorf. Es liegt weder im Rücken der Geschichte noch in der geographischen Abgeschiedenheit, die der Idylle bekömmlich ist. Es ist ein Dorf von heute: offen, erreichbar, von reisenden Vertretern erobert, von Versandhäusern generalstabsmäßig mit dem letzten Wunschkatalog bedient. Die Filme, die hier gezeigt werden, laufen auch gerade in der Stadt. Die Informationen aus Brüssel sind so neu, daß sie nur die alte Weißglut bestätigen können. Was die Mädchen tragen, wird zur gleichen Zeit in München, in Köln, in Kopenhagen spazierengeführt. An Sonntagen, da zeigen allenfalls Hände und Gesichtsfarbe der Einwohner, daß hier Land ist, und vielleicht noch die Autos, die pfleglicher behandelt oder seltener benutzt werden als in der Stadt. Die eingeführten, die derben Indizien für Land und Landleben sind jedenfalls sehr gering geworden. Und die fünfzehn Sommer, die ich in der Nachbarschaft von Bollerup gelebt habe, beweisen mir, wie entscheden die äußerlichen Unterschiede zwischen Land und Stadt aufgehoben bzw. verwischt wurden.
Dennoch: von einer vollkommenen Angleichung kann man nicht sprechen. Es gibt etwas in Bollerup, das nur ihm und – in der Verlängerung – dem Land gehört: eine eigentümliche Erlebnisfähigkeit und eine spezifische Art, auf Erlebtes zu reagieren. Einen Beweis dafür liefern die Geschichten, die hier umgehen oder die nur hier möglich wären. In seinen Geschichten bewahrt sich Bollerup seine Eigenart, seinen verbogenen Charakter, meinetwegen: sein zweites Gesicht. Mir scheint, sie haben so viel eingrenzenden und bezeichnenden Wert, daß man sie auch Geschichten vom Lande nennen könnte. Doch das wird den Bollerupern gleichgültig sein: ich meine allerdings nicht die Einwohner des bekannten Bollerup, sondern die aus einem anderen Dorf gleichen Namens, nördlich von Kiel gelegen bzw. südlich von Aabenraa.
Ein Bein für alle Tage
In Bollerup, Nachbarn, läßt sich der Wind nicht aufhalten: kommt frisch von der Ostsee heran, der er seine torkelnden Schaumlichter aufsetzt, staut sich an der ausgewaschenen Steilküste, wird abgelenkt, drückt sich flach durch die Rinne und hat freien Zugang zum Dorf. Da hält ihn kein Knick auf und kein beliebter Mischwald, forsch fällt er ein und verwechselt, möcht ich mal sagen, das abfallende Roggenfeld mit der Ostsee: bringt die Halme in Aufruhr, will sie zur Flucht veranlassen, möchte sie vielleicht vor sich herwerfen wie Wellen und aus den Ähren ein bißchen planlosen Schaum schlagen, und wenn ihm dies auch nicht gelingt – dem Roggenfeld selbst verschafft er unerwartete Bewegung: duckt und schleudert es, walkt es durch, läßt es den Hang hinauflaufen und all so ’n Zeug.
Immer, wenn ich in Bollerup zu Besuch bin, nehme ich mir Zeit, den Wind im Getreide zu beobachten, was er so anstellt und sich einfallen läßt, um, beispielsweise, Schatten zu machen oder das Auge derart zu täuschen, daß man mitunter glaubt, man könnte mit einem Kahn übers Feld fahren.
Als ich das letzte Mal auf dem Hünengrab saß und den Wind beobachtete, war Jens Otto Dorsch gerade beim Mähen; er ist ein Großneffe meines Schwagers und heißt, wie dieser, Feddersen, aber da in Bollerup nur wenige Leute anders heißen als Feddersen, ist man übereingekommen, sich einen Zusatznamen zu geben, damit man sich, was ich verstehen kann, gelegentlich voneinander unterscheidet. Dieser Jens Otto Dorsch also saß auf dem Wippsitz seiner Mähmaschine – er lehnte es ab, einen Mähdrescher anzuschaffen –, saß mürrisch und gedankenlos, nahm das wogende Feld von außen an, umrundete es Mal für Mal, wobei er, sagen wir mal, den Wind immer ärmer machte, ihm nur kurze Stoppeln überließ. Mähend fuhr er zur Küste hinunter, dann ein Stück parallel zum Strand – eine Strecke, auf der er wie ein Reiter erschien, der durch ein lehmhelles, mäßig bewegtes Gewässer schwamm –, wendete kurz und kam zum Mischwald herauf, nie pfeifend oder singend, obwohl es auf Feierabend zuging. Alles, was er zeigte, war ein lustloses Interesse, dem Wind das Feld wegzumähen – womit er ungefragt den Leuten von Bollerup recht gab, die ihm den Zusatznamen Dorsch gegeben hatten.
Ich kann mich nicht erinnern, wie oft er um das Feld fuhr und da tätig war; jedenfalls hatte er das schwankende Rechteck erheblich verkleinert, ohne ein einziges Mal anzuhalten, hatte weder den Pferden ein Wort gegönnt noch sich selbst – da setzte, zu meiner Überraschung, das Klappern aus und das ratternde Geräusch der scharfzahnigen Schneidemesser, die aus bestem Metall gearbeitet sind. Ich sprang auf, kletterte auf die zeitgraue Steinbank, womit sie dem Hünen, meinetwegen, die Brust beschwert hatten, denn ich wollte genau erfahren, warum Jens Otto Dorsch seine Arbeit unterbrach, jetzt sogar abstieg und um die Mähmaschine herumging, die wie ein – na, sagen wir: beschädigtes Rieseninsekt aussah mit ihren Greifstangen, dem schrägen Flügelarm und all ihrem schwenkbaren und ausziehbaren Gestänge.
Der Dorsch ging um die Maschine herum, trat hier mal gegen und da mal, blickte mürrisch, vorwurfsvoll, horchte mit schräggelegtem Kopf, klopfte, und schließlich beugte er sich tief über die Maschine, wobei er, allem Anschein nach, entdeckte, wo der Schaden lag. Da war etwas in die Messer geraten, in die scharfzahnigen Messerketten, die gegeneinanderarbeiteten; etwas hatte sich festgeklemmt, ein Stein, ein Stück Holz, ein ganzer Ast womöglich, und um seine Maschine wieder in Gang zu bekommen, schwang sich der Dorsch auf ein Trittbrett und ließ sich von dort in die offene, luftig gebaute Maschine hinab. Er fand Boden unter den Füßen, griff, wie ich beobachten konnte, mit beiden Händen nach dem sperrenden Gegenstand, zerrte, ruckte heftig und zog aus den Messerketten, die, ich möchte wiederholen, aus allerbestem Metall gearbeitet sind, eine armdicke Astgabel, die die Messer nur deshalb nicht hatten durchsäbeln können, weil die Gabel zu elastisch war, keinen Widerstand bot.
Gut, erst einmal bis hierher, und am liebsten nur bis hierher; denn wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich den Jens Otto Dorsch aufsitzen, anfahren und für alle Zeit weitermähen lassen; aber die Geschichte besteht darauf, daß er noch ein Weilchen in der offenen Mähmaschine stehenbleibt, an der Astgabel zerrt und sich, von mir aus, verlegen den Kopf kratzt – was man ja mitunter von Landleuten lesen kann.
Ich jedenfalls sehe ihn dort noch tätig sein, sehe ihn zumindest mit einem Auge so, während ich mit dem andern Auge längst Lothar Emmendinger erkannt habe, einen Feinkosthändler aus Kiel, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Bollerup von der Herrschaft der Kaninchen zu befreien. Der ordentliche Jagdpächter trat mit schußbereiter Flinte aus dem Mischwald, warf den Kopf nervös hin und her, hob das Gewehr, ließ es sinken, schien überall Kaninchen zu sehen, wo ich keine sah, erfreute sich weder am Abendrot noch am Spiel des Winds im Roggen, und auf einmal stürzte er auf das Feld hinaus, riß das Gewehr hoch und schoß. Schoß, ja, und lief, von üblicher Erregung getragen, bis zur Küste hinab, gerade so, als verfolge er das fliehende Kaninchen, das sein Heil, sagen wir mal, am Strand, vielleicht sogar auf dem Wasser suchte.
Auch jetzt konnte ich kein Kaninchen erkennen, wenngleich ich zugeben muß, daß der Schuß nicht wirkungslos geblieben war: wie man sich erinnert, stand Jens Otto Dorsch in der offenen Mähmaschine; die Pferde, zwei braune Holsteiner von schlichter Gemütsart, standen angeschirrt davor, und als der Schuß fiel, taten sie, was sie für ihr Recht hielten: sie gingen durch. Die Pferde sprangen panisch ins Geschirr, tief erschreckt, vor allem erschreckt, zogen mit der Kraft, die der Schrecken angeblich verleihen soll, an und sausten in unnatürlich gehemmtem Galopp übers Feld. Die Räder der Maschine begannen sich zu drehen, das Greifgestänge zu greifen, die Flügelarme zu schlagen, und die scharfzahnigen Messerketten begannen zu arbeiten.
Daran konnte sie auch Jens Otto Dorsch nicht hindern, der, als die Maschine in gewaltsame Bewegung geriet, einfach herausgeschleudert wurde wie, ich möchte sagen: wie eine besonders schwere, lose gebundene Roggengarbe, auf das Feld fiel und dort liegenblieb. Doch noch während des Falls bemerkte ich – der ich von meinen Verwandten für scharfäugig gehalten werde –, daß der Jens Otto eigentümlich verkürzt war, besonders eines seiner Beine schien mir nicht die ordentliche Länge zu haben – was ich, in geschwinder Erkenntnis, der Qualität der Messerketten zuschrieb. Jedenfalls blieb der mürrische Mensch auf den Stoppeln liegen, rührte sich nicht, und das machte mich sozusagen kopflos: in dem heftigen Verlangen, dem verkürzten Dorsch Hilfe zu bringen, und zwar verständige Hilfe, stürzte ich den ausgefahrenen Weg nach Bollerup und fand keinen, fand ein ausgestorbenes Dorf; und so klopfte ich bei Wilhelm Feddersen, der Axt. Sie nannten ihn in Bollerup die Axt, weil er unweigerlich alles spaltete, womit er in Berührung kam. Hastig teilte ich ihm mit, was ich beobachtet hatte, und merkte erst zum Schluß, daß die Axt schweißglänzend unter schwerem Zudeck lag, teilnahmslos, mit hohem Fieber.
So lief ich, ärgerlich über mich selbst, weiter zu Fedder Feddersen, dem Leuchtturm, erzählte ihm von dem Unglück, ließ es jedoch nicht genug sein, sondern weihte außerdem noch Jörn, Gudrun und Lars Feddersen ein, die, ihrer Eigentümlichkeit entsprechend, der Knurrhahn, die Krähe und der Rammler hießen. In der erwähnten Reihenfolge strebten die Genannten dem Roggenfeld zu, um dem verkürzten Jens Otto Dorsch Hilfe zu bringen. Ich kam als letzter an.
Kam an, trat aus dem Mischwald und sah den Dorsch auf dem Wippsitz seiner Mähmaschine, mürrisch und gedankenlos, wie es ihm entsprach. Das verblüffte mich so sehr, daß ich mir ein Herz faßte, näher heranging und meinen Blick, möcht ich mal sagen, gleichmütig zu dem verkürzten Bein hob. Ich erkannte sofort, daß das linke Bein etwa um die Hälfte kürzer war, erkannte aber auch, an einem Haken neben dem Wippsitz, das passende Stück, das dort sachgemäß mit Hilfe von Schnürsenkeln angebunden war.
Es war ein Holzbein. Es baumelte in sanftem Rhythmus hin und her. Fragend, vielleicht auch verstört blickte ich zu Jens Otto Dorsch auf, und er sagte: »War man nur mein Alltagsbein, das die Messer kaputtgehauen haben. Wär mir das passiert mit der Ausführung für sonntags, hätt ich mich mehr geärgert! Denn das Sonntagsbein, das zu Hause steht, ist aus Eiche. Dies aber ist man nur aus Fichtenholz. Hüh.«
Das unterbrochene Schweigen
Zwei Familien, Nachbarn, gab es in Bollerup, die hatten seit zweihundert Jahren kein Wort miteinander gewechselt – obwohl ihre Felder aneinandergrenzten, obwohl ihre Kinder in der gleichen Schule erzogen, ihre Toten auf dem gleichen Friedhof begraben wurden. Beide Familien hießen, wie man vorauseilend sich gedacht haben wird, Feddersen, doch wollen wir aus Gründen der Unterscheidung die eine Feddersen-Ost, die andere Feddersen-West nennen, was auch die Leute in Bollerup taten.
Diese beiden Familien hatten nie ein Wort gewechselt, weil sie sich gegenseitig – wie soll ich sagen: für Abschaum hielten, für Gezücht, für Teufelsdreck mitunter; man haßte und verachtete sich so dauerhaft, so tief, so vollkommen, daß man auf beiden Seiten erwogen hatte, den Namen zu ändern – was nur unterblieben war, weil die einen es von den andern glaubten erwarten zu können. So hieß man weiter gemeinsam Feddersen, und wenn man die Verhaßten bezeichnen wollte, behalf man sich mit Zoologie, sprach von Wölfen, Kröten, von Raubaalen, Kreuzottern und gelegentlich auch von gefleckten Iltissen. Was den Anlaß zu zweihundertjährigem Haß und ebenso langem Schweigen gegeben hatte, war nicht mehr mit Sicherheit festzustellen; einige Greise meinten, ein verschwundenes Wagenrad sei die Ursache gewesen, andere sprachen von ausgenommenen Hühnernestern; auch von Beschädigung eines Staketenzauns war die Rede.
Doch der Anlaß, meine ich, ist unwichtig genug, er braucht uns nicht zu interessieren, wohingegen von Interesse sein könnte, zu erfahren, daß in beiden Familien alles getan wurde, um dem Haß dauerhaften Ausdruck zu verleihen. Um nur ein Beispiel zu geben: wenn in einer Familie die Rede auf den Gegner kam, machten eventuell anwesende kleine Kinder ungefragt die Geste des Halsabschneidens, und wie mein Schwager wissen will, verfärbten sich sogar anwesende Säuglinge – was ich jedoch für eine Mißdeutung halte. Fest steht jedoch, daß die Angehörigen beider Familien bei zwangsläufigen Begegnungen mit geballten Fäusten wegsahen oder automatisch Zischlaute der Verachtung ausstießen. Gut. Bis hierher setzt das keinen in Erstaunen, etwas Ähnliches hat jeder wohl schon mal gehört.