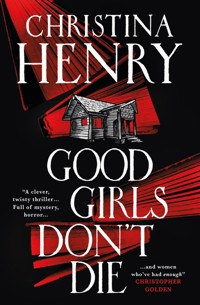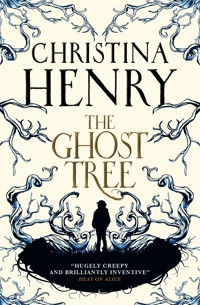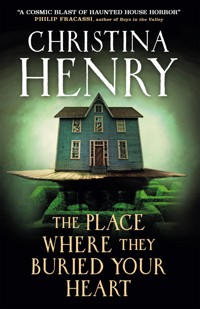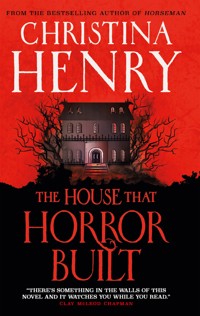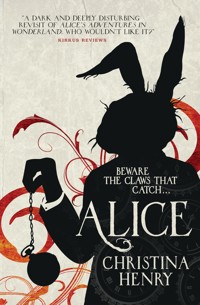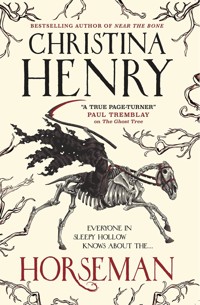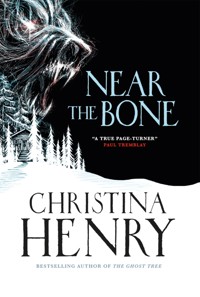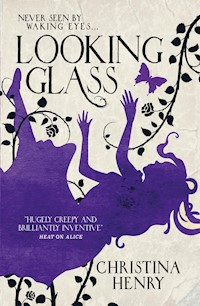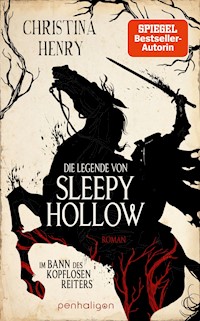12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine abgelegene Kleinstadt, eine blutige Mordserie und ein entsetzliches Monster: Der neue Fantasy-Horror-Roman von Christina Henry!
Als die Leichen von zwei Mädchen in der Stadt Smiths Hollow auftauchen, weiß die 14-jährige Lauren, dass die blutige Tat ungesühnt bleiben wird. Schließlich konnte die Polizei auch den Mörder ihres Vaters nicht finden, dessen Leiche ein Jahr zuvor im Wald gefunden wurde: Sein Herz war ihm herausgerissen worden, und zwar unter dem berüchtigten Geisterbaum. Warum musste Laurens Vater sterben? Wieso vergessen die Bewohner von Smiths Hollow, dass aus ihren Reihen immer wieder Mädchen verschwinden? Und welches blutige Geheimnis bewahrt der schreckliche und Lauren doch so vertraute Geisterbaum? Sie ahnt, dass sie in Gefahr ist – und dass sie die nächste ist, die ihr Leben verlieren soll ...
Düster, gruselig, einfach phantastisch – verpass nicht die anderen Bücher von Christina Henry wie »Die dunklen Chroniken« oder »Die Legende von Sleepy Hollow«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Als die Leichen von zwei Mädchen in der Stadt Smiths Hollow auftauchen, weiß die 14-jährige Lauren, dass die blutige Tat ungesühnt bleiben wird. Schließlich konnte die Polizei auch den Mörder ihres Vaters nicht finden, dessen Leiche ein Jahr zuvor im Wald gefunden wurde: Sein Herz war ihm herausgerissen worden, und zwar unter dem berüchtigten Geisterbaum. Warum musste Laurens Vater sterben? Wieso vergessen die Bewohner von Smiths Hollow, dass aus ihren Reihen immer wieder Mädchen verschwinden? Und welches blutige Geheimnis bewahrt der schreckliche und Lauren doch so vertraute Geisterbaum? Sie ahnt, dass sie in Gefahr ist – und dass sie die nächste ist, die ihr Leben verlieren soll …
Autor
Die Amerikanerin Christina Henry ist als Fantasyautorin bekannt für ihre finsteren Neuerzählungen von literarischen Klassikern wie »Alice im Wunderland«, »Peter Pan« oder »Die kleine Meerjungfrau«. Im deutschsprachigen Raum wurden diese unter dem Titel »Die Dunklen Chroniken« bekannt und gehören zu den erfolgreichsten Fantasybüchern der letzten Jahre. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin liebt Langstreckenläufe, Bücher sowie Samurai- und Zombiefilme. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Chicago.
Alle Bücher von Christina Henry bei Penhaligon:
Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland
Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin
Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland
Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland
Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen
Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald
Die Legende von Sleepy Hollow – Im Bann des kopflosen Reiters
Der Geisterbaum
Der Knochenwald
Weitere in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Christina Henry
DERGEISTER-BAUM
Roman
Deutsch von Sigrun Zühlke
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Ghost Tree« bei Berkley, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Tina Raffaele
Published by Arrangement with Tina Raffaele
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Covergestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung eines Motivs von iStock.com/Turnevisual
BL · Herstellung: mar
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-29099-3V005
www.penhaligon.de
Für Alexis Nixon im October Country
Teil eins
Die Mädchen
1
Juni 1985
Mittwoch
Lauren warf einen Blick nach unten auf ihre Schuhe, die sich auf den Pedalen auf- und abbewegten, während sie mit ihrem Fahrrad Richtung Wald fuhr. Sie trug brandneue türkisfarbene High-Top-Sneaker; sie ähnelten den Chucks, die sie eigentlich gewollt hatte, waren aber markenlose Schuhe von Kmart. Auch wenn sie nicht über den kreisförmigen Aufnäher am Knöchel verfügten, sahen sie ziemlich cool aus. Dachte sie zumindest.
Sie mussten genügen, denn – wie ihre Mutter immer wieder sagte – sie konnten sich keine Markenkleidung leisten. Immerhin hatte sonst niemand an der Schule welche in Türkis. Die Farbe war so grell, dass sie praktisch in der Sommersonne leuchteten, aber bis zum Herbst, wenn die Schule wieder anfing, würden sie ausreichend abgetragen sein, damit sie sich nicht blamierte.
Wenn die Schule wieder losging, wäre sie schon fast fünfzehn (Ende November – noch fünf Monate), was bedeutete, sie würde zu den Älteren in der Jahrgangsstufe gehören; allerdings wäre sie immer noch jünger als Miranda, deren Geburtstag letzte Woche gewesen war. Miranda versäumte es nie, sie daran zu erinnern, weil es bedeutete, dass sie den Führerschein vor Lauren bekommen würde. Lauren machte das nichts aus, solange sie überhaupt in einem Auto zur Schule kam (auch wenn es nicht ihr eigenes war) statt mit dem Fahrrad.
Lauren wusste, dass es Mom nicht gefiel, wenn sie sich mit Miranda im Wald traf. Erst recht nicht seit letztem Jahr. Erst recht nicht, seit Laurens Vater tot in der Nähe der alten Jagdhütte aufgefunden worden war. Mom fand Lauren makaber, wenn sie sich auch nur in die Nähe des Platzes wagte, an dem ihr Vater ermordet worden war.
Doch Lauren interessierte die Meinung ihrer Mutter genauso viel, wie Laurens Mutter sich für ihre Meinung interessierte – nicht im Geringsten. Mom hatte Dad nie so geliebt, wie Lauren es getan hatte. Mom verstand nicht, was es für Lauren bedeutete, sich da aufzuhalten, wo er zuletzt am Leben gewesen war.
Miranda und Lauren trafen sich schon, seit sie ganz klein waren, unter dem Geisterbaum – so lange schon, dass sie nicht mehr wussten, wer als Erste auf die Idee gekommen war. Eine rief die andere an und sagte: »Wir treffen uns am alten Geisterbaum«, und dann fuhren sie beide los.
In den geheimen Schatten der Wälder erlebten sie Abenteuer: Sie errichteten Buden, planschten durch Bäche und kletterten auf Bäume und bauten Schaukeln aus Seilen. In der Nähe der alten Jagdhütte, versteckt im Wald, hatten sie ihr geheimes Basislager. Das war, lange bevor Laurens Vater dort aufgefunden worden war, und jetzt war es schon eine ganze Weile her, dass sie überhaupt dort gespielt hatten.
Im Laufe des letzten Jahres hatte sich viel verändert. Auf einmal wollte Miranda sich nicht mehr schmutzig machen, weshalb sie auch nicht mehr am Seil über den kleinen Bach schwingen wollte, der durch den Wald floss, oder im Laub herumrollen. Sie wollte vor allem Sachen machen, die Lauren eher nicht interessierten, wie sich die Nägel lackieren oder sich gegenseitig die Haare flechten oder über Jungs reden, die Miranda niedlich fand – ältere Jungs, immer, Jungs, die sich nicht im Geringsten für kleine Neuntklässlerinnen interessierten.
Dennoch trafen sie sich immer noch am liebsten am Geisterbaum. Das war der Ort, der nur ihnen gehörte.
Lauren sauste am Imperial Drive-In vorbei, dem Autokino am Stadtrand. Zwei Filme standen auf dem Programm – Die Goonies und Cocoon. Der weitläufige Platz war mit Müll vom gestrigen Abend übersät – leere Popcornbehälter, Bonbonpapierchen, Zigarettenstummel. Manchmal verdiente sich Lauren zehn Dollar und Freikarten für den Abend, indem sie Mr. Harper, dem Besitzer, dabei half, den Platz zu säubern. Aber sie hatte Die Goonies schon zweimal gesehen, und Miranda meinte, Cocoon sei ein Film über alte Leute, sodass sie nie für den zweiten Film des Abends geblieben waren.
Die Rückseite der Leinwand grenzte direkt an den Wald, der Smiths Hollow umgab. Lauren hatte diesen Namen immer gemocht, weil er sie an Sleepy Hollow erinnerte.
Jedes Jahr zu Halloween hatte sie mit ihrem Vater Die Abenteuer von Ichabod und Taddäus Kröte angesehen. Auch wenn Ichabods Name im Titel stand, kam Die Legende von Sleepy Hollow erst als Zweites in dem Film, aber Lauren gefiel sie am besten. Sie liebte es, gespannt auf den Moment zu warten, wenn der kopflose Reiter erschien und mit irrem Lachen das riesige Schwert schwang.
Als sie noch klein war, hatte sie sich bei dieser Stelle immer mit pochendem Herzen eng in den Arm ihres Vaters gekuschelt, auch wenn sie wusste, dass sie sich nicht wirklich fürchten musste, weil ihr Daddy ja bei ihr war. Natürlich war es Jahre her, dass die Szene ihr Angst eingejagt hatte, aber sie kuschelte sich trotzdem jedes Jahr wieder eng an ihn. Er roch immer ein bisschen nach Schmiere und Öl, selbst wenn er frisch geduscht war, und auch nach der Old-Spice-Seife an der Kordel, die sie ihm jedes Jahr zum Vatertag schenkte.
Lauren überlegte, ob sie dieses Jahr zu Halloween den Zeichentrickfilm überhaupt sehen und ob sie ihn ihrem Bruder David zeigen sollte. Letztes Jahr war er noch zu klein dafür gewesen.
Letztes Jahr hatte Miranda verlangt, dass Lauren bei ihr übernachtete, damit sie »echt gruselige« Filme auf dem Videorekorder gucken konnten. Laurens Familie besaß keinen Videorekorder, und das war für Miranda ein unbestreitbarer Nachteil, weshalb sie keinesfalls bei Lauren übernachten konnten.
Jedes Jahr zogen sie zusammen los, um Süßigkeiten zu sammeln, doch nachdem ihre Tüten prall gefüllt waren, gingen sie ihrer eigenen Wege. Letztes Jahr hatte Miranda eigentlich schon gar nicht mehr mitgehen wollen, aber Lauren hatte sie doch noch überredet, und Miranda hatte auf den letzten Drücker aus alten Klamotten noch ein Kostüm zusammengeschmissen und war als Landstreicher gegangen. Die ganze Zeit hatte sie darüber gejammert, wie lahm und kindisch es war, Süßigkeiten zu sammeln, und war dann sauer geworden, als Lauren hinterher nach Hause musste.
»Ich dachte, wir gucken zusammen Halloween«, sagte Miranda. »Das ist der perfekte Abend dafür.«
Lauren schüttelte den Kopf. »Das können wir doch auch noch wann anders machen. Mein Dad wartet auf mich.«
»Wann anders ist es nicht dasselbe«, beharrte Miranda. »Ich fass es nicht, dass du mich durch die halbe Stadt geschleift hast, um bescheuerte kleine Schokoriegel einzusammeln, und jetzt gucken wir nicht mal einen Gruselfilm zusammen.«
»Ich nehm dir deine Süßigkeiten gern ab, falls du sie nicht mehr willst«, antwortete Lauren und hielt ihre Tüte auf.
»Von wegen. Ich bin dafür durch die halbe Stadt gelatscht, ich ess die jetzt auch«, schnaubte Miranda.
Sie war schmollend nach Hause gegangen, aber beim nächsten Mal, als Lauren bei ihr übernachtete, hatten sie sich Halloween angesehen. Oder besser gesagt, Miranda hatte sich den Film angesehen und war jedes Mal in hysterisches Lachen ausgebrochen, wenn jemand von dem Mörder niedergemetzelt wurde, während Lauren sich die Hände vor den Augen hielt, durch die Finger lugte und inständig hoffte, dass sie keine Albträume davon bekam. Sie mochte keine Horrorfilme. Miranda schien daran gewöhnt zu sein.
Wie dem auch sei, Lauren war froh, an jenem Abend nach Hause gegangen zu sein, denn es war das letzte Mal gewesen, dass sie Ichabod und Taddäus Kröte zusammen mit ihrem Dad gesehen hatte. Keinen Monat später war er tot gewesen.
Er war tot, und niemand wollte darüber sprechen. Niemand sprach darüber, warum es geschehen war oder wie. Der Polizeichef hatte Laurens Mutter gesagt, dass es irgendein Herumtreiber gewesen sein musste, ein Perverser, der von Stadt zu Stadt zog. Doch das ergab für Lauren überhaupt keinen Sinn. Warum sollte irgendein Perverser nach Smiths Hollow kommen, um ihren Dad zu töten?
Und es hatte ihr auch niemand sagen können, was ihr Dad so spät in der Nacht noch da draußen gewollt hatte. Jedes Mal, wenn Lauren danach fragte, presste ihre Mutter die Lippen zu einem Strich zusammen und sagte: »Darüber diskutieren wir nicht, Lauren.«
Lauren erreichte das Gebüsch am Waldrand und zog die Bremsen an ihrem Fahrrad. Es war ein zehngängiges Damenrennrad, das sie zum letzten Geburtstag bekommen hatte, auch wenn sie noch etwas zu klein dafür war und wahrscheinlich nie besonders groß werden würde. Miranda sagte, Mädchen hörten, ein Jahr nachdem sie ihre Periode bekamen, auf zu wachsen, und Lauren hatte ihre noch nicht, also bestand noch Hoffnung, dass sie nicht bei 1,58 stehen bleiben würde.
Miranda hatte ihre Regel schon vor fast einem Jahr bekommen, aber ihre beiden Eltern waren auch groß, sodass sie Lauren schon immer um fünfzehn Zentimeter überragte. Außerdem hatte sie lange, lange Beine und konnte tragen, was sie wollte, an ihr sah einfach alles gut aus. Lauren musste immer einen kleinen Eifersuchtsanfall unterdrücken, wenn sie Miranda so cool und schön und erwachsen sah.
Lauren sprang vom Rad und schob es in den Wald den kleinen Trampelpfad entlang, den ihre Füße dort gebahnt hatten. Das Fahrrad holperte über die Baumwurzeln und spritzte kleine Steinchen gegen ihre Schienbeine.
Manche Leute gingen nicht gern in die Wälder rund um Smiths Hollow. Gut, wenn Lauren ehrlich war, ging eigentlich niemand gern hier in den Wald. Mehr als einmal hatte sie gehört, wie der Wald als »gruselig« und »unheimlich« und »schaurig« bezeichnet wurde, aber Lauren fand das nicht.
Sie mochte die Bäume und ihre geheimnisvolle Natur und die ganzen kleinen Lebewesen, die ins Unterholz huschten, wenn sie sie herankommen hörten. Und es gab viele Plätze, an denen man in Ruhe sitzen und nachdenken oder einfach nur allein sein und dem Rascheln des Windes in den Blättern lauschen konnte. Es kam häufig vor, dass Miranda nach Hause ging und Lauren noch allein im Wald blieb, mit einem Buch an den Fuß eines Baums zwischen die großen Wurzeln geschmiegt. So konnte man fast die Zeit vergessen.
Sogar Laurens Dad hatte immer gesagt, dass ihm der Wald unbehaglich war. »Immer hab ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtet, wenn ich da in die Nähe komme«, gestand er ihr eines Tages. Sie standen beide in der Küche und schrubbten sich die Hände – Laurens waren matschverkrustet, und ihr Vater hatte wie üblich Öl von der Arbeit in der Werkstatt an den Händen.
»I always feel like somebody’s watching me«, sang Lauren den Song von Rockwell, während sie weiterging, auch wenn das nicht wirklich der Fall war. Falls überhaupt irgendjemand sie hier beobachtete, war es jemand Wohlwollendes, das hatte sie im Gefühl.
Sie liebte diesen Song, auch wenn Miranda nicht viel davon hielt. Miranda hatte Def Leppards Pyromania nonstop gehört, seit sie das Album im Vorjahr entdeckt hatte, und legte es immer auf, wenn Lauren sie besuchte. Lauren war sich ziemlich sicher, dass sie für den Rest ihres Lebens oft genug Rock of Ages gehört hatte und fortan wunderbar darauf verzichten konnte.
Der Geisterbaum stand etwa zehn Minuten Fußweg vom Waldrand entfernt, wo Lauren vom Rad gestiegen war. Miranda war schon da und stand mit verschränkten Armen und geschlossenen Augen an den Baum gelehnt. Worüber sie wohl nachdachte?
Sie trug eine weiße, ärmellose Bluse mit einer Knopfleiste an der Vorderseite, und Lauren konnte durch den Stoff hindurch ihren Trainings-BH sehen. Lauren hatte auch angefangen, einen Trainings-BH zu tragen, obwohl sie ihn noch nicht wirklich brauchte. Wenn sie tatsächlich einen BH benötigte, würde Miranda wahrscheinlich längst echte Frauen-BHs tragen.
Die Bluse trug Miranda in die Jeans gesteckt – Jordache, natürlich, deren Saum an ihre weißen Adidas-Turnschuhe mit den drei schwarzen Streifen reichte. Miranda trug immer Markenkleidung, weil ihre Eltern beide in Führungspositionen in der Chili-Fabrik arbeiteten und mit ihr zum Einkaufen in die Mall der nächstgrößeren Stadt fuhren.
Außerdem war sie ein Einzelkind, weshalb ihre Eltern sich keine Sorgen darüber machen mussten, auch für die Geschwisterkinder noch genug Sachen kaufen zu können. Lauren hatte ihre Mutter oft seufzen hören, dass man nichts zum Auftragen aufbewahren konnte, wenn man ein Mädchen und einen Jungen hatte. Nicht dass es noch viel zum Auftragen gegeben hätte, als David auf die Welt kam – er war zehn Jahre jünger als Lauren, ein »Überraschungspaket«, wie Laurens Dad ihn nannte. Laurens Eltern hatten gedacht, dass die Zeiten, in denen sie mit einem schreienden Baby die Nächte durchwachten, längst vorüber waren.
»Was kommst du denn so spät?«, fragte Miranda und richtete sich auf, als sie Laurens Fahrradkette klappern hörte. »Und was hast du da überhaupt an?«
Was hast du denn da an?, wollte Lauren fragen, blickte jedoch stattdessen auf ihr Rundhals-T-Shirt und die abgeschnittenen Jeans hinunter und sagte: »Sachen, mit denen man im Wald spielen kann.«
Miranda schüttelte ihr Haar, eine kunstvoll auftoupierte und eingesprühte Masse, die in einen hoch angesetzten Pferdeschwanz mündete. »Wir spielen nicht im Wald. Was sind wir denn, neun? Wir gehen in die Dream Machine.«
»Und warum hast du das nicht gleich gesagt?«, fragte Lauren.
Lauren hatte nicht wirklich was für Spielautomaten übrig, außer vielleicht für den Flipper, und sie ging erst recht nicht gern in die Dream Machine, weil das in letzter Zeit nur darauf hinauslief, dass sie und Miranda herumstanden und Jungs beobachteten, die Miranda niedlich fand.
»Tad hat mich gefragt, ob wir uns da treffen wollen«, erklärte Miranda aufgeregt und überging Laurens Frage. »Er hat mich vorhin extra deswegen angerufen.«
Und wozu muss ich dann mit?, dachte Lauren. Wenn sie gewusst hätte, was Miranda vorhatte, hätte sie sich ein Buch mitgenommen. Es gab doch nichts Langweiligeres, als einem Jungen dabei zuzusehen, wie er Pac-Man spielte. Und was für ein bescheuerter Name war denn wohl Tad? Lauren war sich nicht sicher, ob sie überhaupt wusste, wer Tad genau war. Es war nicht ganz einfach, bei Mirandas ständig wechselnder Liste interessanter Jungs auf dem Laufenden zu bleiben.
»Und er hat gesagt, er bringt noch ein paar Freunde mit, also wird auch wer für dich dabei sein«, schloss Miranda triumphierend. Sie hörte sich an, als hätte sie Lauren damit ein wirklich tolles Geschenk gemacht und könne es kaum erwarten zu hören, wie sehr sie sich darüber freute.
»Oh«, sagte Lauren.
»Gehen wir«, sagte Miranda. »Lass das Fahrrad hier. Wir können die Abkürzung durch den Wald nehmen, um hinter Frank’s rauszukommen.«
Frank’s Deli befand sich direkt gegenüber der Spielhalle. Lauren nahm diesen Weg nicht gern, weil hinter dem Geschäft, bei dem sie herauskamen, häufig Ratten herumhuschten. Deshalb sagte sie ihrer Mutter auch immer wieder, dass sie da kein Fleisch zum Lunch holen sollte.
»Sei nicht albern, Lauren«, sagte Mom dann immer. »Natürlich gibt’s dahinter Ratten. Die Mülleimer locken sie an. Das heißt aber nicht, dass im Geschäft Ratten herumlaufen.«
»Heißt aber auch nicht, dass keine da rumlaufen«, entgegnete Lauren dann düster und weigerte sich, auch nur eine Scheibe Roastbeef zu essen, wenn sie von Frank’s stammte. Das bedeutete wiederum, dass es für Lauren zum Lunch sehr häufig Erdnussbutter-Sandwiches gab, weil ihre Mutter stets bei Frank’s einkaufte, wenn sie nicht in den Supermarkt in die Stadt fuhr, und immer Aufschnitt mitnahm, wenn sie dort war.
»Welcher war noch gleich Tad?«, fragte Lauren, während sie ihr Fahrrad an den Baum lehnte. Sie musste keine Angst haben, dass es gestohlen wurde. Niemand stahl etwas, das zum Geisterbaum gehörte.
Miranda versetzte Lauren mit dem Handrücken einen Schlag auf die Schulter. »Der bei Wagon Wheel arbeitet, das weißt du doch! Wir haben ihn letzte Woche da besucht.«
Lauren erinnerte sich vage an einen Jungen mit fettigen Haaren, der ihnen zwei Stücke Pizza hingeknallt hatte, als sie mit baumelnden Füßen auf den Barhockern am Tresen saßen. Er hatte Mirandas Existenz kaum wahrgenommen.
»Dieser Typ?«, fragte Lauren ungläubig.
»Er sieht genauso aus wie Matt Dillon in Die Outsider«, sagte Miranda mit einem kleinen Seufzer.
»Nein, tut er nicht«, gab Lauren zurück.
Normalerweise widersprach sie Mirandas Behauptungen nicht, aber das konnte sie ihr nicht einfach so durchgehen lassen. Lauren hatte ein Poster mit den Schauspielern des Films an ihrer Zimmertür hängen, und sie sah Matt Dillon jeden Morgen. Tad ähnelte ihm nicht im Geringsten.
»Tut er wohl!«, beharrte Miranda.
»Niemals«, gab Lauren zurück.
»Egal, er kommt nächstes Jahr in die Zehnte, und er hat einen Camaro«, verkündete Miranda, als wäre damit alles geklärt.
Wenn Miranda solche Sachen sagte, konnte Lauren spüren, wie sich die lebenslangen Verbindungen zwischen ihnen eine nach der anderen lösten. Lauren war es nicht wichtig, ob jemand einen Camaro hatte, und die alte Miranda hätte das auch nicht wichtig gefunden. Die alte Miranda hätte im Wald bleiben wollen, statt in die Spielhalle zu gehen. Aber die alte Miranda war im Laufe des letzten Jahres verschwunden, und Lauren fragte sich immer öfter, warum sie eigentlich noch kam, wenn Miranda rief.
Vielleicht ist es einfach schwierig, die beste Freundin gehen zu lassen, auch wenn man nichts mehr gemeinsam hat, dachte Lauren und seufzte ein wenig.
Sie kamen hinter Frank’s Deli aus dem Wald. Zwei Ratten, eine sehr große und eine winzig kleine, ließen die Brotkruste liegen, an der sie genagt hatten, und flohen hinter die drei großen metallenen Mülltonnen, die neben der Hintertür aufgereiht standen.
»Eklig«, sagte Miranda, während Lauren zusammenzuckte und einen kleinen Quietscher ausstieß.
Jemand lachte leise. Lauren sah Jake Hanson, den Sohn eines ihrer Nachbarn, hinter dem Elektronikladen nebenan stehen und eine Zigarette rauchen. Er war drei oder vier Jahre älter als Lauren, weshalb sie sich nur selten über den Weg liefen. Aber sie erinnerte sich daran, dass er ihr, als sie vielleicht sieben oder acht Jahre alt war, mal gezeigt hatte, wie man einen Baseball wirft, und eine halbe Stunde geduldig alle ihren wilden Pitches gefangen hatte.
Miranda marschierte direkt auf den schmalen Durchgang zwischen Frank’s und dem Elektronikgeschäft zu und ignorierte Jake vollkommen.
Lauren blieb stehen, weil es ihr gegen den Strich ging, so zu tun, als gäbe es jemanden gar nicht. »Hey, Jake.«
Er war sehr groß geworden, überragte Lauren um Längen, aber seine enge Jeans hielt kaum auf seinen Hüften, obwohl der Gürtel im letzten Loch war. Er trug ein schwarzes Firmen-Poloshirt mit der eingestickten Beschriftung Best Electronics oben links.
»Hey, Lauren«, sagte er und blies dabei Rauch aus der Nase.
Sie fragte sich, seit wann seine Stimme so erwachsen klang. Er hörte sich wirklich nicht mehr wie ein Junge an – aber andererseits war er wohl auch keiner mehr. Er musste achtzehn Jahre alt sein, oder fast. Jedenfalls alt genug für einen echten Bartschatten auf den Wangen statt des löchrigen Flaums, auf den die meisten Jungen auf der Highschool so stolz waren.
Seine blauen Augen musterten sie von unten bis oben, abschätzend. Was er abschätzte, da war sich Lauren nicht sicher. Sie hatte seine Augen immer gemocht, den Kontrast seiner blauen Augen gegen das schwarze Haar, aber jetzt ließ ihr irgendetwas an der Art, wie er sie ansah, das Blut in die Wangen steigen.
»Schöne Schuhe«, sagte er, und sie wusste nicht genau, ob er es ernst meinte oder sich über sie lustig machte.
»Lau-ren«, rief Miranda ungeduldig.
»Beeil dich lieber«, sagte Jake beiläufig. Er ließ den Zigarettenstummel auf den Boden fallen und trat ihn mit der Sohle seines schwarzen Stiefels aus. »Man sieht sich, Lauren.«
»Yeah«, sagte sie und eilte Miranda nach. Sie wusste nicht genau, warum sie so verlegen war, aber es ärgerte sie, wenn sie sich so fühlte.
»Was machst du denn da so lange?«, fragte Miranda.
»Hab nur kurz Hallo gesagt«, erklärte Lauren, jetzt noch genervter, weil Miranda das Gespräch ja wohl mit angehört hatte.
»Du solltest nicht mit Losern wie dem reden«, sagte Miranda.
»Er ist mein Nachbar«, antwortete Lauren. Ihr Gesicht fühlte sich immer noch heiß an, und sie wusste aus leidvoller Erfahrung, dass es eine Weile dauern würde, bis ihre Wangen wieder zu ihrer normalen Farbe zurückfanden.
Miranda beugte sich dicht zu Lauren und warf einen verstohlenen Blick über die Schulter, um sicherzugehen, dass niemand in der Nähe war und mithörte.
»Er dealt«, flüsterte Miranda.
Lauren zog die Augenbrauen zusammen. »Jetzt mach aber mal halblang. Drogen? In Smiths Hollow? Woher sollte er die hier überhaupt kriegen?«
»Drogen gibt’s sogar in Smiths Hollow«, erklärte Miranda geheimnisvoll.
Das Einzige, was Lauren über Drogen wusste, stammte aus Kinofilmen, in denen ab und zu eine Figur auftrat, die einen Joint rauchte. Aber Miranda hatte im Gegensatz zu Lauren schon Scarface gesehen und benahm sich seither, als wüsste sie alles, was es über Kokain zu wissen gab.
Zwischen dem Deli und dem Elektronikgeschäft traten sie auf die Hauptstraße. Die Dream Machine war direkt gegenüber. Alle Fenster standen offen. Die laute Musik, zusammen mit dem unablässigen Piepen und Klingeln der Spielautomaten, untermalt vom gelegentlichen Jubel eines Spielers, war auch über den Verkehrslärm hinweg gut zu hören.
Lauren blickte nach links und rechts, um die Straße zu überqueren, doch Miranda zog sie am Arm und zeigte auf den Sweet Shoppe ein paar Häuser weiter.
»Ich brauch noch Tic Tacs«, sagte sie. »Ich hab zu Mittag ein Thunfisch-Sandwich gegessen, bevor Tad angerufen hat. Hätte ich gewusst, dass er anruft, hätte ich überhaupt nichts gegessen. Schließlich will ich ihm gegenüber nicht fett aussehen.«
Bei diesen Worten tätschelte sie ihren papierflachen Bauch und warf Lauren einen Blick zu, als erwartete sie, dass sie ihr sagte: Du siehst doch nicht fett aus.
Doch Lauren achtete nur halb auf Miranda. Zum Sweet Shoppe zu gehen bedeutete, dass sie an dem großen Schaufenster von Best Electronics vorbeimussten. Jake Hanson stand hinter dem Tresen, seine Zigarettenpause war anscheinend zu Ende, und er beugte sich über einen Haufen aus schwarzem Plastik und Drähten.
Schnell wandte sie den Blick ab, erstens, weil sie nicht beim Starren ertappt werden wollte, und zweitens, weil sie nicht wusste, ob sie winken oder so tun sollte, als hätte sie ihn nicht gesehen, falls er aufsah. Ihr Blick schoss auf die Straße und die vorbeifahrenden Autos hinaus.
Ein großer brauner Kombi kam auf sie zu, und Lauren tat schnell, als wäre sie vollkommen in den Anblick von Mirandas Gesicht vertieft, als er vorbeifuhr. Der einzige Mensch, bei dem es Lauren nie schwerfiel, so zu tun, als hätte sie ihn nicht gesehen, war ihre Mutter.
2
»Na komm, David«, sagte Karen diMucci, während sie den Sicherheitsgurt löste und ihren Sohn aus dem Auto hob. Sie hatte Glück gehabt, einen Parkplatz direkt vor Frank’s zu ergattern, weshalb ihre Laune eigentlich hätte besser sein müssen. Es war immer anstrengend, mehr als einen Block zu laufen mit David im Schlepptau und den Einkäufen, erst recht in der Junihitze. Heute blieb ihr das erspart.
Genau wie Lauren es sich erspart hat, mir in die Augen zu sehen, als ich vorbeigefahren bin.
Sie versuchte, sich ihre Verärgerung nicht anmerken zu lassen, doch David hörte die Schärfe in ihrer Stimme und blickte sie fragend an, mit diesem ernsten Blick, der so typisch für ihn war.
»Lass uns etwas für die Sandwiches kaufen«, sagte sie betont fröhlich. »Und hinterher holen wir uns noch ein Eis beim Sweet Shoppe, okay?«
»Okeh«, sagte David.
Bis dahin waren Lauren und Miranda sicher wieder weg, dachte Karen. Nicht dass sie ihrer eigenen Tochter aus dem Weg gehen wollte. Sie wusste einfach nur, dass sie ihre Verärgerung nicht unterdrücken könnte und es ansprechen würde, wenn sie Lauren jetzt sah, und dass Lauren sie dann den ganzen Abend lang mit Schweigen strafen würde, weil sie sie in der Öffentlichkeit blamiert hatte.
Karen stellte David auf die Füße und nahm seine Hand. Er versuchte nicht, sich zu entwinden oder vorzulaufen, wie es die meisten Vierjährigen taten. Lauren hatte das immer versucht – versucht, sie abzuschütteln, sogar als sie noch klein war.
Die klimatisierte Kühle im Deli war eine Wohltat nach der erstickenden Hitze auf der Straße. Die Wettervorhersage im Smiths Hollow Observer hatte an die 30 Grad für den Nachmittag angekündigt, aber es fühlte sich jetzt schon viel heißer an, weil sich kein Lüftchen regte. Die Hitze schien sich auf die Stadt zu legen und sich dort einzurichten, besonders auf der Hauptstraße, wo es keine Bäume gab, die hätten Schatten spenden können. Bereits vor einiger Zeit hatten die Stadtväter entschieden, dass es in den umliegenden Wäldern genug Bäume gab und für die Stadt keine Notwendigkeit bestand, für teures Geld entlang der Bürgersteige Vegetation am Leben zu erhalten.
Karen stellte sich an. Vor ihr standen drei andere Leute, Leute, die sie vom Sehen kannte, aber nicht gut. In einer kleinen Stadt wie Smiths Hollow kannte man so gut wie jeden vom Sehen. Sie war dankbar dafür, keine mitleidigen Blicke und gezwungenen Small Talk mit Bekannten ertragen zu müssen.
In letzter Zeit fürchtete sie genau das, wenn sie das Haus verließ – dass sie jemandem in die Arme laufen könnte, den sie aus dem Elternbeirat kannte oder der sein Auto in Joes Werkstatt reparieren ließ. Leute, die sie nicht so gut kannte, dass sie Freunde waren, die sich aber dennoch genötigt sahen, stehen zu bleiben und ihr über den Rücken zu streichen und ihr zu sagen, dass sie hofften, es würde bald wieder besser gehen.
Karen tat alles, um diesen Begegnungen aus dem Weg zu gehen, sah auf die Uhr, sagte, sie habe noch einen Termin … Alles, damit der- oder diejenige einfach nur weiterging. Sie hasste diese falsche Anteilnahme, die Art, wie jedes Gespräch in Seufzern auslief.
David wartete geduldig neben ihr, während sie in der Schlange standen. Er ist wirklich das beste Kind der Welt, dachte Karen. Er war gutmütig und rücksichtsvoll, und es machte ihm nie etwas aus, irgendwo zu warten. Er blickte sich nur mit seinen großen braunen Augen um – deren Farbe und Form so genau zu ihren passten, dass alle immer ausriefen, er sei »seiner Mommy wie aus dem Gesicht geschnitten« – und machte sich seine eigenen kleinen Gedanken.
Später, wenn sie wieder allein waren, wenn sie ihm seinen Lunch gab oder sie zur Bank fuhren oder er hinter dem Haus im Sandkasten spielte, erzählte er ihr, worüber er nachgedacht hatte, und sie war jedes Mal von Neuem beeindruckt davon, wie tiefsinnig die Gedanken waren, die aus dem Mund ihres Vierjährigen kamen.
»Mr. Adamcek mag es, wenn alle sein Geld sehen«, hatte David einmal gesagt.
Karen, die gerade das Scheckbuch ausfüllte und sich bemühte, angesichts der schwindenden Summe auf ihrem Bankkonto nicht in Tränen auszubrechen, hatte aufgeblickt. David spielte auf dem Küchenfußboden mit Play-Doh. Um sich herum hatte er Zeitungspapier verteilt, damit der Boden nicht schmutzig wurde – seine Idee, nicht ihre. Er war so ein Kind.
»Wie kommst du denn darauf?«, fragte Karen.
»Er nimmt sich immer extra viel Zeit, um sein Wechselgeld einzustecken, und manchmal steht er einfach so an der Theke und hält seine Geldbörse offen, während er redet«, erklärte David, während er die rote Knetmasse in eine neue Form rollte.
Am Morgen war Karen auf dem Weg von der Bibliothek nach Hause kurz im Laden gewesen, weil sie keine Milch mehr hatten. Normalerweise kaufte sie dort keine Milch, weil sie immer zehn oder zwanzig Cent teurer war als im Lebensmittelgeschäft, aber der Lebensmittelladen lag nicht auf dem Weg, und sie hatte keine Lust gehabt, nur für die Milch extra dorthin zu fahren.
Es stimmte, Paul Adamcek hatte vor ihnen gestanden und drei Päckchen Marlboro gekauft, und jetzt, da sie daran zurückdachte, fiel ihr tatsächlich auf, dass er die ganze Zeit seine Geldbörse offen gehalten und es unmöglich gemacht hatte, das Bündel Zwanziger zu übersehen.
»Wenn er so weitermacht, wird er eines Tages noch ausgeraubt«, murmelte Karen.
»Er glaubt nicht, dass sich jemand das traut«, sagte David. »Mr. Adamcek hält sich für richtig stark.«
Karen fragte sich, wie David zu diesem Urteil kam. Es stimmte, dass Paul sich für einen echt harten Kerl hielt, aber sie konnte sich nicht vorstellen, was David gesehen haben könnte, das ihn zu diesem Schluss gebracht hatte.
Seine Vorschullehrerin hatte anfangs gedacht, es stimmte etwas mit David nicht, weil er oft so still war. Er spielte gern mit den anderen Kindern und kam mit allen gut aus, aber er sprach nicht viel. Viele Leute erlagen dem Irrtum, dass ein Kind, das nicht viel sprach, dumm war. David war nicht dumm. Er dachte nur nach, bevor er den Mund aufmachte, und verbrachte mehr Zeit damit, gut hinzusehen und gut zuzuhören, statt Lärm zu machen.
»Hallo, Karen«, sagte Frank, als sie endlich die Verkaufstheke erreichten. Er beugte sich ein wenig vor, um David anzusehen. »Und wie geht es uns heute, junger Mann?«
David winkte zu Frank hinauf, und Frank zwinkerte ihm zu.
»Was kann ich dir heute geben?«
Karen sah auf ihrer Einkaufsliste nach: »Halbes Pfund Pute, halbes Pfund American Cheese und ein viertel Pfund Roastbeef.«
Als Joe noch am Leben war, hatte sie drei Mal so viel von allem bestellt, weil Joe mittags zwei Sandwiches zum Lunch aß und es nicht mochte, wenn sie nur knauserig mit Fleisch belegt waren. Doch Joe war nicht mehr am Leben, und Lauren aß sowieso nichts von Frank’s, also brauchte sie nicht mehr so viel zu bestellen, weil niemand da war, der es essen würde. Sie konnten es sich nicht leisten, Essen wegzuwerfen.
Während sie wartete, warf sie einen Blick auf die fertig angerichteten Salate, die Frank in der Kühltruhe hatte. Es wäre so leicht, einfach noch etwas Kartoffelsalat mitzunehmen, aber es wäre definitiv günstiger, ihn schnell selbst zu machen, und sie hatte noch Kartoffeln in der Speisekammer.
Frank reichte Karen ihre Bestellung zusammen mit einem Tootsie-Pop-Lutscher für David. Er hatte immer Lutscher für seine »besonderen Gäste«, wie er sie nannte.
»Danke, Mr. Frank«, sagte David, als Karen ihm den Lutscher gab.
Karen lächelte Frank dankbar an.
»Was macht dein Mädchen denn so?«, fragte Frank. Hinter Karen wartete niemand.
Karen zuckte die Achseln. »Oh, du weißt schon. Eine Teenagerin.«
Frank hatte drei erwachsene Töchter, also wusste er es tatsächlich. »In ein paar Jahren wird sie wieder ein normaler Mensch sein. Halt einfach durch.«
»Da tue ich schon«, sagte Karen kläglich. »Gerade so.«
Frank lachte und winkte David. »Pass gut auf deine Mama auf, David, okay?«
Er nickte ernst. »Okeh, Mr. Frank. Das mache ich.«
Karen und David traten in die heiße Junisonne hinaus. »Ein Eis, das hört sich doch jetzt nach einer richtig guten Idee an, oder, Kumpel?«
David steckte seinen Lutscher sorgfältig in die Hosentasche, für später. »Wir haben noch kein Mittag gegessen.«
»Ich glaube, wir dürfen uns heute schon vor dem Lunch einen kleinen Nachtisch gönnen. Was meinst du?«
Er lächelte zu ihr hinauf. »Wie du meinst, Mommy.«
»Ich meine es«, sagte Karen und hängte sich die Tasche mit dem Lunch-Fleisch zusammen mit ihrer Handtasche über die Schulter. Sie würden sich beeilen müssen mit dem Eis, damit das Fleisch nicht schlecht wurde, bevor sie nach Hause kamen.
Sie waren gerade erst losgegangen, als David plötzlich wie angewurzelt mitten auf dem Bürgersteig stehen blieb.
»Was ist?«, fragte Karen.
David legte den Kopf ein wenig schief, erst zur einen Seite, dann zur anderen, als lauschte er auf etwas, das aus weiter Ferne kam.
»Mrs. Schneider«, sagte er. »Sie schreit.«
»Was?«, fragte Karen. Sie ging vor ihm in die Hocke, damit sie ihm direkt in die Augen sehen konnte. Er blickte durch sie hindurch. »David, was ist los?«
Sein Blick schien von weither zurückzukommen, dann sah er Karen direkt an.
»Hab ich doch gesagt«, erklärte er. »Es ist Mrs. Schneider. Sie hört gar nicht mehr auf zu schreien. Da ist so viel Blut.«
3
Mrs. Schneider hatte den Morgen damit verbracht, durch die Vorhänge zu lugen, um ihre neuen Nachbarn gegenüber zu beobachten. Sie wusste wirklich nicht, was noch aus der Welt werden sollte, wenn sich Mexikaner es jetzt schon erlauben konnten, in eine anständige Straße zu ziehen, wo anständige Leute wohnten, ohne auch nur um Erlaubnis fragen zu müssen. Sie spielten laute Musik auf Spanisch und riefen sich laut etwas auf Spanisch zu und schienen ständig irgendetwas Ausländisches zu kochen.
Wenn sie unbedingt komische Sachen essen und ausländisch sprechen wollen, warum bleiben sie dann nicht einfach in ihrem eigenen Land, statt hierherzukommen und anständigen Amerikanern die Jobs wegzunehmen?, dachte sie.
Sie wusste, dass die meisten der Erwachsenen in dem Haus da drüben am Fließband in der Chili-Fabrik arbeiteten, und das hielt sie nicht für richtig, auch wenn Mrs. Schneider niemanden kannte, der tatsächlich seinen Job wegen dieser Mexikaner verloren hatte, die sich hier überall breitmachten.
Es ging ums Prinzip, entschied sie. Was, wenn ein richtiger Amerikaner einen Job in der Chili-Fabrik wollte und ihn wegen der Mexikaner nicht bekommen konnte?
Und einer von denen arbeitete doch tatsächlich bei der Polizei! Sie hatte einen von den Männern, die da drüben wohnten – man konnte nun wirklich nicht von ihr verlangen, sich diese ganzen ausländischen Namen zu merken – dabei beobachtet, wie er jeden Morgen in einen Smiths-Hollow-Streifenwagen einstieg. Wie konnte so etwas überhaupt erlaubt sein?
Sie hatte auch Karen diMucci, die etwas weiter die Straße hinunter wohnte, dabei beobachtet, wie sie mit einer der Frauen gesprochen hatte, die im Haus gegenüber wohnten, und ihre Kinder spielten sogar zusammen. Mrs. Schneider hatte darüber nachgedacht, sie zu warnen, war dann jedoch zu dem Schluss gekommen, dass sie das besser nicht tun sollte. Karen könnte es ihr übelnehmen. Schließlich wusste man ja, dass Mexikaner und Italiener praktisch dasselbe waren, auch wenn Mrs. Schneider zugestehen musste, dass die italienische Küche besser war.
Sie war allerdings keine Rassistin. In Smiths Hollow gab es viele Schwarze, und Mrs. Schneider hatte kein Problem mit ihnen. Das waren alles anständige, saubere und schwer arbeitende Menschen – nun, abgesehen von Harry Jackson, den man jederzeit, Tag und Nacht, in der Arena-Bar finden konnte. Doch sogar dafür hatte sie Verständnis. Dass seine Frau Krebs bekommen und daran gestorben war, hatte ihn schwer getroffen, und daher musste man Verständnis für ihn haben. Er war seither einfach nicht mehr derselbe.
Sie blickte auf die Uhr und fand, dass es Zeit war, sich zum Deli zu begeben und etwas zum Dinner zu holen. Seit ihr Mann vor fünf Jahren an Herzversagen gestorben war, machte sich Mrs. Schneider nur noch selten die Mühe zu kochen. Sie hatte es nie sonderlich gemocht, hatte immer nur für ihn gekocht, weil er gern selbst gekochte Mahlzeiten aß. Sie aß sowieso meistens nur wie ein Vögelchen – ein halbes Sandwich oder eine Tasse Suppe.
Den ganzen Weg zu dem großen, glänzenden Supermarkt zu fahren, ergab in ihren Augen auch keinen Sinn, selbst wenn ihre Nachbarin Mrs. Walker immer sagte, der Supermarkt böte günstigere Preise. Abgesehen davon gefiel es Mrs. Schneider, bei Frank an der Verkaufstheke zu stehen und ein Schwätzchen mit ihm zu halten und sich »auf den neuesten Stand« bringen zu lassen, wie sie zu sagen pflegte.
Mrs. Schneider holte ihre Handtasche, kontrollierte zweimal, ob die Haustür auch abgeschlossen war (man kann gar nicht vorsichtig genug sein mit diesen ganzen Ausländern hier in der Nachbarschaft), ging durch die Küche zur Hintertür und trat hinaus auf die kleine Veranda auf der Rückseite des Hauses.
Als Erstes bemerkte sie die Fliegen – ein dicker schwarzer Schwarm, viel mehr Fliegen als an einem so heißen Tag wie heute da draußen sein dürften. Ihr erster Gedanke war, dass ein Waschbär oder ein Fuchs in ihrem Garten gestorben war, was bedeutete, dass sie im Rathaus anrufen musste, damit die Leute von der Animal Control ihn abholten. Wie so viele Gärten in Smiths Hollow grenzte auch ihrer direkt an den Wald, und es war nicht ungewöhnlich, dass sich ein Wildtier in ihren Garten verirrte.
Zu den Nachbarn hin hatte ihr Mann auf beiden Seiten hohe Sichtschutzzäune errichtet, damit »die uns nicht ausspionieren können« – Mr. Schneider hatte überaus viel Wert auf seine Privatsphäre gelegt und unter allen Umständen vermeiden wollen, dass seine Nachbarn ihn womöglich beim Grillen sahen und ihm ein Bier anboten, was ihn dazu nötigen würde, den Gefallen zu erwidern – und manchmal fanden die Tiere den Ausweg nicht mehr zwischen dem Haus, der Garage und den Zäunen, die das Grundstück begrenzten.
Dann drang der Geruch in ihre Verärgerung darüber, dass sie die Animal Control anrufen musste – es dauerte immer ewig, bis die endlich rauskamen, was sie angesichts der Größe von Smiths Hollow absurd fand –, und sie hielt sich erschreckt die Hand vor Mund und Nase. Der Geruch war schrecklich, grauenhaft, und einen Moment lang überlegte sie, ob vielleicht ein Reh da hinten verendet war.
Der Schwarm umsummte eine Stelle am Rand des Rasens, wo sich das Gelände zu einem kleinen Graben hin absenkte, der die Grenze zum Wald markierte. Von der Veranda aus konnte Mrs. Schneider nicht genau sehen, was die Fliegen so anzog, und sie seufzte.
Sie würde nachsehen müssen, aber sie hatte wirklich kein Verlangen danach, sich der Quelle dieses unerträglichen Gestanks zu nähern, was es auch sein mochte. Doch wenn sie sich nur mit einem unbestimmten »Ich glaube, in meinem Garten liegt ein totes Tier« bei Animal Control meldete, würde Christy Gallagher sie nur wieder belehren, dass sie das Team nur schicken konnte, wenn sie sicher wusste, worum es sich handelte.
»Was für ein Früchtchen«, dachte sie, eine Bezeichnung, die ihre Mutter schon für solch respektlose, naseweise Mädchen verwendet hatte.
Sie zog ein weißes Taschentuch aus ihrer Handtasche, gab einen kleinen Tropfen ihres Parfüms von Estée Lauder darauf und hielt sich dann den Baumwollstoff vor Mund und Nase.
Sie ertappte sich dabei, dass sie die Handtasche auf der Veranda abstellen wollte, besann sich dann aber eines Besseren. Schließlich konnte hinter ihrem Rücken jederzeit jemand durch das Gartentor hereinkommen und sich mit ihrem Scheckbuch und ihrer Geldbörse davonmachen. Die Gegend war nicht mehr das, was sie früher einmal gewesen war.
Die Handtasche fest unter den rechten Arm geklemmt, in der linken Hand das parfümierte Taschentuch, das sie sich vor Mund und Nase hielt, näherte sich Mrs. Schneider vorsichtig der summenden schwarzen Wolke aus Fliegen. Ihre Gedanken waren weiter vorausgeeilt – sie würde ihren kleinen Ausflug zu Frank’s verschieben und stattdessen darauf warten müssen, dass die von der Animal Control ihre Hintern in Bewegung setzten –, und so trat sie, ohne es zu merken, in das Blut.
Als sie etwas Klebriges am Schuh fühlte, hob sie den Fuß und erblickte die blutbedeckte Sohle. Erneut rümpfte sie vor Abscheu die Nase. Hatte dieses Tier denn ausgerechnet in ihrem Garten verbluten müssen? Die weißen Tennisschuhe waren ruiniert, sie würde sie wegwerfen müssen, obwohl sie noch wunderbar in Ordnung waren. Was für eine Verschwendung!
Während sie noch damit beschäftigt war, sich über die Blutspritzer auf dem weißen Stoff zu ärgern, kroch seitlich etwas anderes in ihr Blickfeld, das sie nicht erkannte. Oder besser gesagt, sie erkannte es sehr wohl, wollte aber nicht wahrhaben, dass es das war, wonach es aussah.
Mrs. Schneider holte erschreckt Luft und hob den Blick, und als sie sah, was da lag – was da überall verteilt lag –, ließ sie die Hand mit dem Taschentuch fallen und schrie und schrie und schrie.
4
Sofia Lopez klemmte den Bettbezug an die Wäscheleine und zog sie dann weiter, um das nächste Stück aufzuhängen. Es gab doch nichts Schöneres als an der Sonne getrocknete Bettwäsche. Mit dem Unterarm wischte sie sich den Schweiß von der Stirn. Bei der Hitze würde die gesamte Waschmaschinenladung in Nullkommanichts trocken werden.
»Mama?« Ihre ältere Tochter Valeria stand in der Fliegengittertür, die in die Küche führte. »Kann ich ein paar Marshmallows haben?«
Sofia blinzelte Val an. Das Mädchen war elf Jahre alt und besessen von chemischen Reaktionen, weshalb es reichlich Grund zu der Annahme gab, dass sie die Marshmallows nicht essen wollte. Eher würde das Endergebnis eine klebrige Masse auf dem Boden ihres Zimmers beinhalten oder eine Rauchwolke, die aus ihrem Fenster drang.
»Was hast du denn damit vor?«, fragte Sofia.
»Ähm«, sagte Val, während sie mit dem Zeh ein Muster auf den Boden malte. »Nur, ähm, ein Experiment.«
»Ein Experiment«, wiederholte Sofia trocken. »Mit Feuer?«
»Ähm«, sagte Val noch einmal.
Aus dem Inneren des Hauses hörte Sofia ihre andere Tochter Camila mit ihrem Cousin Daniel streiten. Sie waren beide acht Jahre alt und schienen immer und jederzeit ausgerechnet dasselbe haben zu wollen wie der andere.
»Geh mal rein und sieh nach, was dieses Mal das Problem ist«, sagte Sofia und wandte sich wieder ihrer Wäsche zu.
»Darf ich die Marshmallows …«, sagte Val.
»Wenn ich hier fertig bin, kannst du mir sagen, wozu du sie genau brauchst, und dann sage ich dir, ob du sie haben darfst«, sagte Sofia.
Mit einem Seufzen kehrte Val ins Haus zurück, um ihre Schwester und ihren Cousin voneinander zu trennen.
Sofia freute sich über Vals Interesse an Naturwissenschaften und hätte sie gern ermutigt, aber sie wollte sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass Val das Haus niederbrennen könnte. Gern hätte sie sie irgendwohin geschickt, wo sie ihre Experimente unter Aufsicht machen konnte, vorzugsweise von jemandem, der einen Abschluss in Chemie hatte, doch an so etwas war in Smiths Hollow nicht zu denken.
In Chicago vielleicht, aber sie waren nun einmal aus Chicago hierhergezogen, um sich ein besseres Leben aufzubauen, und das bedeutete immerhin, dass Valeria chemische Reaktionen draußen im Garten beobachten konnte statt in einer beengten Zweizimmerwohnung in der Stadt.
Im Gegensatz zu dem, was die alte Schrapnelle von gegenüber dachte, waren weder Sofia noch ihr Mann Alejandro noch Alejandros Bruder Eduardo noch seine Frau Beatriz in Mexiko geboren. Sie waren alle US-Bürger, hier geboren und aufgewachsen, und ihre Eltern waren legal eingewandert.
Aber das werde ich ihr nie auf die Nase binden. Soll sie doch über uns denken, was sie will.
Alejandro hatte zehn Jahre lang im Chicago Police Department gedient, während Sofia, Eduardo und Beatriz alle bei Nabisco gearbeitet hatten, in der Keksfabrik an der Southwest Side. Eduardo und Beatriz hatten mit Daniel im selben Mietshaus in Blue Island gewohnt, auf demselben Flur in jeweils gegenüberliegenden Wohnungen, und in verschiedenen Schichten gearbeitet, sodass sie abwechselnd auf ihre Kinder aufpassen konnten.
Doch sie hatten alle vier das Gefühl gehabt, in der Stadt nicht weiter voranzukommen, wo die steigenden Kosten es schwer machten, auch nur an den Erwerb eines Hauses zu denken. Sogar jetzt, zu siebt in diesem Haus in Smiths Hollow, hatten sie mehr Platz als jemals in Chicago. Allein, dass Camila und Valeria jede ein eigenes Zimmer hatten, war eine unendliche Erleichterung für Sofias Nerven gewesen, die es an den Rand des Wahnsinns getrieben hätte, wenn sie nur noch ein einziges Mal einen Streit zum Thema »ihre Sachen kommen auf meine Seite« hätte anhören müssen.
Die meisten Nachbarn waren ihnen freundlich und offen begegnet, sodass die Lopez-Familien schnell Anschluss gefunden hatten. Beatriz und Eduardo hatten besser bezahlte Jobs in der Chili-Fabrik bekommen, und Alejandro hatte problemlos in der winzigen Polizeieinheit des Orts einen Platz gefunden. Meistens schaffte er es sogar, zum Lunch nach Hause zu kommen, und zum Dinner war er immer pünktlich, weil es hier, wie er es ausdrückte, »wirklich nicht mal annähernd so was wie Verbrechen« gab. Die dunklen Ringe um seine Augen, die er in Chicago aufgrund der schier unendlich langen Schichten immer hatte, waren verschwunden. Und Sofia konnte mit allen Kindern zu Hause bleiben, weil ihr Einkommen nicht mehr unverzichtbar für die Familie war.
Allerdings gab es da auch die alte Schrapnelle von gegenüber, musste Sofia sich eingestehen, während sie das letzte Stück Wäsche aufhängte. Mrs. Schneider stand ständig hinter dem Vorhang und spähte zu ihnen herüber, als glaubte sie, Sofia könnte sie nicht sehen. Wann immer die alte Schrapnelle auf die Straße trat, um die Post aus dem Kasten zu holen, warf sie böse Blicke zum Haus der Lopez’, als rechnete sie damit, dass sie ihr den Sozialversicherungsscheck gestohlen hatten.
Als das Schreien anfing, dachte Sofia erst, dass Daniel wieder einmal Camila geschlagen hatte. Auch wenn man ihm immer wieder sagte, dass er seine Cousine nicht hauen sollte, gipfelten ihre Streitigkeiten regelmäßig darin, dass sie sich gegenseitig schubsten und schlugen, bis ein Erwachsener dazukam. Camila schlug durchaus zurück, war aber Profi darin, es aussehen zu lassen, als wäre Daniel der einzige Schuldige.
Ihre jüngere Tochter war eine geborene Schauspielerin, und schon das leiseste Anstoßen, eine minimale Schürfwunde oder ein leichter Klaps konnten wasserfallartige Tränenergüsse auslösen und melodramatische Anklagen, die besser in einen Joan-Crawford-Film gepasst hätten – oder in diesen Film über Joan Crawford, wie hieß der noch gleich? In diesem Film gab es eine Menge theatralischer Momente, und Camila schien ihre Stichworte vom selben Regisseur zu empfangen. Sofia ließ sich von diesen Vorstellungen nicht beeindrucken, aber ihrem Vater konnte Camila immer noch Sand in die Augen streuen, denn er kam niemals auf den Gedanken, seine kleine Prinzessin könne übertreiben.
Sofia machte einen Schritt auf die Fliegengittertür zu, dann blieb sie stehen. Das Schreien kam nicht aus dem Haus, sondern von draußen. Waren die Kinder vor dem Haus? Alejandro hatte den Rasensprenger dort stehen gelassen, damit die Kinder heute mit dem Wasser spielen konnten, aber Sofia hatte nicht mitbekommen, dass jemand den Hahn an der Seite des Hauses aufgedreht hätte.
Val kam mit großen Augen zur Tür hinaus, Camila und Daniel drängten sich hinter ihr. »Was ist das?«
»Ich dachte, ihr wäret das«, antwortete Sofia kopfschüttelnd.
Sobald sie es aussprach, wurde ihr klar, wie idiotisch das war. Das Geräusch ähnelte nicht im Mindesten dem, was sie normalerweise von ihren Kindern hörte, raue Ausbrüche von Gelächter oder ebenso raue Ausbrüche von Streitigkeiten. Dieses Schreien war lang gezogen und anhaltend, beinahe unmöglich in Länge und Breite. Wie konnte jemand so lange und ausdauernd schreien, ohne zwischendurch Luft zu holen?
»Bleibt hier«, sagte Sofia.
Camila versuchte sofort, sich an Val vorbeizudrängen, um ihrer Mutter zu folgen – Camila war zutiefst neugierig –, doch Val schlang die Arme um ihre Hüfte und hob sie hoch, bevor sie entkommen konnte.
»Hey!«, rief Camila und trat mit dem Absatz nach dem Schienbein ihrer Schwester.
»Au!«, brüllte Val und ließ Camila los.
Camila brach auf dem Boden zusammen und begann, unverzüglich zu heulen, als hätte sie sich den Knöchel gebrochen.
»Es reicht«, sagte Sofia mit einer ungeduldigen Handbewegung. Ihr Ton war so streng, dass Camila sofort verstummte und sie verblüfft ansah. »Ihr bleibt im Haus, während ich rübergehe und nachsehe, was da los ist, verstanden? Und ihr setzt nicht einen Zeh vor die Tür, wenn ihr nicht für den Rest des Sommers alle eure Sonderrechte verlieren wollt, ist das klar?«
»Ja, Mama«, sagte Val.
»Ja, Mama«, wiederholte Camila.
»Ja, Tante Sofia«, setzte Daniel hinzu.
»Ich bin gleich wieder zurück«, sagte sie. »Wenn ich länger als eine Viertelstunde weg bin, ruft ihr Papa auf der Arbeit an.«
Val warf einen Blick über die Schulter zur Uhr und begann den Countdown.
Sofia wusste, dass die Kinder gut aufgehoben waren – die kleinen würden in ein paar Minuten sowieso vergessen, wohin sie gegangen war, und ihre normalen Aktivitäten wieder aufnehmen.
Sie ging um das Haus herum und die Zufahrt hinunter. Die Lopez’ hatten keine Garage, nur eine befestigte Fahrspur, die neben dem Vorgarten entlang zum Haus führte und hinten auf einer Höhe mit der Veranda endete. Alejandro und Eduardo hatten bereits darüber gesprochen, zumindest einen Carport zu errichten, damit sich die Autos unter der Sommersonne nicht unerträglich aufheizten.
Als sie an ihrem Briefkasten am Straßenrand angekommen war, blieb Sofia stehen und versuchte, die Quelle der Schreie auszumachen. Keiner der anderen Nachbarn schien zu Hause zu sein – oder falls doch, so reagierten sie außergewöhnlich gleichgültig auf den ganzen Lärm. Sofia war die Einzige, die auf der Straße stand, mit Schweißtropfen auf der Stirn.
»Ob das die alte Schrapnelle ist?«, murmelte sie. Sie ging über die Straße. Es war so heiß, dass sich der Asphalt unter den Sohlen ihrer Turnschuhe klebrig anfühlte.
Bereits auf halbem Weg war sie sich sicher, dass es in der Tat Mrs. Schneider war. Was konnte die Frau so dermaßen außer Fassung gebracht haben? Sofia ärgerte sich, dass ausgerechnet sie jetzt einer Frau zu Hilfe kommen musste, die sie und ihre ganze Familie verabscheute. Ja, Jesus sagte, man solle seinen Peinigern vergeben, aber es fiel ihr doch schwer, dieser Frau christliche Nächstenliebe entgegenzubringen.
Nichtsdestotrotz würde Sofia Mrs. Schneider nicht in einer so offensichtlichen Notlage im Stich lassen, selbst wenn ein Teil von ihr genau das am liebsten tun würde. Sie war sich ziemlich sicher, dass die alte Schrapnelle nicht mal einen Tropfen Spucke für sie übrig hätte, wenn sie selbst in Flammen stünde.
Als sie auf Mrs. Schneiders Grundstück stand, war es unverkennbar, dass das Heulen aus dem Garten hinter dem Haus kam. Die Schreie hatten weder an Länge noch an Lautstärke eingebüßt, auch wenn Sofia den Eindruck hatte, dass die Stimme der alten Frau allmählich heiser wurde. Während sie das Törchen zum Garten öffnete, wuchs ihre Beunruhigung. Das hörte sich nicht nach einer Laune einer alten Frau an, der irgendetwas querging. Das war ernst.
Klappernd fiel das Törchen hinter Sofia zu. Als sie in den Garten kam, stand Mrs. Schneider hinten auf ihrem fein säuberlich gemähten Rasen, wo ein kleiner Abhang zum angrenzenden Wald abfiel. Die alte Frau stand stocksteif da, die Arme an den Seiten. Eine Handtasche lag zu ihren Füßen, und ein weißes Taschentuch flatterte schwach im Gras wie eine halbherzige Kapitulation.
»Mrs. Schneider?«, rief Sofia, während sie zu ihr ging.
Da hörte Mrs. Schneider endlich auf zu schreien, ganz plötzlich, als hätte ihr jemand den Strom abgedreht. Sie wirbelte herum, erblickte Sofia und zeigte dann mit einem steifen Arm ans Ende des Gartens.
»Sehen Sie!«, rief sie. »Sehen Sie nur, was Sie angerichtet haben. Das war hier mal eine anständige, friedliche Gegend, bevor Leute wie Sie hierhergezogen sind! Sehen Sie! Sehen Sie sich das nur an!«
Sofia spürte, wie ihr Zorn in die Stratosphäre hinaufschoss. Sie war schon immer leicht erregbar gewesen, ein Charakterzug, den sie an sich nicht mochte, weil er den Vorurteilen der Leute über die heißblütigen Latinas so entgegenkam. »Was reden Sie da, Sie alte …«, setzte Sofia an. Sie hatte »alte Hexe« sagen wollen, weil es genau das war, was Mrs. Schneider war, eine hasserfüllte alte Hexe, doch dann durchdrang der Geruch ihren Zorn, und sie stolperte rückwärts: »Was um Himmels willen?«
Sie bedeckte Mund und Nase mit einer Hand, doch das schien den Gestank nur noch näher zu bringen. Sie hustete, musste ein wenig würgen.
»Sehen Sie? SEHEN Sie das?«, rief Mrs. Schneider und schüttelte die Faust mit dem Furor eines evangelikalen Erweckungspredigers. »Das passiert, wenn Leute nicht wissen, wohin sie gehören! Ich wusste, dass Ihr Haus voller Diebe und Mörder ist.«
Doch Sofia hörte ihr nicht mehr zu, weil sie das Ding gesehen hatte, auf das Mrs. Schneider gezeigt hatte, das Ding, das sie mit seinem Gestank schockierte.
Blut. Da waren so viel Blut und noch andere Dinge, die kaum erkennbar waren, aber mit Sicherheit von einem Menschen stammten. Von zwei Menschen, wie es aussah.
»Ich muss sofort telefonieren«, sagte sie, und ihre Stimme klang in ihren Ohren, als käme sie von sehr weit weg. »Ich muss Alejandro anrufen. Wo steht Ihr Telefon?«
Ja, sie musste Alejandro anrufen, und er würde einen Streifenwagen und einen Krankenwagen mitbringen und wissen, was zu tun war.
Sofia drehte sich um, kehrte der verrückten alten Frau und ihrem anklagenden Zeigefinger den Rücken und ging auf die Veranda zu. Sie hatte das Gefühl, unter Wasser zu schwimmen, es fühlte sich an, als wäre die Treppe zur Veranda meilenweit entfernt.
»Wagen Sie es nicht, mein Haus zu besudeln!«, kreischte Mrs. Schneider. »Wehe, Sie setzen auch nur einen Ihrer dreckigen mexikanischen Füße auf die Veranda, die mein Mann mit seinen eigenen Händen gebaut hat!«
Sofia ignorierte sie. Sie musste dringend telefonieren, und das Telefon in Mrs. Schneiders Haus war das nächste. Abgesehen davon wollte sie nicht von zu Hause anrufen, denn die Kinder sollten nicht mithören. Sie würde erklären müssen, weshalb die Polizei unverzüglich herkommen musste.
Als sie die Sturmtür aufzog, stürmte Mrs. Schneider über den Rasen auf sie zu.
»Finger weg!«, rief die alte Frau. »Nehmen Sie sofort Ihre Finger da weg!«
Sofia ließ die Tür los und drehte sich zu Mrs. Schneider um, die inzwischen unten an der Treppe angekommen war und nach dem Saum von Sofias Shorts griff, als wollte sie sie von der Veranda herunterzerren.
Irgendwo unter dem Schock und dem Gefühl, sich unter Wasser zu befinden, brodelte immer noch Sofias Zorn. Sie war hierhergekommen, um dieser schreienden Frau zu helfen, und die alte Hexe machte sich Sorgen darum, dass sie ihr Haus »besudelte«.
Sie holte aus und versetzte der alten Frau eine Ohrfeige, so fest sie nur konnte. Das Klatschen schien in der Luft zwischen ihnen widerzuhallen wie ein seismisches Nachbeben.
»Ich rufe jetzt die Polizei«, sagte sie in einem Ton, den sie normalerweise den Kindern vorbehielt, und auch nur dann, wenn sie sich bereits auf dünnstmöglichem Eis befanden. »Ich werde dafür Ihr Telefon benutzen. Sie werden mich weder anschreien noch beschimpfen oder versuchen, mich in irgendeiner Form zu behindern, während ich das tue.«
Mrs. Schneider nickte, schlagartig ernüchtert. Ihr Blick fiel auf Sofias No-Name-Tennisschuhe.
»Das Telefon ist direkt hinter der Tür«, sagte sie. »Ich denke … ich warte einfach hier.«
Sie drehte sich um und ließ sich mühevoll auf einer Stufe der Holztreppe nieder. Mit einem Mal wirkte sie sehr alt, mindestens zehn Jahre älter als noch vor ein paar Minuten.
Als Sofia ins Haus ging, hörte sie, wie Mrs. Schneider anfing zu schluchzen.
Das Telefon hing an der Wand rechts hinter der Tür, genau wie angekündigt. Sofia nahm den Hörer ab und wählte Alejandros Durchwahl statt den Notruf 911. Sie wollte nicht erst mit einem Disponenten sprechen. Sie wollte mit ihrem Mann sprechen. Sie wollte, dass ihr Mann sofort zu ihr kam.
»Officer Lopez«, meldete er sich.
»Alejandro«, sagte Sofia und war überrascht zu hören, wie ihre Stimme brach. »Alejandro, du musst sofort kommen. Da liegen Mädchen.«
»Sof?«, fragte er. »Was ist denn los? Ist etwas mit Val oder Camila?«
»Nein«, sagte sie und holte tief Luft. »Es sind nicht unsere Mädchen. Es sind die Mädchen von jemand anderem. Zwei sind es, und jemand hat ihre Körperteile überall auf Mrs. Schneiders Rasen verteilt.«
5
Lauren sah ihre Mutter und ihren Bruder aus Frank’s Deli kommen und zum Sweet Shoppe gehen. Mit leicht gerümpfter Nase wandte sie den Kopf ab, auch wenn ihre Mutter sie durch das Fenster hindurch in der schummerigen Spielhalle wohl kaum sehen konnte.
Sie stand neben Miranda, die sehr dicht neben Tad stand, dem fetthaarigen (und auch im Gesicht fettglänzenden, dachte Lauren) Objekt ihrer Zuneigung, der nicht im Geringsten auch nur an Matt Dillon erinnerte.
Gegenüber von Tad stand sein Freund Billy, der ebenfalls ganz und gar nicht wie Matt Dillon aussah und sich ungefähr genauso viel für Lauren zu interessieren schien wie sie sich für ihn – überhaupt nicht.
Tad spielte begeistert seine letzte Runde Karate Champ, und sie alle sollten sich genauso dafür begeistern wie er. Lauren verstand nicht, wieso sie nicht zumindest selbst spielen durften, wo sie nun einmal in der Spielhalle waren, aber Tad wollte sich gern bejubeln lassen.
Billy brach jedes Mal in Begeisterungsschreie aus und klatschte, wenn Tad einen guten Schlag gegen seinen Gegner platzierte, und verstand das offensichtlich als seinen Auftrag. Vielleicht war das eine Voraussetzung dafür, um in Tads Camaro mitfahren zu dürfen: dass man seine Geschicklichkeit am Joystick bejubelte. Miranda hatte vielsagend auf das Fahrzeug gezeigt, als sie in die Spielhalle gegangen waren, aber Lauren war nur aufgefallen, dass Tad sich nicht die Mühe gemacht hatte, es zwischen die diagonalen Parkplatzmarkierungen zu stellen.
Sie glaubte nicht, dass Miranda sich für den Ausgang des letzten Matches interessierte. Allerdings schien ihre Freundin es zu genießen, mit ihren Brüsten an Tads Arm entlangzustreichen, und Tad sagte nichts dagegen, also musste er es wohl auch genießen.
Und wenn ich jetzt einfach gehe, ohne was zu sagen?, überlegte Lauren. Würde Miranda es überhaupt sofort merken, oder erst, wenn sie Lauren auf die Toilette zerren wollte, um ihren Lipgloss zu erneuern und über Tad zu reden?
Sie war schon so gut wie entschlossen – einfach wegzugehen, ohne Miranda etwas zu sagen –, als das Heulen einer Krankenwagensirene alle dazu brachte, sich den Hals um die Videomonitore herum zu verdrehen und zum Fenster hinauszusehen. Der Krankenwagen raste die Hauptstraße hinunter, an sich schon ein bemerkenswertes Ereignis in einer Kleinstadt, in der es nicht viele Notfälle gab, aber dass ihm außerdem beide Streifenwagen des Smiths Hollows Police Departement folgten, setzte dem Ganzen die Krone auf.
»Wow, was da wohl passiert ist?«, fragte Billy.
»Wir sollten der Polizei hinterherfahren«, schlug Tad vor und sah aus, als würde er dafür sein Spiel Spiel sein lassen und nach draußen rennen, um ins Auto zu springen.
Wenn das passierte, würde Miranda mit dabei sein, das wusste Lauren und beschloss sofort, nicht mitzukommen. Sie würde sich nicht in Tads Auto setzen, nur um am Ende irgendwo zu landen, wo sie ehrlicherweise gar nicht sein wollte, wie zum Beispiel in der Mall in der Nachbarstadt oder auf der Knutschwiese. So wie Miranda sich an Tad rieb, war die Knutschwiese ziemlich wahrscheinlich, und Lauren hatte vor zu entkommen, bevor irgendjemand von ihr erwartete, Billy zu küssen.
»Die sind doch längst weg, Mann«, sagte Billy. »Die holen wir nie ein.«
»Mit dem Camaro schon«, gab Tad angriffslustig zurück, als hätte Billy irgendwie die Männlichkeit seines Autos infrage gestellt.
»Klar«, sagte Billy. »Aber wenn du die Cops in der Geschwindigkeit verfolgst, kriegst du mit Sicherheit ein Ticket.«
Tads Schultern entspannten sich. »Yeah. Und wenn ich noch ein Ticket kriege, nimmt meine Monster-Mutter mir die Autoschlüssel ab, hat sie zumindest gesagt.«
»Monster-Mutter«, trällerte Miranda. »Der war gut!«
»Sie nervt mich ständig«, sagte Tad und verstellte seine Stimme, sodass sie schrill klang: »›Räum dein Zimmer auf, geh zum Friseur, sieh zu, dass du mehr arbeitest.‹ Es ist Sommer, Mann! Kann sie nicht mal für fünf Sekunden locker bleiben?«
»Yeah«, sagte Miranda. »Du arbeitest schon ganz schön viel bei Wagon Wheel.«
»So viel nun auch wieder nicht«, gab Tad zu und warf noch einen Quarter in den Automaten. »Ich denk drüber nach, mich irgendwo in der Mall zu bewerben.«
Lauren merkte, dass sie Kopfschmerzen bekam. Sie brauten sich hinter ihren Augen zusammen, und schon bald würde sie dort hinter ihren Augäpfeln auf sie einhämmern, bis ihr schlecht und schwindelig wurde. Schon als Kind hatte sie hin und wieder Migräne bekommen, aber in letzter Zeit kamen die Anfälle häufiger. Wenn sie nicht bald nach Hause ging, würde sie sich nicht mal mehr auf ihrem Fahrrad halten können.
Sie setzte an, um etwas zu Miranda zu sagen, die inzwischen tief in die Diskussion über Tads künftige Aussichten auf dem Arbeitsmarkt involviert war.
»Was denn?«, fragte Miranda mit einem genervten Blick Richtung Lauren.
Lauren zeigte mit dem Daumen zum Tresen, wo ein paar gelangweilte Teenager Popcorn, Getränke und Süßigkeiten verkauften. »Ich hole mir ’ne Cola. Willst du auch eine?«