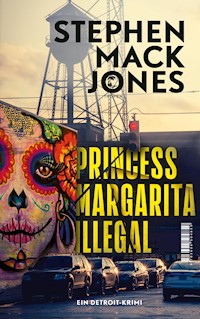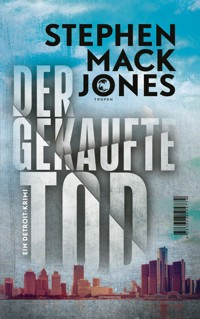
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Stephen Mack Jones haucht Detroit neues Leben ein.« The Boston Globe Mexicantown, Detroit. August Snow kehrt mit zwölf Millionen Dollar Schadenersatz zurück in das Viertel seiner Kindheit. Genug Geld für den Ex-Polizisten, um seinen alten Humor wiederzufinden und ein neues Leben zu beginnen. Doch er hat die Rechnung ohne seine Feinde gemacht: Kurz nach seiner Rückkehr wird eine der mächtigsten Unternehmerinnen der Stadt tot aufgefunden. Snow setzt sich auf die Fährte des Mörders – und gerät in einen gefährlichen Strudel, der ihn in Detroits dunkelste Winkel hinabzieht. Die zwölf Millionen stammen aus einem Prozess gegen den korrupten Polizeiapparat der Stadt. Mit dem Geld will Snow, Sohn eines afroamerikanischen Polizisten und einer mexikanisch-amerikanischen Malerin, den Stadtteil seiner Kindheit wieder aufbauen. Da bittet ihn die Großunternehmerin Eleanore Padget, verdächtige Vorkommnisse in ihrer Bank aufzuklären. Snow lehnt ab. Kurz darauf wird die Frau tot aufgefunden. Selbstmord, lautet die Diagnose der Polizei. Snow hat Zweifel und begibt sich auf die Suche nach dem Mörder. Ein packender Thriller inmitten der rauen, multikulturellen Realität Detroits.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stephen Mack Jones
Der gekaufte Tod
Ein Detroit-Krimi
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Tropen
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »August Snow« im Verlag Soho Press, New York
© 2017 by Stephen Mack Jones
Für die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
Fotokomposing: FinePic®, München
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50477-4
E-Book: ISBN 978-3-608-12079-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Für meine Familie:die vergangene, gegenwärtige & zukünftige
1
Das schmale Haus im Kolonialstil hat zwei Geschosse, drei Zimmer, zweieinhalb Bäder, Parkettboden und eine kleine Küche. Der Blickfang im Wohnzimmer ist ein gemauerter Kamin, umrahmt von Bücherregalen. Früher standen in diesen Regalen Bände von Federico García Lorca, Pablo Neruda, Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz und Pita Amor. Meine Mutter, Isabella Marie Santiago-Snow, las mir gern aus ihren Lieblingsgedichten vor, und ihre ruhige Stimme floss dahin wie warmer Honig aus Juárez.
In unserem Haus mussten sich diese Dichterinnen und Dichter ihren Platz im Regal natürlich mit klassischen Kriminalromanen teilen, und die standen Schulter an Hardcover-Schulter mit dem unendlich Langweiligen und mitunter Grotesken: dicke Wälzer über Polizeiarbeit und Strafrecht, Beweiserhebung und Forensik samt Obduktionsfotos von Menschen in verschiedenen Stadien der Sezierung und Verwesung. Wir hatten Kriminalromane von Dashiell Hammett, Arthur Conan Doyle und Raymond Chandler sowie signierte Erstausgaben von Rudolph Fisher und Chester Himes. Und wir besaßen die Programmhefte von fünf August-Wilson-Stücken, die wir – meine Eltern und ich – im Fisher Theatre im Zentrum von Detroit gesehen hatten.
Nach dem Tod meiner Mutter vor nunmehr fünf Jahren ging das bescheidene Backsteinhaus im Viertel Mexicantown, das ursprünglich einmal »La Bagley« genannt wurde, in meinen Besitz über.
»Es ist nicht mehr das, was es mal war«, hatte sie über Mexicantown gesagt. Ein reichverziertes Kruzifix, das sie mit ins Krankenhaus genommen hatte, hing über dem Bett, während klare Flüssigkeiten in ihren langsam schwindenden Körper tropften. »Keiner hat Arbeit. Leute werden aus Häusern vertrieben, in denen sie jahrelang gewohnt haben. Diebe werden immer dreister. Lastwagen donnern durch Straßen, auf denen Kinder spielen. Verkauf das Haus, Octavio. Nimm das Geld. Zieh woanders hin. Vergiss Mexicantown.«
Ich log und sagte, das würde ich machen. Dann beteten wir den Rosenkranz.
Weder die Zeit noch die Politik sind freundlich mit Detroit umgegangen. In Mexicantown waren sie sogar regelrecht brutal.
In den 1940er Jahren kamen die Mexikaner aus dem gleichen Grund nach Detroit, aus dem Schwarze zehn Jahre zuvor den Süden verlassen hatten: gutbezahlte, feste Arbeit in den Autofabriken. Die einzige Farbe, die Henry Ford sah, war das Grün der Dollarscheine. Ihm war egal, ob du Latino, Araber oder Schwarzer warst, Hauptsache, du konntest eine Schraube festziehen oder eine Karosserie auf ein Chassis montieren. Schraube festziehen, Karosserie montieren, Lohn kassieren.
Als sich herumsprach, dass Arbeit bei Ford und General Motors einen guten, sicheren Job und gutes, sicheres Geld bedeuteten, kamen noch mehr Mexikaner nach Detroit.
Entgegen der landläufigen Meinung begann Detroits »weiße Flucht« nicht in den 60ern. Gringos sind schon immer aus den konzentrischen Kreisen von Detroit »geflohen«. Und zwar, um praktisch allen aus dem Weg zu gehen. Den Deutschen. Den Italienern. Den Iren. Griechen. Schweden. Finnen. Schwarzen. Mexikanern. Vietnamesen. Mittlerweile auch dem Zustrom von Chaldäern und Muslimen aus dem Nahen Osten.
Wir alle haben unsere wütenden und beängstigenden Gespenster in dieser verrückten amerikanischen Maschine.
In Mexicantown wurden Häuser, die sich zuvor nur Ärzte und skrupellose Geschäftemacher leisten konnten, schon bald zum Spottpreis von Mexikanern gekauft, die nach etwas strebten, das einst ausschließlich Weißen vorbehalten war: dem amerikanischen Traum.
Aus Liebe zu meiner mexikanischen Mutter kaufte mein afroamerikanischer Vater 1978 das zweigeschossige Häuschen im Kolonialstil. Meine Mutter sollte ihre Familie, ihre Freunde, ihre Kultur in der Nähe haben. Er selbst war eine Anomalie: ein Schwarzer, der in einem mexikanischen Viertel lebte. Doch dank nicht unerheblicher Bemühungen seitens meiner Mutter und aufgrund meiner Geburt wurde er schließlich akzeptiert. Auf samstäglichen Gartenpartys prostete man ihm mit Tequila zu, und sonntags betete man für ihn in der spanischsprachigen Messe in der Holy Redeemer Church.
Es schadete auch nicht, dass mein Vater ein Detroiter Cop war.
Ich habe mit einem Teil meines Entschädigungsgeldes dieses Haus wieder zum Leben erweckt und sogar noch sieben andere Häuser auf der Markham Street gekauft und renovieren lassen. Das einzige Haus, das ich abreißen ließ, war eines nördlich von mir, das mal ein Schmuckkästchen gewesen war, aber nach zwei Jahrzehnten mit kaputten Crack- und Meth-Pfeifen, Heroinspritzen, menschlichen und tierischen Fäkalien und versuchten Brandstiftungen in der »Devil’s Night«, wie die Nacht vor Halloween genannt wird, einfach nicht mehr zu retten war.
Ein Garten auf diesem leeren Grundstück wäre schön.
Paprika, Grün- und Weißkohl, Salat und Tomaten.
Was ist ein Schwarzmexikaner ohne Garten?
Besonders, wenn du nicht in den frühen oder späten Abendstunden mit einer Flasche NegraModeloBier oder einem gekühlten Glas Cabresto Tequila in der Hand voller Stolz auf deine harte Arbeit blicken kannst.
Während ich fort war, am Mittelmeer und in Skandinavien abgetaucht auf den Boden zahlreicher Schnapsflaschen, dachte die Stadt offenbar, es wäre eine gute Idee, die demolierten Straßenlampen durch acht neue solarbetriebene LED-Straßenlampen zu ersetzen. Eine weitgehend wirkungslose Maßnahme, um Straftaten auf einer nahezu verlassenen Straße in Mexicantown zu verhindern.
Ich hatte versucht, nach dem Prozess und dem Geldsegen mein Leben weiterzuführen. Als Normalbürger zu leben. Doch ich konnte nicht ganz vergessen, dass ich in einem Job, den ich geliebt hatte, gescheitert war. Ein Judas für die Apostel in Blau geworden war. Die Blicke, die mich in Supermärkten und Restaurants verfolgten, die gnadenlose Ablehnung. Man sah mich an, als wäre da jemand dicht hinter mir – eine verschwommene und beunruhigende Gestalt.
Alle lieben den Helden.
Keiner liebt den Verräter.
In Oslo hatte ich eine Frau kennengelernt, die mir half, meinen Alkoholkonsum zu mäßigen. Eine schöne junge Frau mit weicher brauner Haut, einem Lächeln wie ein Sonnenaufgang und bernsteinfarbenen Augen. Sie hieß Tatina und war halb Somalierin, halb Deutsche, eine Geflüchtete aus dem schon Jahre andauernden Bürgerkrieg in Somalia. Sie hatte Gräuel gesehen, die mein Vorstellungsvermögen bei weitem überstiegen. Doch irgendwie hatte ihre Seele überlebt, und sie nahm Licht auf und strahlte Wärme aus. Unter dem eisblauen norwegischen Himmel hielt ich sie drei Monate lang in den Armen, liebte sie, spürte meinen Körper schwerelos werden, wenn sie lachte. Ihr Atem auf meiner Brust fühlte sich an, als wäre ich genau dort, wo ich sein musste.
Es fühlte sich an wie zu Hause.
Da ich aus Detroit stamme, habe ich dem Glück natürlich nie so recht getraut.
Also kehrte ich in eine Stadt zurück, wo Glück sich meist darauf beschränkt, eine gewisse Zufriedenheit in einem hinnehmbaren Maß an diffuser Angst, unspezifischer Abscheu und unerklärlichem Überdruss zu finden.
Es war Anfang Herbst, als ich unversehens wieder in Mexicantown vor meinem Haus auf der kleinen West Markham Street mit ihren gerade mal zwölf Häusern stand. Direkt vor der Eingangstür lag ein Päckchen. Bevor ich die Stufen hinaufging, blieb ich stehen und schaute mich um. Eine wohlgenährte buntgefleckte Katze verharrte mitten auf der Straße und sah mich aus zusammengekniffenen Augen an, als wollte sie sagen: »Was glotzt du so blöd?«, ehe sie weiterschlich.
Ich stieg die Stufen hinauf und ging vor dem Päckchen in die Hocke. Es hatte die Größe und Form eines Schuhkartons und war säuberlich in Packpapier eingeschlagen. Ich war zwar ein Jahr weg gewesen, aber nach meiner Zeugenaussage gegen den ehemaligen Bürgermeister und etliche Detroiter Cops – jetzt entlassen oder im Gefängnis –, die ihm bei seinen diversen kriminellen Machenschaften behilflich gewesen waren, hatten sich die Gemüter noch immer nicht ganz beruhigt. Ein in Packpapier eingeschlagener Schuhkarton konnte durchaus ein Willkommensgeschenk von jemandem enthalten, der wütend war, dass ich Karrieren zerstört und mich mit einem dicken Batzen Geld von einer bankrotten Stadt aus dem Staub gemacht hatte.
Nachdem ich das Päckchen eine Weile beäugt hatte, hob ich es vorsichtig an.
Zu leicht für eine Bombe. Kein verräterischer Geruch. Ich riss das Papier ab – ein ausrangierter Schuhkarton von einem Paar Nike Air Max 90, Herrengröße 43 – und suchte nach Drähten. Nichts. Vielleicht lag eine simple Warnung drin: ein Zeitungsartikel über den Prozess mit einem rot durchgestrichenen Foto von mir. Eine dümmliche Warnung, dass ich bis Sonnenuntergang aus der Stadt verschwunden sein sollte. Eine tote Ratte als geschmackloses Symbol für einen Verräter.
Ich lüftete den Deckel.
Darin lag eine leere Skittles-Verpackung.
Ich lachte.
Immerhin freute sich einer, dass ich wieder da war.
2
Allmählich kann man als Kathole in Detroit nicht mehr beten.
Zur großen Freude der Lutheraner, Baptisten, der wohlhabenden Katholiken von Oakland County und der Atheisten hat das Erzbistum Detroit im letzten Jahr an die sechzig katholische Kirchen entweder geschlossen oder zusammengelegt, sodass die schwarzen, hispanischen, alten und armen Katholiken der Stadt sich von einer Kirche verlassen fühlen, in der sie jahrelang gebetet und ihr Scherflein gespendet haben. Jetzt fühlen sich die Leute, die während Detroits unaufhaltsamem Abgleiten in die Insolvenz am meisten gelitten haben, noch mehr ins Abseits gedrängt, und sie sind noch verängstigter.
Ebenfalls von Schließung bedroht waren die Old St. Anne, eine prächtige, vor über dreihundert Jahren erbaute katholische Kathedrale, und die Kirche St. Aloysius auf dem Washington Boulevard mit ihren rosa Marmorsäulen und der halbrunden Empore, die den Blick auf den unteren Altar und die Sitzbänke eröffnet.
Heute ging ich zur St. Al – erstens, weil ich es gut finde, dass die Franziskanerbrüder sich um Obdachlose und alte Menschen kümmern, und zweitens, weil sie sich durch nichts davon abbringen lassen, jeden Nachmittag die Messe zu feiern, ganz egal, ob sich ein einziges oder einhundert Schäfchen blicken lassen. Im Zuge der jüngsten Wiederbelebung des Zentrums machten immer mehr junge weiße Vorstadtkatholiken in Outfits von Donna Karan und Pierre Cardin während ihrer Mittagspause einen kurzen Abstecher in die Kirche, um sich hinzuknien, den Kopf zu senken und die Kommunion zu empfangen. Nicht genug frisches Blut, um St. Al vor der Schließungswelle zu retten. Aber genug für die Diözese, ein paar Dollar einzusacken.
Am Ende der Messe fasste Father Grabowski mich am Ellbogen und zog mich in eine Nische.
»Freut mich, dass du wieder da bist, August«, sagte er, und ein Lächeln bildete sich irgendwo in seinem struppigen weißen Vollbart. Grabowski kannte meine Familie seit Jahren und war einer der wenigen Priester, denen mein Vater tatsächlich vertraut hatte. »Aber du weißt ja, dass du dir den Himmel nicht erkaufen kannst, oder?«
Ich vermutete, dass er auf die zwei Riesen anspielte, die ich in den Kollektenkorb gelegt hatte, woraufhin Mr Lokat, ein älterer schwarzer Laienbruder, fast einen Herzinfarkt bekam.
»Sie brauchen das Geld mehr als ich, Padre«, sagte ich.
Grabowski nickte heftig und erwiderte: »Oh, ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht annehme. Im Gegenteil, wenn du noch etwas Kleingeld übrig hast, nehme ich das auch. Ich habe bloß gesagt, du kannst dir den Himmel nicht erkaufen.«
Ich erzählte Father Grabowski, dass ich gerade die Gräber meiner Eltern besucht hatte. Big Jake, der Friedhofswärter, ein grauhaariger schwarzer Bär von einem Mann, hatte mich dabei erwischt, wie ich für Mom eine Tüte Cashewnüsse hinlegte, ihren Lieblingssnack, und für Dad ein Schlückchen einundzwanzig Jahre alten Auchentoshan Single Malt Scotch in das Gras auf seinem Grab goss.
Der alte Priester nickte. »Ich schließe sie immer in meine Abendgebete mit ein, August.«
Ich sagte: »Für das, was ich vorhin in den Kollektenkorb gelegt habe, müssten Sie sie eigentlich auch noch in Ihre Morgen- und Nachmittagsgebete einschließen, Padre.«
»›Nochmals sage ich euch: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.‹«
»Guter Spruch«, sagte ich scherzhaft. »Den sollten Sie sich aufschreiben.«
»Matthäus 19,24«, sagte Father Grabowski mit einem breiten, gelbzahnigen Grinsen. »Noch ein Grund, warum du bei Jeopardy keine Chance hättest, du Trottel.«
Wie die meisten Nonnen und Priester, die ich kannte, träumte auch Father Grabowski davon, an der Himmelspforte vom Moderator der Quizshow, Alex Trebeck, begrüßt zu werden.
Ich fischte einen Zehndollarschein aus der Tasche und drückte ihn Father Grabowski in die Hand. »Mehr hab ich nicht. Gönnen Sie sich davon eine Rasur, alter Mann.«
Anders als die etwa zwanzig Gläubigen, die an diesem Donnerstag aus der Nachmittagsmesse kamen, stellte ich fest, dass draußen ein Wagen auf mich wartete. Zu dem Wagen – einem neuen, blitzsauberen dunkelblauen Ford Taurus mit getönten Scheiben – gehörte ein schwarzer Fahrer, der ebenfalls blitzsauber aussah.
»Ich hab für dich gebetet«, sagte ich zu dem großen, schlanken und gutgekleideten Fahrer, der lässig an der Motorhaube lehnte. Sein teures Eau de Cologne hing in der frühherbstlichen Luft. Es hatte eine aufdringliche Note, die in der Nase kitzelte und in den Augen brannte. Jedes Eau de Cologne riecht ordinär, wenn man darin badet.
»Ach ja?«, sagte der Fahrer, während er mich von Kopf bis Fuß durch seine Ray-Ban-Sonnenbrille musterte. »Hat wohl nichts gebracht. Ich bin noch am Leben.« Das Filmstargrinsen in Detective Leo Cowlings scharf geschnittenem abessinischem Gesicht wich einer geübt finsteren Miene. Cowling übte diese Miene schon seit über zwölf Jahren, seit wir zusammen auf der Polizeischule waren. Sie benötigte noch immer Übung. »Wie ich sehe, hast du das ganze Geld der Steuerzahler für feinen Zwirn ausgegeben.«
Ich trug ein Paar leicht abgewetzte Bjorn-Halbschuhe, eine schöne alte schwarze Buffalo-Jeans, ein graues Nike-Sweatshirt und eine braune Motorradlederjacke, die mal meinem Vater gehört hatte.
Nicht gerade Haute Couture, aber verdammt bequem.
Ich trug außerdem eine schicke Glock 9-Millimeter-Halbautomatik, die ich hinten in den Gürtel gesteckt hatte. Meine Mutter wäre entsetzt gewesen, dass ich eine Pistole mit in die Kirche gebracht hatte. Mein Vater dagegen hätte das an jedem Wochentag in der Stadt und am Sonntag erst recht für erforderlich gehalten.
In dem Jahr, in dem ich weit weg von Detroit gewesen war, hatte ich es nie für nötig gehalten, eine Schusswaffe bei mir zu haben, abgesehen von zwei sehr interessanten Wochen im Nordosten von Indien. Zurück in Detroit traten alte Gewohnheiten rasch wieder zutage. Meine Glock war eines von etlichen Dingen, die ich widerwillig aus dem Lagerraum holte, in dem ich mein Leben verstaut hatte, bevor ich das Land mit dem Vorsatz verließ, an einer Kombination aus Selbstmitleid und Leberzirrhose zu sterben.
»Danbury will dich sehen«, sagte Cowling. »Steig ein.«
»Was will Danbury?«
»Woher zur Hölle soll ich das wissen?« Cowlings Augenbrauen zogen sich über der Sonnenbrille zusammen, und er machte ein paar aggressive Schritte auf mich zu. »Steig in den Wagen, Tex-Mex.«
Cowling war etwa zwei, drei Zentimeter größer als ich und gut in Form. Ich hatte ihn im Fitnessraum des 14. Bezirks gesehen. Er war schnell und kam richtig gut mit der Boxbirne klar. Am Sandsack jedoch war er eine Niete, weil seine Fäuste im Handgelenk wegknickten.
Ein kräftiger Schlag auf den Solarplexus, ein rechter Haken unters Kinn, und Cowling würde auf dem Hintern landen und Disney-Vögelchen um sich rumflattern sehen. Aber es wäre eine Schande gewesen, ihn wenige Meter von einem Gotteshaus entfernt niederzustrecken.
»Weißt du was«, sagte ich und blinzelte hinauf in den diamantblauen frühherbstlichen Himmel, »heute ist so ein schöner Tag. Ich glaub, ich geh zu Fuß.«
»Zwing mich nicht –«
»Wozu?«, sagte ich und schloss mit zwei Schritten die Lücke zwischen uns. Ich war bereits mit Adrenalin vollgepumpt. Jetzt kam es – wie immer – darauf an, zu wissen, wann der Motor angeworfen und Gas gegeben werden musste. Nach ein paar Sekunden harter Blicke lächelte ich Cowling an, drehte mich um und spazierte los, den Washington Boulevard hoch Richtung Campus Martius.
Wie geht noch mal dieses alte Sprichwort, dass man nie wieder heimkehren kann?
3
Lieutenant Leo Cowling war charmant und gut aussehend im Sinne eines Straßenschläger-Hip-Hoppers. Er war geschickt und berechnend, wenn es darum ging, herauszufinden, wer in den lokalen Medien besonders nützlich für das Detroit Police Department war. Und für seine Karriere. Ansonsten war es bedauerlich, dass er eine Dienstmarke besaß. Der Leitsatz der Polizei »Zu dienen und zu schützen« lautete bei ihm: »Mir zu dienen und zu schützen, was ich habe«.
Cowling war einem Mann unterstellt, der das genaue Gegenteil von ihm war. Captain Ray Danbury beförderte Cowling kurz nachdem sich der Staub um meinen Gerichtsprozess gelegt hatte und die Luft wieder rein war – soweit diese Luft überhaupt rein sein kann. Danbury war clever und politisch geschickt. Er wusste, dass Cowling die Beförderung nicht verdient hatte. Cowling steckte mindestens einen kleinen Finger tief im korrupten inneren Zirkel der Polizei unter dem früheren Bürgermeister. Kleinere Bestechungen, sanfte Erpressung und die Beschaffung von Edelnutten für ein paar Politiker und Wirtschaftsbosse auf den Privatpartys in der Manoogian Mansion, der Residenz des Bürgermeisters. Wegen meiner Ermittlungen gegen den Bürgermeister und seine Mischpoke wurde ich degradiert, dann kurzerhand gefeuert. Als die Sache richtig fies wurde, reichte ich Klage wegen ungerechtfertigter Entlassung ein. Eigentlich wollte ich das nicht, aber wie mein Vater zu sagen pflegte: »Der einzige Boden, den ein Mann jemals wirklich besitzt, ist der halbe Quadratmeter, auf dem er steht – und Gott steh ihm bei, wenn man ihm den nimmt.«
Meine Klage erregte die Aufmerksamkeit des Staatsanwalts und des Oberstaatsanwalts – beide profitierten mindestens peripher von Cowlings Fähigkeit, Nutten zu besorgen. Nachdem ich meinen Prozess gewonnen und zwölf Millionen Dollar eingesackt hatte, fand Danbury, Polizei und Rathaus hätten genug gelitten. Cowling auf die lange Liste der Cops und Verwaltungsmitarbeiter zu setzen, die entlassen worden waren oder im Knast saßen, hätte das Leiden der Stadt nur verlängert und womöglich einen totalen und katastrophalen Zusammenbruch des Departments bedeutet. Niemand wollte, dass die bundesstaatliche Polizei sich einmischte. Und erst recht niemand wollte, dass die Detroiter Außenstelle des FBI weiterhin verbissen im jahrealten Müll der Stadt wühlte.
Lieber die kleinen Dämonen, die du kontrollieren kannst, als die großen Teufel, die du nicht kontrollieren kannst.
Danbury beförderte Cowling, um ihn an die kurze Leine zu nehmen.
Der Spaziergang über den Washington Boulevard weckte eine alte Leidenschaft für ein frisch zubereitetes Putenbrust-Reuben-Sandwich mit getoastetem Roggenbrot in mir. Ohne zu zögern, beschloss ich, diesem drängenden Verlangen frohen Herzens nachzugehen.
Schmear’s Deli hatte in den fünfzig Jahren seines Bestehens hart gekämpft, knapp überlebt und florierte jetzt auf der Woodward Avenue in der Nähe des Kreisverkehrs am One Campus Martius. Sobald das alte Kaufhaus Kern abgerissen und durch das moderne glänzende Glas-und-Stahl-Schmuckstück One Campus Martius ersetzt worden war, erlebten die Geschäfte entlang der Woodward Avenue eine Neubelebung, die sich nur wenige für Detroit hatten vorstellen können und noch weniger für möglich gehalten hätten.
Klar, es gibt noch immer Leute, die sich gern an das Kaufhaus Hudson erinnern, Kerns größeren Konkurrenten gleich nebenan, und die von seinen riesigen Schaufenstern oder den in der Weihnachtszeit hell erleuchteten zweiunddreißig Stockwerken schwärmen. Oder von dem Maurice-Salat und dem Knoblauch-Kartoffelpüree mit Hackbraten im Kaufhausrestaurant.
Aber mal ehrlich, die Yuppies, die heute die Straßen in Downtown Detroit beherrschen, haben entweder keinerlei Erinnerung an das Hudson (wo jetzt eine riesige Tiefgarage ist), oder sie interessieren sich einen Dreck für Maurice-Salate und Knoblauch-Kartoffelpüree mit Hackbraten. Sie wollen bloß Buffalo Chicken Wings oder extrascharfes Pad Thai, während sie das Wall Street Journal und Advertizing Age studieren oder in ihren iPhones den Like-Button auf Facebook anklicken.
Dank des Booms von One Campus Martius war es für weiße Vorstädter in Ordnung, in das Herz einer Stadt zurückzukehren, die längst als brodelnder Kessel schwarzer Armut, ethnischer Konflikte und unaufhaltsamen städtischen Verfalls abgeschrieben worden war. Die mit Rollgittern geschützten Friseurläden, die kakerlakenverseuchten Starkbierkneipen und leerstehenden Bürogebäude, über die einst landesweit in den Nachrichten mit scheinheiligem Bedauern berichtet wurde, waren plötzlich durch internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Hypothekenbanken, Software-Start-ups, Werbeagenturen, todschicke »Ziegenkäse und Bioeier«-Frühstückscafés und die allgegenwärtigen Starbucks ersetzt worden.
Schmear’s Deli, eine feste Größe in guten wie in schlechten Zeiten, war jetzt umringt von trendigen Restaurants und exklusiven Boutiquen. Um im neuen Detroiter Geschäftszentrum mithalten zu können, hatte sich das Schmear’s von dem kleinen, nach Zigarren riechenden Lokal mit in einer Vitrine gut sichtbar ausgelegten Rinderzungen in etwas verwandelt, das für die Montag-bis-Freitag-Invasion von technikaffinen, iPads schleppenden Karrieretypen attraktiver war.
Die Poster von Che Guevara, Angela Davis, Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King jr. und David Ben Gurion, die einst an den nikotingefärbten Wänden des Schmear’s vergilbten, waren verschwunden. Ebenso verschwunden waren die Kellner, die auf den nassen Stummeln von billigen Zigarren gekaut hatten. Die meisten waren aufgrund von Alter und Kehlkopfkrebs in den Ruhestand gegangen. Statt der verschrammten, wackeligen Holzstühle und -tische, an denen ich früher mit meiner Mom und meinem Dad gesessen hatte, gab es jetzt glänzenden Edelstahl und schimmernde meerschaumgrüne Keramikfliesen der Töpferei Pewabic. Anstelle der vergilbten Poster hingen nichtssagende Acrylgemälde und Fotos von Detroits lächelnden ethnisch buntgemischten Einwohnern an den Wänden. Auf einem der Fotos war ich mit fünf Jahren, flankiert von meiner Mom, meinem Dad und dem breitbrüstigen, zahnlückigen Vater des aktuellen Besitzers, zu sehen.
Als ich eintrat, waren die Yuppies gerade munter dabei, ihre Mittagspause zu beenden und ihre Rechnungen zu bezahlen. Für sie wurde es Zeit, zu dem zurückzukehren, was Leute in Michael-Kors- und Jones-New-York-Outfits beruflich so machen.
An der Theke wurde ein Hocker frei, und kaum hatte ich Platz genommen, hörte ich: »Der verlorene Sohn ist wieder da!«
Ben Breitler, Besitzer des Schmear’s in zweiter Generation, war jetzt Mitte sechzig. Je älter er wurde, desto mehr sah er aus wie Albert Einstein auf einem Methamphetamin-Trip.
Ben trug ein regenbogenfarbenes Batik-T-Shirt mit den fett aufgedruckten Worten: »Steck dir einen an!«.
Wir umarmten uns, und ich sagte: »Scheußlich, was du aus dem Laden gemacht hast, Ben.«
»Tja, ich find’s auch scheußlich«, sagte Ben mit einem gleichgültigen Achselzucken. »Aber man muss der aufstrebenden Schicht eben geben, was sie haben will. Pass dich an oder stirb. Du bist also wieder da? Für immer oder bloß auf der Durchreise?«
»Für eine Weile«, sagte ich. »Ich hab angefangen, das alte Haus meiner Eltern in Mexicantown zu renovieren, bevor ich weg bin. Das bring ich zu Ende und entscheide dann, was ich machen will, wenn ich groß bin.«
»Gut!«, sagte Ben mit einem Grinsen, das kosmetischen Zahnersatz im Wert von ein paar Riesen aufblitzen ließ. »Lebe nach einem guten Vorbild und sei für andere ein gutes Vorbild. Mexicantown ist eine super Gegend! Und es wird immer besser. Denk an meine Worte. Und bei der Entscheidung, was du mal werden willst, wenn du groß bist, frag bloß nicht mich um Rat, Kleiner. Ich weiß noch immer nicht, was ich mal werden will – aber ganz bestimmt nicht Betreiber von einem jüdischen Deli, der sich die Haare rauft wegen der Kosten von gutem Räucherlachs und beschissenem grünem Tee.«
Ben drehte sich um und winkte hektisch einer seiner Kellnerinnen – einer jungen Frau mit roter Stachelfrisur und imposantem dunklem Lidschatten, Tattoos von Kois, die ihren linken Arm hochschwammen, und einem silbernen Nasenring. Der Emo-Look zog mich normalerweise nicht an. Allerdings war Lucy »Tank Girl« Tarapousian schon immer die Ausnahme von dieser relativ lockeren Regel gewesen.
»Guck mal, wer wieder da ist!«, brüllte Ben über die Gäste hinweg, die auf dem Weg nach draußen waren.
Tank Girl sah mich und befahl ihren neuen Gästen: »Beschäftigt euch mal kurz.« Als sie auf mich zukam, sagte sie: »Oh-la, me amigo! Que pasa?«
»Dein Spanisch ist noch immer grottenschlecht«, sagte ich. »Aber der Look hat was.«
Tank Girl gab mir eine rippenquetschende Umarmung und – zu meiner großen Überraschung und Freude – einen Kuss auf den Mund. Noch ein Grund, warum mir das Ambiente im Schmear’s so gefiel. Sie schmeckte nach gutem Sex oder frischem Räucherlachs. Beides verwechselte ich häufig.
Ben, Tank Girl und ich plauderten ein wenig. Hauptsächlich über mein einjähriges Abenteuer im internationalen Trinkgenuss und ein bisschen darüber, wie die Stadt versucht hatte, mich fertigzumachen. Nach einer Weile schrieb mir Tank Girl ihre Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse, BH-Größe und wo genau ihre neusten Piercings waren auf eine Serviette und stopfte sie in die Innentasche meiner Jacke.
»Schreib mir«, sagte sie. »Ich kann meinen Freund nicht mehr sehen.«
»Stehst du wieder auf Jungs?«
Sie grinste, zuckte die Achseln und ging zurück zu ihren ausgehungerten Gästen.
»Ist das Flirten des Personals mit den Gästen hier nicht verboten?«, sagte ich zu Ben.
»Hey, Jungchen, dann würde ich ja nie eine ins Bett kriegen.«
Ben holte mir eine Speisekarte: sechs laminierte, farbenfrohe Seiten in burgunderrotes Kunstleder gebunden. Sie enthielt eine Liste mit dem Angebot an Mineralwasser – einheimischem und importiertem, stillem und mit viel Kohlensäure – und »gesunden« Smoothies und Tee.
»Menschenskind, Ben«, sagte ich, während ich die Karte studierte. »Du hast dich ja wirklich auf die dunkle Seite geschlagen.«
»Was soll ich machen?«, erwiderte Ben erneut mit einem gleichgültigen Achselzucken. »Die dunkle Seite zahlt besser.«
Der Bürgermeister, der Stadtrat und mindestens ein Drittel des Detroit Police Department hatten vor einem Jahr dasselbe gedacht …
4
Ich bestellte das Putenbrust-Reuben »Extraordinaire« mit scharf gewürzten Süßkartoffelpommes und dazu einen Krautsalat samt gehackten Walnüssen und McIntosh-Äpfeln. Ben gab mir eine kräftige Umarmung und entschuldigte sich dann.
Ich hatte gerade erst drei Mal in mein Sandwich gebissen, als ein stämmiger Schwarzer von Ende vierzig das Deli betrat. Er trug einen dicken schwarzen Schnurrbart, eine runde Schildpattbrille, einen gutgeschnittenen hellbraunen Anzug und Oxford-Halbschuhe. Er setzte sich auf den Hocker neben mir und sagte: »Ist hier noch frei?«
Captain Ray Danbury, Detroit Police Department. Der Mann, zu dem Cowling mich hatte bringen sollen.
»Wie ist das Sandwich?«, fragte Danbury mit einem breiten Grinsen.
»Es war lecker«, sagte ich. »Bis du reingekommen bist.«
»Was soll ich machen?« Danbury lachte. »Ich hab nun mal diese Wirkung.« Danbury war ein guter Cop in einer Stadt, in der das Gute nicht immer zu erkennen und Moral häufig amorph war. Sein Aufstieg zum Captain war langsam und mühevoll gewesen. Er bevorzugte niemanden, und seine Ansichten deckten sich nicht immer mit denen seiner Vorgesetzten. Aber er erledigte seinen Job. Und nach den Korruptionsskandalen der letzten Jahre waren die Menschen von Detroit endlich bereit für jemanden wie Danbury.
»Lädst du mich ein?«, fragte er. »Gerüchten zufolge sollst du ordentlich was auf dem Konto haben.«
Danbury bestellte schwarzen Kaffee mit drei Stückchen Zucker und ein Omelett namens Jewish Farmer: Paprika, Zwiebeln und grob zerkleinerter Räucherlachs mit geröstetem Challa-Brot. Er machte sich über sein Essen her, als hätte er seit Tagen nichts mehr zwischen die Zähne bekommen – was ich bezweifelte, da er zehn Kilo mehr auf den Rippen hatte, als ein Mann von einem Meter achtundsiebzig haben sollte.
»Willst du dein Hündchen nicht auf einen Napf Trockenfutter reinholen?«, sagte ich mit Blick auf den dunkelblauen Ford Taurus, der draußen nicht weit vom Kreisverkehr am Campus Martius stand.
»Cowling?«, sagte Danbury mit vollem Mund. »Sei nicht zu hart zu ihm, August. Er ist genau da, wo ich ihn haben will, und ganz glücklich in seinem goldenen Käfig.« Danbury nahm wieder eine Gabel voll von seinem Omelett. »Außerdem. Das Letzte, was diese Stadt braucht, ist noch ein Cop vor Gericht. Dafür hast du gesorgt.«
»Was willst du, Ray? Ich meine, außer meine stets geistreiche Gesellschaft zu genießen.«
Danbury zuckte die Achseln. »Hab gehört, dass du wieder da bist. Wollte bloß hallo sagen, mehr nicht.«
»Schwachsinn.«
»Ja, stimmt.« Danbury lachte und schlürfte einen Schluck von seinem Diabetes fördernden Kaffee. »Rate mal, wer dich vermisst hat!« Er machte eine effektvolle Pause und sagte dann: »Eleanor Paget.«
Ich spürte, wie sich die Muskeln in meinen Schultern anspannten.
»Ja«, sagte Danbury munter. »Hat mir auch einen Scheißschock versetzt. Aber die Zicke ruft seit zwei Wochen andauernd bei mir, beim Chief und beim Commissioner höchstpersönlich an und fragt nach dir. Ich sage ihr jedes Mal, dass du kein Cop mehr bist und dir Gott weiß wo einen blasen lässt. Aber du weißt ja, wie die Frau ist.«
»Allerdings.«
Danbury sah mich an und sagte dann leiser: »Hast du gedacht, du kannst dich zurück in die Stadt schleichen und keiner merkt’s? Scheiße, Mann, ich hab schon gewusst, dass du wieder da bist, bevor du am Flughafen gelandet bist.«
»Was will sie?«, fragte ich.
»Woher soll ich das wissen?«, erwiderte Danbury. »Ich bin bloß ein gutbezahlter Bote. Und außerdem will ich’s gar nicht wissen. Hab schon genug andere Sorgen, auch ohne die Frau und deinen kleinen schlappen Hintern.«
Wir saßen einen Moment schweigend da, bis ich den Mut aufbrachte, ihn zu fragen: »Wieso hast du nicht für mich ausgesagt, Ray?«
»Weil deine Wunden deine Wunden sind«, blaffte Danbury, »und meine sind meine. Ich brauche niemanden, der meine Wunden wieder aufreißt und mit dem Finger drin herumbohrt.« Nach einem Moment seufzte er und sagte: »Weißt du, wie hoch die Studiengebühren an der University of Michigan sind?« Dann sagte er: »Du bist ein guter Cop, August. Warst ein guter Cop. Hab dich immer gemocht, Mann. Hab auch deinen Daddy gemocht, Gott hab ihn selig. Aber zwischen damals und heute liegen viel Zeit und ein langer, schwerer Weg. Ich hab zwei Kinder, die studieren, eine Hypothek und eine Frau, die ihre neue Küche mag, die übrigens erst in zwei Jahren abbezahlt sein wird.«
Ich nickte. »Verstehe.«
»Nein. Ich glaube, das tust du nicht, August.« Danbury schob seinen leeren Teller ein Stück von sich weg. »Aber, hey, das ist in Ordnung. Such dir eine Frau, mit der du ein paar Kinder in die Welt setzt, und –« Danbury verstummte mitten im Satz, sagte dann: »Sorry.«
Ich zuckte die Achseln und sagte: »Es ist drei Jahre her.«
Eine Sekunde.
Eine Kugel.
Zwei Leben.
Danbury streckte mir schließlich seine Hand hin. »Alles okay zwischen uns?«
Ich nickte zögerlich und schüttelte ihm die Hand. »Alles okay.«
Danbury griff in seine Jacketttasche und holte einen gefalteten Zettel hervor.
»Eleanor Pagets Nummer. Ruf sie an. Oder auch nicht. Mir scheißegal. Aber nur, damit du’s weißt. Sie kann ganz schön vielen Leuten das Leben schwermachen, wenn man sie nicht zurückruft. Und mein Leben ist weiß Gott schon schwer genug, auch ohne dass mir die Frau wieder ans Bein pinkelt.«
Danbury stand auf und bedankte sich fürs Mittagessen. Als er sich zum Gehen wandte, sagte ich: »Bestell Cowling, wenn er mich noch einmal so anmacht wie draußen vor der St. Al, kriegt er die Hucke voll.«
»Zur Kenntnis genommen und verstanden«, sagte Danbury mit einem entschiedenen Kopfnicken. Er ging.
Ich blickte auf die Nummer, die auf dem Zettel stand.
Die schwarze Emo-Kellnerin namens Crazy Horse füllte mein Glas mit frischem grünem Eistee, lehnte sich auf die Theke und sagte mit einem Grübchenlächeln: »Kann ich sonst noch was für dich tun, Meister?«
»Ja«, sagte ich, den Blick noch immer auf Eleanor Pagets Telefonnummer gerichtet. »Mir eine Kugel verpassen.«
5
Früher einmal war der Kaminsims im Wohnzimmer vollgestellt mit Fotos von meinen schwarzen Großeltern und meinen mexikanischen Großeltern, mit Kinderfotos (von mir, von Cousins und Nachbarskindern, zu viele, um mich an alle zu erinnern), mit dem Hochzeitsfoto meiner Eltern, auf dem mein Dad in der Galauniform des Detroit Police Department furchtlos und unbesiegbar aussah und meine Mutter auf dem Sand der Sleeping Bear Dunes mit Blick auf den Michigansee wunderbar lässig wirkte. Dann waren da noch ein Foto von unserem gebrauchten 1979er Oldsmobile 98 (Dad liebte dieses Auto), ein Foto von einer Feier zum Tag der Toten, dem Día de los Muertos, in einem mexikanischen Restaurant und selbstverständlich eine gerahmte Andachtskarte der Muttergottes.
Im Laufe der Jahre wechselten die Bilder: ich, wie ich mit sechs Jahren den gelben Karategürtel bekam; friedlich in ihren Särgen liegende Großeltern; ein Familienausflug nach Traverse City; Rusty, eine grau-braune Promenadenmischung, mein erster, einziger und bester Hund; meine Abschlussfeiern an der Highschool, an der Wayne State University und an der Polizeischule. Die Anzahl der Fotos von Cousins und Nachbarskindern nahm mit den Jahren kontinuierlich ab, während die Anzahl der Cousins und Nachbarskinder, die ins Gefängnis kamen oder starben, zunahm. Die einzigen Bilder, die blieben, waren die gerahmte Andachtskarte von der Muttergottes und das Foto des 1979er Oldsmobile 98.
Mittlerweile standen auf dem Kaminsims nur noch zwei Bilder: das Hochzeitsfoto meiner Eltern und eines, das ich in Oslo von Tatina gemacht hatte.
In den Bücherregalen waren noch keine Bücher.
Ich stand in der Mitte des leeren Wohnzimmers und überlegte, was ich mit dem Haus und meinem Leben anfangen sollte, als es an der Haustür klingelte und gleich darauf jemand anklopfte. Instinktiv griff ich nach meiner Glock.
Ich ging zur Tür und spähte durch das hohe schmale Fenster: Mein Blick fiel auf zwei sehr kleine ältere Frauen, eine Latina und eine Weiße, beide in lila Steppjacken von North Face.
Ich öffnete die Tür und sagte: »Hi, Ladys.«
Meine Begrüßung war wohl amüsant, denn beide Frauen kicherten.
»Mr Snow?«, sagte die Latina-Lady.
»Ja, Ma’am.«
»Hi!«, sagte sie. »Ich bin Carmela Montoya. Das ist meine Freundin Sylvia Zychek.« Sylvia winkte überschwänglich, obwohl wir keine zwei Schritte voneinander entfernt waren. »Wir sind Ihre Nachbarinnen!«
»Wir wollten bloß vorbeischauen und uns für die wunderbare Arbeit bedanken, die Sie an unserem Haus geleistet haben«, sagte Sylvia. Die Häuser, die ich auf der Markham gekauft und renoviert hatte, waren für mich lediglich eine Möglichkeit, mich zu beschäftigen und mit Leuten verbunden zu fühlen, ohne tatsächlich Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Offenbar hatten diese Ladys das nicht begriffen. »Und der Mann? Der mexikanische Gentleman, der auf Ihr Haus aufgepasst hat, während Sie weg waren? Mein Gott, was für ein netter Mann. Sieht ein bisschen unheimlich aus, ist aber richtig nett.«
»Wir wollten uns auch dafür bedanken, dass Sie diese Nachbarschaft wieder zum Leben erwecken«, sagte Carmela. »Mein Sohn und meine Schwiegertochter waren dagegen, dass ich zurück nach Mexicantown ziehe, aber hier bin ich nun mal zu Hause. Hier fühle ich mich lebendig.«
»Gern geschehen, Ladys«, sagte ich.
»Nicht viel«, sagte Sylvia zu ihrer Mitbewohnerin. Sie reckte den Hals, um besser an mir vorbei ins Innere des Hauses schauen zu können.
»Was?«, erwiderte Carmela.
»Ich hab gesagt, er hat nicht viel!«, sagte Sylvia lauter.
»Ich bin gerade erst von einer langen Reise zurück«, sagte ich. »Die meisten Sachen sind noch eingelagert.«
»Also, wenn Sie Hilfe brauchen«, sagte Carmela, »rufen Sie uns an. Oder kommen Sie einfach rüber. Wir haben immer Kekse und Kuchen da, manchmal auch unsere besonderen Brownies und –«
»Oh, sie macht die absolut besten Erdbeer-Churros!«, sagte Sylvia.
Die Ladys dankten mir noch einmal und wandten sich zum Gehen. »Die Straßenlampen?«, sagte ich rasch. »Wann hat die Stadtverwaltung die aufgestellt?«
»Oh, das war nicht die Stadtverwaltung«, sagte Sylvia. »Das war irgendeine Privatfirma. Ich glaube, die heißt –«
»LifeLight«, sagte Carmela. »Der Name stand auf dem Lieferwagen. LifeLight.«
»Die sehen hübsch aus, nicht?«, sagte Sylvia.
Ich sah den Ladys nach, wie sie Hand in Hand meine Eingangsstufen hinunterstiegen und dann langsam zu dem Haus nebenan zurückkehrten. Sie gingen so, wie die Leute in meiner Erinnerung vor einer Ewigkeit in dieser Nachbarschaft gegangen waren, mit lässigem Selbstvertrauen, als wäre diese kleine Straße die beste aller möglichen Welten.
Aus unerfindlichen Gründen hatte das Gespräch mit den beiden alten Mädels meine Stimmung ein wenig gehoben. Vielleicht bestand ja doch noch Hoffnung für dieses fast vergessene Viertel. Und vielleicht war ich ein Teil dieser Hoffnung.
Außerdem war ich dankbar, dass Carmela und Sylvia mich nicht auf meinen Prozess angesprochen hatten. Vielleicht wussten sie nichts davon. Vielleicht war es ihnen egal.
Zwanzig Minuten und einen Anruf später hatte ich mich in einen Anzug geschmissen und war auf dem Weg in eine Welt, die auch Camelot hätte sein können – oder der Mars: die nordöstliche Spitze des südöstlichen Michigan, Postleitzahl 48 236.
Grosse Pointe.
Gringos, die auf dem Lodge Freeway aus der Unterführung unter dem Cobo Hall Convention Center kommen und auf der Jefferson Avenue in nordöstlicher Richtung weiterfahren, werden in Midtown von einer gigantischen gusseisernen Faust begrüßt. Aber nur keine Angst vor der vom mexikanischstämmigen Bildhauer Robert Graham geschaffenen herrlichen Skulptur, die den Unterarm und die wuchtige Faust der Boxikone Joe Louis darstellt: Sie hat nur selten jemanden ausgeknockt.
Ich fuhr an der Faust vorbei und nickte ihr respektvoll zu.
Nimm das, Hitler …
Der stahlgraue Detroit River strömte zu meiner Rechten dahin, während ich meinen gemieteten weißen Cadillac CTS durch den Nachmittagsverkehr steuerte. Vorbei am touristenfreundlichen weitläufigen Riverwalk. Vorbei an der Mariner’s Church (als guter Mexikaner mit jahrelang antrainiertem katholischem Muskelgedächtnis machte ich unwillkürlich das Kreuzzeichen für die Besatzung des untergegangenen Frachters Edmund Fitzgerald) und an den imposanten zylindrischen Türmen des Renaissance Center, der Weltkonzernzentrale von General Motors.
Weiter östlich passierte ich Belle Isle – über die Jahrzehnte hinweg auch bekannt als das Kronjuwel »des Paris des Mittleren Westens«, als »Blood Island« und in jüngster Zeit aufgrund eines Umschuldungsdeals in einem Konkursverfahren als »Michigan State Park No. 101«. Jenseits der weißen Belle Isle Bridge zogen Hochhäuser, Apartmentgebäude und Motels vorbei. Ich sah die Flachbauten von Supermärkten und eine mit Brettern vernagelte Sporthalle, wo Boxchampions wie Lennox Lewis, Wladimir Klitschko und Thomas »The Hit Man« Hearns bei dem legendären Trainer Emanuel Steward Lehrveranstaltungen in der »Sweet Science« besucht hatten. Bröckelnde Denkmäler einer einst stolzen Geschichte.
Rechts von der Jefferson Avenue in westlicher Fahrtrichtung gab es noch immer Viertel, die als Tor zur Hölle dienten. Wo schwarze Kinder in den Ecken leerstehender Häuser kauerten und im letzten Tageslicht Bücher lasen, die sie aus Schulbibliotheken gestohlen hatten. Orte, wo der Teufel sein tägliches Abendessen von einem Bundesstaat bekam, der seine größte Stadt verachtete, und von einem Land, das theatralisch diejenigen bemitleidete, die hier lebten.
Die meisten der Restaurants und angesagten Bars, die früher am Ufer des Detroit River lagen, waren seit Jahren verschwunden. Opfer von gescheiterten Immobilienprojekten, wachsender Armut und einer schwer durchschaubaren Stadtverwaltung, die sich unbedingt an das Drehbuch für den Untergang Roms halten wollte.
Ein paar wenige hatten überlebt, aber die meisten kleinen schummrigen Bars, in denen einst Sippie Walker, John Lee Hooker und James Cotton auftraten, waren bloß noch hässliche braune Felder, auf denen nachts wilde Hunde und der ein oder andere Coywolf jagten.
Etwas weiter und näher am Lake St. Claire lag das erste der Grosse Pointes: Grosse Pointe Park, das Vorzimmer der anderen nördlichen Pointes. Eine Gemeinde speziell für Leute, die möglicherweise reiche Großeltern hatten, aber auf Sicherheitsabstand zu ihnen gegangen waren, weil sie jemanden geheiratet hatten, der nicht protestantischen Glaubens war oder durch dessen Adern nicht schon seit Generationen reines angelsächsisches Blut floss.
Als Nächstes kam Grosse Pointe Farms. Hier lebten die Paterfamilias des alten Geldadels, abgeschieden in ihren Villen aus Backstein und Bleiglas, wo sie Mozart oder Duke Ellington hörten, während sie ihren Sherry oder Portwein schlürften und über den Zustand des heutigen Detroit den Kopf schüttelten.
Und dann kam Grosse Pointe Estates.
Grosse Pointe Estates, womöglich der zweite Anlaufhafen für die Mayflower, war das Epizentrum des Grosse-Pointe-Reichtums. Hier war das Geld von Ururgroßmutter eine feste Größe. Eine Zitadelle, in der Gerüchte Imperien zum Einsturz brachten, Gebiete eroberten oder Geschichte schrieben und Zukunft schufen. Die »leuchtende Stadt auf dem Berge«, beschützt durch die Zinnen eines obskuren Immobilien-Algorithmus.
Hier lebte alter Geldadel mit noch älteren Skeletten.
Berlin war nicht die einzige Stadt, die durch eine Mauer geteilt worden war: Zwischen Grosse Pointe Estates und der übrigen Metropolregion um Detroit verlief zweifellos eine hohe und nahezu unüberwindbare Mauer, auch wenn sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen war. Generationen von Geld, Macht und Privilegien hatten diese Mauer errichtet. Hier nahm der Begriff »ethnische Säuberung« seine unterschwelligen amerikanischen Rhythmen und Reime an.
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Mexikaner in das Reich der Pointes gelangt …
Ich gondelte durch das idyllische, penibel gepflegte und streng bewachte Wohngebiet und hoffte, nicht von der Polizei angehalten zu werden, weil ich nicht so richtig in das enge farbliche Konzept dieses Stadtteils passte.
Unwissende Plebejer begehen häufig den Fehler, auf der gewundenen, von Bäumen gesäumten Straße zu parken und an der Tür des dreigeschossigen, zweihundert Jahre alten Hauses keine vierzig elegante Schritte entfernt zu klingeln: Man hat dann nämlich die Klingel des einstigen Gesindehauses gedrückt. Personal in separaten Unterkünften auf dem Grundstück gehörte im Grunde in eine vergangene Ära, als Dinnergäste noch Smoking trugen und mit Pferdekutschen vorfuhren. Dieselbe Ära, in der schwarze Bedienstete pfeifen mussten, wenn sie das Abendessen von der Küche in den Speisesaal trugen, sodass ihre Herrschaften sicher sein konnten, dass sie nicht heimlich einen Bissen vom Essen der Herrschaften genascht hatten.
Ich war mir ziemlich sicher, dass sich hier noch immer manch einer nach der längst vergangenen Zeit sehnte, als französischsprachiger Service und pfeifende Schwarze üblich waren.
Inzwischen waren die meisten Personalunterkünfte in Sicherheitskontrollpunkte, Privatbüros, Generatoren-, Lager- oder Gewächshäuser umgewandelt worden. Bedienstete, die auf diesen Anwesen arbeiteten, mussten in der Regel eine einstündige Anfahrt mit dem Bus quer durch die Stadt auf sich nehmen und obendrein eigene Plastikeimer mit Schwämmen, Lappen und allerlei Reinigungsmitteln anschleppen.
Ein guter Grund mehr, darauf zu hoffen, dass uns so bald nicht die Mexikaner ausgehen.
»Guten Morgen, Sir.«
Der Wächter am Tor zu Eleanor Pagets Anwesen war ein junger Mann mit kurzgeschnittenem blondem Haar. Er hatte eine Statur wie ein Footballspieler und trug einen schicken schwarzen Anzug, ein strahlend weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und schwarze, auf Hochglanz polierte Springerstiefel. Es war leicht zu erkennen, dass die linke Seite seines Jacketts ein bisschen weiter geschnitten war, um Platz für das Hüftholster zu bieten, in dem er eine Waffe trug. Ich tippte auf einen sechsschüssigen Revolver. Vielleicht Smith & Wesson, Kaliber .32. Er hatte das unverwechselbare Aussehen eines gut ausgebildeten Ex-Soldaten. Falls er mehr als sechs Kugeln benötigen würde, um eine Auseinandersetzung am Tor zu beenden, dann war er entweder beim Luftlandetraining durchgefallen oder der IS hatte Grosse Pointe gerade überrannt.
Ich setzte mein beruhigendstes Halb-Mexikaner-halb-Schwarzer-Lächeln auf, hielt ihm meinen Führerschein hin und sagte: »August Snow, ich möchte zu Ms Paget. Sie erwartet mich.«
Der Wachmann erwiderte mein Lächeln, verglich rasch mein Führerscheinfoto mit meinem Gesicht und prägte sich währenddessen die Angaben auf dem Führerschein ein. Nach einem Moment nickte er und sagte: »Alles in Ordnung, Sir. Willkommen auf dem Paget-Anwesen.« Er zeigte auf das viergeschossige Gebäude im Federal Style jenseits des Tors und sagte: »Sie fahren einfach –«
»Ich kenn den Weg«, sagte ich, kaum noch imstande, mein »freundliches Halb-Mexikaner-halb-Schwarzer-bitte-nicht-schießen-Lächeln« beizubehalten. Mir taten schon die Wangen weh. »Danke.«
»Einen angenehmen Aufenthalt, Sir«, sagte der junge Wachmann.
»Den werd ich nicht haben«, entgegnete ich.
Was machen wir nicht Weißen nicht alles, damit Weiße sich wohl fühlen: unaufdringliches Grinsen. Hängende Schultern. Gesenkter Blick. Gefaltete Hände.
Lebensläufe.
Ich lenkte den Wagen langsam die schmale Zufahrt hoch, vorbei an Hartriegelsträuchern, Eichen und Kiefern, und hielt schließlich auf dem Rondell vor Pagets großzügigem Haus.
Es war nicht ganz so idyllisch wie Lord Granthams englischer Landsitz Downton Abbey, aber nah dran.
Als ich den hohen Haupteingang betrachtete, musste ich unwillkürlich schmunzeln. In dem gepflegten Rasen unweit der Stufen steckte ein kleines Schild: DIESES HAUS WIRD VON DER DIGITAL DEFENSE HOME SECURITY, EINEM UNTERNEHMEN DER BLACK TREE CORPORATION, GESCHÜTZT. Ein diskretes rautenförmiges Schild, das von Taylor bis West Bloomfield auf den Rasenflächen von Häusern zu sehen war. Bloß dass Black Tree keine herkömmliche Security-Firma war. Auch das US-Verteidigungsministerium nahm nämlich ihre Dienste in Anspruch. Rief an, wenn es Söldner im Irak, in Afghanistan und für geheime Einsätze in Pakistan, Syrien und dem Jemen brauchte.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich als Scharfschütze der Marines zusammen mit ein paar Typen von Black Tree im fernen Afghanistan patrouilliert. Übereifrige Dumpfbacken mit militärischer Ausbildung, die sich nichts und niemandem verpflichtet fühlten außer ihren fetten Gehaltsschecks und spektakulären Boni. Typen, die nur einen Psychotest von der Zwangsjacke entfernt waren.
Ich stieg aus dem Wagen und ging auf den Eingang zu. Ehe ich die gepflasterten Stufen erreichte, schwang die hohe weiße Doppeltür auf. Im Türrahmen stand ein kräftig gebauter mexikanisch-amerikanischer Mann mittleren Alters mit Haut wie gegerbtem Leder. Er trug ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte, ein hellbraunes Sakko, eine schwarze Hose und schwarze Slipper. Sein Pferdeschwanz war pechschwarz und straff gebunden.
Der Mann musterte mich mit kühlen, schläfrigen Augen und sagte ruhig: »Ich kann mich nicht erinnern, dass die Dame des Hauses mexikanische Salsa mit schwarzen Bohnen bestellt hat, Sir.«
»Mannomann«, sagte ich. »Im ersten Moment hab ich gedacht, du wärst Carlos Santana. Dann ist mir wieder eingefallen, dass Santana nicht wie SpongeBob gebaut ist.«
»Willkommen zurück, Amigo«, sagte der Mann und umarmte mich fest. »Wir haben dich vermisst.«
»Schön, wieder zu Hause zu sein«, antwortete ich auf Spanisch und erwiderte die Umarmung.
Ich kannte Tomás Gutierrez seit meiner Kindheit. Er und mein Vater waren eng befreundet bis zu dem Tag, an dem mein Vater starb. Ich hatte das Glück, diese Freundschaft zu erben.
Tomás und ich gingen hinein. Er nahm meinen Mantel und flüsterte. »Sie ist in letzter Zeit komplett durchgeknallt, August. Tut mir leid, dass du kommen musstest.«
»Ich musste nicht kommen«, sagte ich. »Ich bin aus freien Stücken hier.« Das stimmte nur teilweise. Eigentlich hatten mich Pflicht-, Ehrgefühl und Integrität hergeführt, alles Dinge, die mein Vater mir anerzogen hatte und die ich ums Verrecken nicht loswurde.
»Dann bist du genauso durchgeknallt wie sie«, sagte Tomás halblaut. Selbst ein Flüstern konnte in diesem riesigen Foyer widerhallen.
Während Tomás mich über den weiten schwarz-weiß karierten Marmorboden eskortierte, flüsterte ich: »Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast, während ich weg war.«
»Hast du Carmela und Sylvia schon kennengelernt?«
»Ja«, sagte ich. »Nette Ladys.«
»Völlig bekloppt«, sagte Tomás. »Ich glaube, die kiffen. Aber, ja, nette Ladys.«
Während wir unter hohen, mit Kronleuchtern behängten Decken zum Arbeitszimmer im Erdgeschoss gingen, sagte Tomás, er und seine Familie bedauerten, was ich mit dem Department durchgemacht hatte, und dass er meine Mutter und meinen Vater vermisse. Ich sagte, dass auch ich sie vermisste.
»Dein alter Herr«, sagte Tomás. »Das war ein kluger Mann. Und deine Mutter? Wie eine Schwester von Madre Maria.«
Tomás stand seit zehn Jahren in Eleanor Pagets Diensten, seit seinem gescheiterten Versuch, in Mexicantown ein Restaurant zu betreiben. Die Wirtschaft war zusammengebrochen und hatte seine Gastronomenträume mitgerissen. Danach arbeitete er kurze Zeit in einem Metallstanzwerk in Pontiac, doch der Börsencrash 2008 bereitete dem ein Ende. Das Werk machte dicht, und Tomás landete zusammen mit hundertfünfzig anderen Mitarbeitern auf der Straße. Ich besorgte ihm den Job auf Eleanor Pagets Anwesen.
Kurz fragte ich mich, ob Eleanor Paget überhaupt ahnte, dass sich unter Tomás’ Anzug und seinem geschniegelten Aussehen der Körper von Ray Bradburys Der illustrierte Mann versteckte. Tattoos, die sich um seine Arme schlängelten, über Brust und Rücken wanden. Tattoos von Taranteln, die an einem mit Stacheldraht umwickelten Kreuz Christi hochkrabbelten. Tattoos von verzierten Dolchen im Maul von Klapperschlangen. Das wohl seltsamste von allen war ein Tattoo von General Emiliano Zapata Salazar oben auf seiner rechten Schulter.
Und natürlich waren da auch noch die Narben von Schuss- und Stichwunden aus vergangenen Zeiten …
Wir erreichten das Arbeitszimmer, einen hellen Raum mit prächtigen, zweihundert Jahre alten Familienerbstücken, Perserteppichen und einem historischen Bösendorfer-Flügel, auf dem Eleanor, so mein starker Verdacht, ganz sicher nicht spielte. Durch die Reihe hoher Bogenfenster waren in einiger Entfernung ein weißer Pavillon und der flache Ziegelbau zu sehen, in dem sich Swimmingpool, Sauna und topmoderne Fitnessgeräte befanden. Dahinter lag der Lake St. Clair.
»Du hast ordentlich Kohle gekriegt, was?«, sagte Tomás.
Ich lächelte und nickte.
»Dann kauf noch ein paar Häuser im Viertel«, sagte Tomás. »Bring sie wieder in Schuss, Mann. Wenn du sie nicht kaufst, macht das irgend so ein reicher weißer Schnösel, und in null Komma nichts stecken wir alle bis zum Hals in Grünkohlsmoothies, Tapas, Starbucks und Scheißvollwertkost.«
»Gute Idee«, sagte ich.
»Das kannst du laut sagen«, erwiderte Tomás. Dann, mit einem Blick zur Tür, sagte er: »Viel Glück, Amigo. Halt dein Pulver trocken.«
»Ich hab keinen Schimmer, was das heißen soll«, sagte ich und lächelte meinen Freund an, während ich ihm noch mal die Hand schüttelte.
Bevor er ging, fragte er, ob ich einen Kaffee wolle, und ich bejahte.
Tomás zwinkerte mir zu und sagte: »Ich mach ihn stark. Auf mexikanische Art. Wirst du brauchen.«
Ich betrat das Arbeitszimmer, und da saß sie – die jungfräuliche Königin, bereit, einen weiteren Versager oder Verschwörer in den Tower zu schicken.
»Wo zum Teufel haben Sie gesteckt?«
Eleanor Paget war Mitte sechzig. Dank guter Gene und äußerst dezenter Schönheitsoperationen sah sie zwanzig Jahre jünger aus.
»Hallo, Eleanor«, sagte ich. »Ich freue mich auch, Sie zu sehen.«
»Ach, sparen Sie sich Ihre Impertinenz.«
Eine schwarze Frau saß nicht weit von Paget. Sie war gut gekleidet und etwa im selben Alter, aber ohne den gleichen problemlosen Zugang zur Schönheitschirurgie.
»Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich versucht habe, Sie zu erreichen, Mr Snow?«, sagte Paget mit wütendem Blick. »Auch nur die geringste Ahnung?«
»Vielleicht haben Sie von meinen juristischen Schwierigkeiten gehört?«, sagte ich.
»Ach, wen interessiert’s!«, blaffte sie. »Schnee von gestern, da kräht kein Hahn mehr nach!«
»Beruhige dich, Eleanor«, sagte die andere Frau.
»Sag mir nicht, ich soll mich beruhigen!«, herrschte Paget sie an. »Für wen hältst du dich?«
Die Frau rang sich ein Lächeln ab und sagte dann: »Ich muss zurück ins Büro!«
»Ja, genau!«, kreischte Paget. »Ab ins Büro! Tu mal was, wofür ich dich bezahle!«
Die schwarze Frau warf mir einen verlegenen Blick zu. »Sie entschuldigen mich.«
Sie steuerte auf die Tür des Arbeitszimmers zu. Paget erhob sich rasch von ihrem Thron, klackte auf gefährlich hohen schwarzen Stilettos über den Marmorboden und holte die Frau an der Tür ein. Die beiden sprachen leise miteinander. Nach einem Moment tupfte die schwarze Frau die Tränenspuren auf Eleanor Pagets Wangen sanft mit einem Papiertaschentuch ab und verließ den Raum.
»Rosey«, sagte Paget zu niemand Bestimmtem. »Rose Mayfield. Sie ist – vielleicht erinnern Sie sich, von …«
Ja, das tat ich.
Paget riss sich aus ihrer kurzen Erstarrung und ging zurück zu ihrem Ohrensesselthron aus weinrotem Leder. Sie setzte sich und schlug die langen, glatten Beine übereinander. Schönheitschirurgen konnten mit dem menschlichen Körper ziemlich viel anstellen, aber bei Beinen stießen sie an ihre Grenzen. Eleanor Pagets Beine waren die hochwertige Originalversion.
Paget richtete wieder ihren eisigen Blick auf mich, holte scharf Luft und sagte: »Wie viel würden Sie darauf wetten, dass meine Sorgen schwerer wiegen als Ihre belanglose öffentliche Hinrichtung?«
Ohne die Augen gentlemanlike abzuwenden, sah ich mir ungeniert gut zwei Sekunden lang ihre Beine an. Diese Art von Aufmerksamkeit mochte Paget. »Sie sind durchtrainiert, Eleanor«, sagte ich. »Sie sehen gut aus.«
»Spielen Sie mir hier nicht den Gigolo Latino, Mr Snow«, fauchte sie. »Haben Sie eine Ahnung, was für Anstrengungen ich unternommen habe, Sie zu erreichen?«
Ich war noch nie als »Gigolo Latino« bezeichnet worden. Ich war mir nicht sicher, ob ich das als Beleidigung oder Kompliment auffassen oder einfach nur lachen sollte. »Ich war auf Reisen«, sagte ich.
Eine junge, in Bediensteten-Weiß gekleidete Mexikanerin brachte meinen Kaffee und stellte ihn vorsichtig auf den kleinen Couchtisch zwischen Paget und mir. Die Frau – achtzehn, höchstens neunzehn – fragte leise, ob »Madam« noch irgendeinen Wunsch hätte. Paget winkte ab.
Ehe sie ging, musterte mich die braunhäutige Bedienstete verstohlen, wohl in der Hoffnung, mich entweder als »freundlich« oder als Bedrohung für ihren Migrantenstatus einstufen zu können.
Ich nahm meine Tasse Kaffee und sagte leise: »Danke.«
»Bitte sehr, Sir«, sagte die junge Frau. Dann machte sie eine angedeutete Verbeugung vor Paget und verließ das Arbeitszimmer. »Müssen die Leute sich noch immer vor Ihnen verbeugen, Eleanor?«, fragte ich nach einem Schluck Kaffee. »Ist das nicht ein bisschen antiquiert?«
»Es erstaunt mich immer wieder, dass Leute Höflichkeit, Anstand und Respekt vor sozialem Status heutzutage für ›antiquiert‹ halten«, sagte sie, wobei sie mich weiter mit ihrem starren blauäugigen Blick fixierte. Ich war sicher, dass ich jeden Moment zur Salzsäule erstarren würde. »Kommen wir zur Sache«, fuhr sie fort, »Sie müssen für mich Untersuchungen in einer delikaten Angelegenheit anstellen.«
»Ich bin kein Cop mehr, Eleanor«, sagte ich. »Ich bin nicht mal zugelassener Privatdetektiv. Ich bin jetzt bloß ein stinknormaler Bürger.«
»Ich brauche Ihre Hilfe!«, kreischte sie plötzlich und schlug eine schlanke und manikürte Hand auf die Armlehne ihres Sessels. Sie schloss den Mund wieder, holte zittrig Luft und richtete ihre jetzt feuchten Augen auf eine Fensterfront, die einen weiten Blick auf eine grüne, leicht hügelige Landschaft bot. In ihrem Schweigen lag ein bedenkliches atomares Gewicht.