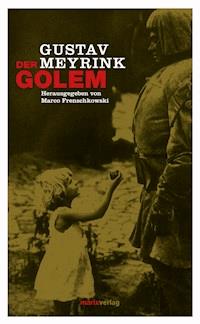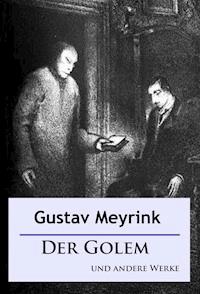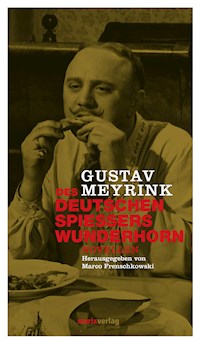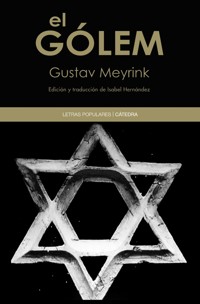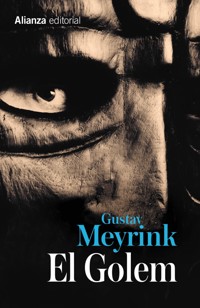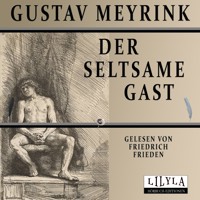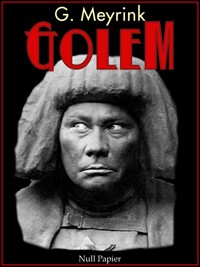
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Horror bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Der Golem - ein früher Schauerroman der unbekannteren Art Der namenlose Icherzähler träumt, ein Handwerker aus dem Prager Getto zu sein, der in zahlreiche Intrigen verwickelt wird, die ihn nicht nur des Mordes bezichtigen, sondern schließlich sogar an seiner eigenen Existenz zweifeln lassen. Es entsteht ein impressionistisches Vexierbild vor dem Hintergrund der Sage um den Golem. Verwirrt? - Vom Autor gewollt. Parallelen zu Kafkas unglücklichen Figuren liegen nah, auch hier sind die Handelnden nicht wirklich handelnd, sondern hilflos einer grundlos feindlichen Umwelt ausgesetzt. Meyrinks Golem ist ein Gespenst auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen, das alle 33 Jahre im Prager Getto auftaucht, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ein literarisches Experiment Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gustav Meyrink
Der Golem
Ein phantastischer Roman
Gustav Meyrink
Der Golem
Ein phantastischer Roman
Überarbeitung und Korrekturen: Null Papier VerlagHerausgeber: J. Schulze Published by Null Papier Verlag, Deutschland Copyright © 2017 by Null Papier Verlag 1. Auflage, ISBN 978-3-954185-82-5
www.null-papier.de/293
Das hier veröffentlichte Werk ist eine kommentierte, überarbeitete und digitalisierte Fassung und unterliegt somit dem Urheberrecht. Verstöße werden juristisch verfolgt. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Genehmigung des Verlages ist ausdrücklich untersagt.
Inhaltsverzeichnis
Buch
Gustav Meyrink – Übersetzer und Autor
Ein Gedicht als Vorwort
Schlaf
Tag
I
Prag
Punsch
Nacht
Wach
Schnee
Spuk
Licht
Not
Angst
Trieb
Weib
List
Qual
Mai
Mond
Frei
Schluß
Danke
Danke, dass Sie dieses E-Book aus meinem Verlag erworben haben.
Sollten Sie Fehler finden oder Anregungen haben, so melden Sie sich bitte bei mir.
Ihr Jürgen Schulze, Verleger, [email protected]
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Buch
Der Golem – ein früher Schauerroman der unbekannteren Art
Der namenlose Icherzähler träumt, ein Handwerker aus dem Prager Getto zu sein, der in zahlreiche Intrigen verwickelt wird, die ihn nicht nur des Mordes bezichtigen, sondern schließlich sogar an seiner eigenen Existenz zweifeln lassen. Es entsteht ein impressionistisches Vexierbild vor dem Hintergrund der Sage um den Golem.
Verwirrt? - Vom Autor gewollt.
Parallelen zu Kafkas unglücklichen Figuren liegen nah, auch hier sind die Handelnden nicht wirklich handelnd, sondern hilflos einer grundlos feindlichen Umwelt ausgesetzt. Meyrinks Golem ist ein Gespenst auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen, das alle 33 Jahre im Prager Getto auftaucht, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
Ein literarisches Experiment
Ich weiß nur, mein Körper liegt schlafend im Bett, und meine Sinne sind losgetrennt und nicht mehr an ihn gebunden. – Wer ist jetzt ›ich‹, will ich plötzlich fragen; da besinne ich mich, daß ich doch kein Organ mehr besitze, mit dem ich Fragen stellen könnte; dann fürchte ich, die dumme Stimme werde wieder aufwachen und von neuem das endlose Verhör über den Stein und das Fett beginnen. Und so wende ich mich ab.
Gustav Meyrink – Übersetzer und Autor
Gustav Meyrink (1868 - 1932), österreichischer Autor und Übersetzer, war der uneheliche Sohn eines Staatsministers und einer Hofschauspielerin.
Nach dem Besuch der Handelsakademie wurde Meyrink 1889 Mitinhaber, dann Alleininhaber einer Bank. 1902 ging er bankrott, geriet deswegen in Untersuchungshaft und war gezwungen, sich fürderhin trotz Freispruch zu rehabilitieren, was ihm nie ganz gelingen sollte.
Aber 1897 kam es zu ersten erste literarischen Versuchen und Veröffentlichungen. 1901 erfolgte die erste nennenswerte Publikation ("Der heiße Soldat") im Münchner Simplicissimus. 1907 zog Meyrink nach München, wo er die bayrische Staatsbürgerschaft annahm.
Es erfolgten erste Übersetzungen aus dem Englischen; hauptsächlich Charles Dickens und Rudyard Kipling.
Als einer der ersten deutschensprachigen Autoren verfasste Meyrink fantastische Romane. Während sein Frühwerk mit dem Spießbürgertum seiner Zeit abrechnete („Des deutschen Spießers Wunderhorn“), befassten sich seine späteren Werke oftmals mit übersinnlichen Phänomenen und dem Sinn des Lebens („Der Golem“, „Das grüne Gesicht“, „Der Engel vom westlichen Fenster“).
1927 konvertierte Gustav Meyrink vom Protestantismus zum Buddhismus.
Meyrink war Mitglied mehrerer Geheimbünde und behauptete, in telepathischem Kontakt mit Geistern zu stehen. Er nahm an spiritistischen Sitzungen teil – ein Hobby, dem viele Intellektuelle des frühen 20. Jahrhunderts frönten.
»Meyrink verband … eine außerordentliche Begabung für antibürgerliche Satire mit einer nicht weniger ausgeprägten für mystische Marktschreierei.« (Gershom Scholem, Religionshistoriker)
Ein Gedicht als Vorwort
Der Golem (Detlev von Liliencron)
Prag, das alte sagenreiche, Barg schon viele Menschenweisheit, Barg schon viele Menschentorheit, Auch den hohen Rabbi Löw. Rabbi Löw war sehr zu Hause In den Künsten, Wissenschaften, Und besonders in der schwarzen, In der schweren Kabbala. So erschuf er einen Golem, Einen holzgeschnitzten Menschen, Tat belebend in den Mund ihm Einen Zauberspruch: den Schem. Unverdrossen, als sein Diener, Muß der Golem fegen, kochen, Kinder wiegen, Fenster putzen, Stiefel wichsen und so fort. Nur am Sabbath darf er rasten; Nahm ihm dann der hohe Rabbi Aus dem Mund den Zauberzettel, Stand er stockstill augenblicks. Einmal hat er es vergessen, Einmal, was ist da geschehen: Rasend wurde, dwatsch der Golem, Ein Berserker ward der Kerl. Bäume reißt er aus der Erde, Häuser wuppt er in die Wolken, Schleudert Menschen in die Lüfte, Stülpt den Hradschin auf den Kopf. Schon im Anzug war der Sabbath, Alle Arbeit muß nun ruhen. Alles flüchtet, brüllt und zetert Nach dem hohen Rabbi Löw. Der erscheint; packt eben, eben Noch den Tollhans am Schlafittchen, Ist mit ihm bald oben, unten, Bald auf Bergen, bald im Tal: Wie ein Bändiger, der dem Pferde, Das sich bäumt und wirft und schüttelt, Einen Kappzaum legen möchte, Und nun mit ihm tanzen muß. Hopsa, hopsa, was für Sprünge! Aber endlich glückts, er würgt ihn, Zerrt den Schem ihm aus den Zähnen - Und zerschmettert liegt der Kerl. Nicht noch einmal hat der Rabbi Einen Golem sich geschnitzelt, Jede Lust war ihm vergangen: Allzu klug ist manchmal dumm
Dieses Gedicht war nicht Bestandteil der ersten Veröffentlichung, sondern wurde vom Null Papier Verlag hinzugefügt.
Schlaf
Das Mondlicht fällt auf das Fußende meines Bettes und liegt dort wie ein großer, heller, flacher Stein.
Wenn der Vollmond in seiner Gestalt zu schrumpfen beginnt und seine rechte Seite fängt an zu verfallen, – wie ein Gesicht, das dem Alter entgegengeht, zuerst an einer Wange Falten zeigt und abmagert, – dann bemächtigt sich meiner um solche Zeit des Nachts eine trübe, qualvolle Unruhe.
Ich schlafe nicht und wache nicht, und im Halbtraum vermischt sich in meiner Seele Erlebtes mit Gelesenem und Gehörtem, wie Ströme von verschiedener Farbe und Klarheit zusammenfließen.
Ich hatte über das Leben des Buddha Gotama gelesen, ehe ich mich niedergelegt, und in tausend Spielarten zog der Satz immer wieder von vorne beginnend durch meinen Sinn:
»Eine Krähe flog zu einem Stein hin, der wie ein Stück Fett aussah, und dachte: vielleicht ist hier etwas Wohlschmeckendes. Da nun die Krähe dort nichts Wohlschmeckendes fand, flog sie fort. Wie die Krähe, die sich dem Stein genähert, so verlassen wir – wir, die Versucher, – den Asketen Gotama, da wir den Gefallen an ihm verloren haben.«
Und das Bild von dem Stein, der aussah wie ein Stück Fett, wächst ins Ungeheuerliche in meinem Hirn:
Ich schreite durch ein ausgetrocknetes Flußbett und hebe glatte Kiesel auf.
Graublaue mit eingesprengtem glitzerndem Staub, über die ich nachgrüble und nachgrüble und doch mit ihnen nichts anzufangen weiß, – dann schwarze mit schwefelgelben Flecken wie die steingewordenen Versuche eines Kindes, plumpe, gesprenkelte Molche nachzubilden.
Und ich will sie weit von mir werfen, diese Kiesel, doch immer fallen sie mir aus der Hand, und ich kann sie aus dem Bereich meiner Augen nicht bannen.
Alle jene Steine, die je in meinem Leben eine Rolle gespielt, tauchen auf rings um mich her.
Manche quälen sich schwerfällig ab, sich aus dem Sande ans Licht emporzuarbeiten – wie große schieferfarbene Taschenkrebse, wenn die Flut zurückkommt, – und als wollten sie alles daransetzen, meine Blicke auf sich zu lenken, um mir Dinge von unendlicher Wichtigkeit zu sagen.
Andere – erschöpft – fallen kraftlos zurück in ihre Löcher und geben es auf, je zu Worte zu kommen.
Zuweilen fahre ich empor aus dem Dämmer dieser halben Träume und sehe für einen Augenblick wiederum den Mondschein auf dem gebauschten Fußende meiner Decke liegen wie einen großen, hellen, flachen Stein, um blind von neuem hinter meinem schwindenden Bewußtsein herzutappen, ruhelos nach jenem Stein suchend, der mich quält – der irgendwo verborgen im Schutte meiner Erinnerung liegen muß und aussieht wie ein Stück Fett.
Eine Regenröhre muß einst neben ihm auf der Erde gemündet haben, male ich mir aus – stumpfwinklig abgebogen, die Ränder von Rost zerfressen, – und trotzig will ich mir im Geiste ein solches Bild erzwingen, um meine aufgescheuchten Gedanken zu belügen und in Schlaf zu lullen.
Es gelingt mir nicht.
Immer wieder und immer wieder mit alberner Beharrlichkeit behauptet eine eigensinnige Stimme in meinem Innern – unermüdlich wie ein Fensterladen, den der Wind in regelmäßigen Zwischenräumen an die Mauer schlagen läßt: es sei das ganz anders, das sei gar nicht der Stein, der wie Fett aussehe.
Und es ist von der Stimme nicht loszukommen.
Wenn ich hundertmal einwende, alles das sei doch ganz nebensächlich, so schweigt sie wohl eine kleine Weile, wacht aber dann unvermerkt wieder auf und beginnt hartnäckig von neuem: gut, gut, schon recht, es ist aber doch nicht der Stein, der wie ein Stück Fett aussieht. –
Langsam beginnt sich meiner ein unerträgliches Gefühl von Hilflosigkeit zu bemächtigen.
Wie es weiter gekommen ist, weiß ich nicht. Habe ich freiwillig jeden Widerstand aufgegeben, oder haben sie mich überwältigt und geknebelt, meine Gedanken?
Ich weiß nur, mein Körper liegt schlafend im Bett, und meine Sinne sind losgetrennt und nicht mehr an ihn gebunden. –
Wer ist jetzt ›ich‹, will ich plötzlich fragen; da besinne ich mich, daß ich doch kein Organ mehr besitze, mit dem ich Fragen stellen könnte; dann fürchte ich, die dumme Stimme werde wieder aufwachen und von neuem das endlose Verhör über den Stein und das Fett beginnen.
Und so wende ich mich ab.
Tag
Da stand ich plötzlich in einem düsteren Hofe und sah durch einen rötlichen Torbogen gegenüber – jenseits der engen, schmutzigen Straße – einen jüdischen Trödler an einem Gewölbe lehnen, das an den Mauerrändern mit altem Eisengerümpel, zerbrochenen Werkzeugen, verrosteten Steigbügeln und Schlittschuhen und vielerlei anderen abgestorbenen Sachen behangen war.
Und dieses Bild trug das quälend Eintönige an sich, das alle jene Eindrücke kennzeichnet, die tagtäglich so und so oft wie Hausierer die Schwelle unserer Wahrnehmung überschreiten, und rief in mir weder Neugierde noch Überraschung hervor.
Ich wurde mir bewußt, daß ich schon seit langer Zeit in dieser Umgebung zu Hause war.
Auch diese Empfindung hinterließ mir trotz ihres Gegensatzes zu dem, was ich doch vor kurzem noch wahrgenommen und wie ich hierher gelangt, keinerlei tieferen Eindruck. – –
Ich muß einmal von einem sonderbaren Vergleich zwischen einem Stein und einem Stück Fett gehört oder gelesen haben, drängte sich mir plötzlich der Einfall auf, als ich die ausgetretenen Stufen zu meiner Kammer emporstieg und mir über das speckige Aussehen der Steinschwellen flüchtige Gedanken machte.
Da hörte ich Schritte die oberen Treppen über mir vorauslaufen, und als ich zu meiner Tür kam, sah ich, daß es die vierzehnjährige, rothaarige Rosina des Trödlers Aaron Wassertrum gewesen war.
Ich mußte dicht an ihr vorbei, und sie stand mit dem Rücken gegen das Stiegengeländer und bog sich lüstern zurück.
Ihre schmutzigen Hände hatte sie um die Eisenstange gelegt, – zum Halt – und ich sah, wie ihre nackten Unterarme bleich aus dem trüben Halbdunkel hervorleuchteten.
Ich wich ihren Blicken aus.
Mich ekelte vor ihrem zudringlichen Lächeln und diesem wächsernen Schaukelpferdgesicht.
Sie muß schwammiges, weißes Fleisch haben wie der Axolotl, den ich vorhin im Salamanderkäfig bei dem Vogelhändler gesehen habe, fühlte ich.
Die Wimpern Rothaariger sind mir widerwärtig wie die eines Kaninchens.
Und ich sperrte auf und schlug rasch die Tür hinter mir zu. – –
Von meinem Fenster aus konnte ich den Trödler Aaron Wassertrum vor seinem Gewölbe stehen sehen.
Er lehnte am Eingang der dunklen Wölbung und zwickte mit einer Beißzange an seinen Fingernägeln herum.
War die rothaarige Rosina seine Tochter oder seine Nichte? Er hatte keine Ähnlichkeit mit ihr.
Unter den Judengesichtern, die ich Tag für Tag in der Hahnpaßgasse auftauchen sehe, kann ich deutlich verschiedene Stämme unterscheiden, die sich so wenig durch die nahe Verwandtschaft der einzelnen Individuen verwischen lassen, wie sich öl und Wasser vermengen wird. Da darf man nicht sagen: die dort sind Brüder oder Vater und Sohn.
Der gehört zu jenem Stamm und dieser zu einem andern, das ist alles, was sich aus den Gesichtszügen lesen läßt.
Was bewiese es auch, wenn selbst Rosina dem Trödler ähnlich sähe!
Diese Stämme hegen einen heimlichen Ekel und Abscheu voreinander, der sogar die Schranken der engen Blutsverwandtschaft durchbricht, – aber sie verstehen ihn geheimzuhalten vor der Außenwelt, wie man ein gefährliches Geheimnis hütet.
Kein einziges läßt ihn durchblicken, und in dieser Übereinstimmung gleichen sie haßerfüllten Blinden, die sich an ein schmutzgetränktes Seil klammern: der eine mit beiden Fäusten, ein anderer nur widerwillig mit einem Finger, alle aber von abergläubischer Furcht besessen, daß sie dem Untergang verfallen müssen, sobald sie den gemeinsamen Halt aufgeben und sich von den übrigen trennen.
Rosina ist von jenem Stamme, dessen rothaariger Typus noch abstoßender ist, als der der andern. Dessen Männer engbrüstig sind und lange Hühnerhälse haben mit vorstehendem Adamsapfel.
Alles scheint an ihnen sommersprossig, und ihr ganzes Leben leiden sie unter brünstigen Qualen, diese Männer, – und kämpfen heimlich gegen ihre Gelüste einen ununterbrochenen, erfolglosen Kampf, von immerwährender widerlicher Angst um ihre Gesundheit gefoltert.
Ich war mir nicht klar, wieso ich Rosina überhaupt in verwandtschaftliche Beziehungen mit dem Trödler Wassertrum bringen konnte.
Nie habe ich sie doch in der Nähe des Alten gesehen oder bemerkt, daß sie jemals einander etwas zugerufen hätten.
Auch war sie fast immer in unserem Hofe oder drückte sich in den dunklen Winkeln und Gängen unseres Hauses umher.
Sicherlich halten sie alle meine Mitbewohner für eine nahe Verwandte oder zumindest Schutzbefohlene des Trödlers, und doch bin ich überzeugt, daß kein einziger einen Grund für solche Vermutungen anzugeben vermöchte.
Ich wollte meine Gedanken von Rosina losreißen und sah von dem offenen Fenster meiner Stube hinab auf die Hahnpaßgasse.
Als habe Aaron Wassertrum meinen Blick gefühlt, wandte er plötzlich sein Gesicht zu mir empor.
Sein starres, gräßliches Gesicht mit den runden Fischaugen und der klaffenden Oberlippe, die von einer Hasenscharte gespalten ist.
Wie eine menschliche Spinne kam er mir vor, die die feinste Berührung ihres Netzes spürt, so teilnahmslos sie sich auch stellt.
Und wovon er nur leben mag? Was denkt er, und was ist sein Vorhaben?
Ich wußte es nicht.
An den Mauerrändern seines Gewölbes hängen unverändert Tag für Tag, jahraus jahrein dieselben toten wertlosen Dinge.
Mit geschlossenen Augen hätte ich sie hinzeichnen können: hier die verbogene Blechtrompete ohne Klappen, das vergilbte Bild auf Papier gemalt, mit den so sonderbar zusammengestellten Soldaten. Dann eine Girlande verrosteter Sporen an einem schimmligen Lederriemen und anderes halb vermodertes Gerümpel.
Und vorne auf dem Boden, dicht nebeneinander geschichtet, so daß niemand die Schwelle des Gewölbes überschreiten kann, eine Reihe runder eiserner Herdplatten. –
Alle diese Dinge nahmen an Zahl nie zu, nie ab, und blieb wirklich hier und da einmal ein Vorübergehender stehen und fragte nach dem Preis des einen oder andern, geriet der Trödler in heftige Erregung.
In grauenerregender Weise zog er dann seine Lippen mit der Hasenscharte empor und sprudelte gereizt irgend etwas Unverständliches in einem gurgelnden, stolpernden Baß hervor, daß dem Käufer die Lust weiter zu fragen verging und er abgeschreckt seinen Weg fortsetzte.
Der Blick des Aaron Wassertrum war blitzschnell von meinen Augen abgeglitten und ruhte jetzt mit gespanntem Interesse an den kahlen Mauern, die vom Nebenhause an mein Fenster stoßen.
Was konnte er dort nur sehen?
Das Haus steht doch mit dem Rücken gegen die Hahnpaßgasse, und seine Fenster blicken in den Hof! Nur eines ist in die Straße gekehrt.
Zufällig schienen die Räume, die nebenan in derselben Stockhöhe wie die meinigen liegen – ich glaube, sie gehören zu einem winkligen Atelier – in diesem Moment betreten worden zu sein, denn durch die Mauern hörte ich plötzlich eine männliche und eine weibliche Stimme miteinander reden.
Unmöglich konnte das aber der Trödler von unten aus wahrgenommen haben! – –
Vor meiner Tür bewegte sich jemand, und ich erriet: es ist immer noch Rosina, die draußen im Dunkeln steht in begehrlichem Warten, daß ich sie doch vielleicht zu mir hereinrufen wolle.
Und unten, ein halbes Stockwerk tiefer, lauert der blatternarbige, halbwüchsige Loisa auf den Stiegen mit angehaltenem Atem, ob ich die Tür öffnen werde, und ich spüre förmlich den Hauch seines Hasses und seine schäumende Eifersucht bis herauf zu mir.
Er fürchtet sich näher zu kommen und von Rosina bemerkt zu werden. Er weiß sich von ihr abhängig wie ein hungriger Wolf von seinem Wärter und möchte doch am liebsten aufspringen und besinnungslos seiner Wut die Zügel schießen lassen! – – –
Ich setzte mich an meinen Arbeitstisch und suchte meine Pinzetten und Stichel hervor.
Aber ich konnte nichts fertigbringen und meine Hand war nicht ruhig genug, die feinen japanischen Gravierungen auszubessern.
Das trübe, düstere Leben, das an diesem Hause hängt, läßt mein Gemüt nicht stillwerden, und immer tauchen alte Bilder in mir auf.
Loisa und sein Zwillingsbruder Jaromir sind wohl kaum ein Jahr älter als Rosina.
An ihren Vater, der Hostienbäcker gewesen, konnte ich mich kaum mehr erinnern, und jetzt sorgt für sie, glaube ich, ein altes Weib.
Ich wußte nur nicht, welche es war unter den vielen, die versteckt im Hause wohnen wie Kröten in ihrem Schlupfwinkel.
Sie sorgt für die beiden Jungen, das heißt: sie gewährt ihnen Unterkunft; dafür müssen sie ihr abliefern, was sie gelegentlich stehlen oder erbetteln. –
Ob sie ihnen wohl auch zu essen gibt? Ich konnte es mir nicht denken, denn erst spät abends kommt die Alte heim.
Leichenwäscherin soll sie sein.
Loisa, Jaromir und Rosina sah ich, als sie noch Kinder waren, oft harmlos im Hof zu dritt spielen.
Die Zeit aber ist lang vorbei.
Den ganzen Tag ist Loisa jetzt hinter dem rothaarigen Judenmädel her.
Zuweilen sucht er sie lange umsonst, und wenn er sie nirgends finden kann, dann schleicht er sich vor meine Tür und wartet mit verzerrtem Gesicht, daß sie heimlich hierher komme.
Da sehe ich ihn, wenn ich bei meiner Arbeit sitze, im Geiste draußen in dem winkligen Gange lauern, den Kopf mit dem ausgemergelten Genick horchend vorgebeugt.
Manchmal bricht dann durch die Stille plötzlich ein wilder Lärm.
Jaromir, der taubstumm ist, und dessen ganzes Denken eine ununterbrochene wahnsinnige Gier nach Rosina erfüllt, irrt wie ein wildes Tier im Hause umher, und sein unartikuliertes heulendes Gebell, das er, vor Eifersucht und Argwohn halb von Sinnen, ausstößt, klingt so schauerlich, daß einem das Blut in den Adern stockt.
Er sucht die beiden, die er stets beieinander vermutet – irgendwo in einem der tausend schmutzigen Schlupfwinkel versteckt – in blinder Raserei, immer von dem Gedanken gepeitscht, seinem Bruder auf den Fersen sein zu müssen, daß nichts mit Rosina vorgehe, von dem er nicht wisse.
Und gerade diese unaufhörliche Qual des Krüppels ist, ahnte ich, das Reizmittel, das Rosina antreibt, sich stets von neuem mit dem andern einzulassen.
Wird ihre Neigung oder Bereitwilligkeit schwächer, so ersinnt Loisa immer wieder besondere Scheußlichkeiten, um Rosinas Gier von neuem zu entfachen.
Da lassen sie sich scheinbar oder wirklich von dem Taubstummen ertappen und locken den Rasenden heimtückisch hinter sich her in dunkle Gänge, wo sie aus rostigen Faßreifen, die in die Höhe schnellen, wenn man auf sie tritt, und eisernen Rechen – mit den Spitzen nach oben gekehrt – bösartige Fallen errichtet haben, in die er stürzen muß und sich blutig fällt.
Von Zeit zu Zeit denkt sich Rosina, um die Folter aufs äußerste anzuspannen, auf eigene Faust etwas Höllisches aus.
Dann ändert sie mit einem Schlage ihr Benehmen zu Jaromir und tut, als fände sie plötzlich Gefallen an ihm.
Mit ihrer ewig lächelnden Miene teilt sie dem Krüppel hastig Dinge mit, die ihn in eine fast irrsinnige Erregung versetzen, und sie hat sich dazu eine geheimnisvoll scheinende, nur halbverständliche Zeichensprache ersonnen, die den Taubstummen rettungslos in ein unentwirrbares Netz von Ungewißheit und verzehrenden Hoffnungen verstricken muß. –
Einmal sah ich ihn im Hofe vor ihr stehen, und sie sprach mit so heftigen Lippenbewegungen und Gestikulationen auf ihn ein, daß ich glaubte, jeden Augenblick würde er in wilder Aufregung zusammenbrechen.
Der Schweiß lief ihm übers Gesicht vor übermenschlicher Anstrengung, den Sinn der absichtlich so unklaren, hastigen Mitteilungen zu erfassen.
Und den ganzen folgenden Tag lauerte er dann fiebernd in Erwartung auf den finsteren Stiegen eines halb versunkenen Hauses, das in der Fortsetzung der engen, schmutzigen Hahnpaßgasse liegt, – bis er die Zeit versäumt hatte, sich an den Ecken ein paar Kreuzer zu erbetteln.
Und als er spät abends halbtot vor Hunger und Aufregung heim wollte, hatte ihn die Pflegemutter längst ausgesperrt. – – –
Ein fröhliches Frauenlachen drang aus dem anstoßenden Atelier durch die Mauern herüber zu mir.
Ein Lachen! – In diesen Häusern ein fröhliches Lachen? Im ganzen Getto wohnt niemand, der fröhlich lachen könnte.
Da fiel mir ein, daß mir vor einigen Tagen der alte Marionettenspieler Zwakh anvertraute, ein junger, vornehmer Herr hätte ihm das Atelier teuer abgemietet – offenbar, um mit der Erwählten seines Herzens unbelauscht zusammenkommen zu können.
Nach und nach, jede Nacht, müßten nun, damit niemand im Hause etwas merke, die kostbaren Möbel des neuen Mieters heimlich Stück für Stück hinaufgeschafft werden.
Der gutmütige Alte hatte sich vor Vergnügen die Hände gerieben, als er es mir erzählte, und sich kindlich gefreut, wie er alles so geschickt angefangen habe: keiner der Mitbewohner könne auch nur eine Ahnung von dem romantischen Liebespaar haben.
Und von drei Häusern aus sei es möglich, unauffällig in das Atelier zu gelangen. – Sogar durch eine Falltüre gäbe es einen Zugang!
Ja, wenn man die eiserne Tür des Bodenraumes aufklinke, – und das sei von drüben aus sehr leicht, – könne man an meiner Kammer, vorbei zu den Stiegen unseres Hauses gelangen und diese als Ausgang benützen …
Wieder klingt das fröhliche Lachen herüber und läßt in mir die undeutliche Erinnerung an eine luxuriöse Wohnung und an eine adlige Familie auftauchen, zu der ich oft gerufen wurde, um an kostbaren Altertümern kleine Ausbesserungen vorzunehmen. –
Plötzlich höre ich nebenan einen gellenden Schrei. Ich horche erschreckt.
Die eiserne Bodentür klirrt heftig, und im nächsten Augenblick stürzt eine Dame in mein Zimmer.
Mit aufgelöstem Haar, weiß wie die Wand, einen goldenen Brokatstoff über die bloßen Schultern geworfen.
»Meister Pernath, verbergen Sie mich, – um Gottes Christi willen! – fragen Sie nicht, verbergen Sie mich hier!«
Ehe ich noch antworten konnte, wurde meine Tür abermals aufgerissen und sofort wieder zugeschlagen. –
Eine Sekunde lang hatte das Gesicht des Trödlers Aaron Wassertrum wie eine scheußliche Maske hereingegrinst. –
Ein runder, leuchtender Fleck taucht vor mir auf, und im Schein des Mondlichtes erkenne ich wiederum das Fußende meines Bettes. Noch liegt der Schlaf auf mir wie ein schwerer, wolliger Mantel und der Name Pernath steht in goldenen Buchstaben vor meiner Erinnerung.
Wo nur habe ich diesen Namen gelesen? – Athanasius Pernath?
Ich glaube, ich glaube vor langer, langer Zeit habe ich einmal irgendwo meinen Hut verwechselt, und ich wunderte mich damals, daß er mir so genau passe, wo ich doch eine höchst eigentümliche Kopfform habe.
Und ich sah in den fremden Hut hinein – damals und – – ja, ja, dort hatte es gestanden in goldenen Papierbuchstaben auf dem weißen Futter:
ATHANASIUS PERNATH.
Ich hatte mich vor dem Hut gescheut und gefürchtet, ich wußte nicht warum.
Da fährt plötzlich die Stimme, die ich vergessen hatte, und die immer von mir wissen wollte, wo der Stein ist, der wie Fett ausgesehen habe, auf mich los, gleich einem Pfeil.
Schnell male ich mir das scharfe, süßlich grinsende Profil der roten Rosina aus, und es gelingt mir auf diese Weise, dem Pfeil auszuweichen, der sich sogleich in der Finsternis verliert.
Ja, das Gesicht der Rosina! Das ist doch noch stärker als die stumpfsinnige plappernde Stimme; und gar, wo ich jetzt gleich wieder in meinem Zimmer in der Hahnpaßgasse geborgen sein werde, kann ich ganz ruhig sein.
I
Wenn ich mich nicht getäuscht habe in der Empfindung, daß jemand in einem gewissen, gleichbleibenden Abstand hinter mir die Treppe heraufkommt, in der Absicht, mich zu besuchen, so muß er jetzt ungefähr auf dem letzten Stiegenabsatz stehen.
Jetzt biegt er um die Ecke, wo der Archivar Schemajah Hillel seine Wohnung hat, und kommt von den ausgetretenen Steinfliesen auf den Flur des oberen Stockwerkes, der mit roten Ziegeln ausgelegt ist.
Nun tastet er sich an der Wand entlang, und jetzt, gerade jetzt, muß er, mühsam im Finstern buchstabierend, meinen Namen auf dem Türschild lesen.
Und ich stellte mich aufrecht in die Mitte des Zimmers und blickte zum Eingang.
Da öffnete sich die Türe, und er trat ein.
Nur wenige Schritte machte er auf mich zu und nahm weder den Hut ab, noch sagte er ein Wort der Begrüßung.
So benimmt er sich, wenn er zu Hause ist, fühlte ich, und ich fand es ganz selbstverständlich, daß er so und nicht anders handelte.
Er griff in die Tasche und nahm ein Buch heraus.
Dann blätterte er lange drin herum.
Der Umschlag des Buches war aus Metall, und die Vertiefungen in Form von Rosetten und Siegeln waren mit Farbe und kleinen Steinen ausgefüllt.
Endlich hatte er die Stelle gefunden, die er suchte, und deutete darauf.
Das Kapitel hieß ›Ibbur‹, ›die Seelenschwängerung‹, entzifferte ich.
Das große, in Gold und Rot ausgeführte Initial ›I‹ nahm fast die Hälfte der ganzen Seite ein, die ich unwillkürlich überflog, und war am Rande verletzt.
Ich sollte es ausbessern.
Das Initial war nicht auf das Pergament geklebt, wie ich es bisher in alten Büchern gesehen, schien vielmehr aus zwei Platten dünnen Goldes zu bestehen, die im Mittelpunkte zusammengelötet waren und mit den Enden um die Ränder des Pergaments griffen.
Also mußte, wo der Buchstabe stand, ein Loch in das Blatt geschnitten sein?
Wenn das der Fall war, mußte auf der nächsten Seite das ›I‹ verkehrt stehen?
Ich blätterte um und fand meine Annahme bestätigt.
Unwillkürlich las ich auch diese Seite durch und die gegenüberliegende.
Und ich las weiter und weiter.
Das Buch sprach zu mir, wie der Traum spricht, klarer nur und viel deutlicher. Und es rührte mein Herz an wie eine Frage.
Worte strömten aus einem unsichtbaren Munde, wurden lebendig und kamen auf mich zu. Sie drehten sich und wandten sich vor mir wie buntgekleidete Sklavinnen, sanken dann in den Boden oder verschwanden wie schillernder Dunst in der Luft und gaben der nächsten Raum. Jede hoffte eine kleine Weile, daß ich sie erwählen würde und auf den Anblick der Kommenden verzichten.
Manche waren unter ihnen, die gingen prunkend einher wie Pfauen, in schimmernden Gewändern, und ihre Schritte waren langsam und gemessen.
Manche wie Königinnen, doch gealtert und verlebt, die Augenlider gefärbt, – mit dirnenhaftem Zug um den Mund und die Runzeln mit häßlicher Schminke verdeckt.
Ich sah an ihnen vorbei und nach den kommenden, und mein Blick glitt über lange Züge grauer Gestalten mit Gesichtern, so gewöhnlich und ausdrucksarm, daß es unmöglich schien, sie dem Gedächtnis einzuprägen.
Dann brachten sie ein Weib geschleppt, das war splitternackt und riesenhaft wie ein Erzkoloß.
Eine Sekunde blieb das Weib vor mir stehen und beugte sich nieder zu mir.
Ihre Wimpern waren so lang wie mein ganzer Körper, und sie deutete stumm auf den Puls ihrer linken Hand.
Der schlug wie ein Erdbeben, und ich fühlte, es war das Leben einer ganzen Welt in ihr.
Aus der Ferne raste ein Korybantenzug heran.
Ein Mann und ein Weib umschlangen sich. Ich sah sie von weitem kommen, und immer näher brauste der Zug.
Jetzt hörte ich den hallenden Gesang der Verzückten dicht vor mir, und meine Augen suchten das verschlungene Paar.
Das aber hatte sich verwandelt in eine einzige Gestalt und saß, halb männlich, halb weiblich, – ein Hermaphrodit – auf einem Throne von Perlmutter.
Und die Krone des Hermaphroditen endete in einem Brett aus rotem Holz; darein hatte der Wurm der Zerstörung geheimnisvolle Runen genagt.
In einer Staubwolke kam eilig hinterdreingetrappelt eine Herde kleiner, blinder Schafe: die Futtertiere, die der gigantische Zwitter in seinem Gefolge führte, seine Korybantenschar am Leben zu erhalten.
Zuweilen waren unter den Gestalten, die aus dem unsichtbaren Munde strömten, etliche, die kamen aus Gräbern, – Tücher vor dem Gesicht.
Und blieben sie vor mir stehen, ließen sie plötzlich ihre Hüllen fallen und starrten mit Raubtieraugen hungrig auf mein Herz, daß ein eisiger Schreck mir ins Hirn fuhr und sich mein Blut zurückstaute wie ein Strom, in den Felsblöcke vom Himmel herniedergefallen sind – plötzlich und mitten in sein Bette. –
Eine Frau schwebte an mir vorbei. Ich sah ihr Antlitz nicht, sie wandte es ab, und sie trug einen Mantel aus fließenden Tränen. –
Maskenzüge tanzten vorüber, lachten und kümmerten sich nicht um mich.
Nur ein Pierrot sieht sich nachdenklich um nach mir und kehrt zurück. Pflanzt sich vor mich hin und blickt in mein Gesicht hinein, als sei es ein Spiegel.
Er schneidet so seltsame Grimassen, hebt und bewegt seine Arme, bald zögernd, bald blitzschnell, daß sich meiner ein gespenstiger Trieb bemächtigt ihn nachzuahmen, mit den Augen zu zwinkern, mit den Achseln zu zucken und die Mundwinkel zu verziehen.
Da stoßen ihn ungeduldig nachdrängende Gestalten zur Seite, die alle vor meine Blicke wollen.
Doch keines der Wesen hat Bestand.
Gleitende Perlen sind sie, auf eine Seidenschnur gereiht, die einzelnen Töne nur einer Melodie, die dem unsichtbaren Mund entströmen.
Das war kein Buch mehr, das zu mir sprach. Das war eine Stimme. Eine Stimme, die etwas von mir wollte, was ich nicht begriff; wie sehr ich mich auch abmühte. Die mich quälte mit brennenden, unverständlichen Fragen.
Die Stimme aber, die diese sichtbaren Worte redete, war abgestorben und ohne Widerhall.
Jeder Laut, der in der Welt der Gegenwart erklingt, hat viele Echos, wie jegliches Ding einen großen Schatten hat und viele kleine Schatten, doch diese Stimme hatte keine Echos mehr, – lange, lange schon sind sie wohl verweht und verklungen. – – –
Und bis zu Ende hatte ich das Buch gelesen und hielt es noch in den Händen, da war mir, als hätte ich suchend in meinem Gehirn geblättert und nicht in einem Buche! – –
Alles, was mir die Stimme gesagt, hatte ich, seit ich lebte, in mir getragen, nur verdeckt war es gewesen und vergessen und hatte sich vor meinem Denken versteckt gehalten bis auf den heutigen Tag. –
Ich blickte auf.
Wo war der Mann, der mir das Buch gebracht hatte?
Fortgegangen!?
Wird er es holen, wenn es fertig ist?
Oder sollte ich es ihm bringen? –
Aber ich konnte mich nicht erinnern, daß er gesagt hätte, wo er wohne.
Ich wollte mir seine Erscheinung ins Gedächtnis zurückrufen, doch es mißlang.
Wie war er nur gekleidet gewesen? War er alt, war er jung? – Und welche Farben hatten sein Haar und sein Bart gehabt?
Nichts, gar nichts mehr konnte ich mir vorstellen. – Alle Bilder, die ich mir von ihm schuf, zerrannen haltlos, noch ehe ich sie im Geiste zusammenzusetzen vermochte.
Ich schloß die Augen und preßte die Hand auf die Lider, um einen winzigen Teil nur seines Bildnisses zu erhaschen.
Nichts, nichts.
Ich stellte mich hin, mitten ins Zimmer, und blickte auf die Tür, wie ich es getan – vorhin, als er gekommen war, und malte mir aus: jetzt biegt er um die Ecke, jetzt schreitet er über den Ziegelsteinboden, liest jetzt draußen mein Türschild »Athanasius Pernath« und jetzt tritt er herein.
Vergebens.
Nicht die leiseste Spur einer Erinnerung, wie seine Gestalt ausgesehen, wollte in mir erwachen.
Ich sah das Buch auf dem Tische liegen und wünschte mir im Geiste die Hand dazu, die es aus der Tasche gezogen und mir gereicht hatte.
Nicht einmal, ob sie einen Handschuh getragen, ob sie entblößt gewesen, ob jung oder runzlig, mit Ringen geschmückt oder nicht, konnte ich mich entsinnen.
Da kam mir ein seltsamer Einfall.
Wie eine Eingebung war es, der man nicht widerstehen darf.
Ich zog meinen Mantel an, setzte meinen Hut auf und ging hinaus auf den Gang und die Treppen hinab. Dann kam ich langsam wieder zurück in mein Zimmer.
Langsam, ganz langsam, so wie er, als er gekommen war. Und als ich die Tür öffnete, da sah ich, daß meine Kammer voll Dämmerung lag. War es denn nicht heller Tag noch gewesen, als ich soeben hinausging?
Wie lange mußte ich da gegrübelt haben, daß ich nicht bemerkte, wie spät es ist!
Und ich versuchte den Unbekannten nachzuahmen in Gang und Mienen und konnte mich an sie doch gar nicht erinnern. –
Wie sollte es mir auch glücken, ihn nachzuahmen, wenn ich keinen Anhaltspunkt mehr hatte, wie er ausgesehen haben mochte.
Aber es kam anders. Ganz anders, als ich dachte.
Meine Haut, meine Muskeln, mein Körper erinnerten sich plötzlich, ohne es dem Gehirn zu verraten. Sie machten Bewegungen, die ich nicht wünschte und nicht beabsichtigte.
Als ob meine Glieder nicht mehr mir gehörten!
Mit einem Male war mein Gang tappend und fremdartig geworden, als ich ein paar Schritte im Zimmer machte.
Das ist der Gang eines Menschen, der beständig im Begriffe ist, vornüber zu fallen, sagte ich mir.
Ja, ja, ja, so war sein Gang!
Ganz deutlich wußte ich: so ist er.
Ich trug ein fremdes, bartloses Gesicht mit hervorstehenden Backenknochen und schaute aus schrägstehenden Augen.
Ich fühlte es und konnte mich doch nicht sehen.
Das ist nicht mein Gesicht, wollte ich entsetzt aufschreien, wollte es betasten, doch meine Hand folgte meinem Willen nicht und senkte sich in die Tasche und holte ein Buch hervor.
Ganz so, wie er es vorhin getan hatte. –
Da plötzlich sitze ich wieder ohne Hut, ohne Mantel, am Tische und bin ich. Ich, ich.
Athanasius Pernath.
Grausen und Entsetzen schüttelten mich, mein Herz raste zum Zerspringen, und ich fühlte: gespenstische Finger, die soeben noch in meinem Gehirn herumgetastet, haben von mir abgelassen.
Noch spürte ich im Hinterkopf die kalten Spuren ihrer Berührung. –
Nun wußte ich, wie der Fremde war, und ich hätte ihn wieder in mir fühlen können, – jeden Augenblick – wenn ich nur gewollt hätte; aber sein Bild mir vorzustellen, daß ich es vor mir sehen würde Auge in Auge – das vermochte ich noch immer nicht und werde es auch nie können.
Es ist wie ein Negativ, eine unsichtbare Hohlform, erkannte ich, deren Linien ich nicht erfassen kann – in die ich selber hineinschlüpfen muß, wenn ich mir ihrer Gestalt und ihres Ausdrucks im eigenen Ich bewußt werden will – –
In der Schublade meines Tisches stand eine eiserne Kassette; – in diese wollte ich das Buch sperren und erst, wenn der Zustand der geistigen Krankheit von mir gewichen sein würde, wollte ich es wieder hervorholen und an die Ausbesserung des zerbrochenen Initialen ›I‹ gehen.
Und ich nahm das Buch vom Tisch.
Da war mir, als hätte ich es gar nicht angefaßt; ich griff die Kassette an: dasselbe Gefühl. Als müßte das Tastempfinden eine lange, lange Strecke voll tiefer Dunkelheit durchlaufen, ehe es in meinem Bewußtsein mündete, als seien die Dinge durch eine jahresgroße Zeitschicht von mir entfernt und gehörten einer Vergangenheit an, die längst an mir vorübergezogen!
Die Stimme, die nach mir suchend in der Finsternis kreist, um mich mit dem fettigen Stein zu quälen, ist an mir vorbeigekommen und hat mich nicht gesehen. Und ich weiß, daß sie aus dem Reiche des Schlafes stammt. Aber was ich erlebt, das war wirkliches Leben, – darum konnte sie mich nicht sehen und sucht vergeblich nach mir, fühle ich.
Prag
Neben mir stand der Student Charousek, den Kragen seines dünnen, fadenscheinigen Überziehers aufgeschlagen, und ich hörte, wie ihm vor Kälte die Zähne aufeinanderschlugen.
Er kann sich den Tod holen in diesem zugigen, eisigen Torbogen, sagte ich mir, und ich forderte ihn auf, mit hinüber in meine Wohnung zu kommen.
Er aber lehnte ab.
»Ich danke Ihnen, Meister Pernath«, murmelte er fröstelnd, »leider habe ich nicht mehr so viel Zeit übrig; – ich muß eilends in die Stadt. – Auch würden wir bis auf die Haut naß, wenn wir jetzt auf die Gasse treten wollten – schon nach wenigen Schritten! – – Der Platzregen will nicht schwächer werden!«
Die Wasserschauer fegten über die Dächer hin und liefen an den Gesichtern der Häuser herunter wie ein Tränenstrom.
Wenn ich den Kopf ein wenig vorbog, konnte ich da drüben im vierten Stock mein Fenster sehen, das, vom Regen überrieselt, aussah, als seien seine Scheiben aufgeweicht, – undurchsichtig und höckerig geworden wie Hausenblase.
Ein gelber Schmutzbach floß die Gasse herab, und der Torbogen füllte sich mit Vorübergehenden, die alle das Nachlassen des Unwetters abwarten wollten.
»Dort schwimmt ein Brautbukett«, sagte plötzlich Charousek und deutete auf einen Strauß aus welken Myrten, der in dem Schmutzwasser vorbeigetrieben kam.
Darüber lachte jemand hinter uns laut auf.
Als ich mich umdrehte, sah ich, daß es ein alter, vornehm gekleideter Herr mit weißem Haar und einem aufgedunsenen, krötenartigen Gesicht gewesen war.
Charousek blickte ebenfalls einen Augenblick zurück und brummte etwas vor sich hin.
Unangenehmes ging von dem Alten aus; – ich wandte meine Aufmerksamkeit von ihm ab und musterte die mißfarbigen Häuser, die da vor meinen Augen wie verdrossene alte Tiere im Regen nebeneinander hockten.
Wie unheimlich und verkommen sie alle aussahen!
Ohne Überlegung hingebaut standen sie da, wie Unkraut, das aus dem Boden dringt.
An eine niedrige, gelbe Steinmauer, den einzigen standhaltenden Überrest eines früheren, langgestreckten Gebäudes, hat man sie angelehnt – vor zwei, drei Jahrhunderten, wie es eben kam, ohne Rücksicht auf die übrigen zu nehmen. Dort ein halbes, schiefwinkliges Haus mit zurückspringender Stirn; – ein andres daneben: vorstehend wie ein Eckzahn.
Unter dem trüben Himmel sahen sie aus, als lägen sie im Schlaf, und man spülte nichts von dem tückischen, feindseligen Leben, das zuweilen von ihnen ausstrahlt, wenn der Nebel der Herbstabende in den Gassen liegt und ihr leises, kaum merkliches Mienenspiel verbergen hilft.
In dem Menschenalter, das ich nun hier wohne, hat sich der Eindruck in mir festgesetzt, den ich nicht loswerden kann, als ob es gewisse Stunden des Nachts und im frühesten Morgengrauen für sie gäbe, wo sie erregt eine lautlose, geheimnisvolle Beratung pflegen. Und manchmal fährt da ein schwaches Beben durch ihre Mauern, das sich nicht erklären läßt, Geräusche laufen über ihre Dächer und fallen in den Regenrinnen nieder, – und wir nehmen sie mit stumpfen Sinnen achtlos hin, ohne nach ihrer Ursache zu forschen.
Oft träumte mir, ich hätte diese Häuser belauscht in ihrem spukhaften Treiben und mit angstvollem Staunen erfahren, daß sie die heimlichen, eigentlichen Herren der Gasse seien, sich ihres Lebens und Fühlens entäußern und es wieder an sich ziehen können, – es tagsüber den Bewohnern, die hier hausen, borgen, um es in kommender Nacht mit Wucherzinsen wieder zurückzufordern.
Und lasse ich die seltsamen Menschen, die in ihnen wohnen wie Schemen, wie Wesen – nicht von Müttern geboren, – die in ihrem Denken und Tun wie aus Stücken wahllos zusammengefügt scheinen, im Geiste an mir vorüberziehen, so bin ich mehr denn je geneigt zu glauben, daß solche Träume in sich dunkle Wahrheiten bergen, die mir im Wachsein nur noch wie Eindrücke von farbigen Märchen in der Seele fortglimmen.
Dann wacht in mir heimlich die Sage von dem gespenstischen Golem, jenem künstlichen Menschen, wieder auf, den einst hier im Getto ein kabbalakundiger Rabbiner aus dem Elemente formte und ihn zu einem gedankenlosen automatischen Dasein berief, indem er ihm ein magisches Zahlenwort hinter die Zähne schob.
Und wie jener Golem zu einem Lehmbild in derselben Sekunde erstarrte, in der die geheime Silbe des Lebens aus seinem Munde genommen ward, so müßten auch, dünkt mich, alle diese Menschen entseelt in einem Augenblick zusammenfallen, löschte man irgendeinen winzigen Begriff, ein nebensächliches Streben, vielleicht eine zwecklose Gewohnheit bei dem einen, bei einem andern gar nur ein dumpfes Warten auf etwas gänzlich Unbestimmtes, Haltloses – in ihrem Hirn aus.
Was ist dabei für ein immerwährendes, schreckhaftes Lauern in diesen Geschöpfen!
Niemals sieht man sie arbeiten, diese Menschen, und dennoch sind sie früh beim ersten Leuchten des Morgens wach und warten mit angehaltenem Atem – wie auf ein Opfer, das doch nie kommt.
Und hat es wirklich einmal den Anschein, als träte jemand in ihren Bereich, irgendein Wehrloser, an dem sie sich bereichern könnten, dann fällt plötzlich eine lähmende Angst über sie her, scheucht sie in ihre Winkel zurück und läßt sie von jeglichem Vorhaben zitternd abstehen.
Niemand scheint schwach genug, daß ihnen noch so viel Mut bliebe, sich seiner zu bemächtigen.
»Entartete, zahnlose Raubtiere, von denen die Kraft und die Waffe genommen ist«, sagte Charousek zögernd und sah mich an. –
Wie konnte er wissen, woran ich dachte? –
So stark facht man zuweilen seine Gedanken an, daß sie imstande sind, auf das Gehirn des Nebenstehenden überzuspringen wie sprühende Funken, fühlte ich.
»– – – wovon sie nur leben mögen?« sagte ich nach einer Weile.
»Leben? Wovon? Mancher unter ihnen ist ein Millionär!«
Ich blickte Charousek an. Was konnte er damit meinen!
Der Student aber schwieg und sah nach den Wolken.
Für einen Augenblick hatte das Stimmengemurmel in dem Torbogen gestockt, und man hörte bloß das Zischen des Regens.
Was er nur damit sagen will: »Mancher unter ihnen ist ein Millionär!?«
Wieder war es, als hätte Charousek meine Gedanken erraten. Er wies nach dem Trödlerladen neben uns, an dem das Wasser den Rost des Eisengerümpels in fließenden, braunroten Pfützen vorbeispülte.
»Aaron Wassertrum! Er zum Beispiel ist Millionär, – fast ein Drittel der Judenstadt ist sein Besitz. Wissen Sie es denn nicht, Herr Pernath?!«
Mir blieb förmlich der Atem im Mund stecken. »Aaron Wassertrum! Der Trödler Aaron Wassertrum Millionär?!«
»Oh, ich kenne ihn genau«, fuhr Charousek verbissen fort, und als hätte er nur darauf gewartet, daß ich ihn frage. »Ich kannte auch seinen Sohn, den Dr. Wassory. Haben Sie nie von ihm gehört? Von Dr. Wassory, dem – berühmten – Augenarzt? – Vor einem Jahr noch hat die ganze Stadt begeistert von ihm gesprochen, – von dem großen – – Gelehrten. Niemand wußte damals, daß er seinen Namen abgelegt und früher Wassertrum geheißen. – Er spielte sich gerne auf den weitabgewandten Mann der Wissenschaft hinaus, und wenn einmal auf Herkunft die Rede kam, warf er bescheiden und tiefbewegt so mit halben Worten hin, daß sein Vater noch aus dem Getto stamme, – sich aus den niedrigsten Anfängen heraus unter Kummer aller Art und unsäglichen Sorgen empor ans Licht habe arbeiten müssen.
Ja! Unter Kummer und Sorgen!
Unter wessen Kummer und unsäglichen Sorgen aber und mit welchen Mitteln, das hat er nicht dazu gesagt!
Ich aber weiß, was es mit dem Getto für eine Bewandtnis hat!« Charousek faßte meinen Arm und schüttelte ihn heftig.
»Meister Pernath, ich bin so arm, daß ich es selbst kaum mehr begreife; ich muß halbnackt gehen wie ein Vagabund, sehen Sie her, und ich bin doch Student der Medizin, – bin doch ein gebildeter Mensch!«
Er riß seinen Überzieher auf und ich sah zu meinem Entsetzen, daß er weder Hemd noch Rock anhatte und den Mantel über der nackten Haut trug.
»Und so arm war ich bereits, als ich diese Bestie, diesen allmächtigen, angesehenen Dr. Wassory zu Fall brachte, – und noch heute ahnt keiner, daß ich, ich der eigentliche Urheber war.
Man meint in der Stadt, ein gewisser Dr. Savioli sei es gewesen, der seine Praktiken ans Tageslicht gezogen und ihn dann zum Selbstmord getrieben hat. – Dr. Savioli war nichts als mein Werkzeug, sage ich Ihnen. Ich allein habe den Plan erdacht und das Material zusammengetragen, habe die Beweise geliefert und leise und unmerklich Stein um Stein in dem Gebäude Dr. Wassorys gelockert, bis der Zustand erreicht war, wo kein Geld der Erde, keine List des Gettos mehr vermocht hätten, den Zusammenbruch, zu dem es nur noch eines unmerklichen Anstoßes bedurfte, abzuwenden.
Wissen Sie, so – so wie man Schach spielt.
Gerade so wie man Schach spielt.
Und niemand weiß, daß ich es war!
Den Trödler Aaron Wassertrum, den läßt wohl manchmal eine furchtbare Ahnung nicht schlafen, daß einer, den er nicht kennt, der immer in seiner Nähe ist und den er doch nicht fassen kann, – ein anderer als Dr. Savioli – die Hand im Spiele gehabt haben müsse.
Wiewohl Wassertrum einer von jenen ist, deren Augen durch Mauern zu schauen vermögen, so faßt er es doch nicht, daß es Gehirne gibt, die auszurechnen imstande sind, wie man mit langen, unsichtbaren, vergifteten Nadeln durch solche Mauern stechen kann, an Quadern, an Gold und Edelsteinen vorbei, um die verborgene Lebensader zu treffen.«
Und Charousek schlug sich vor die Stirn und lachte wild.
»Aaron Wassertrum wird es bald erfahren; genau an dem Tage, an dem er Dr. Savioli an den Hals will! Genau an demselben Tage!
Auch diese Schachpartie habe ich ausgerechnet bis zum letzten Zug. – Diesmal wird es ein Königsläufergambit sein. Da gibt es keinen einzigen Zug bis zum bittern Ende, gegen den ich nicht eine verderbliche Entgegnung wüßte.
Wer sich mit mir in ein solches Königsläufergambit einläßt, der hängt in der Luft, sage ich Ihnen, wie eine hilflose Marionette an feinen Fäden, – an Fäden, die ich zupfe, – hören Sie wohl, die ich zupfe, und mit dessen freiem Willen ist’s dahin.«
Der Student redete wie im Fieber, und ich sah ihm entsetzt ins Gesicht.
»Was haben Ihnen Wassertrum und sein Sohn denn getan, daß Sie so voll Haß sind?«
Charousek wehrte heftig ab:
»Lassen wir das – fragen Sie lieber, was Dr. Wassory den Hals gebrochen hat! – Oder wünschen Sie, daß wir ein andres Mal darüber sprechen? – Der Regen hat nachgelassen. Vielleicht wollen Sie nach Hause gehen?«
Er senkte seine Stimme, wie jemand, der plötzlich ganz ruhig wird. Ich schüttelte den Kopf.
»Haben Sie jemals gehört, wie man heutzutage den grünen Star heilt? – Nicht? – So muß ich Ihnen das deutlich machen, damit Sie alles genau verstehen, Meister Pernath!