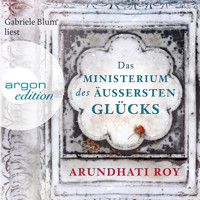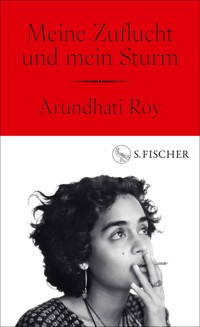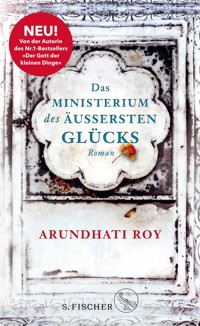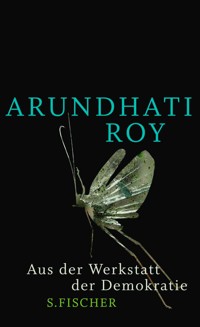9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem Bestsellerroman ›Der Gott der kleinen Dinge‹ erzählt Arundhati Roy die schillernde Geschichte einer Familie, die an einer verbotenen Liebe zerbricht. Als die 31-jährige Rahel nach vielen Jahren zurückkehrt in ihr Heimatdorf im südindischen Kerala, ist nichts mehr, wie es einst war. Die Konservenfabrik der Familie verfallen, die geliebte Mutter tot, der Zwillingsbruder verstummt. Zurückgeblieben sind nur die Erinnerungen an eine Kindheit am Fluss, an die bewundernde Liebe zu Velutha, dem dunklen Angestellten ihrer Großmutter, und an einen tragischen Tag im Jahr 1969, der alles veränderte. Eine magische Geschichte vor dem Hintergrund der politischen Umbrüche Indiens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Arundhati Roy
Der Gott der kleinen Dinge
Roman
Über dieses Buch
Als die einunddreißigjährige Rahel nach vielen Jahren zurückkehrt in ihr Heimatdorf im südindischen Kerala, ist nichts mehr, wie es einst war. Die Konservenfabrik der Familie verfallen, die geliebte Mutter tot, der Zwillingsbruder verstummt. Zurückgeblieben sind nur die Erinnerungen an eine Kindheit am Fluss, an die bewundernde Liebe zu Velutha, dem dunklen Angestellten ihrer Großmutter, und an einen tragischen Tag im Jahr 1969, der alles veränderte.
»Geschickt komponiert Arundhati Roy eine kleine Geschichte aus vielen unscheinbaren Zufälligkeiten, dass am Schluss eine große Geschichte entsteht.« Literarisches Quartett
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arundhati Roy, geboren 1959, wuchs in Kerala auf und lebt in Neu-Dehli. Den internationalen Durchbruch schaffte sie mit ihrem Debüt »Der Gott der kleinen Dinge«, für das sie 1997 den Booker Prize erhielt. In den letzten zehn Jahren widmete sie sich außer ihrem politischen und humanitären Engagement vor allem ihrem zweiten Roman »Das Ministerium des äußersten Glücks«.
Anette Grube, geboren 1954, lebt in Berlin. Sie ist die Übersetzerin von Werken von Vikram Seth, Chimamanda Ngozi Adichie, V.S. Naipaul, Mordecai Richler, Kate Atkinson, Richard Yates u.a.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel »The God of Small Things« bei Flamingo
© 1997 by Arundhati Roy
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
Coverabbildung: Sanjeev Saith
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490531-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Stammbaum
Paradise Pickles & Konserven
Pappachis Falter
Großer Mann der Laltain, kleiner Mann der Mombatti
Abhilash Talkies
Gottes eigenes Land
Cochin-Kängurus
Weisheitsübungshefte
Willkommen zu Hause, unsere Sophie Mol
Mrs Pillai, Mrs Eapen, Mrs Rajagopalan
Der Fluss im Boot
Der Gott der kleinen Dinge
Kochu Thomban
Der Pessimist und der Optimist
Es war gegen neun Uhr morgens
Das Leid
Arbeit ist Kampf
Velutha fuhr mit dem letzten Bus
Über den Fluss
Ein paar Stunden später
Der Bahnhof von Cochin
Das Haus der Geschichte
Ammu retten
Der Madras-Express
Dreiundzwanzig Jahre später
Der Preis des Lebens
Dank
Für Mary Roy, die mich aufzog.
Die mich lehrte, zuerst »Entschuldigung« zu sagen,
wenn ich sie in der Öffentlichkeit unterbrach.
Die mich genug liebte, um mich gehen zu lassen.
Für LKC, der, wie ich, überlebt hat.
Nie wieder wird eine einzige Geschichte
so erzählt werden, als wäre sie die einzige.
JOHN BERGER
Illustration: Lucia Obi
Paradise Pickles & Konserven
Der Mai in Ayemenem ist ein heißer, brütender Monat. Die Tage sind lang und feucht. Der Fluss schrumpft, und schwarze Krähen laben sich an leuchtenden Mangos in reglosen, staub-grünen Bäumen. Rote Bananen reifen. Jackfrüchte platzen auf. Schmeißfliegen brummen stumpfsinnig in der nach Früchten duftenden Luft. Dann prallen sie gegen Fensterscheiben und sterben verdutzt in der Sonne.
Die Nächte sind klar, jedoch durchdrungen von Trägheit und dumpfer Erwartung.
Anfang Juni setzt dann der Südwestmonsun ein, und es folgen drei Monate voll Wind und Wasser, unterbrochen von kurzen Intervallen grellen, glitzernden Sonnenlichts, das sich begeisterte Kinder schnappen, um damit zu spielen. Die Landschaft wird schamlos grün. Grenzmarkierungen verwischen, wenn Tapiokazäune Wurzeln schlagen und Blüten treiben. Ziegelmauern werden moosgrün. Pfeffersträucher winden sich an Strommasten empor. Rabiate Kriechpflanzen sprengen den Lateritboden und schlängeln sich über die überschwemmten Straßen. Boote schippern durch die Basare. Und in den Pfützen, die die Schlaglöcher in den großen Landstraßen ausfüllen, tauchen kleine Fische auf.
Es regnete, als Rahel nach Ayemenem zurückkehrte. Schräge, silberfarbene Schnüre prallten auf die lockere Erde, wühlten sie auf wie Geschützfeuer. Das alte Haus auf dem Hügel trug sein steiles Giebeldach tief über die Ohren gezogen wie einen Hut. Die von Moos überwachsenen Mauern waren aufgeweicht und platzten fast vor Feuchtigkeit, die aus dem Boden aufstieg. Im wilden, wuchernden Garten wisperten und raschelten kleine Lebewesen. Eine Rattenschlange rieb sich im Unterholz an einem glänzenden Stein. Gelbe Ochsenfrösche kreuzten hoffnungsvoll im schaumigen Teich und suchten nach Weibchen. Ein durchnässter Mungo flitzte über die mit Laub bedeckte Einfahrt.
Das Haus wirkte verlassen. Türen und Fenster waren verschlossen. Die vordere Veranda war kahl. Unmöbliert. Aber der himmelblaue Plymouth mit den Heckflossen aus Chrom stand noch immer davor, und drinnen war Baby Kochamma noch immer am Leben.
Sie war Rahels kleine Großtante, die jüngere Schwester ihres Großvaters. Eigentlich hieß sie Navomi, Navomi Ipe, aber alle Welt nannte sie Baby. Zu Baby Kochamma wurde sie, als sie alt genug war, eine Tante zu sein. Rahel war allerdings nicht gekommen, um sie zu besuchen. Weder Nichte noch kleine Großtante gaben sich diesbezüglich irgendwelchen Illusionen hin. Rahel war gekommen, um ihren Bruder Estha zu sehen. Sie waren zweieiige Zwillinge. »Dizygotisch«, wie die Ärzte es nannten. Gezeugt aus zwei verschiedenen, jedoch gleichzeitig befruchteten Eiern. Estha – Esthappen – war um achtzehn Minuten älter.
Sie hatten sich noch nie sehr ähnlich gesehen, Rahel und Estha, und auch als sie dünnarmige Kinder gewesen waren, flachbrüstig, wurmverseucht, mit Elvis-Presley-Tolle, fragte keiner das übliche »Wer ist wer?« oder »Welches ist welches?«, weder die übermäßig lächelnden Verwandten noch die syrisch-orthodoxen Bischöfe, die das Haus in Ayemenem häufig aufsuchten, um Spenden zu erbitten.
Konfusion herrschte an einem tieferen, geheimeren Ort.
In jenen frühen amorphen Jahren, als das Gedächtnis gerade einsetzte, als das Leben nur aus Anfängen bestand und nichts ein Ende hatte, als alles für immer war, hielten sich Esthappen und Rahel, wenn sie an sich beide dachten, für ein einziges Ich, und einzeln waren sie ein Wir oder Uns. Als wären sie eine seltene Art siamesischer Zwillinge, mit getrennten Körpern, aber mit einer gemeinsamen Identität.
Jetzt, Jahre später, erinnert sich Rahel daran, wie sie eines Nachts aufwachte und leise über Esthas komischen Traum lachte.
Sie hat auch andere Erinnerungen, die zu haben sie kein Recht hat.
Sie erinnert sich zum Beispiel daran (obwohl sie nicht dabei war), was der Orangenlimo-Zitronenlimo-Mann im Abhilash Talkies mit Estha gemacht hat. Sie erinnert sich an den Geschmack der Tomatensandwiches – Esthas Sandwiches, die Estha gegessen hat – im Madras-Express nach Madras.
Und das sind nur die kleinen Dinge.
Wie auch immer, jetzt denkt sie an Estha und Rahel als an sie, denn einzeln betrachtet sind sie nicht mehr das, was sie einmal waren oder was sie dachten, dass sie jemals sein würden.
Jemals.
Ihr Leben hat jetzt eine Größe und eine Form. Estha hat seines und Rahel ihres.
Ecken, Kanten, Grenzen, Ränder und Schranken sind an ihren getrennten Horizonten aufgetaucht wie ein Trupp Kobolde. Kleine Gestalten mit langen Schatten, die als Wachtposten am nebelhaften Ende stehen. Zarte Halbmonde haben sich unter ihren Augen gebildet, und sie sind so alt, wie Ammu war, als sie starb. Einunddreißig.
Nicht alt.
Nicht jung.
Aber ein lebensfähiges, sterbensfähiges Alter.
Beinahe wären sie im Bus geboren worden, Estha und Rahel. Der Wagen, in dem Baba, ihr Vater, Ammu, ihre Mutter, ins Krankenhaus nach Shillong bringen wollte, als es so weit war, blieb in Assam auf der kurvenreichen Straße durch die Teeplantage liegen. Sie ließen den Wagen zurück und hielten einen überfüllten öffentlichen Bus an. Mit dem eigentümlichen Mitgefühl der Armen für die vergleichsweise Wohlhabenden – oder vielleicht nur, weil sie sahen, dass Ammu hochschwanger war – überließen sitzende Fahrgäste ihre Plätze dem Paar, und während der restlichen Fahrt musste Esthas und Rahels Vater den Bauch ihrer Mutter (mit ihnen darin) festhalten, um die Erschütterungen aufzufangen. Das war, bevor sie sich scheiden ließen und Ammu nach Kerala zurückkehrte.
Estha behauptete, wenn sie im Bus geboren worden wären, hätten sie für den Rest ihres Lebens umsonst mit dem Bus fahren dürfen. Es war nicht klar, woher er diese Information hatte oder wie er auf derartige Dinge kam, aber die Zwillinge hegten jahrelang einen leisen Groll gegen ihre Eltern, weil sie sie um den lebenslangen Genuss von Freifahrten mit dem Bus gebracht hatten.
Außerdem glaubten sie, dass die Regierung ihre Beerdigung bezahlen würde, sollten sie auf einem Zebrastreifen überfahren werden. Sie waren fest davon überzeugt, dass Zebrastreifen nur aus diesem Grund existierten. Kostenlose Beerdigungen. Natürlich gab es in Ayemenem keine Zebrastreifen, auf denen man umkommen konnte, und auch nicht in Kottayam, der nächsten Stadt, aber in Cochin, das eine zweistündige Autofahrt entfernt war, hatten sie aus dem Autofenster welche gesehen.
Die Regierung kam nicht für Sophie Mols Beerdigung auf, weil sie nicht auf einem Zebrastreifen getötet wurde. Die Trauerfeier fand in Ayemenem in der alten Kirche mit dem neuen Anstrich statt. Sophie Mol war Esthas und Rahels Cousine, die Tochter ihres Onkels Chacko, und sie war auf Besuch aus England da. Estha und Rahel waren sieben Jahre alt, als sie starb. Sophie Mol war fast neun. Sie bekam einen Kindersarg.
Mit Satin ausgeschlagen.
Mit schimmernden Messinggriffen.
Sie lag darin in ihrer gelben Schlaghose aus Polyester, mit einem Band im Haar und ihrer schicken kleinen Handtasche made in England, die sie heiß und innig liebte. Ihr Gesicht war bleich und so runzlig wie der Daumen eines Wäschers, weil sie zu lange im Wasser gelegen hatte. Die Trauergemeinde versammelte sich um den Sarg, und vom Klang der traurigen Lieder schwoll die gelbe Kirche an wie ein Hals. Priester mit lockigen Bärten schwangen Weihrauchtöpfe an Ketten und lächelten kein einziges Mal die Babys an, so wie sie es an gewöhnlichen Sonntagen taten. Die langen Kerzen auf dem Altar waren verbogen. Die kurzen nicht.
Eine alte Dame, die so tat, als wäre sie eine entfernte Verwandte (die niemand erkannte), und häufig bei Beerdigungen neben dem Leichnam auftauchte (ein Beerdigungsjunkie? Eine latent Nekrophile?), träufelte Kölnisch Wasser auf einen Wattebausch und betupfte damit Sophie Mols Stirn, mit andächtiger und leise herausfordernder Miene. Sophie Mol roch nach Kölnisch Wasser und dem Holz des Sarges.
Margaret Kochamma, Sophie Mols englische Mutter, ließ nicht zu, dass Chacko, Sophie Mols leiblicher Vater, tröstend den Arm um sie legte.
Die Familie stand beieinander. Margaret Kochamma, Chacko, Baby Kochamma und neben ihr ihre Schwägerin Mammachi – Esthas und Rahels (und Sophie Mols) Großmutter. Mammachi war fast blind und trug stets eine dunkle Brille, wenn sie aus dem Haus ging. Ihre Tränen tropften dahinter hervor und rannen zitternd an ihrem Unterkiefer entlang wie Regentropfen an einer Dachkante. In ihrem steifen, eierschalenfarbenen Sari sah sie klein und krank aus. Chacko war Mammachis einziger Sohn. Ihr eigener Schmerz peinigte sie. Seiner brach ihr das Herz.
Zwar war es Ammu, Estha und Rahel gestattet, an der Beerdigung teilzunehmen, aber sie mussten abseits vom Rest der Familie stehen. Niemand würdigte sie eines Blickes.
In der Kirche war es heiß, und die weißen Ränder der Aronstabblüten kräuselten und wellten sich. In einer Blume im Sarg starb eine Biene. Ammus Hände zitterten und mit ihnen ihr Gesangbuch. Ihre Haut war kalt. Estha stand neben ihr, halb schlafend, die schmerzenden Augen glitzernd wie Glas, und drückte seine heiße Wange an die bloße Haut von Ammus zitterndem, gesangbuchhaltendem Arm.
Rahel dagegen war hellwach, grimmig und wachsam und gereizt und erschöpft vom Kampf gegen das wirkliche Leben.
Sie bemerkte, dass Sophie Mol ihre Beerdigung in wachem Zustand miterlebte. Sophie machte Rahel auf zwei Dinge aufmerksam.
Ding eins war die frisch gestrichene Kuppel der gelben Kirche, die Rahel noch nie von innen betrachtet hatte. Sie war blau wie der Himmel, bemalt mit vorbeiziehenden Wolken und winzigen, schwirrenden Flugzeugen, die kreuz und quer durch die Wolken flogen und weiße Kondensstreifen hinterließen. Es stimmt (und muss gesagt werden), dass es zweifellos leichter war, diese Dinge zu bemerken, wenn man in einem Sarg lag und nach oben blickte und nicht in einer Kirchenbank stand, eingekeilt zwischen gramgebeugten Hüften und Gesangbüchern.
Rahel dachte an denjenigen, der sich die Mühe gemacht hatte und dort hinaufgestiegen war, mit Eimern voll Farbe – Weiß für die Wolken, Blau für den Himmel, Silber für die Flugzeuge –, mit Pinseln und Verdünner. Sie stellte ihn sich dort oben vor, jemanden wie Velutha, mit glänzendem nackten Oberkörper, wie er auf einem Brett saß, das am Gerüst in der hohen Kirchenkuppel hing, und silberne Flugzeuge auf den blauen Kirchenhimmel malte.
Sie überlegte, was passieren würde, falls ein Seil riss. Sie stellte sich vor, wie er wie ein schwarzer Stern aus dem Himmel fiel, den er geschaffen hatte. Wie er zerschmettert auf dem heißen Kirchenboden lag und dunkles Blut aus seinem Schädel sickerte wie ein Geheimnis.
Zu diesem Zeitpunkt hatten Esthappen und Rahel bereits gelernt, dass die Welt über andere Möglichkeiten verfügt, um Menschen zu zerbrechen. Der Geruch war ihnen bereits vertraut. Faulig süß. Wie verblühte Rosen im Wind.
Ding zwei, das Sophie Mol Rahel zeigte, war das Fledermausbaby.
Während des Gottesdienstes beobachtete Rahel eine kleine schwarze Fledermaus, die an Baby Kochammas teurem Trauer-Sari hinaufkletterte, sich mit gebogenen Krallen vorsichtig festklammerte. Baby Kochamma schrie auf, als das Tier die Stelle zwischen Sari und Bluse, ihren Wulst der Traurigkeit, ihre nackte Taille erreichte, und schlug mit dem Gesangbuch um sich. Der Gesang brach ab für ein »Wasistlos? Wasistpassiert?«, für ein Flügelsurren und ein Sariflattern.
Die traurigen Priester entstaubten mit goldberingten Fingern ihre lockigen Bärte, als hätten Spinnen ganz unerwartet Netze darin gesponnen.
Das Fledermausbaby flog zum Himmel empor und wurde zu einem Flugzeug, allerdings ohne Kondensstreifen.
Nur Rahel bemerkte, wie Sophie Mol in ihrem Sarg heimlich ein Rad schlug.
Der traurige Gesang setzte wieder ein, und sie sangen dieselbe traurige Strophe zum zweiten Mal. Und erneut schwoll die gelbe Kirche von den vielen Stimmen an wie ein Hals.
Als sie Sophie Mols Sarg auf dem kleinen Friedhof hinter der Kirche in das Grab hinunterließen, wusste Rahel, dass sie noch nicht tot war. Sie hörte (an Sophie Mols Stelle) den leisen Aufprall des roten Lehms und den lauten Aufprall der orangefarbenen Lateritklumpen, die den Hochglanz des Sarges ruinierten. Sie hörte die dumpfen Geräusche durch das polierte Holz des Sarges, durch sein Satinfutter. Die Stimmen der traurigen Priester waren gedämpft von Lehm und Holz.
In deine Hände legen wir, barmherziger Vater,
die Seele dieses verstorbenen Kindes.
Ihren Körper übergeben wir der Erde,
Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Unter der Erde schrie Sophie Mol, zerfetzte mit den Zähnen Satin. Aber durch Erde und Steine sind Schreie nicht zu hören.
Sophie Mol starb, weil sie keine Luft bekam.
Ihre Beerdigung brachte sie um. Staub zu Staub zu Staub zu Staub zu Staub. Auf ihrem Grabstein stand: Ein Sonnenstrahl, der nur flüchtig auf uns fiel.
Ammu erklärte ihnen später, dass »flüchtig« »vorübergehend« und »kurz« bedeutete.
Nach der Beerdigung brachte Ammu die Zwillinge zurück zum Polizeirevier von Kottayam. Das Revier kannten sie bereits. Dort hatten sie den größten Teil des vorhergehenden Tages verbracht. Sie wussten schon, dass Wände und Möbel einen scharfen beißenden Gestank nach altem Urin verströmten, und hielten sich vorsorglich die Nase zu.
Ammu fragte nach dem verantwortlichen Polizeioffizier, und nachdem man sie in sein Zimmer geführt hatte, sagte sie, es liege ein schrecklicher Irrtum vor, und sie wolle eine Aussage machen. Sie bat darum, Velutha sehen zu dürfen.
Inspektor Thomas Mathews Schnurrbart war so adrett wie der des freundlichen Air-India-Maharadschas, aber seine Augen blickten verschlagen und gierig.
»Dafür ist es ein bisschen spät, nicht wahr?«, sagte er in dem ungehobelten Dialekt des Malayalam, den man in Kottayam sprach. Während er redete, starrte er auf Ammus Brüste. Er sagte, die Polizei wisse alles, was sie wissen müsse, und dass die Polizei in Kottayam keine Aussagen von veshyas und ihren illegitimen Kindern aufnehme. Ammu erwiderte, das würden sie schon sehen. Inspektor Thomas Mathew ging um den Schreibtisch und näherte sich Ammu mit seinem Schlagstock.
»Wenn ich Sie wäre«, sagte er, »würde ich ganz still sein und nach Hause gehen.« Dann berührte er mit dem Schlagstock ihre Brüste. Sachte. Tapp, tapp. Als würde er Mangos in einem Korb auswählen. Diejenigen bestimmen, die er verpackt und nach Hause geliefert haben wollte. Inspektor Thomas Mathew schien zu wissen, wen er schikanieren konnte und wen nicht. Polizisten haben diesen Instinkt.
Auf einem rot-blauen Schild an der Wand hinter ihm stand:
P
flichtbewusstsein
O
rdnungsliebe
L
oyalität
I
nformation
Z
ucht
E
ffizienz
I
ntegrität
Als sie das Polizeirevier verließen, weinte Ammu, deshalb fragten Estha und Rahel sie nicht, was veshya bedeutete. Oder illegitim. Es war das erste Mal, dass sie ihre Mutter weinen sahen. Sie schluchzte nicht. Ihre Miene war hart wie Stein, aber Tränen füllten ihre Augen und liefen ihr über die starren Wangen. Die Zwillinge waren krank vor Angst. Ammus Tränen machten alles, was ihnen bislang unwirklich erschienen war, wirklich.
Sie fuhren mit dem Bus zurück nach Ayemenem. Der Schaffner, ein schmaler, in Khaki gekleideter Mann, kam auf sie zu und hielt sich dabei an den Haltestangen fest. Er lehnte sich mit seiner knochigen Hüfte an die Kante eines Sitzes und knipste mit seinem Fahrkartenlocher in Ammus Richtung. Wohin? sollte das Knipsen bedeuten. Rahel roch das Bündel Fahrkarten und den säuerlichen Geruch der eisernen Haltestangen an den Händen des Schaffners.
»Er ist tot«, sagte Ammu leise zu ihm. »Ich habe ihn umgebracht.«
»Ayemenem«, sagte Estha schnell, bevor der Schaffner die Geduld verlor.
Estha holte das Geld aus Ammus Börse. Der Schaffner reichte ihm die Fahrkarten. Estha faltete sie sorgfältig zusammen und steckte sie in die Tasche. Dann nahm er seine erstarrte, weinende Mutter in seine kleinen Arme.
Zwei Wochen später wurde Estha zurückgegeben. Man zwang Ammu, ihn zu seinem Vater zurückzuschicken, der mittlerweile seinen einsamen Job auf der Teeplantage in Assam aufgegeben hatte, nach Kalkutta gezogen war und in einer Firma arbeitete, die Kohlengrus produzierte. Er hatte wieder geheiratet, das Trinken (mehr oder weniger) eingestellt und nur gelegentlich einen Rückfall erlitten.
Estha und Rahel hatten sich seit damals nicht mehr gesehen.
Und jetzt, dreiundzwanzig Jahre später, hatte ihr Vater Estha zurück-zurückgegeben. Er hatte ihn mit einem Koffer und einem Brief nach Ayemenem geschickt. Der Koffer war voll schicker neuer Kleidung. Baby Kochamma zeigte Rahel den Brief. Er war in einer schrägen, femininen Klosterschulhandschrift geschrieben, aber die Unterschrift am Ende war die ihres Vaters. Oder zumindest war es sein Name. Rahel hätte die Unterschrift sowieso nicht wiedererkannt. In dem Brief stand, dass ihr Vater den Kohlengrus-Job aufgegeben habe und nach Australien auswandere, wo er eine Stelle als Chef des Sicherheitsdienstes in einer Keramikfabrik angenommen habe, und dass er Estha nicht mitnehmen könne. Er wünschte allen in Ayemenem das Beste und schrieb, dass er Estha besuchen werde, sollte er jemals nach Indien zurückkehren, was, so fuhr er fort, jedoch ziemlich unwahrscheinlich sei.
Baby Kochamma sagte zu Rahel, dass sie den Brief behalten könne, wenn sie wolle. Rahel steckte ihn zurück in den Umschlag. Das Papier war weich und faltig geworden wie Stoff.
Sie hatte vergessen, wie feucht die Monsunluft in Ayemenem sein konnte. Aufgedunsene Schränke ächzten. Verschlossene Fenster sprangen auf. Bücher weichten zwischen den Buchdeckeln auf und wellten sich. Seltsame Insekten tauchten am Abend auf wie Ideen und verbrannten an Baby Kochammas matten 40-Watt-Glühbirnen. Am nächsten Tag lagen ihre steifen, verkohlten Leichen auf dem Boden und den Fensterbrettern herum, und es roch verbrannt, bis Kochu Maria sie auf ihrer Kehrichtschaufel aus Plastik fortschaffte.
Er hatte sich nicht verändert, der Juniregen.
Der Himmel öffnete sich, und das Wasser stürzte herab, erweckte den widerspenstigen alten Brunnen zu neuem Leben, überzog den schweinelosen Schweinestall mit grünem Moos, belegte stille teefarbene Pfützen mit einem Bombenteppich, so wie die Erinnerung einen stillen teefarbenen Geist bombardiert. Das Gras war nassgrün und zufrieden. Glückliche Regenwürmer wanden sich purpurn im Schlamm. Grüne Nesseln nickten. Bäume verneigten sich.
Weiter weg, in Wind und Regen, am Ufer des Flusses, in der plötzlichen Gewitterdunkelheit des Tages, ging Estha spazieren. Er trug ein T-Shirt, so rot wie zerdrückte Erdbeeren und jetzt nass und dunkel, und er wusste, dass Rahel gekommen war.
Estha war immer ein stilles Kind gewesen, so dass niemand auch nur einigermaßen exakt angeben konnte, wann genau (zumindest das Jahr, wenn schon nicht den Monat oder den Tag) er aufgehört hatte zu reden. Das heißt, wann er das Reden ganz eingestellt hatte. Tatsache ist, dass es kein »wann genau« gab. Es war eine schrittweise Reduktion und Stilllegung des Betriebs gewesen. Ein kaum wahrnehmbares Stillerwerden. Als ob ihm einfach der Gesprächsstoff ausgegangen wäre und er nichts mehr zu sagen hätte. Doch Esthas Schweigen war nie unangenehm. Nie aufdringlich. Nie laut. Es war kein vorwurfsvolles, trotziges Schweigen, vielmehr eine Art Sommerschlaf, ein Ruhezustand, das psychologische Äquivalent zu dem, was Lungenfische tun, um die Trockenzeit zu überstehen, nur dass in Esthas Fall die Trockenzeit ewig zu dauern schien.
Im Lauf der Jahre hatte er sich die Fähigkeit angeeignet, wo immer er war, mit dem Hintergrund zu verschmelzen – mit Bücherregalen, Gärten, Vorhängen, Eingängen, Straßen –, unbelebt zu erscheinen, für das ungeübte Auge nahezu unsichtbar. Fremde brauchten gewöhnlich eine Weile, bis sie ihn bemerkten, sogar wenn sie mit ihm im selben Zimmer waren. Noch länger brauchten sie, bis ihnen auffiel, dass er nie etwas sagte. Manchen fiel es nie auf.
Estha nahm sehr wenig Raum ein in der Welt.
Nach Sophie Mols Beerdigung, nachdem Estha zurückgegeben worden war, schickte ihn sein Vater auf eine Jungenschule in Kalkutta. Er war kein außergewöhnlicher Schüler, aber er blieb auch nicht zurück oder war in irgendeinem Fach besonders schlecht. Ein durchschnittlicher Schüler oder zufriedenstellende Leistungen lauteten im Allgemeinen die Kommentare, die seine Lehrer in das jährliche Zeugnis schrieben. Nimmt nicht an Gruppenaktivitäten teil, beschwerten sie sich wiederholt. Aber was genau sie mit »Gruppenaktivitäten« meinten, erklärten sie nie.
Estha schloss die Schule mit mittelmäßigen Resultaten ab, er weigerte sich jedoch, auf ein College zu gehen. Stattdessen begann er, anfänglich sehr zum Unmut seines Vaters und seiner Stiefmutter, die Hausarbeit zu erledigen. Als ob er auf seine Art versuchte, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er fegte, wischte auf und wusch die ganze Wäsche. Er lernte kochen und Gemüse einkaufen. Hinter ihren Pyramiden aus eingeöltem, glänzendem Gemüse erkannten ihn die Händler im Basar bald wieder und bedienten ihn, ungeachtet des Protestgeschreis der anderen Kunden, immer auf der Stelle, reichten ihm die verrosteten Filmdosen, in die er das von ihm ausgewählte Gemüse legte. Er feilschte nie. Sie hauten ihn nie übers Ohr. Nachdem das Gemüse ausgewogen und bezahlt war, packten sie es in seinen roten Einkaufskorb aus Plastik (Zwiebeln nach unten, Auberginen und Tomaten obendrauf), und dazu stets einen Zweig Koriander und eine Handvoll grüner Chilis umsonst. All das brachte Estha dann in einer überfüllten Trambahn nach Hause. Eine stille Blase, die auf einem Meer aus Lärm dahintrieb.
Wenn er während des Essens etwas wollte, stand er auf und nahm es sich.
Nachdem die Stille erst einmal da war, blieb sie und breitete sich in Estha aus. Sie wucherte aus seinem Kopf heraus und nahm ihn in ihre morastigen Arme. Sie wiegte ihn im Takt eines uralten, fötalen Herzschlags. Sie sandte ihre unsichtbaren, mit Saugnäpfen versehenen Tentakel in seinem Gehirn aus, wo sie die Kuppen und Täler seines Gedächtnisses absaugten, alte Sätze entfernten, sie von seiner Zungenspitze fegten. Sie raubte seinen Gedanken die Worte, die sie beschrieben, und ließ sie gestutzt und nackt zurück. Unaussprechbar. Betäubt. So dass sie für einen Außenstehenden vielleicht kaum noch existierten. Langsam, im Lauf der Jahre, zog sich Estha von der Welt zurück. Er gewöhnte sich an den ruhelosen Oktopus, der in ihm lebte und sein tintenblaues Beruhigungsmittel auf seine Vergangenheit spritzte. Allmählich wurde der Grund für sein Schweigen unauffindbar, irgendwo tief vergraben in den lindernden Falten der Tatsache als solcher.
Als Khubchand, seine geliebte, blinde, grauköpfige, inkontinente, siebzehnjährige Promenadenmischung beschloss, einen elenden, sich lang hinziehenden Tod zu sterben, pflegte Estha den Hund während seines finalen Martyriums, als hinge sein eigenes Leben davon ab. In den letzten Monaten vor seinem Tod schleppte sich Khubchand mit den besten aller Absichten, aber der unzuverlässigsten aller Blasen zu der Klappe, die unten in die Tür eingebaut war und in den rückwärtigen Teil des Gartens führte, steckte den Kopf hinaus und pisste wacklig und leuchtend gelb ins Haus. Mit leerer Blase und gutem Gewissen blickte er dann aus seinen trüben grünen Augen, die in seinem grauhaarigen Kopf schwammen wie schaumige Pfützen, zu Estha auf und schwankte zu seinem feuchten Kissen zurück, wobei er nasse Pfotenabdrücke auf dem Boden hinterließ. Als Khubchand sterbend auf seinem Kissen lag, sah Estha das Spiegelbild des Schlafzimmerfensters auf seinen glatten roten Hoden. Und den Himmel jenseits des Fensters. Und einmal einen Vogel, der über den Himmel flog. Für Estha, der durchdrungen war vom Duft verblühter Rosen, an Blut gewöhnt dank der Erinnerung an einen gebrochenen Mann, war die Tatsache, dass etwas so Zerbrechliches, etwas so unerträglich Zartes überlebt hatte, hatte überleben dürfen, ein Wunder. Ein fliegender Vogel, reflektiert in den Hoden eines alten Hundes. Er musste laut lächeln.
Nachdem Khubchand gestorben war, begann Estha mit seinen Spaziergängen. Er ging stundenlang. Anfangs patrouillierte er nur durch die Nachbarschaft, aber nach und nach entfernte er sich immer weiter.
Die Menschen gewöhnten sich daran, ihn auf der Straße zu sehen. Ein gutangezogener Mann mit einem ruhigen Gang. Sein Gesicht wurde dunkel und wettergegerbt. Zerfurcht. Von der Sonne verwittert. Er sah weiser aus, als er tatsächlich war. Wie ein Fischer in der Stadt. Der Meergeheimnisse mit sich herumtrug.
Jetzt, da er zurück-zurückgegeben worden war, wanderte Estha durch Ayemenem.
An manchen Tagen ging er an den Ufern des Flusses entlang, wo es nach Scheiße stank und nach Pestiziden, die mit Krediten der Weltbank angeschafft worden waren. Der Großteil der Fische war tot. Die, die überlebt hatten, litten unter Flossenfäule und Furunkeln.
An anderen Tagen ging er die Straße entlang. Vorbei an den neuen Golfhäusern aus frisch gebrannten und glasierten Ziegeln, gebaut von Krankenschwestern, Steinmetzen, Stahlarbeitern und Bankangestellten, die an fernen Orten hart arbeiteten und ein unzufriedenes Leben führten. Vorbei an aufgebrachten alten Häusern, die, vor Neid grün verfärbt, an eigenen Einfahrten, unter eigenen Kautschukbäumen kauerten. Jedes von ihnen ein schwankendes Lehen, das eine Geschichte zu erzählen hatte.
Er ging an der Dorfschule vorbei, die sein Urgroßvater für unberührbare Kinder von Unberührbaren gebaut hatte.
An Sophie Mols gelber Kirche. Am Kung-Fu-Jugendclub von Ayemenem. Am Kindergarten »Zarte Knospen« (für Berührbare), an dem Laden, der rationierte Mengen Reis und Zucker und Bananen verkaufte, die in gelben Stauden vom Dach hingen. Billige Softpornohefte über fiktive südindische Sexunholde waren mit Wäscheklammern an Schnüren befestigt, die von der Decke baumelten. Gemächlich drehten sie sich in der warmen Brise und führten mit dem Anblick von üppigen nackten Frauen, die in Lachen aus falschem Blut lagen, anständige Kunden in Versuchung.
Manchmal ging Estha an Lucky Press vorbei – der Druckerei des alten Genossen K.N.M. Pillai, einst das Büro der Kommunistischen Partei von Ayemenem, wo mitternächtliche Sitzungen stattfanden und Pamphlete mit den aufrüttelnden Texten marxistischer Lieder gedruckt und verteilt wurden. Die Fahne, die auf dem Dach flatterte, war mittlerweile schlaff und alt. Das Rot ausgeblutet.
Genosse Pillai trat morgens in einem verschossenen Aertex-Unterhemd vors Haus, seine Hoden eine Silhouette unter dem weichen weißen mundu. Er ölte sich mit warmem, gepfeffertem Kokosnussöl ein, knetete sein altes schlappes Fleisch, das sich willig wie Kaugummi von den Knochen ziehen ließ. Mittlerweile lebte er allein. Seine Frau Kalyani war an Eierstockkrebs gestorben. Sein Sohn Lenin war nach Delhi gezogen, wo er als Hausmeister für ausländische Botschaften arbeitete.
Stand Genosse Pillai vor seinem Haus und ölte sich ein, wenn Estha vorbeikam, legte er Wert darauf, ihn zu grüßen.
»Estha Mon!«, rief er dann mit seiner hohen pfeifenden Stimme, die rissig und faserig geworden war, wie geschältes Zuckerrohr. »Guten Morgen! Machst du deinen täglichen Gesundheitsspaziergang?«
Estha ging einfach weiter, nicht unhöflich, nicht höflich. Einfach nur still.
Genosse Pillai versetzte sich am ganzen Körper leichte Schläge, um seinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Er wusste nicht, ob Estha ihn nach den vielen Jahren überhaupt wiedererkannte. Nicht, dass ihm viel daran gelegen wäre. Zwar war seine Rolle bei der ganzen Sache durchaus keine kleine gewesen, aber Genosse Pillai hielt sich in keiner Weise für persönlich verantwortlich für das, was geschehen war, sondern hatte die Angelegenheit als unvermeidliche Konsequenz unumgänglicher politischer Maßnahmen zu den Akten gelegt. Es war die alte Geschichte: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Genosse K.N.M. Pillai war in erster Linie ein politischer Mensch. Ein professioneller Hobler. Er ging durch die Welt wie ein Chamäleon. Nie gab er etwas von sich preis, nie sah es so aus, als würde er es nicht tun. Auch das größte Chaos überstand er unversehrt.
Er war der Erste in Ayemenem gewesen, der von Rahels Rückkehr erfuhr. Die Nachricht hatte mehr seine Neugier angestachelt als ihn beunruhigt. Estha war für den Genossen Pillai ein Fremder. Seine Vertreibung aus Ayemenem war so plötzlich und ohne großes Aufsehen erfolgt und vor so langer Zeit. Rahel dagegen kannte er gut. Er hatte sie aufwachsen sehen. Und jetzt fragte er sich, warum sie zurückgekommen war. Nach so vielen Jahren.
In Esthas Kopf war es still gewesen, bis Rahel kam. Sie brachte das Geräusch vorbeifahrender Züge mit und das Licht und den Schatten, das Licht und den Schatten, die auf einen fallen, wenn man am Zugfenster sitzt. Die Welt, die jahrelang ausgeschlossen gewesen war, flutete plötzlich zurück, und jetzt konnte Estha sich vor lauter Lärm selbst nicht mehr hören. Züge. Verkehr. Musik. Die Börse. Ein Damm war gebrochen, und wildes Wasser schwemmte alles in einem Strudel empor. Kometen, Violinen, Märsche, Einsamkeit, Wolken, Bärte, Frömmlerinnen, Listen, Fahnen, Erdbeben, Verzweiflung wurden in einem verquirlten Strudel an die Oberfläche gespült.
Und Estha, der das Flussufer entlangspazierte, spürte weder die Nässe des Regens noch das plötzliche Schaudern des frierenden Welpen, der ihn vorübergehend adoptiert hatte und neben ihm hertapste. An dem alten Mangostanbaum vorbei kam er an das Ende eines Lateritausläufers, der in den Fluss hineinragte. Er ging in die Hocke und wiegte sich im Regen vor und zurück. Der nasse Schlamm unter seinen Schuhen machte obszöne, saugende Geräusche. Das frierende Hündchen zitterte – und ließ ihn nicht aus den Augen.
Baby Kochamma und Kochu Maria, die launische, zu kurz geratene Köchin mit Essig im Herzen, waren die einzigen Personen, die noch in dem Haus in Ayemenem lebten, als Estha zurück-zurückgegeben wurde. Mammachi, die Großmutter der Zwillinge, war tot. Chacko lebte jetzt in Kanada, wo er erfolglos einen Antiquitätenhandel betrieb.
Was Rahel betrifft:
Nachdem Ammu gestorben war (nachdem sie zum letzten Mal nach Ayemenem gekommen war, aufgeschwemmt vom Kortison und mit einem Rasseln in der Brust, das klang wie ein aus weiter Ferne rufender Mann), trieb Rahel ziellos dahin. Von Schule zu Schule. Die Ferien verbrachte sie in Ayemenem, weitgehend unbeachtet von Chacko und Mammachi (die, vor Kummer erschlafft, in ihrer Trauer zusammengesackt waren wie zwei Säufer in einer Palmweinbar) und weitgehend ohne Baby Kochamma zu beachten. Was Rahels Erziehung anbelangte, so versuchten es Chacko und Mammachi, aber es gelang ihnen nicht. Sie sorgten für das Notwendige (Essen, Kleidung, Schulgebühren), kümmerten sich aber sonst nicht um sie.
Der Verlust von Sophie Mol schlich leise durch das Haus in Ayemenem wie ein stilles Etwas in Socken. Er versteckte sich in Büchern und Lebensmitteln. In Mammachis Geigenkasten. Im Schorf der Wunden auf Chackos Schienbeinen, den er ständig abkratzte. In seinen schlaffen, weibischen Beinen.
Es ist eigenartig, wie manchmal die Erinnerung an einen Tod viel länger lebendig bleibt als die Erinnerung an das Leben, das er beendete. Im Lauf der Jahre, während die Erinnerung an Sophie Mol (die Sucherin kleiner Weisheiten: Wohin fliegen alte Vögel, um zu sterben? Warum fallen tote Vögel nicht wie Steine vom Himmel?; die Vorbotin harscher Wirklichkeit: Ihr seid beide ganze Farbige, und ich bin nur halbfarbig; der Guru geronnenen Blutes: Ich habe bei einem Unfall einen Mann gesehen, dem hing ein Auge an einem Nervenende heraus, wie ein Jo-Jo) langsam verblasste, wurde der Verlust Sophie Mols kräftig und lebendig. Er war immer da. Wie eine Frucht zur rechten Zeit. Jederzeit. So dauerhaft wie eine Stelle bei der Regierung. Er begleitete Rahel durch die Kindheit (von Schule zu Schule zu Schule) ins Erwachsenenalter.
Als man sie vor dem Gartentor ihrer Hausmutter dabei erwischte, wie sie einen Klumpen frischen Kuhdung mit kleinen Blumen dekorierte, wurde Rahel im Alter von elf Jahren in der Nazareth-Klosterschule auf die schwarze Liste gesetzt. Am nächsten Morgen musste sie während der Andacht im Oxford-Wörterbuch unter »Verderbtheit« nachschlagen und die Worterklärung laut vorlesen. »Die Eigenschaft oder der Zustand des Verderbt- oder Verdorbenseins«, las Rahel vor, eine Reihe strengmündiger Nonnen hinter sich und ein Meer kichernder Schulmädchengesichter vor sich. »Schlechte Eigenschaft: Moralische Verworfenheit; die der menschlichen Natur innewohnende Verderbtheit aufgrund der Erbsünde; sowohl die Erwählten als auch die Nichterwählten kommen in einem Zustand vollkommener Verderbtheit und Entfremdung von Gott auf die Welt und können aus eigenem Antrieb nichts tun außer sündigen. J.H. Blunt.«
Ein halbes Jahr später wurde sie nach wiederholten Anschuldigungen älterer Schülerinnen von der Schule gewiesen. Ihr wurde (zu Recht) vorgeworfen, sich hinter Türen zu verstecken und absichtlich mit älteren Schülerinnen zusammenzustoßen. Als sie von der Schulleiterin zu ihrem Verhalten befragt wurde (unter gutem Zureden, unter Züchtigung mit dem Rohrstock, unter Essensentzug), gab sie schließlich zu, dass sie es getan hatte, um herauszufinden, ob Brüste weh tun. In dieser christlichen Institution wurde die Existenz von Brüsten nicht anerkannt. Sie wurde geleugnet (und wenn sie nicht existierten, wie konnten sie dann weh tun?).
Das war der erste von drei Rauswürfen. Der zweite erfolgte wegen Rauchens. Der dritte, weil sie das Haarteil ihrer Hausmutter in Brand gesteckt hatte. Unter Druck gesetzt, gestand Rahel, es tatsächlich entwendet zu haben.
In jeder Schule, in die sie ging, schrieben die Lehrer, dass sie
(a) ein außergewöhnlich höfliches Kind sei;
(b) keine Freundinnen habe.
Es schien eine höfliche, einsame Art der Verderbtheit zu sein. Und aus diesem Grund, darin stimmten alle überein (sie ließen sich ihre lehrerhafte Missbilligung im Munde zergehen, berührten sie mit der Zungenspitze, lutschten sie wie ein Bonbon), umso gravierender.
Es war, flüsterten sie einander zu, als wüsste sie nicht, wie man ein Mädchen ist.
Sie hatten nicht weit gefehlt.
Merkwürdigerweise schien Vernachlässigung eine unbeabsichtigte Befreiung des Geistes zur Folge zu haben.
Rahel wuchs auf ohne jemanden, der sich ihrer annahm. Ohne jemanden, der eine Heirat für sie arrangiert hätte. Ohne jemanden, der für ihre Aussteuer aufgekommen wäre, und deshalb ohne dass der obligatorische Ehemann drohend am Horizont aufragte.
Solange sie also kein Aufhebens darum machte, konnte sie ihre Nachforschungen betreiben. Über Brüste und wie sehr sie weh taten. Über falsche Haarteile und wie gut sie brannten. Über das Leben und wie es gelebt werden sollte.
Nachdem sie die Schule beendet hatte, wurde sie an einem mittelmäßigen College für Architektur in Delhi zugelassen. Nicht, weil sie ein ernsthaftes Interesse an Architektur gehabt hätte. Nicht einmal ein oberflächliches. Sie machte zufälligerweise die Aufnahmeprüfung und schaffte sie zufälligerweise. Die Dozenten waren nicht so sehr von ihrem Talent beeindruckt als vielmehr von der (enormen) Größe ihrer mit Kohle skizzierten Stillleben. Sie verwechselten die unbekümmerten, verwegenen Striche mit künstlerischem Selbstvertrauen, obwohl ihre Urheberin in Wirklichkeit keine Künstlerin war.
Rahel verbrachte acht Jahre auf dem College, ohne einen Abschluss zu machen. Die Gebühren waren niedrig, und es war nicht schwer, zu Rande zu kommen, solange sie im Studentenwohnheim wohnte, in der subventionierten Mensa aß, selten ihre Kurse besuchte und stattdessen als Zeichnerin in düsteren Architekturbüros arbeitete, die Studenten als billige Arbeitskräfte ausbeuteten, indem sie sie die Reinzeichnungen anfertigen ließen und ihnen die Schuld in die Schuhe schoben, wenn etwas schiefging. Rahels Eigensinn und massiver Mangel an Ehrgeiz schüchterten die anderen Studenten, vor allem die männlichen, ein. Sie ließen sie links liegen. Nie wurde sie in ihre hübschen Häuser oder zu ihren lärmigen Partys eingeladen. Auch ihre Professoren waren etwas misstrauisch – wegen ihrer bizarren, unpraktischen Baupläne, die sie auf billigem Papier zeichnete, und ihrer Gleichgültigkeit gegenüber der leidenschaftlichen Kritik, die sie an ihr übten.
Gelegentlich schrieb sie an Chacko und Mammachi, aber sie kehrte nie nach Ayemenem zurück. Nicht, als Mammachi starb. Nicht, als Chacko nach Kanada auswanderte.
Während sie noch auf das College ging, lernte sie Larry McCaslin kennen, der in Delhi Material für seine Doktorarbeit über »Effiziente Energienutzung in der landestypischen Architektur« sammelte. Zum ersten Mal fiel ihm Rahel in der Collegebibliothek auf, und ein paar Tage später sah er sie im Khan Market wieder. Sie trug Jeans und ein weißes T-Shirt. Ein Stück einer Patchworkdecke war an ihrem Hals befestigt und hing ihr über den Rücken wie ein Cape. Ihr wildes Haar hatte sie nach hinten gebunden, damit es glatt aussah, was es nicht war. In einem Nasenflügel funkelte ein winziger Diamant. Sie hatte absurd schöne Schlüsselbeine und einen anmutigen, athletischen Gang.
Da geht eine Jazzmelodie, dachte Larry McCaslin und folgte ihr in eine Buchhandlung, in der keiner von beiden Bücher ansah.
Rahel steuerte in die Ehe, wie ein Flugpassagier auf einen nicht besetzten Stuhl in einem Flughafenwarteraum zusteuert. Mit der Absicht, sich niederzulassen. Als Larry nach Boston zurückkehrte, ging sie mit ihm.
Wenn er seine Frau in den Armen hielt, ihre Wange an seinem Herzen, war Larry groß genug, um auf ihren Kopf hinabsehen zu können, auf das dunkle Wirrwarr ihres Haars. Wenn er sie mit dem Finger neben dem Mundwinkel berührte, spürte er ganz sacht ihren Herzschlag. Er liebte diese Stelle. Und das schwache, unsichere Pulsieren, direkt unter der Haut. Er berührte es, horchte mit den Augen, wie ein erwartungsvoller Vater, der sein ungeborenes Kind im Bauch der Mutter strampeln spürt.
Er hielt sie, als wäre sie ein Geschenk. In Liebe überreicht. Etwas Stilles und Kleines. Unerträglich Wertvolles.
Aber wenn sie sich liebten, kränkten ihn ihre Augen. Sie verhielten sich, als gehörten sie zu jemand anders. Jemand, der beobachtete. Der aus dem Fenster aufs Meer sah. Auf ein Boot auf dem Fluss. Oder auf einen Passanten im Nebel, der einen Hut aufhatte.
Er war wütend, weil er nicht wusste, was dieser Blick bedeutete, siedelte ihn irgendwo zwischen Gleichgültigkeit und Verzweiflung an. Er wusste nicht, dass an manchen Orten, zum Beispiel in dem Land, aus dem Rahel kam, unterschiedliche Arten von Verzweiflung um den Vorrang kämpften. Und dass persönliche Verzweiflung nie verzweifelt genug sein konnte. Dass etwas passierte, wenn persönlicher Aufruhr am Wegesrand stehen blieb und dem Schrein des unermesslichen, gewalttätigen, kreisenden, ungestümen, lächerlichen, wahnsinnigen, unfassbaren, öffentlichen Aufruhrs einer ganzen Nation einen Besuch abstattete. Dass der Große Gott heulte wie ein heißer Sturm und Vergöttlichung forderte. Der Kleine Gott (lieb und gebändigt, privat und begrenzt) kam mit Brandwunden davon und lachte benommen über seine eigene Tollkühnheit. Abgehärtet von der Bestätigung seiner eigenen Belanglosigkeit, wurde er unverwüstlich und wahrhaft gleichgültig. Nichts war sehr wichtig. Nicht viel war wichtig. Und je weniger wichtig es war, umso unwichtiger wurde es. Es war nie wichtig genug. Weil schlimmere Dinge geschehen waren. In dem Land, aus dem sie kam, einem Land, das für alle Zeiten zwischen dem Terror des Krieges und dem Horror des Friedens balancierte, passierten ständig schlimmere Dinge.
So lachte der Kleine Gott ein hohles Lachen und hüpfte fröhlich davon. Wie ein reicher Junge in kurzen Hosen. Er pfiff, trat nach Steinen. Quelle seiner brüchigen Hochstimmung war die relative Geringfügigkeit seines Unglücks. Und dann kletterte er den Leuten in die Augen und wurde zu einem ärgerlichen Blick.
Was Larry McCaslin in Rahels Augen sah, war überhaupt keine Verzweiflung, sondern eine Art erzwungener Optimismus. Und eine Leere, da, wo Esthas Worte gewesen waren. Man konnte nicht erwarten, dass Larry das verstand. Dass die Leere in einem Zwilling nur eine andere Version der Stille in dem anderen Zwilling war. Dass die beiden Dinge zusammenpassten. Wie aufeinanderliegende Löffel. Wie die Körper von Liebenden, die miteinander vertraut sind.
Nachdem sie geschieden waren, arbeitete Rahel ein paar Monate als Kellnerin in einem indischen Restaurant in New York. Und dann mehrere Jahre lang nachts als Kassiererin einer Tankstelle außerhalb von Washington, wo sie in einer kugelsicheren Kabine saß und Betrunkene sich bisweilen in die Schale für das Geld übergaben und Zuhälter ihr lukrativere Jobs anboten. Zweimal sah sie, wie Männer durch ein Autofenster erschossen wurden. Und einmal, wie ein Mann, der erstochen worden war, mit dem Messer im Rücken aus einem fahrenden Auto geworfen wurde.
Dann schrieb Baby Kochamma, dass Estha zurück-zurückgegeben worden war. Rahel gab ihren Tankstellenjob auf und war froh, Amerika verlassen zu können. Um nach Ayemenem zurückzukehren. Zu Estha im Regen.
In dem alten Haus auf dem Hügel saß Baby Kochamma am Esstisch und rieb die dicke, schaumige Bitterkeit aus einer alten Gurke. Sie trug ein schlaffes kariertes Nachthemd aus Krepp mit Puffärmeln und Gelbwurzflecken. Unter dem Tisch schwang sie ihre winzigen, pedikürten Füße wie ein Schulmädchen auf einem zu hohen Stuhl. Sie waren angeschwollen, mit Wasser gefüllt, und sahen aus wie kleine aufgeblasene Kissen in Fußform. In früheren Zeiten hatte Baby Kochamma darauf bestanden, jeden, der nach Ayemenem kam und große Füße hatte, bloßzustellen. Sie bat darum, seine Sandalen anprobieren zu dürfen, und sagte: »Schaut nur, sie sind viel zu groß für mich!« Dann hob sie ihren Sari ein Stückchen hoch und ging im ganzen Haus herum, damit alle ihre winzigen Füße bewundern konnten.
Sie bearbeitete die Gurke mit einer Miene kaum verhohlenen Triumphes. Es freute sie, dass Estha nicht mit Rahel gesprochen hatte. Dass er sie angesehen und geradewegs an ihr vorbeigegangen war. In den Regen hinaus. So wie er es bei allen anderen auch getan hatte.
Sie war dreiundachtzig. Ihre Augen verschwammen wie Butter hinter den dicken Brillengläsern.
»Ich hab’s dir doch gesagt, stimmt’s?«, sagte sie zu Rahel. »Was hast du erwartet? Eine Sonderbehandlung? Er hat den Verstand verloren, ich sag’s dir! Er erkennt niemanden mehr! Was hast du denn geglaubt?«
Rahel erwiderte nichts.
Sie konnte den Rhythmus spüren, in dem Estha sich vor und zurück wiegte, und die Nässe des Regens auf seiner Haut. Sie hörte die heisere, verquirlte Welt in seinem Kopf.
Baby Kochamma warf einen beunruhigten Blick auf Rahel. Sie bedauerte bereits, ihr wegen Esthas Rückkehr einen Brief geschrieben zu haben. Aber was sonst hätte sie tun sollen? Sich für den Rest ihres Lebens mit ihm belasten? Warum sollte sie? Sie war nicht für ihn verantwortlich.
Oder doch?
Das Schweigen saß zwischen Großnichte und kleiner Großtante wie eine dritte Person. Ein Fremder. Aufgeschwemmt. Ungesund. Baby Kochamma ermahnte sich, nachts ihre Schlafzimmertür abzuschließen. Sie versuchte an etwas zu denken, was sie sagen könnte.
»Wie gefällt dir mein Bubikopf?«
Mit der Gurke in der Hand griff sie sich an ihren neuen Haarschnitt. Wo sie ihr Haar berührte, blieb ein Klecks bitteren Gurkenschaums zurück.
Rahel fiel nichts ein, was sie hätte sagen können. Sie sah Baby Kochamma dabei zu, wie sie die Gurke schälte. Gelbe Stückchen Gurkenschale klebten an ihrem Busen. Ihr Haar, tiefschwarz gefärbt, war auf ihrem Kopf arrangiert wie abgewickeltes Garn. Das Färbemittel hatte die Haut auf ihrer Stirn blassgrau getönt, so dass sie einen schattenhaften zweiten Haaransatz zu haben schien. Rahel fiel auf, dass sie begonnen hatte, Make-up zu tragen. Lippenstift. Khol. Ein verstohlener Hauch Rouge. Und weil das Haus verschlossen und dunkel war und weil sie ausschließlich an 40-Watt-Glühbirnen glaubte, war ihr Lippenstiftmund auf ihrem richtigen Mund ein bisschen verrutscht.
Sie hatte im Gesicht und an den Schultern abgenommen, so dass sie nicht mehr wie eine runde Person aussah, sondern wie eine konisch geformte. Bei Tisch jedoch, wo man ihre ausladenden Hüften nicht sah, wirkte sie nahezu zerbrechlich. Das gedämpfte Licht im Esszimmer hatte die Falten in ihrem Gesicht ausradiert und ließ es – auf eine seltsame, eingefallene Art – jünger aussehen. Sie trug eine Menge Schmuck. Den Schmuck von Rahels toter Großmutter. Allen Schmuck. Funkelnde Ringe. Diamantene Ohrringe. Goldene Armreife und eine wunderschön gearbeitete, flache goldene Kette, die sie von Zeit zu Zeit berührte, um sich zu vergewissern, dass sie noch da war und ihr gehörte. Wie eine junge Braut, die ihr Glück nicht glauben konnte.
Sie lebt ihr Leben rückwärts, dachte Rahel.
Das war eine merkwürdig zutreffende Beobachtung. Baby Kochamma hatte ihr Leben tatsächlich rückwärts gelebt. Als junge Frau hatte sie der materiellen Welt entsagt, und jetzt, als alte Frau, schien sie sie in die Arme zu schließen. Es war eine wechselseitige Umarmung.
Mit achtzehn hatte sich Baby Kochamma in einen hübschen jungen irischen Benediktinermönch, Pater Mulligan, verliebt, der als Abgesandter seines Seminars in Madras ein Jahr in Kerala verbrachte. Er studierte Hinduschriften, um sie fachkundig anprangern zu können.
Jeden Donnerstagvormittag kam Pater Mulligan nach Ayemenem, um Baby Kochammas Vater zu besuchen, Reverend E. John Ipe, der Priester der Mar-Thoma-Kirche war. Reverend Ipe war in der christlichen Gemeinde wohlbekannt als der Mann, der vom Patriarchen von Antiochia, dem unabhängigen Oberhaupt der syrisch-christlichen Kirche, persönlich gesegnet worden war – eine Episode, die Bestandteil von Ayemenems Folklore wurde.
1876, als Baby Kochammas Vater sieben Jahre alt war, hatte ihn sein Vater nach Cochin mitgenommen, um den Patriarchen zu sehen, der den syrischen Christen Keralas einen Besuch abstattete. Sie standen ganz vorn in einer Gruppe von Menschen, zu denen der Patriarch von der westlichsten Veranda des Kalleny-Hauses sprach. Die Gelegenheit beim Schopfe packend, flüsterte der Vater seinem jungen Sohn etwas ins Ohr und stieß das Bürschchen vorwärts. Der zukünftige Reverend, der, starr vor Angst, beinahe ins Stolpern geriet, presste seine entsetzten Lippen auf den Ring am Mittelfinger des Patriarchen und benetzte ihn mit Spucke. Der Patriarch wischte den Ring am Ärmel ab und segnete den kleinen Jungen. So kam es, dass Reverend Ipe, noch als er längst erwachsen und Priester war, Punnyan Kunju genannt wurde – der Kleine Gesegnete –, und die Menschen kamen mit Booten auf dem Fluss bis von Alleppey und Ernakulam, um ihre Kinder von ihm segnen zu lassen.
Obwohl ein erheblicher Altersunterschied zwischen Pater Mulligan und Reverend Ipe bestand und obwohl sie unterschiedlichen Bekenntnissen angehörten (deren einzige Gemeinsamkeit ihre gegenseitige Abneigung war), fühlten sich die beiden Männer in der Gesellschaft des jeweils anderen überaus wohl, und meist wurde Pater Mulligan dazu aufgefordert, zum Mittagessen zu bleiben. Von den beiden Männern bemerkte nur einer die sexuelle Erregung, die wie eine Flutwelle in dem schlanken Mädchen aufstieg, das sich lange, nachdem der Tisch abgeräumt war, in seiner Nähe aufhielt.
Zunächst versuchte Baby Kochamma Pater Mulligan mit wöchentlichen Vorstellungen geheuchelter Nächstenliebe zu verführen. Jeden Donnerstagvormittag um die Zeit, zu der Pater Mulligan eintraf, wusch Baby Kochamma zwangsweise ein armes Dorfkind neben dem Brunnen, mit harter roter Seife, die schmerzhaft über seine hervorstehenden Rippen schrubbte.
»Guten Morgen, Pater!«, rief Baby Kochamma, sobald sie ihn sah, mit einem Lächeln, das über den schraubstockhaften Griff, mit dem sie den seifenglitschigen Arm des dürren Kindes festhielt, hinwegtäuschte.
»Ihnen auch einen Guten Morgen, Baby!«, sagte Pater Mulligan, blieb stehen und machte seinen Regenschirm zu.
»Es gibt da etwas, was ich Sie fragen wollte«, sagte Baby Kochamma. »In 1. Korinther, Vers 10,23 steht: ›Alles ist erlaubt, aber es frommt nicht alles.‹ Vater, wie kann Er alles erlauben? Ich meine, ich kann verstehen, dass Er manches erlaubt, aber –«
Pater Mulligan war mehr als nur geschmeichelt von den Gefühlen, die er in dem attraktiven Mädchen hervorrief, das mit bebenden, küssbaren Lippen und glühenden kohlschwarzen Augen vor ihm stand. Denn auch er war jung, und vielleicht merkte er nicht, dass seine feierlichen Erklärungen, mit denen er ihre vorgetäuschten biblischen Zweifel zerstreute, in vollkommenem Widerspruch standen zu dem Versprechen, das er mit seinen strahlenden smaragdgrünen Augen gab.
Unbeeindruckt von der erbarmungslosen mittäglichen Sonne standen sie jeden Donnerstag neben dem Brunnen. Das junge Mädchen und der unerschrockene Mönch – beide bebend vor unchristlicher Leidenschaft. Sie benutzten die Bibel als List, um zusammen sein zu können.
Stets gelang es dem unglücklichen seifigen Kind, das zwangsgewaschen wurde, sich mitten in der Unterhaltung zu befreien, und Pater Mulligan kam wieder zu Sinnen und sagte: »Hoppla! Besser wir erwischen es, bevor es eine Erkältung tut.«
Dann spannte er seinen Regenschirm wieder auf und marschierte in schokoladenbrauner Kutte und bequemen Sandalen davon wie ein hoch ausschreitendes Kamel, das eine Verabredung einzuhalten hat. An der Leine nahm er das schmerzende Herz der jungen Baby Kochamma mit, das, über Blätter und kleine Steine stolpernd, hinter ihm hertorkelte. Verletzt und nahezu gebrochen.
Ein ganzes Jahr von Donnerstagen ging dahin. Schließlich war es an der Zeit, dass Pater Mulligan nach Madras zurückkehrte. Da Nächstenliebe keine sichtbaren Ergebnisse gezeitigt hatte, setzte die verzweifelte junge Baby Kochamma all ihre Hoffnung in den Glauben.
Sie legte eine störrische Zielstrebigkeit an den Tag (die bei einem jungen Mädchen zu jener Zeit als ebenso schlimm erachtet wurde wie eine körperliche Missbildung, eine Hasenscharte etwa, oder ein Klumpfuß), widersetzte sich den Wünschen ihres Vaters und wurde römisch-katholisch. Mit einer Sondererlaubnis des Vatikans legte sie ihr Gelübde ab und trat als Novizin in ein Kloster in Madras ein, in der Hoffnung, dass sich auf diese Weise legitime Gelegenheiten ergäben, Pater Mulligan zu sehen. Sie stellte sich vor, wie sie in düsteren, grabähnlichen Räumen mit schweren samtenen Vorhängen theologische Fragen diskutierten. Das war alles, was sie wollte. Was sie zu hoffen wagte. Ihm nahe zu sein. Nah genug, um seinen Bart riechen zu können. Um das grobe Gewebe seiner Kutte zu erkennen. Um ihn zu lieben, indem sie ihn lediglich ansah.
Sehr schnell wurde ihr die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen klar. Sie musste feststellen, dass die älteren Schwestern die Priester und Bischöfe mit weit ausgefalleneren biblischen Zweifeln in Beschlag nahmen, als ihre es jemals sein würden, und es Jahre dauern konnte, bis sie auch nur in die Nähe von Pater Mulligan kam. Sie wurde ruhelos und unglücklich im Kloster. Weil ihr Nonnenschleier ständig scheuerte, entwickelte sie einen hartnäckigen allergischen Ausschlag auf dem Kopf. Sie fand, dass sie besser Englisch sprach als alle anderen, und das machte sie noch einsamer.
Ungefähr ein Jahr nachdem sie in das Kloster eingetreten war, begann ihr Vater rätselhafte Briefe von ihr zu erhalten. Mein liebster Papa, ich bin froh und glücklich im Dienste Unserer Lieben Frau. Aber Koh-hi-noor scheint unglücklich zu sein und Heimweh zu haben. Mein liebster Papa, heute hat sich Koh-hi-noor nach dem Mittagessen übergeben müssen, und jetzt hat sie Fieber. Mein liebster Papa, das Klosteressen scheint Koh-hi-noor nicht gut zu bekommen, obwohl ich es gerne mag. Mein liebster Papa, Koh-hi-noor ist aufgebracht, weil ihre Familie sich um ihr Wohlbefinden weder zu kümmern noch Sorgen zu machen scheint …
Abgesehen davon, dass es der Name des (damals) größten Diamanten der Welt war, wusste Reverend Ipe von keiner Koh-hi-noor. Er fragte sich, wie ein Mädchen mit einem muslimischen Namen in ein katholisches Kloster geraten war.
Es war Baby Kochammas Mutter, die schließlich begriff, dass Koh-hi-noor niemand anderes als Baby Kochamma selbst war. Sie erinnerte sich daran, dass sie vor langer Zeit Baby Kochamma eine Abschrift des Testaments ihres Vaters (Baby Kochammas Großvater) gezeigt hatte, in dem er in Bezug auf seine Enkelkinder geschrieben hatte: Ich habe sieben Kleinode, eines davon ist mein Koh-hi-noor. Des Weiteren vermachte er jedem ein bisschen Geld und ein paar Schmuckstücke, stellte jedoch nirgends klar, wen er als seinen Koh-hi-noor betrachtete. Baby Kochammas Mutter begriff, dass Baby Kochamma aus unerfindlichen Gründen angenommen hatte, er könne nur sie gemeint haben – und jetzt, all die Jahre später, hatte sie Koh-hi-noor im Kloster, wo die Mutter Oberin alle Briefe las, bevor sie abgeschickt wurden, wiederauferstehen lassen, um ihrer Familie ihre Not mitzuteilen.
Reverend Ipe fuhr nach Madras und holte seine Tochter aus dem Kloster. Sie war froh, wegzukönnen, bestand jedoch darauf, nicht zu rekonvertieren, und blieb für den Rest ihrer Tage römisch-katholisch. Reverend Ipe musste zur Kenntnis nehmen, dass seine Tochter mittlerweile einen »Ruf« erworben hatte und es unwahrscheinlich war, dass sie jemals einen Ehemann finden würde. Da sie nicht heiraten würde, beschloss er, konnte es ihr nicht schaden, eine Ausbildung zu erhalten. Deshalb traf er Vorkehrungen für ein Studium an der Universität von Rochester.
Zwei Jahre später kehrte Baby Kochamma aus Rochester zurück, mit einem Diplom in Ziergärtnerei und verliebter in Pater Mulligan als je zuvor. Von dem schlanken attraktiven Mädchen, das sie einst gewesen war, war nichts mehr übrig. In den Jahren in Rochester hatte Baby Kochamma übermäßig zugenommen. Um es deutlicher zu sagen, sie war fett geworden. Sogar der schüchterne kleine Schneider Chellappen an der Chungam Bridge bestand darauf, für ihre Sariblusen Buschhemdpreise zu verlangen.
Um sie vom Grübeln abzuhalten, vertraute ihr Vater ihr den Garten vor dem Haus in Ayemenem an, wo sie einen garstigen, galligen Ziergarten anlegte, und die Leute kamen bis aus Kottayam, um ihn anzusehen.
Es war ein rundes, schräg abfallendes Stück Land, um das sich der steile Kiesweg der Einfahrt wand. Baby Kochamma verwandelte es in ein üppiges Labyrinth aus niedrigen Hecken, Felsen und Wasserspeiern. Ihre Lieblingspflanze war die Flamingoblume. Anthurium andreanum. Sie hatte eine ganze Sammlung davon, die Rubrum, die Honeymoon und diverse japanische Arten. Die Farben der fleischigen, einblättrigen Blütenhüllen variierten zwischen schwarz gesprenkelt über blutrot bis zu knallorange. Die herausragenden, getüpfelten Blütenstände waren immer gelb. In der Mitte von Baby Kochammas Garten, umgeben von Beeten mit Kannas und Phlox, pisste ein marmorner Cherub einen endlosen silbernen Strahl in hohem Bogen in einen seichten Teich, in dem eine einzige blaue Lotosblume blühte. An jeder Ecke des Teiches lümmelte ein rosaroter Gartenzwerg aus Gips mit rosigen Backen und roter Zipfelmütze.
Baby Kochamma verbrachte die Nachmittage in ihrem Garten. In Sari und Gummistiefeln. Ihre Hände steckten in orangefarbenen Gartenhandschuhen. Wie eine Löwenbändigerin zähmte sie mit einer riesigen Heckenschere wuchernde Kletterpflanzen und pflegte stachlige Kakteen. Sie stutzte Bonsaipflanzen und verhätschelte seltene Orchideen. Sie führte Krieg gegen das Wetter. Sie versuchte, Edelweiß und chinesische Guaven zu ziehen.
Jeden Abend cremte sie sich die Füße mit flüssiger Sahne ein und schob die Haut an ihren Zehennägeln zurück.
Erst kürzlich, nachdem er ein halbes Jahrhundert unerbittlicher, pingeliger Zuwendung über sich hatte ergehen lassen, war der Ziergarten aufgegeben worden. Sich selbst überlassen, war er gewuchert und verwildert, wie Zirkustiere, die ihre Tricks vergessen haben. Das Unkraut, das die Leute »Communist Patcha« nennen (weil es in Kerala gedeiht wie der Kommunismus), erstickte die exotischeren Pflanzen. Nur die Kriech- und Kletterpflanzen wuchsen weiter, wie die Zehennägel einer Leiche. Sie trieben durch die Nasenlöcher der rosaroten Gipszwerge, blühten in ihren hohlen Köpfen und verliehen ihnen eine Miene, die halb überrascht wirkte und halb, als müssten sie gleich niesen.
Der Grund für diese sang- und klanglose Aufgabe war eine neue Liebe. Baby Kochamma hatte eine Satellitenschüssel auf dem Dach des Hauses in Ayemenem installiert. Via Satellitenfernsehen beaufsichtigte sie die Welt von ihrem Wohnzimmer aus. Die unglaubliche Aufregung, die das Fernsehen in Baby Kochamma verursachte, war nicht schwer zu verstehen. Es war nicht etwas, was sich schrittweise ereignete. Es geschah über Nacht. Blondinen, Kriege, Hungersnöte, Football, Sex, Musik, Staatsstreiche – sie alle trafen mit demselben Zug ein. Sie stiegen im selben Hotel ab. Sie packten gemeinsam aus. Und in Ayemenem, wo einst das lauteste Geräusch das musikalische Hupen eines Busses gewesen war, konnten jetzt Kriege, Hungersnöte, pittoreske Massaker und Bill Clinton zusammengetrommelt werden wie Dienstboten. Und während ihr Ziergarten welkte und starb, verfolgte Baby Kochamma die Spiele der amerikanischen NBA-Liga, Kricketspiele und alle Grand-Slam-Tennisturniere. Unter der Woche sah sie Fashion Affairs und California Clan, Serien, in denen spröde Blondinen mit Lippenstift und vor Haarspray steifen Frisuren Androiden verführten und ihre sexuellen Imperien verteidigten. Baby Kochamma liebte ihre glitzernde Kleidung und ihre schlauen, schlagfertigen Antworten. Tagsüber fielen ihr zusammenhanglos Bruchstücke ein, und dann musste sie jedes Mal kichern.
Kochu Maria, die Köchin, trug nach wie vor die schweren goldenen Ohrringe, die ihre Ohrläppchen für immer deformiert hatten. Ihr gefielen die WWF-Wrestling-Sendungen, in denen Hulk Hogan und Mr Perfect, deren Hälse breiter waren als ihre Köpfe, glitzernde Leggings aus Lycra trugen und sich gegenseitig brutal verprügelten. In Kochu Marias Lachen schwang ein grausamer Unterton mit, wie bisweilen im Lachen von kleinen Kindern.
Den ganzen Tag saßen sie, zusammengeschweißt in einem lauten Fernsehschweigen, im Wohnzimmer, Baby Kochamma auf dem langlehnigen Pflanzerstuhl oder der Chaiselongue (je nach dem Zustand ihrer Füße), Kochu Maria (die, wenn sie konnte, von Kanal zu Kanal zappte) neben ihr auf dem Boden.
Das Haar der einen schneeweiß, das der anderen kohlrabenschwarz gefärbt. Sie nahmen an allen Preisausschreiben teil, nutzten alle Sonderangebote, für die geworben wurde, und gewannen bei zwei Gelegenheiten ein T-Shirt und eine Thermosflasche, die Baby Kochamma in ihrem Schrank einschloss.
Baby Kochamma liebte das Haus in Ayemenem und die Möbel, die sie geerbt hatte, indem sie alle anderen überlebte. Mammachis Violine und Notenständer, die Schränke aus Ooty, die Plastikkorbstühle, die Betten aus Delhi, die Kommode mit den gesprungenen Elfenbeinknäufen aus Wien. Den Esstisch aus Rosenholz, den Velutha getischlert hatte.
Die BBC-Hungersnöte und Fernsehkriege, auf die sie stieß, während sie von Kanal zu Kanal sprang, machten ihr Angst. Ihr alter Horror vor der Revolution und der marxistisch-leninistischen Bedrohung wurde neu entfacht von Fernsehsorgen wegen der wachsenden Zahl verzweifelter und vertriebener Menschen. Ethnische Säuberungen, Hungersnöte und Völkermord betrachtete Baby Kochamma als direkte Bedrohung ihrer Einrichtung.
Sie verschloss Türen und Fenster, außer sie benutzte sie. Die Fenster öffnete sie nur zu ganz bestimmten Zwecken. Um frische Luft zu schnappen. Um die Milch zu bezahlen. Um eine gefangene Wespe freizulassen (die Kochu Maria vorher mit einem Handtuch durchs Haus gejagt hatte).
Sie verschloss sogar den traurigen Kühlschrank, von dem die Farbe abblätterte und in dem sie ihren wöchentlichen Vorrat an Butterbrötchen aufbewahrte, die Kochu Maria in der Bestbakery in Kottayam kaufte. Und die zwei Flaschen mit Reiswasser, das sie statt gewöhnlichen Wassers trank. Unter der Abtropfschale lagerte sie, was von Mammachis Service mit dem Weidenmuster noch übrig war.
Das Dutzend Fläschchen mit Insulin, die Rahel ihr für ihren Diabetes mitgebracht hatte, stellte sie ins Butter- und Käsefach. Sie hatte nämlich den Verdacht, dass dieser Tage selbst die Unschuldigen und Großäugigen nach Geschirr gierten, sich Butterbrötchen einverleibten oder Ayemenem als diebische Diabetiker nach importiertem Insulin durchstreiften.
Sie traute nicht einmal den Zwillingen. Andererseits traute sie ihnen alles zu. Ganz und gar alles. Womöglich wollen sie sich sogar ihre Gegenwart zurückstehlen, dachte sie, und schlagartig wurde ihr bewusst, wie schnell sie wieder dazu übergegangen war, von den beiden als einem einzigen Wesen zu denken. Nach so vielen Jahren. Entschlossen, die Vergangenheit nicht an sich heranschleichen zu lassen, änderte sie den Gedanken augenblicklich um. Sie. Womöglich will sie sich sogar ihre Gegenwart zurückstehlen.