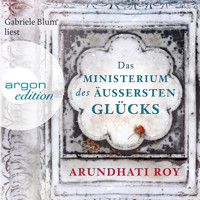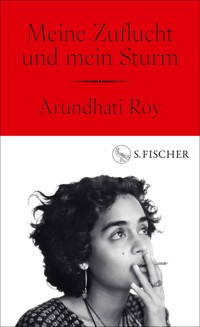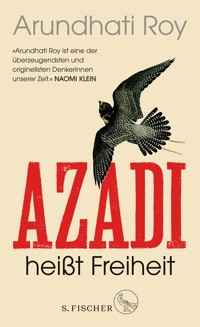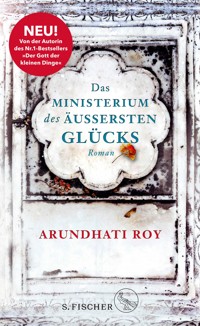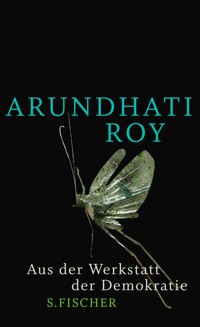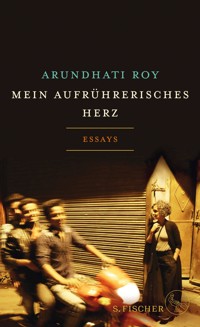
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Mein aufrührerisches Herz« zeigt die dunkle Kehrseite Indiens und ist ein Plädoyer für Freiheit und Gerechtigkeit. Ihr Mut wird bewundert, ihre Unbeirrtheit gefürchtet: Seit ihrem Bestseller »Der Gott der kleine Dinge« tritt Arundhati Roy für ein gerechteres Indien ein, für Freiheit, die nicht nur für die Wenigen gilt. Sie scheut kein Risiko. Sie kämpft nicht nur mit der Feder, sondern auch auf der Straße: gegen die von Modi angezettelten Pogrome, gegen die Besetzung Kaschmirs, gegen Abholzung und den Bau von Staudämmen, die ganze Landschaften zerstören. »Mein aufrührerisches Herz« zeichnet nicht nur diese Reisen einer engagierten Schriftstellerin und couragierten Bürgerin nach, sondern schließt den Bogen zwischen ihren beiden bewunderten Romanen »Der Gott der kleinen Dinge« und »Das Ministerium des äußersten Glücks«: Ihr Engagement ist ihr Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Arundhati Roy
Mein aufrührerisches Herz
Essays
Biografie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Eigenlizenz
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »My Seditious Heart« bei Haymarket Books, Chicago, Illinois. © 2019 by Arundhati Roy Siehe auch Einzelnachweise am Ende des Bandes.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
nach dem Originalumschlag von Two Associates, London
Coverabbildung: Mayank Austen Soofi
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491257-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Vinod Mehta,
ich hatte keine Vorstellung, wie sehr ich
dich vermissen würde –
Vorwort
9
Das Ende des Vorstellbaren
23
Anhang
549
Vorwort
Im Winter 1961 wurde in Kothie, einem kleinen Dorf in Gujarat, die Stammesbevölkerung von ihrem seit Jahrhunderten angestammten Land vertrieben, als wären die Menschen Eindringlinge. Aus Kothie wurde rasch Kevadiya Colony, eine trostlose Siedlung aus Beton für die Ingenieure und Bürokraten der Regierung, die während der nächsten Jahrzehnte den gigantischen 138,68 Meter hohen Sardar-Sarovar-Damm bauen sollten. Er war einer der vier Megadämme – und Tausender kleinerer Dämme –, die Teil des Narmada Valley Development Project waren, geplant für die Narmada und ihre 41 Zuflüsse. Die Bewohner von Kothie schlossen sich den Hunderttausenden von Menschen – Bauern, Landarbeiter und Fischer in den Ebenen, alteingesessene indigene Stämme in den Hügeln – an, deren Häuser und Land ebenfalls überflutet werden sollten, um gegen die in ihren Augen fahrlässige Zerstörung zu kämpfen. Eine Zerstörung nicht nur ihres Lebensunterhalts und ihrer Gemeinschaften, sondern der Erde, des Wassers, der Wälder und der Tiere – eines ganzen Ökosystems, einer ganzen Flusslandschaft und Zivilisation. Der materielle Wohlstand der Menschen war nie ihre einzige Sorge.
Unter dem Banner der Narmada Bachao Andolan (Rettet-die-Narmada-Bewegung) taten sie alles Menschenmögliche und gemäß der indischen Verfassung legal Zulässige, um den Dammbau zu verhindern. Sie wurden geschlagen, ins Gefängnis geworfen, misshandelt und als »antinational« beschimpft, als ausländische Agenten bezeichnet, die Indiens »Entwicklung« sabotieren wollten. Sie kämpften jahrzehntelang gegen den Sardar Sarovar, während er Meter um Meter in die Höhe wuchs. Sie traten in den Hungerstreik, sie zogen vor Gericht, sie marschierten nach Delhi, sie veranstalteten einen Sitzstreik, als das steigende Wasser im Stausee ihre Felder und Häuser überflutete. Dennoch verloren sie. Die Regierung hielt kein einziges der Versprechen, die sie ihnen gegeben hatte. Am 17. September 2017 weihte der indische Premierminister, Narendra Modi, den Sardar-Sarovar-Damm ein. Es war sein Geburtstagsgeschenk an sich selbst an dem Tag, als er 67 Jahre alt wurde.
Obwohl sie kämpfend untergingen, erteilten die Menschen an der Narmada der Welt ein paar wichtige Lektionen – über Ökologie, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie. Sie lehrten mich, dass wir sichtbar sein müssen, auch wenn wir verlieren, was immer wir verlieren – Land, Lebensunterhalt oder eine Weltsicht. Und dass wir es den Mächtigen unmöglich machen müssen, vorgeben zu können, sie würden die Kosten und Konsequenzen dessen, was sie tun, nicht kennen. Sie lehrten mich auch die Grenzen des konstitutionell legitimen Widerstands. Dieser Widerstand hat mein Denken fundamental geprägt. Heute müssen sogar die schärfsten Kritiker der Narmada Bachao Andolan zugeben, dass die Bewegung in fast allem recht hatte. Aber es ist zu spät. Seit Jahrzehnten saugt der Sardar Sarovar das gesamte Bewässerungsbudget von Gujarat auf. Er hat nichts von dem geliefert, was die Planer und Politiker versprochen haben. Ebenso wenig kam sein Nutzen, so gering er ist, den Bauern zugute, in deren Namen er gebaut wurde. Jetzt thront er über dem Fluss, den er auf dem Gewissen hat, wie ein Ungeheuer über einer Beute, die es nicht fressen kann. Ein Denkmal menschlicher Dummheit.
Man hätte meinen können, es wäre Lektion genug gewesen.
Fast genau ein Jahr später, am 31. Oktober 2018, reiste der Premierminister wieder nach Kevadiya Colony, diesmal um die weltgrößte Statue einzuweihen. Die Statue der Einheit ist ein 182 Meter hohes Bronzeabbild von Sardar Vallabhbhai Patel, einem weithin verehrten Freiheitskämpfer und dem ersten Vizepremierminister Indiens, nach dem der Sardar-Sarovar-Damm benannt ist. Sardar Patel war dem Vernehmen nach ein Mann, der ein anspruchsloses Leben führte. Doch an der 430-Millionen-US-Dollar-Statue, die zu seinem Andenken gebaut wurde, ist nichts anspruchslos. Sie ragt aus einem zwölf Quadratkilometer großen künstlichen See auf, besteht aus 200000 Kubiktonnen Beton und 25000 Tonnen verstärktem Stahl, alles mit 1700 Tonnen Bronze überzogen.[1] Indische Kompetenz war einer Aufgabe dieses Ausmaßes nicht gewachsen, weswegen die Statue in einer chinesischen Gießerei hergestellt und von chinesischen Arbeitern unter chinesischer Aufsicht errichtet wurde. So viel zum Nationalismus. Die Statue der Einheit ist fast viermal so hoch wie die Freiheitsstatue und über sechsmal so hoch wie Christus der Erlöser in Rio de Janeiro. An einem klaren Tag ist sie aus sieben Kilometer Entfernung zu sehen. Das Dorf Kothie, so es noch existierte, hätte in einen großen Zeh gepasst. Kothies frühere Bewohner und ihre Kampfgenossen sollen sich wahrscheinlich wie der Dreck unter den Zehennägeln der Statue fühlen. Ebenso die Autoren, die über sie schreiben.
Vierhundert Kilometer südlich der Statue der Einheit, in der Altamount Road in Mumbai, Heim des größten Slums Asiens, steht das andere große Denkmal Indiens, Antilia, das teuerste Privathaus, das je gebaut wurde. Es ist 27 Stockwerke hoch, verfügt über drei Hubschrauberlandeplätze, neun Aufzüge, hängende Gärten und sechs Parkdecks. Es gehört Mukesh Ambani, dem reichsten Mann Indiens und CEO von Indiens reichstem Unternehmen, Reliance Industries Limited (RIL), mit einem Börsenwert von 93 Milliarden US-Dollar. Mukesh Ambanis persönliches Vermögen wird auf 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Seine globalen Geschäftsinteressen umfassen Petrochemie, Öl, Gas, Lebensmitteleinzelhandel und ein Fernsehkonsortium, das in Indien 27 Nachrichtensender in fast allen Regionalsprachen betreibt. Reliance Jio Infocomm Limited ist das größte Telekommunikationsnetzwerk Indiens mit 250 Millionen Abonnenten. Jio Institute, eine supermoderne Privatuniversität, deren Gründung Reliance plant, die jedoch noch nicht existiert, hat es bereits auf die Regierungsliste der sechs »Institutionen hohen Ansehens« geschafft. So groß ist das Bedürfnis, Mukesh Ambani, dem wahren Herrscher Indiens, zu gefallen. Im Dezember 2018 tanzten alle Bollywood-Superstars wie Statisten auf der 100-Millionen-US-Dollar teuren Hochzeit seiner Tochter. Beyoncé trat auf. Hillary Clinton kam, um ihren Respekt zu bekunden. Im Land herrschte vermutlich vorübergehend Knappheit an Blumen und Schmuck.
Ich betrachte die Essays in diesem Buch als Wäschestücke – armer Leute Wäsche –, aufgehängt über der Landschaft zwischen diesen beiden Monumenten, wo sie die amtliche Bekanntmachung guter Nachrichten stören und die Aussicht verschandeln.
Sie wurden in einem Zeitraum von 20 Jahren geschrieben, in denen sich Indien rasanter als je zuvor veränderte. Die Öffnung des indischen Markts für internationale Investitionen hat eine neue Mittelklasse geschaffen – einen Millionenmarkt –, und Investoren überschlugen sich, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die internationalen Medien bemühten sich überwiegend, das neue bevorzugte Land der Kapitalgeber in bestmöglichem Licht darzustellen. Doch nicht alle Nachrichten waren positiv. Die Schaffung der neuen Kohorte brandneuer Milliardäre und neuer Konsumenten hatte einen immens hohen Preis für die Umwelt und einen noch höheren für die Unterschicht. Hinter der Bühne, fernab vom großen Tamtam, wurden Arbeitsschutzgesetze abgeschafft und Gewerkschaften aufgelöst. Der Staat zog sich von seiner Verantwortung zurück, Ernährung, Bildung und die Gesundheitsversorgung bereitzustellen. Öffentliche Vermögenswerte wurden privaten Unternehmen überlassen, massive Infrastruktur- und Bergbauprojekte trieben Hunderttausende Menschen vom Land in die großen Städte, die sie nicht wollten. Die Armen befanden sich im freien Fall.
Zur gleichen Zeit, als sie den geschützten Markt öffnete, richtete die damalige Kongress-Regierung (die Kongresspartei nennt sich liberal und säkular) den Blick auf die »Hindu-Stimmen« und öffnete ein weiteres Schloss. Das Schloss einer alten Moschee aus dem 16. Jahrhundert. Die Babri-Moschee in Ayodhya war 1949 von den Gerichten geschlossen worden infolge eines Streits zwischen Hindus und Muslimen, die beide den Ort für sich beanspruchten – die Muslime mit der Begründung, dass es ein historischer Ort der Gottesverehrung sei, die Hindus behaupteten, es sei der Geburtsort von Lord Ram. Die Öffnung der Babri-Moschee, angeblich damit Hindus dort ihre Religion ausüben können, hat Indien für immer verändert. Die Kongresspartei wurde hinweggefegt. Führende Köpfe der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) reisten durch das ganze Land und wirbelten einen Sturm religiöser Raserei auf. Während ein schockiertes Land und ein rückgratloser Kongress-Premierminister zuschauten, versammelten sie sich am 6. Dezember 1992 mit Mitgliedern der Vishwa Hindu Parishad in Ayodhya und forderten einen Mob von 150000 »Freiwilligen« auf, das Gebäude zu stürmen und die Babri-Moschee dem Erdboden gleichzumachen.
Die Zerstörung der Moschee und die gleichzeitige Öffnung des Marktes war der Beginn eines komplizierten Walzers der beiden Tanzpartner, unternehmerische Globalisierung und mittelalterlicher religiöser Fundamentalismus. Schon früh war offensichtlich, dass diese Strömungen bei weitem keine antagonistischen Kräfte waren, die das alte und das neue Indien repräsentierten, sondern ein Liebespaar, das ein raffiniertes Ritual der Verführung und Koketterie vollführte, das bisweilen als Feindseligkeit missverstanden werden konnte.
Für mich persönlich war es eine Zeit merkwürdiger Unruhe. Während ich zusah, wie sich das große Drama entfaltete, erschien es mir, als wäre ich selbst vom Glück verfolgt. Mein erster Roman, Der Gott der kleinen Dinge, hatte einen großen internationalen Preis gewonnen. Ich stand ganz vorn in der Schlange derjenigen, die erwählt wurden, um das zuversichtliche, neue, marktfreundliche Indien zu personifizieren, das endlich am Tisch der Reichen und Wichtigen Platz nahm. Auf gewisse Weise war es schmeichelhaft, andererseits auch zutiefst beunruhigend. Während ich zusah, wie Menschen ins Elend gestoßen wurden, verkaufte sich mein Buch millionenfach. Mein Bankkonto wuchs. Geld in diesem Ausmaß verwirrte mich. Was hieß es, in Zeiten wie diesen eine Schriftstellerin zu sein?
Während ich darüber nahezu unfreiwillig nachdachte, begann ich, eine lange, verwirrende, episodenhafte, erstaunlich brutale Geschichte über das Balzritual dieses ungewöhnlichen Liebespaars und die Spur der Zerstörung zu schreiben, die es hinterließ. Und über die bemerkenswerten Menschen, die ihm Widerstand leisteten.
Die Reaktion auf die Veröffentlichung nahezu aller Essays – polizeiliche Ermittlungen, Vorladungen, Strafverfahren und sogar eine kurze Gefängnisstrafe – war oft so zermürbend, dass ich beschloss, keine Artikel mehr zu schreiben. Andererseits führte mich fast jeder Artikel – jeder ein gebrochenes Versprechen, das ich mir selbst gegeben hatte – tiefer und tiefer in Welten, die mein Verständnis der Zeiten, in denen wir leben, bereicherten und meine Ansichten dazu komplexer machten. Sie öffneten mir Türen zu geheimen Orten, an denen man nur wenigen vertraut, führten mich in das Herz von Aufständen, an Orte des Schmerzes, des Zorns und wütender Respektlosigkeit. Auf diesen Reisen fand ich meine liebsten Freunde und wahrhaftigsten Lieben. Das sind meine wirklichen Tantiemen, meine größte Belohnung.
Obwohl Schriftsteller meistens allein unterwegs sind, entstand, was ich schrieb, meistens mitten aus einer Menschenmenge heraus. Es war nie als neutraler Kommentar oder als Beobachtung einer unbeteiligten Zuschauerin gemeint. Jeder Essay war ein weiterer Fluss, der in die schnelle, starke, rauschende Strömung floss, über die ich schrieb. Mein Beitrag zur kollektiven Weigerung, gehorsam in den Hintergrund zu treten.
Als meine Verleger vorschlugen, die Essays in einem einzigen Band zu veröffentlichen, dachten wir lange darüber nach, wie sie am besten anzuordnen wären. Thematisch? Wir versuchten, uns sinnvolle Überschriften für Teilabschnitte auszudenken, doch bald wurde uns klar, dass es nicht funktionierte, denn obwohl die meisten Essays spezifische Themen oder Ereignisse behandelten – Atomwaffen, Dämme, Privatisierung, Kaste, Klasse, Krieg, Imperialismus, Kolonialismus, Kapitalismus, Militarismus, Terroranschläge, von der Regierung gedeckte Massaker und der Aufstieg des Hindu-Nationalismus –, sind diese Themen doch eng miteinander verwoben und bedingen sich gegenseitig. Wir beschlossen, die Aufsätze chronologisch anzuordnen. Da jeder für sich allein erschien, manchmal durch Monate oder auch Jahre getrennt, musste ich oft Fakten wiederholen oder Teile einer Geschichte noch einmal erzählen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich diese Wiederholungen habe stehen lassen.
Für die Leser dieses Buches hätte ich gern die Atmosphäre wiederauferstehen lassen, in der jeder Essay publiziert wurde. Ich schrieb sie, wenn ein bestimmter politischer Raum geschlossen oder ein fauler Kompromiss verkauft wurde, wenn ich die unerbittliche Propaganda und das bösartige Drangsalieren verletzlicher Menschen durch zunehmend vereinheitlichte Medien und ihre zunehmend privatisierten Kommentatoren nicht mehr ertrug. Meistens schrieb ich, weil es einfacher war zu schreiben, als das wütende hartnäckige Rauschen meines eigenen Schweigens zu ertragen. Ich schrieb auch, um mir die Sprache wieder anzueignen. Weil es quälend war, mitanzusehen, wie Worte in einem Kontext benutzt wurden, in dem sich ihre Bedeutung ins Gegenteil verkehrte. (»Demokratie vertiefen« hieß, sie zu zerstören. »Ein für alle gleiches Spielfeld« bedeutete einen steilen Abhang, »freier Markt« stand für einen manipulierten Markt. »Frauen stärken« hieß, sie auf jede nur mögliche Weise zu schwächen.)
Ich schrieb, weil ich begriff, dass es meine Fähigkeiten als Schriftstellerin herausfordern würde. In der Vergangenheit hatte ich Drehbücher und einen Roman geschrieben. Ich hatte über Liebe und Verlust, über Kindheit, Kaste, Gewalt und Familien geschrieben – die ewigen Themen von Schriftstellern und Dichtern. Konnte ich ebenso spannend über Bewässerung schreiben? Über die Versalzung von Böden? Über Stromkosten? Über Gesetze? Über die Dinge, die das Leben gewöhnlicher Menschen betrafen? Konnte ich diese Themen in Prosa umsetzen? Ich habe es versucht.
Meine unerschütterlichen Partner bei diesem Unterfangen waren N. Ram, damals Herausgeber von Frontline, und der verstorbene Vinod Mehta, Herausgeber von Outlook, damals zwei der besten Nachrichtenmagazine in Indien. Fast jeder Essay wurde in einer oder beiden Zeitschriften veröffentlicht. Gleichgültig, worüber ich schrieb, ungeachtet des Inhalts und der Länge, Mehta zuckte nie mit der Wimper. Nicht, wenn ich schneidend und schonungslos über einen gewählten Premierminister schrieb; nicht einmal, wenn ich meine Meinung zum umstrittensten aller Themen äußerte: die militärische Besetzung Kaschmirs durch Indien. Gegen Ende seiner Zeit bei Outlook widmete er eine ganze Ausgabe »Bei den Genossen«, meinem Bericht über die Wochen, die ich mit der maoistischen Guerilla im Wald von Bastar verbrachte. Unser stillschweigender Pakt war, dass er alles veröffentlichen würde, was ich schrieb, und ich mich nie über die – seitenweisen – Beleidigungen beschweren würde, die er schadenfroh in den Wochen darauf auf der Leserbriefseite (der frühe Avatar des Trollens) publizierte. Manchmal erschienen die Beleidigungen schon, bevor ich überhaupt etwas geschrieben hatte. In Erwartung dessen, was ich möglicherweise schreiben würde. Ich lernte, sie als Ehrenabzeichen zu tragen.
1998 führte die von der BJP geführte Koalitionsregierung eine Reihe Atomtests durch. Die Tests, die Art und Weise, wie sie angekündigt wurden, und die Begeisterung, mit der sie gefeiert wurden – von Akademikern, Journalisten, Künstlern, Liberalen und säkularen Nationalisten –, waren der Beginn einer gefährlichen neuen öffentlichen Debatte, die von einem aggressiven Nationalismus der Mehrheit zeugte – der von der Regierung offiziell gutgeheißen wurde. Mein Entsetzen, dass ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan zu einer realen Möglichkeit geworden war, war ebenso groß wie meine Befürchtungen, was diese hässliche neue Sprache unserer Phantasie, unserer Vorstellung von uns selbst antun könnte. Im Rückblick wird mir klar, dass die Atomtests jeden Riss und jeden Sprung in einer sowieso schon auf Spaltung ausgelegten Politik vergrößerten. Die Bedrohung durch einen Atomkrieg, der den ganzen Planeten gefährdet, darf nicht kleingeredet werden. Fast genau 20 Jahre nach den Atomtests, im Februar 2019, waren Indien und Pakistan nach einem tragischen Selbstmordattentat in Kaschmir die ersten zwei Atommächte in der Geschichte, die sich gegenseitig bombardierten.
Der 11. September 2001 und der von den USA ausgerufene »Krieg gegen den Terror« waren ein Geschenk für die Faschisten auf der ganzen Welt. Die steigende Flut des Hindu-Nationalismus (Hindutva) machte sich sofort die internationale Islamophobie im Gefolge der Anschläge zunutze. Ein paar Wochen nach dem 11. September entließ die BJP in Gujarat ihren Chief Minister und setzte für ihn einen nicht gewählten politischen Novizen ein. Sein Name war Narendra Modi. Seit Jahren war er Aktivist der Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dieser hindu-nationalistischen Gilde, die seit langem forderte, die indische Verfassung aufzuheben und Indien zu einer Hindu-Nation zu erklären. Vier Monate später, im Februar 2002, verbrannten 59 Hindu-Pilger in einem Eisenbahnwaggon in Gujarat, woraufhin ein Pogrom gegen Muslime stattfand, bei dem 2000 Menschen öffentlich von Hindu-Mobs abgeschlachtet wurden. Nach dem Massaker setzte Modi Neuwahlen an, die er gewann. Er blieb für die nächsten zwölf Jahre Chief Minister in Gujarat. Bei einem offiziellen Treffen indischer Industrieller kurz nach dem Pogrom in Gujarat sprachen sich mehrere Konzernchefs, darunter Mukesh Ambani, begeistert für Modi als zukünftigen Kandidaten für das Amt des indischen Premierministers aus. Nach einem opulenten Wahlkampf, wie ihn Indien noch nie zuvor gesehen hatte, und einem weiteren gut organisierten Massaker in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, wurde der beste Freund der RSS 2014 Premierminister von Indien, mit einer riesigen Mehrheit im Parlament.
Die RSS, das Zugpferd der Hindutva, wurde 1925 gegründet. Heute ist sie die mächtigste Organisation in Indien. Sie verfügt über Tausende Zweigstellen und Hunderttausende engagierter »Freiwilliger« im ganzen Land. Ihre Leute sitzen heute in nahezu jeder Institution. Sie hat die Armee, die Geheimdienste, Gerichte, Schulen, Universitäten, Banken infiltriert. Die Institutionen, die die Türken den »Staat im Staat« nennen, sind entweder völlig unter ihrer Kontrolle oder stark von ihr beeinflusst. Indien ist zu einem Land geworden, in dem Schriftsteller und Intellektuelle kaltblütig ermordet werden und Lynchmobs, die regelmäßig Muslime totprügeln, durch Städte und Dörfer ziehen in der Gewissheit, straffrei auszugehen. Die Ideologie der RSS – die indische Variante des Faschismus – ist nicht mehr auf Wahlsieger angewiesen, sondern wird weiterhin eine existenzielle Bedrohung für das Gewebe des Landes darstellen, ungeachtet welche politische Partei an der Macht ist.
Über das Verschmelzen von Neoliberalismus und Hindu-Nationalismus zu schreiben, hieß Spießrutenlaufen. Über den US-Imperialismus nach dem 11. September 2001 und die US-Invasionen in Afghanistan und Irak zu schreiben, war eine ganz andere Sache. Ich rechnete damit, dass zahllose der Exemplare von Der Gott der kleinen Dinge – das Buch hatte sich in den USA eine Million Mal verkauft – auf dem Scheiterhaufen landen würden. Ich hatte verfolgt, was mit Leuten wie Susan Sontag und fast allen anderen Personen geschah, die eine nicht mit dem Establishment übereinstimmende Meinung geäußert hatten. Ja, ich bekam ein Exemplar meines Buchs zurück, mit einer zittrigen Botschaft der Empörung. Doch es gab keine Bücherverbrennungen. Als ich in die USA reiste, um am ersten Jahrestag des 11. September im Lensic Theatre in New Mexico und kurz nach der Invasion des Iraks in der Riverside Church in New York zu sprechen, war ich zuerst erschrocken und dann begeistert über die vielen Leute, die kamen. Sie vertraten nicht die gängige Meinung. Natürlich nicht. Aber es gab sie. Sie kamen trotz der bösartigen Atmosphäre aggressiven Nationalismus, der wir uns während dieser Tage alle stellen mussten. (Wer kann George W. Bushs Verdikt vergessen: »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.«) Es war eine gute Lektion in aufrührerischem Denken. Ich lernte, Länder, die Politik ihrer Regierungen und die Menschen, die in diesen Ländern leben, nicht in einen Topf zu werfen. Ich lernte, von grundlegenden Prinzipien auszugehen, die der Existenz von Nationalstaaten vorausgehen.
Der längste Essay in diesem Band »Der Doktor und der Heilige« handelt von der Diskussion zwischen Dr. B. R. Ambedkar und Mohandas Gandhi, den zwei ikonischen Gestalten Indiens. Er wurde zum ersten Mal als Einleitung zu der kommentierten Ausgabe von Annihilation of Caste (Abschaffung des Kastenwesens) publiziert, Ambedkars beißendem und legendärem Text von 1936. Das Kastensystem, das uralte eisenharte Raster institutionalisierter Ungleichheit, ist weiterhin der Motor, der das moderne Indien antreibt, und die Ambedkar-Gandhi-Diskussion gehört dieser Tage zu den umstrittensten Themen. Da Dalit-Bewegungen Fahrt aufnehmen, steht Ambedkar mehr als jeder andere, ob lebend oder tot, im Zentrum aktueller indischer Politik. Er sollte in seiner ganzen Komplexität gelesen, gehört und studiert werden. Was Gandhis Aussagen und Verhalten insbesondere bezüglich Kaste, Klasse, Ethnie und Geschlecht angeht – sie bedürfen dringend einer ernsten Überprüfung. »Der Doktor und der Heilige« ist wahrscheinlich wegen der Fußnoten der »akademischste« Aufsatz, den ich je geschrieben habe.
Dieses Buch über gebrochene Versprechen geht zu einem Zeitpunkt in Druck, da sich eine Ära, von der wir glauben, dass wir sie verstehen, ihrem Ende zuneigt. Die Kriege des Kapitalismus und die mit ihm einhergehende Gier haben das Leben auf unserem Planeten in größte Gefahr gebracht und ihn mit Flüchtenden überzogen. Sie haben der Erde während der vergangenen 100 Jahre mehr Schaden zugefügt als in den Jahrtausenden zuvor. In den letzten 30 Jahren hat sich das Ausmaß des Schadens exponentiell gesteigert. Der World Wildlife Fund berichtet, dass die Populationen der Wirbeltiere – Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien – in den letzten 40 Jahren um 60 Prozent zurückgegangen sind. Wir haben uns zu einer Zeit unvorhergesehener Katastrophen verurteilt – Buschfeuer und Waldbrände, Stürme, Erdbeben und Überflutungen. Doch die neuen Imperialisten in China, die alten weißen Rassisten im Weißen Haus und die wohltätigen Neonazis auf den Straßen Europas werden uns mit ruhiger Hand durch diese neue Ära geleiten.
In Indien marschieren die Hindu-Faschisten und fordern einen großen Tempel an der Stelle, wo einst die von ihnen zerstörte Moschee stand. Hochverschuldete Bauern demonstrieren für ihr Überleben, die Arbeitslosen für Arbeit.
Mehr Tempel? Einfach. Aber mehr Arbeit?
Wie wir wissen, steht uns das Zeitalter der künstlichen Intelligenz bevor. Menschliche Arbeitskraft wird bald weitgehend überflüssig sein. Menschen werden konsumieren. Doch viele werden an der neuen Ökonomie nicht mehr teilhaben (oder für ihre Teilhabe entlohnt werden).
Wir stehen demnach vor der Frage, wer – oder was – die Welt regieren wird. Und was wird aus den vielen überschüssigen Menschen? Die nächsten 30 Jahre werden anders als alles, was wir als Spezies je erlebt haben. Um uns auf das Kommende vorzubereiten, um uns das Werkzeug an die Hand zu geben, das Unvorstellbare zu denken, werden alte Ideen – von der Linken, der Rechten oder aus der Mitte – nicht ausreichen.
Wir werden Algorithmen brauchen, die uns zeigen, wie wir unseren trägen, dummen, wahnsinnigen Königen das Zepter aus der Hand nehmen können.
Bis dahin, liebe Leser, überlasse ich euch … mein aufrührerisches Herz.
Arundhati Roy,
Dezember 2018
Das Ende des Vorstellbaren
»Die Wüste bebte«, teilte die indische Regierung uns (ihrem Volk) mit.
»Der ganze Berg wurde weiß«, reagierte die Regierung von Pakistan.
»Am Nachmittag hatte sich der Wind über Pokhran gelegt. Um 15.45 wurden mittels einer Schaltuhr drei Sprengkörper gezündet. Die rund 200 bis 300 Meter tief in der Erde erzeugte Hitze entsprach einer Million Grad Celsius – das ist so heiß wie die Temperaturen auf der Sonne. Augenblicklich verdampfte Gestein mit einem Gewicht um tausend Tonnen, ein kleiner unterirdischer Berg … die Druckwellen der Explosion drückten einen Erdhügel von der Größe eines Fußballfelds einige Meter nach oben. Ein Wissenschaftler sagte bei diesem Anblick: ›Jetzt glaube ich die Geschichte, in der Krishna einen Berg hochhebt.‹«[1]
Mai 1998. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen, vorausgesetzt natürlich, wir haben noch Geschichtsbücher, in die es eingehen kann. Und vorausgesetzt, wir haben noch eine Zukunft. Über Atomwaffen gibt es nichts Neues oder Originelles mehr zu sagen. Es kann für eine Schriftstellerin nichts Demütigenderes geben, als noch einmal ein Anliegen vorzutragen, das schon seit Jahren von anderen Menschen in anderen Teilen der Welt vorgetragen wird, und zwar mit Leidenschaft, Eloquenz und fundiertem Wissen.
Ich bin bereit, mich in den Staub zu werfen. Mich zutiefst zu demütigen, denn Schweigen wäre unter diesen Umständen unentschuldbar. Wer also bereit ist: Schlüpfen wir in unsere Rollen, ziehen wir die ausrangierten Kostüme an und sprechen wir unsere abgenützten Zeilen in diesem traurigen abgenützten Stück. Vergessen wir aber nicht, dass der Einsatz, um den es geht, gewaltig ist. Scham und Erschöpfung könnten unser Ende bedeuten. Das Ende unserer Kinder und Kindeskinder, von allem, das uns lieb ist. Wir müssen in uns die Kraft finden, zu denken. Zu kämpfen.
Wieder einmal hinken wir der Zeit erbärmlich hinterher – nicht nur wissenschaftlich und technisch (hört nicht auf die leeren Behauptungen), sondern, wichtiger noch, mit unserer Fähigkeit zu begreifen, was Kernwaffen in Wirklichkeit sind. Unser Verständnis der Schreckenskammer ist hoffnungslos veraltet. Da diskutieren wir, die Bürger Indiens und Pakistans, über politische Detailfragen, über Außenpolitik und tun vor den Augen der Welt so, als hätten unsere Staaten lediglich eine neue, größere Bombe gebaut, eine Art großer Handgranate, mit der sie den Feind (einander) vernichten und uns vor Schaden bewahren werden. Wie verzweifelt wir uns das einreden. Was für mustergültige, gehorsame, brave und einfältige Untertanen wir doch sind. Die restliche Menschheit (ja, ja, ich weiß, ich weiß, wirklich, aber lassen wir die einmal außer Acht, die haben ihr Stimmrecht längst verwirkt), also der Rest der restlichen Menschheit mag uns das vorwerfen, aber vielleicht – je nachdem, wer ihm die Meinung vorgibt – weiß er ja gar nicht, was für ein müdes, mutloses und gebrochenes Volk wir sind. Vielleicht begreift er nicht, wie dringend wir ein Wunder brauchen. Wie sehr wir uns nach dem Wunderbaren sehnen.
Wenn der Atomkrieg doch nur eine andere Art von Krieg wäre. Wenn es doch nur um übliche Dinge ginge – Staaten und Territorien, Götter und Geschichte. Wenn nur die von uns, die vor ihm Angst haben, verächtliche moralische Feiglinge wären, die nicht für die Verteidigung unseres Glaubens sterben wollen. Wenn der Atomkrieg nur einer von den Kriegen wäre, in denen Länder gegen Länder und Menschen gegen Menschen kämpfen. Aber das ist er nicht. Wenn es einen Atomkrieg gibt, heißt unser Gegner nicht China oder Amerika oder Pakistan. Unser Gegner ist dann der ganze Planet. Die Elemente selbst – der Himmel, die Luft, die Erde, der Wind und das Wasser – werden sich gegen uns wenden, und ihr Zorn wird furchtbar sein.
Unsere Städte und Wälder, unsere Äcker und Dörfer werden tagelang brennen. Flüsse werden zu Gift werden, die Luft zu Feuer, und der Wind wird die Flammen ausbreiten. Wenn alles verbrannt ist, was verbrennen kann, und das Feuer erlischt, wird Rauch aufsteigen und die Sonne verdunkeln. Finsternis wird die Erde einhüllen. Es wird nicht mehr Tag sein, nur noch endlose Nacht. Die Temperatur wird tief unter den Gefrierpunkt fallen, und der nukleare Winter wird anbrechen. Wasser wird zu giftigem Eis erstarren. Radioaktiver Niederschlag wird durch die Erde sickern und das Grundwasser verseuchen. Die meisten lebenden Organismen, Tiere und Pflanzen, Fische und Vögel, werden sterben. Nur Ratten und Kakerlaken werden sich weitervermehren und mit den übrig gebliebenen Menschen um die wenige Nahrung kämpfen, die es noch gibt.
Was tun dann wir, die wir überlebt haben? Verbrannt und blind, ohne Haare und krank, auf den Armen die vom Krebs zerfressenen Leichen unserer Kinder, wohin gehen wir? Was essen wir? Was trinken wir? Was atmen wir?
Der Leiter der Abteilung für Gesundheit, Umwelt und Sicherheit am Atomforschungszentrum Bhabha in Mumbai hat sich das überlegt. Er hat in einem Interview erklärt, Indien könne einen Atomkrieg überleben.[2] Für den Fall eines Atomkrieges rät er zu denselben Sicherheitsmaßnahmen, wie sie Wissenschaftler bei Unfällen in Atomkraftwerken empfehlen.
Er schlägt vor, Jodtabletten einzunehmen. Des Weiteren, drinnen zu bleiben, nur Wasser aus Flaschen und Essen aus Konserven zu sich zu nehmen und keine Milch zu trinken. Säuglinge sollten Milchpulver erhalten. »Menschen in der Gefahrenzone sollten sich unverzüglich ins Erdgeschoss, wenn möglich in den Keller begeben.«
Was soll man mit solchen Ausmaßen des Wahnsinns anfangen? Was tut man, wenn man in einer Irrenanstalt eingesperrt ist und die Ärzte alle gefährliche Irre sind?
Hört nicht auf sie, wird es heißen, sie ist doch nur eine naive Schriftstellerin und übertreibt wie alle Weltuntergangspropheten. Das wird nie geschehen. Es wird keinen Krieg geben. Atomwaffen dienen dem Frieden, nicht dem Krieg. »Abschreckung« lautet das Schlagwort derer, die sich gerne als Falken bezeichnen. (Schöne Vögel. Kalt, elegant, räuberisch. Schade, dass es sie nach dem Krieg nicht mehr geben wird. Wir müssen uns an das Wort »Aussterben« gewöhnen.) Das mit der Abschreckung ist eine alte Theorie, die jetzt wieder belebt und mit etwas Lokalkolorit ausgestattet wurde. Sie nimmt für sich in Anspruch, die Eskalation des Kalten Krieges zum Dritten Weltkrieg verhindert zu haben. Über den Dritten Weltkrieg lässt sich aber nur so viel sagen, dass er, wenn er kommt, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgefochten wird. In anderen Worten, der Zeitpunkt steht noch nicht fest. In anderen Worten, er kann noch kommen. Und vielleicht hat der Doppelsinn des Wortes – Dritte-Welt-Krieg – ja eine prophetische Bedeutung. Der Kalte Krieg ist vorbei, stimmt, aber lassen wir uns nicht von der zehnjährigen Ruhepause der nuklearen Drohgebärden hinters Licht führen. Sie ist nur ein grausamer Witz, eine vorübergehende Besserung. Keine Heilung, kein Beweis für irgendeine Theorie. Was sind zehn Jahre in der Weltgeschichte? Jetzt ist sie wieder da, die Krankheit, verbreiteter und resistenter gegen jede Behandlung denn je. Nein, die Theorie der Abschreckung hat einige fundamentale Mängel. Ihr erster Mangel ist, dass sie ein umfassendes, tiefes Verständnis der Psyche des Gegners voraussetzt. Sie geht davon aus, dass, was einen selbst abschreckt (die Angst vor der Vernichtung), auch die anderen abschreckt. Aber wenn sich jemand dadurch nicht abschrecken lässt? Ist die Psyche des Bombenattentäters, der sein eigenes Leben opfert – die »Wir-nehmen-euch-mit«-Mentalität – wirklich etwas so Abwegiges?
Überhaupt, wer steht auf der einen und wer auf der anderen Seite? Beide Seiten sind nur Regierungen. Regierungen verändern sich. Sie tragen Masken unter Masken. Sie häuten sich und erfinden sich die ganze Zeit neu. Die zum Beispiel, die wir gerade haben, hat nicht einmal genügend Sitze, um eine ganze Amtsperiode zu überstehen. Sie verlangt, dass wir ihren Pirouetten und Kabinettstückchen mit der Atombombe vertrauen, während sie verzweifelt versucht, Tritt zu fassen und eine einfache Mehrheit im Parlament zu halten.
Der zweite Mangel ist, dass die Abschreckung auf Angst basiert. Voraussetzung der Angst ist aber Wissen. Wissen um das wahre Ausmaß der Zerstörung, die ein Atomkrieg anrichtet. Man denkt bei Atombomben nicht auf wundersame Weise automatisch an Frieden. Im Gegenteil, den Atomkrieg abgewendet oder auch nur verschoben hat der unermüdliche Widerstand von Menschen, die den Mut hatten, die Bombe anzuprangern – mit Märschen, Demonstrationen, Filmen, öffentlicher Empörung. Abschreckung wird und kann nicht funktionieren angesichts von Ignoranz und Analphabetentum, die wie zwei dichte, undurchdringliche Schleier über unseren beiden Ländern liegen. (Der Vishwa Hindu Parishad [VHP] – der Welthindurat – etwa will radioaktiven Staub aus der Wüste Pohkran als prasad über ganz Indien verteilen. Ein Krebs-Yantra?) Die Theorie der Abschreckung ist in einer Welt, in der gegen atomare Strahlung vorbeugend Jodtabletten verschrieben werden, nur ein gefährlicher Witz.
Indien und Pakistan haben jetzt Atombomben, und zwar, wie sie meinen, vollkommen zu Recht. Andere werden bald folgen. Israel, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Norwegen, Nepal (ich zähle die Länder auf, wie sie mir einfallen), Dänemark, Deutschland, Bhutan, Mexiko, Libanon, Sri Lanka, Myanmar, Bosnien, Singapur, Nordkorea, Schweden, Südkorea, Vietnam, Kuba, Afghanistan, Usbekistan … und warum nicht? Jedes Land der Welt hat seine besonderen Gründe. Alle haben Grenzen und Überzeugungen. Und wenn unsere Speisekammern prallvoll mit glänzenden Bomben gefüllt sind und unsere Mägen leer (die Abschreckung ist eine unersättliche Bestie), können wir Bomben gegen Nahrungsmittel tauschen. Und wenn die Atomtechnik dann auf den Markt kommt, wenn konkurrierende Anbieter sie verkaufen und die Preise fallen, können sich nicht nur Staaten, sondern alle, die genug Geld haben, ein privates Arsenal einrichten – Geschäftsleute, Terroristen, hin und wieder vielleicht sogar eine wohlhabende Schriftstellerin (wie ich). Unser Planet wird vor schönen Waffen starren. Eine neue Weltordnung wird entstehen. Die Diktatur der Kernwaffenelite. Einander zu bedrohen gibt uns den ganz besonderen Kick. Das ist dann wie Bungee-Jumping ohne zuverlässiges Seil oder den ganzen Tag lang russisches Roulette spielen. Ein zusätzlicher Kitzel wird es sein, nicht zu wissen, wem man glauben darf. Wir sind der räuberischen Phantasie jedes Scharlatans ausgeliefert, der auf der Suche nach einer Aufenthaltsgenehmigung mit wirren Geschichten unmittelbar bevorstehender Raketenangriffe im Westen auftaucht. Wir haben die schöne Aussicht, dass jeder kleine Störenfried und Gerüchtemacher uns erpressen kann, je mehr, desto besser. Um die Wahrheit zu sagen, wir geben alles für einen Grund, noch mehr Bomben herzustellen. Man sieht, es gibt auch ohne Krieg viel Grund zur Freude.
Doch lasst uns innehalten. Ehre, wem Ehre gebührt. Wem haben wir für all dies zu danken?
Denen, die es möglich gemacht haben. Den Herren des Universums. Meine Damen und Herren, den Vereinigten Staaten von Amerika! Kommt rauf, Leute, tretet vor uns und verbeugt euch. Danke für euer Geschenk an die Welt. Danke dafür, dass ihr es möglich gemacht habt. Danke dafür, dass ihr uns den Weg gezeigt habt. Danke dafür, dass ihr dem Leben eine neue Bedeutung gegeben habt.
Von jetzt an müssen wir nicht mehr vor dem Sterben Angst haben, sondern vor dem Leben.
Die größte Narrheit ist es, zu glauben, Atomwaffen seien nur bei Gebrauch tödlich. Allein die Tatsache ihrer Existenz, ihre bloße Gegenwart in unserem Leben wird sich verheerender auswirken, als wir bisher ahnen. Atomwaffen durchsetzen unser Denken, lenken unser Verhalten, verwalten unsere Gesellschaft, beherrschen unsere Träume. Sie graben sich wie Fleischerhaken tief in unsere Hirne. Sie verbreiten Wahnsinn. Sie sind der schlimmste Kolonialherr, weißer als jeder Weiße, der je lebte, die Inkarnation des Weißen.
Ich kann nur allen Männern, Frauen und Kindern hier in Indien und drüben in Pakistan, das uns so nah ist, zurufen: Ihr seid persönlich betroffen. Was immer ihr seid, ob Hindus, Muslime, Städter oder Bauern, spielt dabei keine Rolle. Das einzig Gute am Atomkrieg ist, dass er das Egalitärste ist, was der Mensch sich je ausgedacht hat. Am Tage der Abrechnung wird niemand nach seinen Referenzen gefragt werden. Die Zerstörung wird unterschiedslos alle treffen. Die Bombe liegt nicht bei dir im Garten, sie ist in deinem Körper. Und in meinem. Niemand, kein Land, kein Staat, kein Mensch, kein Gott hat das Recht, sie dort abzulegen. Wir sind schon radioaktiv, und der Krieg hat noch gar nicht begonnen. Also steht auf und sagt etwas. Macht euch nichts daraus, wenn es schon gesagt worden ist. Sprecht für euch. Für euch ganz persönlich.
Die Bombe und ich
Anfang Mai 1998 (vor der Bombe) verreiste ich für drei Wochen. Ich dachte, ich würde wieder zurückkommen. Ich war fest entschlossen dazu. Aber die Dinge hatten sich nicht so entwickelt, wie ich es geplant hatte.
Auf meiner Reise begegnete ich einer Freundin, an der ich unter anderem eines mag, nämlich ihre Fähigkeit, tiefe Zuneigung mit einer an Grausamkeit grenzenden Offenheit zu verbinden.
»Ich habe über dich nachgedacht«, sagte sie, »über den Gott der kleinen Dinge und alles, was irgendwie damit zu tun hat …«
Sie verstummte. Ich war nervös und keineswegs sicher, ob ich den Rest dessen, was sie zu sagen hatte, hören wollte. Sie dagegen hatte keine Bedenken. »Du hast in diesem letzten Jahr – genau genommen weniger als einem Jahr – zu viel von allem gehabt – Ruhm, Geld, Preise, Schmeicheleien, Kritik, Verurteilung, Spott, Liebe, Hass, Wut, Neid, Großzügigkeit – von allem. In gewisser Hinsicht eine vollkommene Geschichte. Das ist alles so total – total barock in seinem Exzess. Das Problem ist, die Geschichte hat nur einen passenden Schluss, kann nur einen haben.« Sie hatte die Augen auf mich gerichtet, sie leuchteten, als sie mich abschätzend, forschend ansah. Sie wusste, dass ich wusste, was sie sagen wollte. Sie war verrückt.
Sie wollte sagen, dass nichts, was mir in der Zukunft noch zustoßen konnte, der Aufregung dieses Jahres gleichkommen würde. Dass der Rest meines Lebens irgendwie unbefriedigend sein würde und dass deshalb der einzige passende Schluss der Geschichte der Tod wäre. Mein Tod.
Der Gedanke war mir auch schon gekommen, natürlich. Dass sich all das, der Rummel, das Scheinwerferlicht in meinen Augen, der Applaus, die Blumen, die Fotografen, die Journalisten, die tiefes Interesse an meinem Leben heuchelten (und zugleich Mühe hatten, ein einziges Detail richtig hinzukriegen), die um mich scharwenzelnden Männer in Anzügen, die blitzenden Hotelbäder mit ihren endlosen Handtüchern, dass sich all das wahrscheinlich nicht wiederholen würde. Würde ich es vermissen? Hatte ich mich so daran gewöhnt, dass ich es brauchte? War ich nach Ruhm süchtig? Würde ich unter Entzugserscheinungen leiden?
Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass ständiger Ruhm mich umbringen, mich mit seinen guten Manieren und seiner Hygiene ersticken würde. Ich gebe zu, ich habe meine fünf Minuten davon ungeheuer genossen, aber vor allem, weil es nur fünf Minuten waren. Weil ich wusste (oder zu wissen glaubte), dass ich, wenn mir langweilig wurde, nach Hause gehen und darüber lachen konnte. Dass ich alt und unzurechnungsfähig werden konnte. Im Mondschein Mangos essen konnte. Vielleicht einige Bücher schreiben konnte, die durchfielen – »Worstsellers« –, um zu erfahren, wie man sich dabei fühlte. Ein ganzes Jahr lang bin ich kreuz und quer durch die Welt gejettet. Was mich aufrecht hielt, waren immer die Gedanken an zu Hause und das Leben, zu dem ich zurückkehren würde. Das war entgegen allen Voraussagen meiner bevorstehenden Auswanderung und entsprechenden Anfragen die Quelle, in die ich eintauchte. Das war mein Nährboden, gab mir Kraft.
Ich antwortete meiner Freundin, es gebe keine vollkommenen Geschichten. Ich sagte, die Annahme, das Glück einer Person, oder sagen wir, ihre Erfüllung, habe den Gipfelpunkt erreicht (nach dem es nur noch abwärts gehen könne), nur weil diese Person zufällig »Erfolg« gehabt habe, sei eine rein äußerliche Sicht der Dinge. Sie basiere auf der phantasielosen Vorstellung, alle Menschen träumten zwangsläufig von Reichtum und Ruhm.
Du lebst schon zu lange in New York, sagte ich. Es gibt andere Welten, andere Arten von Träumen. Träume, zu denen auch das Scheitern gehört. In denen es ehrenhaft ist, manchmal sogar erstrebenswert. Welten, in denen Anerkennung nicht der einzige Maßstab für den Verstand oder Wert eines Menschen ist. Viele Menschen, die ich kenne und liebe, Menschen, die viel wertvoller sind als ich, ziehen täglich in den Kampf, obwohl sie von vornherein wissen, dass sie scheitern werden. Zugegeben, sie sind weniger »erfolgreich« im vulgärsten Sinn des Wortes, aber mitnichten weniger erfüllt.
Der einzige Traum, den es sich lohne zu träumen, sagte ich, sei der Traum, dass man lebt, solange man lebt, und erst stirbt, wenn man tot ist. (Eine Vorahnung? Vielleicht.)
»Und was genau soll das heißen?« (Hochgezogene Augenbrauen, leicht verärgert.)
Ich wollte es erklären, aber es gelang mir nicht recht. Manchmal muss ich schreiben, um denken zu können. Also schrieb ich meine Gedanken für sie auf eine Papierserviette. Ich schrieb Folgendes: Lieben. Geliebt werden. Nie vergessen, wie unwichtig man selbst ist. Sich nie an die unaussprechliche Gewalt und vulgäre Ungleichheit des Lebens um einen herum gewöhnen. Am traurigsten Ort nach Freude suchen. Der Schönheit in ihr Versteck folgen. Nie vereinfachen, was kompliziert ist, oder kompliziert machen, was einfach ist. Stärke achten, nie Macht. Vor allem beobachten. Zu verstehen versuchen. Nie wegsehen. Und nie, nie vergessen.
Ich kenne sie seit Jahren, meine Freundin. Sie ist auch Architektin.
Sie sah mich zweifelnd an, von meiner Serviettenrede nicht überzeugt. Ich begriff, dass sie sich – rein als gedankliches Konstrukt, aus Gründen der narrativen Ausgewogenheit und auch, weil sie mich gernhatte – so sehr und selbstlos über meinen Erfolg freute, dass sich ihre Begeisterung mit ihrer Angst vor meinem möglichen Tod die Waagschale hielt. Ich begriff, dass es sich nicht um etwas Persönliches handelte. Es war nur eine Frage der Form.
Zwei Wochen nach diesem Gespräch kehrte ich nach Indien zurück, in das Land, das ich für meine Heimat halte/hielt. Etwas war gestorben, aber nicht ich. Etwas unendlich viel Wertvolleres. Eine Welt, die schon eine Zeit lang krank gewesen war und endlich den letzten Atemzug getan hatte. Jetzt wurde sie eingeäschert. Die Atmosphäre ist verpestet, und der unverkennbare Geruch des Faschismus liegt in der Luft.
In Leitartikeln, im Rundfunk, in Fernsehtalkshows und in MTV (du meine Güte) laufen sie täglich über – Menschen, denen man glaubte vertrauen zu können, Schriftsteller, Maler, Journalisten. Eiseskälte kriecht mir in die Knochen, als täglich aufs Neue schmerzhaft klar wird, dass es wahr ist, was man in Geschichtsbüchern liest. Dass der Faschismus genauso viel mit Menschen zu tun hat wie mit Regierungen. Dass er zu Hause beginnt. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Bett. »Wir sind wieder wer«, »Auf dem Weg nach oben«, »Ein Augenblick des Stolzes«, so lauteten an den Tagen nach den Atomtests die Schlagzeilen.[1] »Wir haben gezeigt, dass wir keine Eunuchen mehr sind«, sagte Mr. Thackeray, der Vorsitzende von Shiv Sena.[2] (Wer hat das denn behauptet? Sicher, ziemlich viele von uns sind Frauen, aber meines Wissens ist das etwas anderes.) Man konnte bei der Zeitungslektüre oft gar nicht sagen, ob von Viagra die Rede war (das auf den Titelseiten um den zweiten Platz konkurrierte) oder von der Bombe – »Wir sind stärker und potenter.« (Das sagte unser Verteidigungsminister, nachdem Pakistan seine Tests abgeschlossen hatte.)[3]
»Nicht nur die Atombombe, die ganze Nation steht hier auf dem Prüfstand«, hieß es.
Immer wieder wurde es uns eingehämmert. Die Bombe ist Indien, Indien ist die Bombe. Nicht einfach nur Indien, das hinduistische Indien. Seid deshalb gewarnt, Kritik trifft nicht nur die Nation, sondern auch den Hinduismus. (In Pakistan haben sie natürlich eine muslimische Bombe. Davon abgesehen gelten in politischer Hinsicht die gleichen Gesetzmäßigkeiten.) Das ist ein unerwarteter weiterer Vorteil der Atombombe. Die Regierung kann damit nicht nur dem Feind drohen, sie kann dem eigenen Volk den Krieg erklären. Uns.
Im Jahr 1975, ein Jahr nach Indiens ersten nuklearen Gehversuchen, rief Indira Gandhi den Notstand aus. Was wird die Zukunft bringen? Es ist die Rede von der Überwachung staatsfeindlicher Aktivitäten durch eigens dafür geschaffene Einheiten. Von einer Änderung der Mediengesetze, um Sender verbieten zu können, die »die nationale Kultur schädigen«.[4] Von Kirchen, die von der Liste religiöser Stätten gestrichen werden sollen, weil dort »Wein ausgeschenkt« wird (angekündigt und wieder zurückgenommen).[5] Künstler, Schriftsteller, Schauspieler und Sänger werden verfolgt und bedroht (und lassen sich von den Drohungen einschüchtern). Nicht nur von Schlägertrupps, sondern von behördlichen Maßnahmen. Und von Gerichten. Im Internet sind Briefe und Artikel im Umlauf, schöpferische Interpretationen der Prophezeiungen des Nostradamus, laut denen eine mächtige hinduistische Eroberernation entstehen wird, ein starkes Indien, das sich »gegen seine ehemaligen Unterdrücker wenden und sie auslöschen wird«. Durchaus möglich, dass dahinter ein verrückter Einzelgänger oder eine obskure Gruppe religiöser Fanatiker steckt. Das Problem ist nur, dass der Besitz einer Atombombe solche Gedanken durchführbar erscheinen lässt. Die Bombe erzeugt solche Gedanken. Sie gibt dem Menschen ein grundfalsches, tödliches Bewusstsein seiner Macht. Und dann passiert es. Dann passiert es. Ich wollte, ich könnte sagen: »Langsam, aber sicher« – aber ich kann nicht. Es geht alles ziemlich schnell.
Warum kommt einem das alles so vertraut vor? Weil sich die Wirklichkeit, noch während man hinsieht, auflöst und nahtlos in die stummen Schwarz-Weiß-Bilder alter Filme verwandelt – Bilder von Menschen, die aus ihrem Leben gejagt, zusammengetrieben und in Lager gesperrt werden. Von Massakern, blutigem Chaos, endlosen Schlangen gebrochener Menschen auf dem Weg ins Nichts. Warum gibt es keinen Ton? Warum ist es im Saal so still? Habe ich zu viele Filme gesehen? Bin ich verrückt? Oder habe ich recht? Sind diese Bilder vielleicht der unausweichliche Höhepunkt dessen, was wir in Gang gesetzt haben? Entwickelt sich unsere Zukunft in rasendem Tempo zu unserer Vergangenheit? Ich glaube ja. Es sei denn natürlich, ein Atomkrieg löst das Problem ein für alle Mal.
Als ich meinen Freunden erzählte, dass ich an diesem Essay schrieb, mahnten sie zur Vorsicht. »Schreibe ihn«, sagten sie, »aber sorge zuerst dafür, dass du nicht selbst verwundbar bist. Sieh zu, dass deine Papiere in Ordnung sind. Sieh zu, dass du deine Steuern gezahlt hast.«
Meine Papiere sind in Ordnung. Meine Steuern habe ich bezahlt. Aber wie sollte man in einem solchen Klima nicht verwundbar sein? Jeder ist das. Passieren kann immer etwas. Sicher ist nur, wer sich fügt. Während ich dies schreibe, erfüllen mich böse Vorahnungen. Ich habe in diesem Land erfahren, was es für eine Schriftstellerin bedeutet, geliebt (und bis zu einem gewissen Grad auch gehasst) zu werden. 1997 gehörte ich zu den Erfolgsmenschen, die von den indischen Medien stolz zum Jahresende präsentiert wurden. Zu meinem großen Ärger gehörten auch ein Bombenbauer und eine internationale Schönheitskönigin dazu. Jedes Mal, wenn auf der Straße jemand strahlend auf mich zukam und sagte: »Indien ist stolz auf Sie« (was sich auf den Preis bezog, den ich gewonnen hatte, nicht auf mein Buch), war mir unbehaglich zumute. Es machte mir damals Angst, und es erschreckt mich heute, weil ich weiß, wie leicht diese Bewunderung, diese Woge der Zuneigung in ihr Gegenteil umschlägt. Vielleicht ist es jetzt so weit. Ich trete aus dem Licht der Scheinwerfer und sage, was mir am Herzen liegt.
Nämlich das:
Wenn der Protest dagegen, eine Atombombe ins Gehirn eingepflanzt zu bekommen, antihinduistisch und staatsfeindlich ist, dann sage ich mich von diesem Staat los. Dann erkläre ich mich hiermit zu einer unabhängigen mobilen Republik. Ich bin eine Erdenbürgerin. Ich besitze kein Land und habe keine Fahne. Ich bin eine Frau, habe aber nichts gegen Eunuchen. Meine Politik ist einfach. Ich bin bereit, jeden nur denkbaren Atomsperrvertrag und jedes Atomteststoppabkommen zu unterschreiben. Einwanderer sind willkommen.
Meine Welt ist tot. Ich schreibe, um ihr Ende zu betrauern.
Zugegeben, sie hatte Fehler. War so nicht lebensfähig und voller Narben und Wunden. Es war eine Welt, die ich selbst schonungslos kritisiert habe, aber doch nur, weil ich sie liebte. Sie hat den Tod nicht verdient. Sie hat es nicht verdient, zerstückelt zu werden. Verzeihung, ich weiß schon, Sentimentalität ist nicht modern – aber wohin soll ich mit meinem Elend?
Ich liebe diese Welt einfach deshalb, weil sie der Menschheit die Wahl ließ. Sie war ein Felsen draußen im Meer. Sie war ein Lichtspalt, der hartnäckig anzeigte, dass man auch anders leben konnte. Sie war eine funktionierende Möglichkeit. Eine wirkliche Alternative. Damit ist jetzt Schluss. Nichts kann die indischen Atomtests rechtfertigen – die Art, wie sie durchgeführt wurden, die Begeisterung, mit der sie (von uns) begrüßt wurden. Für mich sind sie ein schrecklicher Wendepunkt. Das Ende des Vorstellbaren. Ja, das Ende der Freiheit, denn darum geht es doch letztlich bei der Freiheit. Um die Wahl.
Am 15. August 1997 feierten wir den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens. Von nun an können wir eine Zukunft der atomaren Knechtschaft feiern.
Warum haben sie das getan?
Es war politisch nützlich, lautet die naheliegende, zynische Antwort, nur dass das eine weitere, grundsätzlichere Frage aufwirft: Inwiefern war es politisch nützlich?
Offiziell werden drei Gründe genannt: China, Pakistan und die Entlarvung der westlichen Heuchelei.
Nimmt man diese Gründe ernst und betrachtet man jeden für sich, gerät man ins Stutzen. Ich will überhaupt nicht abstreiten, dass sich dahinter wirkliche Probleme verbergen. Ich sage nur, dass sie nicht neu sind. Das einzig Neue am alten Horizont ist die indische Regierung. In einem erschreckend anmaßenden Brief an den US-Präsidenten (warum überhaupt schreiben, wenn man so schreibt?) sagt unser Premierminister, der Grund für Indiens Entscheidung zur Durchführung der Atomtests sei die »sich verschlechternde Sicherheitslage«. Dann kommt er auf den Krieg mit China 1962 zu sprechen und auf die »drei Aggressionen« Pakistans, »die wir in den vergangenen 50 Jahren über uns ergehen lassen mussten. Und seit zehn Jahren sind wir Opfer eines von Pakistan finanzierten erbarmungslosen Terrorismus und kriegerischer Übergriffe, vor allem in Jammu und Kaschmir.«[6]
Der Krieg mit China ist mehrere Jahrzehnte her. Wenn es nicht irgendein wichtiges Staatsgeheimnis gibt, von dem wir nicht wissen, dann drängte sich doch der Eindruck auf, als hätte sich die Lage zwischen uns etwas entspannt. Nur wenige Tage vor den Tests war General Fu Quanyou, der Generalstabschef der chinesischen Volksbefreiungsarmee, bei unserem Generalstabschef zu Gast. Von Krieg war dabei nichts zu hören.
Der letzte Krieg mit Pakistan liegt 27 Jahre zurück. Zugegeben, Kaschmir ist eine immer noch von heftigen Unruhen erschütterte Region, und zweifellos schürt Pakistan den Konflikt lustvoll. Aber schüren kann man doch wohl nur, wo es Flammen gibt? Wo genügend Zunder bereitliegt? Kann Indien sich, wenn es auch nur einen Funken Ehrlichkeit besitzt, von jeder Mitschuld an den Unruhen in Kaschmir freisprechen? Kaschmir wie übrigens auch Assam, Tripura und Nagaland – im Grunde der ganze Nordosten –, Jharkhand, Uttarakhand und die Krisen, die noch auf uns zukommen, sind nur Symptome einer tiefer liegenden Krankheit. Sie lässt sich nicht durch auf Pakistan gerichtete Atomraketen heilen.
Auch der Konflikt mit Pakistan selbst kann nicht durch auf Pakistan gerichtete Atomraketen gelöst werden. Wir sind zwei verschiedene Länder, aber wir haben einen gemeinsamen Himmel, gemeinsame Winde, gemeinsames Wasser. Wo der radioaktive Fallout niedergeht, hängt von der Richtung ab, aus der Wind und Regen kommen. Lahore und Amritsar liegen 48 Kilometer auseinander. Wenn wir Lahore bombardieren, brennt Punjab. Wenn wir Karatschi bombardieren, brennen Gujarat und Rajasthan, vielleicht sogar Mumbai. Ein Atomkrieg gegen Pakistan wäre ein Krieg gegen uns selbst.
Und der dritte offizielle Grund, die Bloßstellung der westlichen Heuchelei – wie viel mehr kann sie denn noch bloßgestellt werden? Welcher anständige Mensch gibt sich darüber noch Illusionen hin? Die Geschichte der Völker des Westens ist getränkt mit dem Blut anderer. Kolonialismus, Apartheid, Sklaverei, ethnische Säuberungen, biologische Kriegführung, chemische Waffen – sie haben praktisch alles erfunden. Sie haben Nationen ausgeplündert, Kulturen ausgelöscht, ganze Völker ausgerottet. Sie stehen splitternackt auf der Bühne der Welt, ohne dass ihnen dies im Mindesten peinlich wäre, denn sie wissen, dass sie mehr Geld, mehr zu essen und größere Bomben haben als alle anderen. Sie wissen, dass sie uns an einem einzigen, ganz normalen Werktag auslöschen können. Ich persönlich halte das mehr für Arroganz als für Heuchelei.
Wir haben weniger Geld, weniger zu essen und kleinere Bomben. Aber wir haben – oder hatten – alle möglichen anderen Reichtümer. Wunderbare Dinge, nicht quantitativ messbar. Wir haben damit das Gegenteil von dem gemacht, was wir glauben gemacht zu haben. Wir haben alles versetzt, eingetauscht. Für was? Für einen Vertrag mit ebenden Menschen, die wir angeblich verachten. Wir haben uns bereit erklärt, im Großen und Ganzen ihr Spiel zu spielen und es auf ihre Weise zu spielen. Wir haben ihre Bedingungen kritiklos übernommen. Verglichen damit, zählt das Abkommen über einen umfassenden Atomteststopp (CTBT) nichts.
Alles in allem kann man, glaube ich, sagen, dass wir die Heuchler sind. Wir haben selbst aufgegeben, was man einen moralischen Standpunkt nennen konnte, nämlich: Wir haben zwar die Technologie, wir können Bomben herstellen, wenn wir wollen, aber wir tun es nicht. Wir glauben nicht daran.
Wir selbst haben das ganze aufgeregte Geschrei angestimmt, um in den Club der Supermächte aufgenommen zu werden. (Wenn wir drin sind, machen wir sicher frohen Herzens die Tür hinter uns zu und lassen alle guten Vorsätze für den Kampf gegen diskriminierende Weltordnungen zur Hölle fahren.) Die Forderung Indiens nach dem Status einer Supermacht ist so lächerlich wie die Forderung nach Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft, nur weil wir einen Ball haben. Macht ja nichts, dass wir uns nicht qualifiziert haben, dass wir gar nicht viel Fußball spielen und keine Mannschaft haben.
Da wir nun schon beschlossen haben, das Spielfeld zu betreten, wäre es vielleicht keine schlechte Idee, die Spielregeln zu lernen. Die erste Regel ist: Erkenne, wer dir überlegen ist. Wer sind die besten Spieler? Die mit mehr Geld, mehr Essen und mehr Bomben.
Die zweite Regel ist: Finde deinen Platz im Verhältnis zu ihnen, also: Schätze deine Situation und Fähigkeit ehrlich ein. Eine solche Einschätzung (in quantitativ messbaren Begriffen) lautet in unserem Fall:
Wir sind ein Land mit einer Milliarde Menschen. In Sachen Entwicklung stehen wir unter den 175 auf dem Human Development Index des UN-Entwicklungsprogramms aufgeführten Ländern auf Platz 138.[7] Über 400 Millionen Inder sind Analphabeten und leben in völliger Armut, über 600 Millionen haben nicht einmal Zugang zu elementaren sanitären Einrichtungen, und über 200 Millionen haben kein sauberes Trinkwasser.
Für sich betrachtet, sind die drei offiziellen Gründe also nicht besonders stichhaltig. Betrachtet man sie zusammen, zeigt sich jedoch eine Art verbogener Logik, die mehr mit uns als mit den Gründen zu tun hat.
Die Schlüsselwörter im Brief unseres Premierministers an den US-Präsidenten sind »ergehen lassen müssen« und »Opfer«. Darum geht es eigentlich. Das ist unser Fleisch und Brot. Wir brauchen Feinde. Wir können uns so wenig als Nation definieren, dass wir ständig etwas suchen, von dem wir uns wenigstens absetzen können. Zurzeit gilt als der politischen Weisheit letzter Schluss, dass wir ein gemeinsames Ziel brauchen, wenn wir den Zerfall des Staates verhindern wollen, nur dass wir außer unserer Währung (und natürlich der Armut, dem Analphabetentum und den Wahlen) nichts Gemeinsames haben. Das ist der Kern des Problems. Das ist die Straße, die uns zur Bombe geführt hat. Die Suche nach uns selbst. Wenn wir hier einen Ausweg finden wollen, brauchen wir ehrliche Antworten auf einige unbequeme Fragen. Auch diese Fragen sind schon gestellt worden. Nur antworten wir immer ganz leise und hoffen, dass niemand gehört hat.
Gibt es so etwas wie eine indische Identität?
Brauchen wir denn eine?
Wer ist ein authentischer Inder und wer nicht?
Ist Indien indisch?
Ist das wichtig?
Ob es je eine einheitliche Kultur gegeben hat, die sich »indische Kultur« nennen könnte, ob Indien eine zusammenhängende kulturelle Einheit war, ist oder sein wird, hängt davon ab, ob man die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten in der Kultur der Völker betont, die den Subkontinent seit Jahrhunderten bewohnen. Indien als moderner Nationalstaat mit präzisen geographischen Grenzen wurde erst im Jahr 1899 durch ein britisches Gesetz geschaffen. Unser Land, wie wir es kennen, wurde auf dem Amboss des britischen Empire aus ganz unsentimentalen, kommerziellen und bürokratischen Gründen geschmiedet. Aber schon in seiner Geburtsstunde begann es, sich gegen seine Schöpfer aufzulehnen. Ist Indien also indisch? Das ist eine schwierige Frage. Sagen wir einfach, wir sind ein altes Volk, das lernt, in einem jungen Staat zu leben.
Die Mehrheit der indischen Staatsbürger ist bis heute nicht in der Lage, auf einer Karte die indischen Grenzen zu zeigen oder zu sagen, welche Sprache wo gesprochen und welcher Gott wo verehrt wird. Für sie ist Indien bestenfalls ein Schlagwort, das immer zu Wahl- oder Kriegszeiten ertönt. Oder eine Montage von Menschen in den Sendungen des staatlichen Fernsehens, die die jeweilige Landestracht tragen und Mera Bharat Mahaan sagen (»Mein Indien ist das Höchste«).
Die Menschen, die ein vitales (oder, genauer, ein geschäftliches) Interesse an einer ausgeprägten nationalen Identität Indiens haben, sind die Politiker der großen politischen Parteien. Der Grund dafür liegt nahe: Ihr ganzes Bemühen und ihre Karriere sind – notgedrungen – darauf ausgerichtet, mit dieser Identität eins zu werden. Mit ihr identifiziert zu werden. Wenn es keine gibt, müssen sie eine schaffen und die Menschen dazu überreden, für diese Identität zu stimmen. Ihre Schuld ist das nicht. Es hängt mit dem indischen Staatsgebiet zusammen. Es gehört zum Wesen unseres Systems einer zentralistischen Regierung. Es ist ein Geburtsfehler unserer Art von Demokratie. Je totaler der moralische Bankrott der Politiker, desto abstruser werden die Vorstellungen, was diese Identität ausmachen könnte. In einer solchen Lage eine tragfähige »nationale Identität« Indiens zusammenzuschustern, wäre allerdings zugegebenermaßen auch für einen Weisen oder einen Visionär eine gewaltige Herausforderung. Jeder einzelne indische Staatsbürger könnte sich, wenn er oder sie wollte, auf die Zugehörigkeit zu irgendeiner Minderheit berufen. Die Risse verlaufen, wenn man nach ihnen Ausschau hält, vertikal, horizontal, in Schichten und Wirbeln, kreisförmig, spiralig, von innen nach außen und von außen nach innen. Feuer breiten sich, einmal entzündet, entlang dieser Risse aus und setzen dabei gewaltige Mengen an politischer Energie frei, ähnlich dem, was passiert, wenn man ein Atom spaltet.
Es ist diese Energie, die Gandhi nutzbar zu machen versuchte, als er die Wunderlampe rieb und Rama und Rahim einlud, an einer menschlichen Politik und Indiens Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten teilzunehmen. Es war ein raffinierter, großartiger, phantasievoller Kampf, doch sein Ziel war klar umrissen, das Opfer gut sichtbar, leicht auszumachen und strotzend vor politischer Sünde. Unter solchen Umständen fand die Energie leicht einen Sammelpunkt. Leider ist die Situation heute völlig verändert, aber der Geist ist aus der Lampe und will nicht mehr in sie zurück. (Man könnte ihn zwar wieder hineinkriegen, aber das will niemand, er hat sich als zu nützlich erwiesen.) Ja, er hat uns die Freiheit gebracht, aber auch die blutige Teilung. Und jetzt, in den Händen minderer Staatsmänner, hat er uns die hinduistische Atombombe beschert.
Man darf Gandhi und den anderen Führern der Unabhängigkeitsbewegung nicht Unrecht tun. Hinterher ist man oft klüger, und sie konnten unmöglich wissen, was die langfristigen Folgen ihrer Strategie sein würden. Sie konnten nicht vorhersehen, wie schnell die Situation außer Kontrolle geraten würde, was geschehen würde, wenn sie die Fackel in die Hände ihrer Nachfolger gaben, und wie korrupt diese Hände sein konnten.
Der eigentliche Umbruch wurde durch Indira Gandhi ausgelöst. Sie machte den Geist der Lampe zum permanenten Staatsgast. Sie spritzte das Gift in unsere politischen Adern. Sie erfand die besonders bösartige indische Variante von politischem Zweckdenken. Sie zeigte uns, wie man aus dünner Luft Feinde beschwört und wie man auf Phantome schießt, die man zuvor eigens zu diesem Zweck geschaffen hat. Und sie entdeckte, wie vorteilhaft es war, die Toten nicht zu begraben, sondern die verwesenden Leichen bei passender Gelegenheit herauszuholen, um alte Wunden aufzureißen. Gemeinsam mit ihren Söhnen gelang es ihr, das Land in die Knie zu zwingen. Die neue Regierung hat uns nur noch einen Fußtritt verpasst und unsere Köpfe auf den Richtblock gelegt.
Die BJP, die Bharatiya Janata Party, ist in mancher Hinsicht ein von Indira Gandhi und der Kongresspartei geschaffenes Schreckgespenst. Oder, weniger hart formuliert, ein Schreckgespenst, das in der vom Kongress gehegten und gepflegten, von Misstrauen geprägten politischen Landschaft wuchs und gedieh. Die Partei hat dem Stil des Regierens eine neue Farbe gegeben. Während Frau Gandhi mit Politikern und Parteien versteckte Spiele spielte, bediente sie sich bei öffentlichen Auftritten einer schrillen, mit abgedroschenen Phrasen gespickten Klosterschulenrhetorik. Die BJP dagegen beschloss, ihre Feuer direkt auf der Straße und in den Wohnungen und Herzen der Menschen zu entzünden. Sie ist bereit, am Tag zu tun, was der Kongress nur nachts tut, und zu legitimieren, was bis dahin als unakzeptabel galt (aber trotzdem getan wurde). Daraus ließe sich womöglich ein schwaches Argument zugunsten der Heuchelei ableiten. Deutet die Heuchelei der Kongresspartei, die Tatsache, dass sie ihre dunklen Geschäfte im Verborgenen und nicht in aller Öffentlichkeit abwickelt, vielleicht auf einen entfernten Anflug von Schuldbewusstsein hin? Einen letzten Rest Anstand?
Leider nein.
Nein.
Was tue ich hier eigentlich? Warum suche ich nach einem Hoffnungsschimmer?
Funktioniert hat das bei der Zerstörung der Babri-Moschee in Ayodhya oder bei der Herstellung der Atombombe so: Der Kongress säte den Samen, hegte und pflegte die Saat, dann kam die BJP und fuhr die hässliche Ernte ein. Eng umschlungen tanzen die beiden Walzer. Sie sind trotz ihrer lautstark bekundeten Verschiedenheit unzertrennlich. Gemeinsam haben sie uns hierher, in diese furchtbare Lage gebracht.
Die hohnlachenden jungen Männer, die die Babri-Moschee zerstörten, sind dieselben wie die, deren Bilder in den Tagen nach den Atomtests in der Zeitung erschienen. Auf der Straße feierten sie Indiens Atombombe und »verurteilten« zugleich die westliche Kultur, indem sie Kästen mit Cola und Pepsi in die Gullys leerten. Ich verstehe diese Logik nicht ganz: Cola ist also westliche Kultur, aber die Atombombe ist eine alte indische Tradition?
Ja, ich habe davon gehört – das mit der Bombe steht bereits in den Veden. Möglich, aber wer genau hinsieht, findet dort auch Coca-Cola. Das ist ja so großartig an religiösen Texten: Man findet in ihnen alles, was man will – solange man weiß, was man sucht.
Aber zurück zu den nicht vedischen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts: Wir heißen die Inkarnation des Weißen, die teuflischste Schöpfung westlicher Wissenschaftler stürmisch willkommen und reklamieren sie für uns. Aber wir protestieren gegen ihre Musik, ihr Essen, ihre Kleider, ihre Filme und ihre Literatur. Das zeugt nicht von Heuchelei, sondern von Humor.
Es könnte einen Totenschädel zum Lachen bringen.
Wir sitzen wieder im alten Boot. Im Dampfschiff Authentizität & Indischsein.
Wenn es einen Trend hin zu Authentizität und weg vom Nationalismus gibt, sollte der Staat seine Geschichte vielleicht erst einmal berichtigen und falsche Fakten ausmerzen. Und das sollte er, wenn er schon dabei ist, gleich gründlich tun.