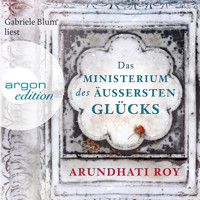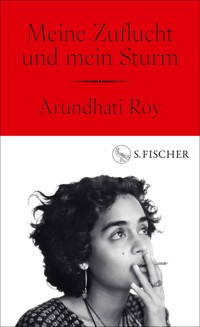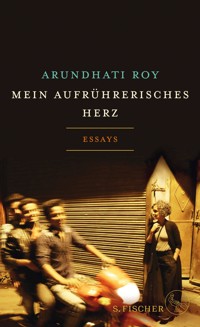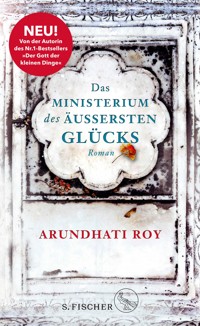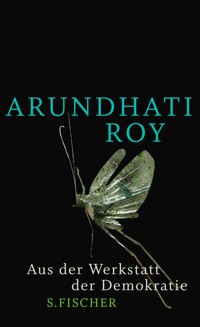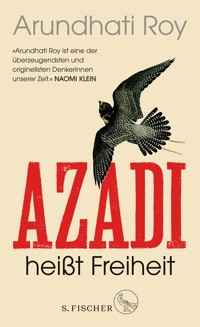
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein mutiges Buch einer der engagiertesten Frauen der Welt: ein Manifest für die Zeit nach der Pandemie »Azadi heißt Freiheit.« Ob sie als Erzählerin in ihren Bestseller-Romanen wie »Der Gott der kleinen Dinge« andere Universen entwirft oder in ihren Essays unsere Welt schonungslos hinterfragt: Kompromisslos kritisiert die indische Autorin Arundhati Roy im Namen der Freiheit die Gesellschaften, die in Ost wie West immer nationalistischer agieren. Schonungslos untersucht sie Umweltzerstörung, Ausbeutung und Überwachung. Und doch muss die Pandemie nicht der Endpunkt dieses Weltvernichtungsprogramms sein: Denn was wäre, wenn Corona ein Portal wäre, an dem wir uns entscheiden müssen, was wir zurücklassen und was wir mit uns nehmen? Die Pandemie könnte eine Wende bedeuten. Der unnachgiebige Blick der Aktivistin Arundhati Roy kann uns Hoffnung schenken. »Arundhati Roy ist eine der überzeugendsten und originellsten Denkerinnen unserer Zeit.« Naomi Klein »Arundhati Roy ist eine der besten Schreiberinnen auf dem Subkontinent. Eine geniale Beobachterin Indiens, ironisch im Ton, herzhaft in der Sache.« Laura Höflinger, Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Arundhati Roy
Azadi heißt Freiheit
Essays
Essays
Über dieses Buch
»Azadi heißt Freiheit.« Ob sie als Erzählerin in ihren Romanen andere Universen entwirft oder in ihren Essays unsere Welt schonungslos hinterfragt: Kompromisslos kritisiert Arundhati Roy im Namen der Freiheit die Gesellschaften, die in Ost wie West immer nationalistischer agieren. Schonungslos untersucht sie Umweltzerstörung, Ausbeutung und Überwachung. Und doch muss die Pandemie nicht der Endpunkt dieses Weltvernichtungsprogramms sein: Denn was wäre, wenn Corona ein Portal wäre, an dem wir uns entscheiden müssen, was wir zurücklassen und was wir mit uns nehmen? Die Pandemie könnte eine Wende bedeuten. Der unnachgiebige Blick der Aktivistin Arundhati Roy kann uns Hoffnung schenken.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arundhati Roy wurde 1959 geboren, wuchs in Kerala auf und lebt in Neu-Delhi. Den internationalen Durchbruch schaffte sie mit ihrem Debütroman »Der Gott der kleinen Dinge«, für den sie 1997 den Booker Prize erhielt. Aus der Weltliteratur der Gegenwart ist er nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen Jahren widmete sie sich außer ihrem politischen und humanitären Engagement vor allem ihrem zweiten Roman »Das Ministerium des äußersten Glücks« (2017). Für ihr Werk und ihr Engagement wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Azadi« bei Penguin Books, London, part of the Penguin Random House group of companies. Der letzte Essay »Wir erleben hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit« erschien am 28. April 2021 im Guardian.
Copyright © Arundhati Roy 2020 und © Arundhati Roy 2021
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491487-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
[Widmung]
Einleitung
1 In welcher Sprache fällt der Regen auf kummergewohnte Städte?
2 Zu Zeiten der Wahl in einer gefährlichen Demokratie
3 Unsere gefangenen, verwundeten Herzen
4 Die Sprache der Literatur
5 Das Schweigen ist der lauteste Ton
6 Andeutungen eines Endes
7 Der Friedhof spricht zurück
8 In den Schächten tobt ein Feuer, das System versagt
9 Die Pandemie ist eine Pforte
10 »Wir erleben hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit«
Dank
Anmerkungen
1 In welcher Sprache fällt der Regen auf kummergewohnte Städte?
2 Zu Zeiten der Wahl in einer gefährlichen Demokratie
3 Unsere gefangenen, verwundeten Herzen
4 Die Sprache der Literatur
5 Das Schweigen ist der lauteste Ton
6 Andeutungen eines Endes. Der unaufhaltsame Aufstieg der hinduistischen Nation
7 Der Friedhof spricht zurück. Fiktion im Zeitalter von Fake News
8 In den Schächten tobt ein Feuer, das System versagt
9 Die Pandemie ist eine Pforte
10 »Wir erleben hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Die indische Politik im Angesicht der Corona-Katastrophe
Möge morgen mehr sein als ein anderer Name für heute.
Eduardo Galeano, Kinder der Tage
An die Welt nach Corona, in Liebe
Einleitung
Während wir über den Titel dieses Buches diskutierten, fragte mich mein britischer Verleger Simon Prosser, woran ich dächte, wenn ich an Azadi dachte. Ich war überrascht, als ich ohne zu zögern antwortete: »An einen Roman.« Denn ein Roman verleiht einer Schriftstellerin die Freiheit, so komplex zu schreiben, wie sie es möchte – sich durch Welten, Sprachen und Zeit, durch Gesellschaften, Gemeinschaften und Politik zu bewegen. Ein Roman kann endlos kompliziert und vielschichtig sein, und dies heißt nicht dasselbe wie vage, aufgebauscht oder willkürlich. Für mich ist ein Roman verantwortungsvolle Freiheit. Echte, uneingeschränkte Azadi – Freiheit. Einige der Essays in diesem Band sind mit den Augen einer Romanschriftstellerin aus dem Universum ihrer Romane heraus geschrieben worden. Einige von ihnen handeln davon, wie sich die Fiktion mit der Welt vereint und zur Welt wird. Alle wurden zwischen 2018 und 2020 geschrieben, zwei Jahre, die sich in Indien wie 200 anfühlten. In dieser Zeit, in der sich die Corona-Pandemie durch uns hindurchbrennt, schreitet unsere Welt durch eine Pforte. Wir haben eine Reise an einen Ort unternommen, und es erscheint unwahrscheinlich, dass wir von diesem Ort zurückkehren können, zumindest nicht, ohne einen harten Bruch mit der Vergangenheit vollzogen zu haben, mit der sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Vergangenheit.
Dies ist das Thema des vorletzten Essays dieses Bandes. Das Coronavirus hat ein weiteres, noch schrecklicheres Verständnis von Azadi mit sich gebracht. Das freie Virus, das die internationalen Grenzen unsinnig erscheinen ließ, ganze Bevölkerungen einsperrte und die moderne Welt zum Stillstand brachte, wie nichts anderes je zuvor dazu in der Lage war. Es wirft ein anderes Licht auf das Leben, das wir bisher geführt haben. Es zwingt uns, die Werte zu hinterfragen, auf denen wir unsere modernen Gesellschaften aufgebaut haben – was wir verehren und was wir missachten wollen. Wenn wir durch diese Pforte in eine andere Art von Welt schreiten, werden wir uns fragen müssen, was wir mitnehmen wollen und was wir hinter uns lassen werden. Vielleicht haben wir nicht immer eine Wahl – doch nicht darüber nachzudenken wird keine Option sein. Und um darüber nachzudenken, brauchen wir ein noch tieferes Verständnis für die vergangene Welt, für die Verwüstung, die wir auf unserem Planeten angerichtet haben, und für die tiefe Ungerechtigkeit zwischen den Mitmenschen, die wir zu akzeptieren gelernt haben. Hoffentlich werden einige dieser Essays, die geschrieben wurden, bevor die Pandemie über uns hereinbrach, einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir mit diesem Riss umzugehen lernen. Zumindest markieren diese Essays einen geschichtlichen Moment, der von einer Schriftstellerin festgehalten wurde, wie eine metaphorische Startbahn, bevor das Flugzeug, in dem wir alle sitzen, zu einem unbekannten Ziel abhob. Eine Angelegenheit von akademischem Interesse für die zukünftige Geschichtsschreibung.
Der erste Aufsatz ist die »W.G. Sebald Lecture on Literary Translation«, die ich im Juni 2018 in der British Library in London gehalten habe. Vieles darin beschäftigt sich damit, wie die chaotische Teilung der Sprache, die wir als Hindustani kannten und die in zwei getrennte Sprachen mit zwei getrennten Schriftsystemen vollzogen wurde – heute leider etwas willkürlich Hindi und Urdu genannt (wobei Hindi fälschlicherweise mit Hindus und Urdu mit Muslimen assoziiert wird) –, wie diese Teilung das gegenwärtige Projekt des Hindu-Nationalismus um mehr als ein Jahrhundert vorwegnahm.
Viele von uns hofften, dass 2018 das letzte Jahr der Regierung von Narendra Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei sein würde. Die frühen Essays in dieser Sammlung spiegeln diese Hoffnung wider. Als die Parlamentswahlen im Jahr 2019 näher rückten, zeigten Umfragen, dass die Popularität von Modi und seiner Partei dramatisch zurückging. Wir wussten, dieser Moment war gefährlich. Viele von uns rechneten mit einem vorgetäuschten Anschlag oder gar einem Krieg, der den Wind im Land ganz gewiss drehen würde. Einer der Essays – »Zu Zeiten der Wahl in einer gefährlichen Demokratie« vom 3. September 2018 – befasst sich unter anderem mit dieser Angst. Wir hielten unseren kollektiven Atem an. Im Februar 2019, einige Wochen vor den Parlamentswahlen, ereignete sich der Anschlag. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in Kaschmir in die Luft und tötete 40 Sicherheitskräfte. Täuschungsmanöver hin oder her, das Timing war perfekt. Modi und die Bharatiya Janata Party gewannen erneut die Wahl.
Und jetzt, nur ein Jahr nach Beginn seiner zweiten Amtszeit, hat Modi durch eine Reihe erschreckender Maßnahmen, die in diesem Buch behandelt werden, Indien bis zur Unkenntlichkeit umgebaut. Die Infrastruktur des Faschismus starrt uns ins Gesicht; die Pandemie beschleunigt diesen Prozess auf unvorstellbare Weise, und dennoch zögern wir, den Faschismus beim Namen zu nennen.
Ich begann, diese Einleitung zu schreiben, als sich US-Präsident Donald Trump und seine Familie in der letzten Februarwoche 2020 zu einem Staatsbesuch in Indien aufhielten. Auch sie mussten also durch den Riss, durch die Pandemie-Pforte, gehen. Der erste Fall von Covid-19 in Indien war am 30. Januar gemeldet worden. Niemand, am allerwenigsten die Regierung, schenkte ihm Beachtung. Es lag mehr als 200 Tage zurück, dass der Bundesstaat Jammu und Kaschmir seines Sonderstatus beraubt und einer Kommunikationsblockade unterworfen worden war, und mehr als zwei Monate, seit ein neues antimuslimisches, verfassungswidriges Staatsbürgerschaftsgesetz Millionen von Demonstrierenden auf die Straßen Indiens getrieben hatte. In einer öffentlichen Rede vor einer Menge, die Modi- und Trump-Masken trug, informierte Donald Trump sein indisches Publikum darüber, dass man in Indien Cricket spielt, Diwali feiert und Bollywood-Filme dreht. Wir waren dankbar für diese Einsichten über uns selbst. Nebenbei verkaufte er uns MH-60-Hubschrauber im Wert von drei Milliarden US-Dollar. Selten hat sich Indien öffentlich in derartiger Weise gedemütigt.
Unweit der Präsidentensuite des Hotels, in dem Trump abstieg, und nicht weit vom Hyderabad House, in dem er Handelsgespräche mit Modi führte, stand Delhi in Flammen. Bewaffnete hinduistische Bürgerwehrmobs griffen mit Unterstützung der Polizei muslimische Menschen in Arbeitervierteln im Nordosten der Stadt an. Seit längerem schwelte bereits die Gewalt, und Politiker der Regierungspartei hatten völlig unverblümt Drohungen gegen muslimische Frauen ausgesprochen, die friedliche Sitzstreiks gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz veranstalteten. Als der Angriff begann, verteidigten sich die Menschen. Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt. Viele, darunter ein Polizist, verloren ihr Leben. Viele weitere wurden mit Schussverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Entsetzliche Videos kursierten im Internet. In einem sind schwerverletzte junge muslimische Männer zu sehen, die auf der Straße nebeneinandergelegt und manche sogar von Polizisten aufeinander geworfen wurden, während man sie dazu zwang, die Nationalhymne zu singen. (Einer von ihnen, Faizan, starb daran, dass ihm ein Polizeischlagstock in die Kehle gerammt wurde.)[1]
Trump verlor kein Wort über das Grauen, das ihn umgab. Stattdessen verlieh er Narendra Modi, die spalterischste, meist gehasste politische Figur im modernen Indien, den Titel »Vater der Nation«. Bis vor kurzem war dies der Titel Gandhis. Ich bin kein Fan von Gandhi, doch sicherlich hat nicht einmal er das verdient.
Nach Trumps Abreise dauerte die Gewalt tagelang an. Mehr als 50 Menschen starben. Etwa 300 kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Tausende von Menschen mussten in Flüchtlingslager ziehen. Im Parlament lobte der Innenminister die Polizei sowie sich selbst. Mitglieder der Regierungspartei hielten Reden vor ihren grinsenden Anhängern, in denen sie Muslime mehr oder weniger beschuldigten, die Gewalt provoziert, sich selbst angegriffen, ihre eigenen Geschäfte und Häuser niedergebrannt und ihre eigenen Leichen in die offenen Abwasserkanäle in ihrer Nachbarschaft geworfen zu haben. Die Regierungspartei, ihre Trolle in den sozialen Medien und die von ihr kontrollierten elektronischen Medien bemühten sich nach Kräften, die Gewalt als hinduistisch-muslimischen »Aufstand« darzustellen. Es war kein Aufstand. Es war der Versuch eines Pogroms gegen Menschen muslimischen Glaubens, angeführt von einem bewaffneten, faschistischen Mob.
Und während noch Leichen im Dreck gefunden wurden, berieten indische Regierungsbeamte erstmals über das Virus. Als Modi am 24. März den landesweiten Lockdown ankündigte, brachte Indien all seine schrecklichen Geheimnisse ans Licht. Sie waren für alle Welt sichtbar.
Was liegt vor uns?
Die Welt muss neu erfunden werden. Mehr nicht.
6. April 2020
Nachbemerkung
Im April 2021 verfasste Arundhati Roy einen zweiten großen Essay über die Corona-Pandemie, die inzwischen durch den Ausbruch der Delta-Variante in Indien ungeahnte Verheerungen angerichtet hatte: »Wir erleben hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Die indische Politik im Angesicht der Corona-Katastrophe. Ohne diesen Text wäre das Buch unvollständig.
S. Fischer Verlag
1In welcher Sprache fällt der Regen auf kummergewohnte Städte?
Das untergründige Wetter in Das Ministerium des äußersten Glücks
Bei einer Lesung in Kolkata, etwa eine Woche nach der Veröffentlichung meines ersten Romans Der Gott der kleinen Dinge, erhob sich ein Mann im Publikum und fragte in einem entschieden feindseligen Tonfall: »Hat irgendein Schriftsteller jemals ein Meisterwerk in einer fremden Sprache geschrieben? In einer anderen Sprache als seiner Muttersprache?«
Ich hatte nicht behauptet, ein Meisterwerk geschrieben zu haben (und auch nicht, ein »er« zu sein), und doch konnte ich seine Wut auf mich nachvollziehen: eine Schriftstellerin, die in Indien lebte, auf Englisch schrieb und absurd viel Aufmerksamkeit erregt hatte. Meine Antwort auf seine Frage machte ihn nur noch wütender. »Nabokov«, sagte ich. Und er stürmte aus dem Saal.
Die richtige Antwort auf diese Frage wäre heute natürlich: »Algorithmen«. Die künstliche Intelligenz, so sagt man uns, ist in der Lage, Meisterwerke in jeder beliebigen Sprache zu verfassen und sie in Meisterwerke in jede beliebige andere Sprache zu übersetzen. Wenn die Ära, die wir kennen und von der wir glauben, dass wir sie vage verstehen, zu Ende geht, sind wir, selbst die Privilegiertesten unter uns, vielleicht nichts weiter als eine Gruppe überflüssiger Menschen, die ein geheimes Interesse an jener Sprache besitzen, die von anderen Überflüssigen erschaffen wurde.
Nur wenige Wochen nach der Begebenheit in Sachen Muttersprache/Meisterwerk war ich für eine Livesendung im Radio nach London eingeladen worden. Der andere Gast war ein englischer Historiker, der als Antwort auf eine Frage eines Zuhörers ein Loblied auf den britischen Imperialismus sang. »Sogar Sie«, sagte er und wandte sich herrisch an mich, »allein die Tatsache, dass Sie auf Englisch schreiben, ist eine Hommage ans britische Empire.«
Da ich zu dieser Zeit wenig Erfahrung mit Radiosendungen hatte, blieb ich eine Weile lang still, wie es sich für eine wohlerzogene, kürzlich zivilisierte Wilde eben auch gehört. Bis ich schließlich irgendwie die Fassung verlor und einige äußerst verletzende Dinge sagte. Der Historiker war verärgert, und nach der Sendung sagte er zu mir, dass seine Worte als Kompliment gemeint waren, da er mein Buch liebe. Ich fragte ihn, ob er auch der Meinung sei, dass der Jazz, der Blues und alle afroamerikanischen Songtexte und Gedichte eigentlich eine Hommage an die Sklaverei darstellen würden. Und ob die gesamte lateinamerikanische Literatur ein Tribut an den spanischen und portugiesischen Kolonialismus sei.
Ungeachtet meines Ärgers waren meine Erwiderungen in beiden Fällen Abwehrreaktionen und keine angemessenen Antworten gewesen. Denn diese Vorfälle berührten eine Reihe aufrührerischer Fragen – in Bezug auf Kolonialismus, Nationalismus, Authentizität, Elitismus, Nativismus, Kastenzugehörigkeit und kulturelle Identität –, die allesamt Erschütterungen des Nervensystems einer jeden Schriftstellerin bedeuteten, deren Arbeit irgendeinen Wert besaß. Doch die Verdinglichung der Sprache auf die Art und Weise, wie diese beiden Männer sie verdinglicht hatten, macht die Sprache zu etwas Sprachlosem. Geschieht dies, wie es in solchen Debatten üblicherweise geschieht, dann spielt das, was tatsächlich geschrieben wurde, überhaupt keine Rolle mehr. Das war es, was für mich so schwer zu ertragen war. Und doch weiß ich – wusste ich –, dass Sprache gleichzeitig die privateste und öffentlichste aller Sachen ist. Der Widerstand, der sich mir entgegenstellte, war eindeutig genug. Und da ich immer noch darüber spreche, ist mein Geist weiterhin damit beschäftigt.
Am Abend dieser Lesung in Kolkata, der Stadt meines entfremdeten Vaters und von Kali, der Muttergöttin mit der langen roten Zunge und den vielen Armen, kam ich ins Grübeln darüber, was denn eigentlich meine Muttersprache war. Was war – ist – die politisch korrekte, kulturell passende und moralisch angemessene Sprache, in der ich denken und schreiben sollte? Es fiel mir auf, dass meine Mutter eigentlich fremd war, vielleicht mit weniger Armen als Kali, jedoch mit viel mehr Zungen. Das Englische ist sicherlich eine davon. Mein Englisch ist durch die Rhythmen und Kadenzen der anderen Sprachen meiner fremden Mutter erweitert und vertieft worden. Ich sage »fremd«, weil an ihr nicht viel Organisches ist. Ihr nationenförmiger Körper wurde zuerst gewaltsam assimiliert und dann durch eine imperiale britische Schreibfeder gewaltsam verstümmelt. Ich sage auch deshalb »fremd«, weil die Gewalt, die in ihrem Namen sowohl gegen jene, die nicht zu ihr gehören wollen (z.B. Kaschmiris), als auch gegen jene, die es wollen (z.B. indische Muslime und Dalits), ausgeübt wird, sie zu einer äußerst unmütterlichen Mutter macht.
Wie viele Zungen besitzt sie? Offiziell etwa 780, von denen nur 22 formell von der indischen Verfassung anerkannt sind, während weitere 38 darauf warten, diesen Status zu erlangen. Jede hat ihre eigene Geschichte der Kolonisierung oder des Kolonisiertwerdens. Es gibt nur wenige reine Opfer oder reine Täter. Es gibt keine Nationalsprache. Noch nicht. Hindi und Englisch werden als »offizielle Sprachen« bezeichnet. Gemäß der Verfassung Indiens (die, wie wir anmerken müssen, auf Englisch geschrieben wurde) sollte der Gebrauch des Englischen durch den Staat für offizielle Zwecke am 26. Januar 1965, also 15 Jahre nach Inkrafttreten des Dokuments, eingestellt werden. An seine Stelle sollte Hindi treten, das im Devanagari-Alphabet geschrieben wird.[1] Allerdings hat jeder ernsthafte Versuch, Hindi zur Nationalsprache zu machen, in den nicht hindisprachigen Regionen des Landes zu Unruhen geführt. (Man stelle sich einmal vor, man würde versuchen, ganz Europa unter einer einzigen Sprache vereinen zu wollen.) Englisch hat also kontinuierlich – schuldhaft, inoffiziell und standardmäßig – seine Basis verfestigt. Schuld ist in diesem Fall ein nur wenig hilfreiches Gefühl. Indien als Land, als Nationalstaat, war eine britische Idee. Die Idee des Englischen ist also so gut oder so schlecht wie die Idee Indiens selbst. Auf Englisch zu schreiben oder zu sprechen ist kein Tribut an das britische Empire, wie der britische Historiker anzudeuten versucht hatte; es ist eine praktische Lösung für die vom Empire geschaffenen Umstände.
Im Grunde genommen ist Indien in vielerlei Hinsicht noch immer ein Imperium, dessen Territorium von seinen Streitkräften zusammengehalten und von Delhi aus verwaltet wird; ein Territorium, das für die meisten seiner Bürgerinnen und Bürger so weit entfernt ist wie jede andere ausländische Metropole. Wenn Indien in Sprachrepubliken zerbrochen wäre, wie es mit den Ländern in Europa der Fall ist, dann wäre es vielleicht an der Zeit, das Englische abzuschaffen. Doch auch dann nicht, nicht wirklich, nicht in nächster Zeit. So wie die Dinge stehen, wird das Englische zwar nur von einer kleinen Minderheit gesprochen (die immer noch im zweistelligen Millionenbereich liegt), doch es ist die Sprache der Mobilität, der Chancen, der Gerichte, der nationalen Presse, des Rechts, der Wissenschaft, der Technik und der internationalen Kommunikation. Es ist die Sprache der Privilegien und des Ausschlusses. Es ist auch die Sprache der Emanzipation, die Sprache, in der das Privileg beredt angeprangert wird. Das Buch Annihilation of Caste von Dr. B. R. Ambedkar, die meistgelesene, am häufigsten übersetzte und verheerendste Anklage des hinduistischen Kastensystems, wurde auf Englisch verfasst. Das Buch revolutionierte die Debatte über das vielleicht brutalste System der institutionalisierten Ungerechtigkeit, das sich eine Gesellschaft je ausgedacht hat. Wie anders wären die Dinge verlaufen, wenn es den privilegierten Kasten gelungen wäre, Ambedkars Schriften in einer Sprache verkapselt zu halten, die nur seine eigene Kaste und Gemeinschaft hätte lesen können. Inspiriert von ihm sehen heute viele Dalit-Aktivistinnen und -Aktivisten die Verweigerung einer qualitativ hochwertigen englischen Bildung für die Unterprivilegierten (im Namen von Nationalismus oder Antikolonialismus) als Fortsetzung der brahmanischen Tradition, all jenen Menschen, die sie als »Shudras« und »Ausgestoßene« bezeichnen, den Zugang zu Bildung und Literatur zu verweigern – oder einfach nur das Recht abzusprechen, Wissen zu erwerben und Wohlstand zu erreichen. Um auf diesen Punkt hinzuweisen, baute der Dalit-Gelehrte Chandra Bhan Prasad 2011 einen Dorftempel für die Dalit-Göttin der englischen Sprache. »Sie ist das Symbol der Dalit-Renaissance«, sagte er. »Wir werden das Englische benutzen, um die Leiter emporzusteigen und für immer frei zu werden.«[2]
Während die Abrissbirne der neuen Weltwirtschaftsordnung ihrer Arbeit nachgeht und einige Menschen zum Licht führt und andere ins Dunkel drängt, spielt die »Kenntnis« und die »Nichtkenntnis« des Englischen eine große Rolle bei der Verteilung von Licht und Dunkelheit.
Auf dieses überwältigende Mosaik versucht die gegenwärtige hindu-nationalistische Regierung ihre Vision von »Eine Nation, eine Religion, eine Sprache« aufzupflanzen. Seit ihrer Gründung in den 1920er Jahren lautet der Schlachtruf der RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) – der Holdinggesellschaft des Hindu-Nationalismus und der mächtigsten Organisation im heutigen Indien – »Hindi-Hindu-Hindustan«. Ironischerweise sind alle drei Wörter vom persisch-arabischen al-Hind abgeleitet; und Hindustan – sein Suffix -stan (Ort) sollte nicht verwechselt werden mit sthan, was im Sanskrit ebenfalls »Ort« bedeutet – war die Region östlich des Flusses Indus. »Hindus« waren die Völker (nicht die Religion), die dort lebten. Es wäre übertrieben zu erwarten, dass die RSS aus den Erfahrungen anderer Länder lernen würde, doch als die Islamische Republik Pakistan versuchte, ihren Bengalisch sprechenden Bürgerinnen und Bürgern in Ostpakistan Urdu aufzuzwingen, verlor die Republik letztendlich die Hälfte ihrer selbst. Sri Lanka versuchte, seinen tamilischen Bürgerinnen und Bürgern Singhalesisch aufzuzwingen, und zahlte mit einem jahrzehntelangen blutigen Bürgerkrieg.
All dies bedeutet, dass wir in Indien in einem komplizierten Land leben und arbeiten (und schreiben), in dem nichts geklärt ist oder jemals geklärt werden wird. Schon gar nicht die Frage der Sprache. Der Sprachen.
Susan Sontag war sich ganz bestimmt eines Teils dieser Komplexität bewusst, als sie im Jahre 2002 die »W.G. Sebald Lecture« hielt. Ihr Vortrag trug den Titel »The World as India: Translation as a Passport Within the Community of Literature« (»Die Welt als Indien – Übersetzen als Kunst der Anverwandlung des Fremden«). Worüber ich sprechen werde, ist »Translation as a Writing Strategy in a Community Without Passports« (»Übersetzung als Schreibstrategie in einer Gemeinschaft ohne Pässe«).
Zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung von Der Gott der kleinen Dinge beendete ich die Arbeit an meinem zweiten Roman Das Ministerium des äußersten Glücks. Vielleicht sollte ich dies nicht sagen, doch wenn ein Roman einen Feind haben kann, dann ist der Feind dieses Romans die Idee »Eine Nation, eine Religion, eine Sprache.« Als ich das Deckblatt meines Manuskripts anfertigte, war ich versucht, anstelle des Autorinnennamens zu schreiben: »Übersetzt aus der/den Originalsprache/n von Arundhati Roy.« Das Ministerium ist ein Roman, der auf Englisch verfasst, allerdings in mehreren Sprachen imaginiert wurde. Die Übersetzung als primäre Schöpfungsform stand im Mittelpunkt des Schreibens (und damit meine ich nicht die Übersetzung des Unausgereiften und des Vorsprachlichen in Worte). Unabhängig davon, in welcher Sprache (und in wessen Muttersprache) Das Ministerium geschrieben wurde, musste diese spezielle Erzählung über diese speziellen Menschen in diesem speziellen Universum in mehreren Sprachen imaginiert werden. Es ist eine Geschichte, die aus einem Ozean von Sprachen auftaucht, in dem ein wimmelndes Ökosystem von Lebewesen umherschwimmt – die Fische der offiziellen Sprache, die Mollusken des inoffiziellen Dialekts und glitzernde Schwärme von Wortfischen –, von denen einige freundlich miteinander umgehen, andere offen feindselig und wieder andere geradeheraus fleischfressend sind. Doch sie alle werden von dem genährt, was der Ozean bietet. Und sie alle haben, wie die Menschen in Das Ministerium, keine andere Wahl, als miteinander zu leben, zu überleben und zu versuchen, einander zu verstehen. Für sie ist Übersetzen keine ausgefeilte literarische Kunst, die von gebildeten Polyglotten ausgeführt wird. Übersetzen ist tägliches Leben, es ist eine Straßentätigkeit, und zunehmend ist es ein notwendiger Teil des Überlebens ganz einfacher Leute. Und so sind es in diesem vielsprachigen Roman nicht nur die Autorin, sondern auch die Figuren selbst, die in einem Meer erlesener Unvollkommenheit umherschwimmen, die ständig füreinander und zueinander übersetzen, die ständig über alle Sprachen hinweg sprechen und die sich ständig bewusst sind, dass Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, nicht unbedingt diejenigen sind, die einander am besten verstehen.
Das Ministerium des äußersten Glücks wurde und wird in 48 Sprachen übersetzt. Jede Übersetzerin und jeder Übersetzer musste sich mit einer Sprache auseinandersetzen, die von vielen Sprachen durchdrungen ist, darunter – wenn ich ein Wort prägen darf – viele Arten von Englishes (Soziolekte ist vielleicht das richtige Wort, aber ich bleibe bei Englishes, weil es auf köstliche Weise schlechter ist), und sie in eine andere Sprache übersetzen, die von vielen Sprachen durchdrungen ist. Ich verwende das Wort durchdrungen mit Bedacht, denn ich spreche nicht nur von einem Text, der einige wenige Zitate oder Wörter in anderen Sprachen als Gimmick oder Tropus enthält, und nicht nur von einem Text, der in bester Peter-Sellers-Manier das indische Englisch verspottet, sondern von dem Versuch, tatsächlich eine Gemeinschaft von Sprachen zu erschaffen.
Von den 48 Übersetzungen sind zwei Urdu und Hindi. Wie wir bald sehen werden, enthält schon die Anforderung, Hindi und Urdu als separate Sprachen zu benennen und sie als getrennte Bücher mit separaten Schriften zu veröffentlichen, eine Geschichte, die in die Geschichte des Romans eingefaltet ist. Angesichts des Schauplatzes des Romans sind die Hindi- und Urdu-Übersetzungen zum Teil eine Art Heimkehr. Ich erfuhr bald, dass dies den Übersetzenden die Arbeit alles andere als erleichtert hat. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Der menschliche Körper und seine Organe spielen eine wichtige Rolle in Das Ministerium. Wir stellten fest, dass Urdu, diese exquisiteste aller Sprachen, in der es mehr Worte für Liebe gibt als vielleicht in jeder anderen Sprache der Welt, kein Wort kennt für Vagina. Es gibt Wörter wie das arabische furj, das als archaisch und mehr oder weniger veraltet gilt, und es gibt Euphemismen, deren Bedeutung von »versteckte Stelle«, »Atemloch«, »Ventil« und »Weg zur Gebärmutter« reicht. Die meistgenutzte Wendung ist aurat ki sharamgah, »der weibliche Ort der Schande«. Wie Sie sehen können, stehen wir hier vor Schwierigkeiten. Bevor wir zu einem voreiligen Urteil kommen, müssen wir uns daran erinnern, dass das Lateinische pudenda bedeutet: »Das, wofür man sich schämen sollte.« Im Dänischen, so sagte mir meine Übersetzerin, heißt der Ausdruck »Lippen der Schande«. Adam und Eva sind also gesund und munter, ihre Feigenblätter am rechten Platz.
Obwohl ich geneigt bin, mehr über die Freuden und Schwierigkeiten der Übersetzung von Das Ministerium des äußersten Glücks in andere Sprachen zu sagen, also über die Übersetzungen nach dem Schreiben, so ist es die Übersetzung vor dem Schreiben, die ich heute behandeln möchte. Nichts von dem, was ich hier sage, entstammt einem ausgeklügelten, vorgefertigten Plan. Ich habe rein instinktiv gearbeitet. Erst während der Ausarbeitung dieses Vortrags erkannte ich langsam, wie wichtig es für mich war, die Sprachen zum Umstellen zu bewegen, sie dazu zu bringen, Platz füreinander zu schaffen. Bevor wir in das Meer der Unvollkommenheit eintauchen und uns in den Wirbeln und Strudeln unserer historischen Blutfehden und Sprachkriege verfangen, möchte ich Ihnen, um Ihnen eine grobe Vorstellung des Geländes zu vermitteln, kurz die Route aufzeichnen, auf der ich zu meinem Standpunkt gelangt bin.
Meine Mutter ist eine syrische Christin aus Kerala, dem malayalamsprachigen südlichsten Zipfel der indischen Halbinsel. Mein Vater war ein Bengale aus Kolkata, wo sich die beiden kennengelernt haben. Damals war er zu Besuch aus Assam, wo er stellvertretender Leiter einer Teeplantage war. Die Sprache, die sie teilten, war Englisch. Ich wurde im Welsh Mission Hospital in der kleinen Stadt Shillong geboren, damals in Assam, der heutigen Hauptstadt des Bundesstaats Meghalaya. In Shillong leben vor allem Khasi, ein indigenes Bergvolk. Ihre Sprache ist eine austroasiatische, die verwandt ist mit dem Kambodschanischen und dem Mon. Die walisischen Missionare von Shillong gaben sich, wie Missionare in ganz Indien, große Mühe, mündliche Sprachen in Schriftsprachen umzuwandeln, vor allem, um die Bibel zu übersetzen und zu drucken. Als Teil ihrer eigenen Kampagne zur Bewahrung der walisischen Sprache gegen die Flutwelle des Englischen sorgten sie dafür, dass Khasi zwar in lateinischer Schrift geschrieben wird, seine Rechtschreibung jedoch der des Walisischen ähnelt.
Die ersten beiden Jahre meines Lebens verbrachte ich in Assam. Noch vor meiner Geburt war die Beziehung meiner Eltern unwiederbringlich zerbrochen. Während sie sich stritten, wurde ich in die Unterkünfte der Angestellten der Teeplantage abgeschoben, wo ich meine erste Sprache lernte, die, wie meine Mutter mir mitteilt, eine Art Hindi war. Die von Hungerlöhnen lebenden Teepflanzerinnen und Teepflanzer gehörten (und gehören) zu den am brutalsten unterdrückten und ausgebeuteten Menschen in Indien. Sie sind Nachkommen der indigenen Stammesvölker Ost- und Zentralindiens, deren eigene Sprachen zersplittert und eingegangen sind ins Baganiya, was wortwörtlich »Gartensprache« bedeutet. Es ist ein Patois aus Hindi, dem Assamesischen und ihren eigenen Sprachen. Baganiya war die erste Sprache, die ich sprach. Ich war kaum drei Jahre alt, als meine Eltern sich trennten. Meine Mutter, mein Bruder und ich zogen nach Südindien – zuerst nach Ootacamund in Tamil Nadu und dann (ungebeten) ins Haus meiner Großmutter in Ayemenem, dem Dorf in Kerala, in dem Der Gott der kleinen Dinge spielt. Bald vergaß ich mein Baganiya. (Viele Jahre später, als ich in meinen Zwanzigern war, begegnete ich zum ersten Mal meinem fröhlichen, aber schwer alkoholkranken Vater. Die allererste Frage, die er mir stellte, war: »Benutzt du immer noch die schlechte Sprache?« Ich hatte keine Ahnung, was er meinte. »Oh, du warst ein schreckliches, unflätiges kleines Mädchen«, sagte er und erzählte mir, wie ich ihn, als er versehentlich eine brennende Zigarette gegen meinen Arm gedrückt hatte, anstarrte und ihn als »choo … ya« bezeichnete – ein Schimpfwort in mehreren Sprachen, unter anderen im Baganiya, dessen Etymologie sich vom lateinischen Wort pudenda ableitet.)
Als ich fünf Jahre alt war, gründete meine hoffnungslos mittellose Mutter ihre eigene Schule. Tagsüber mietete sie einen kleinen Saal vom Rotary Club in der Stadt Kottayam, die eine kurze Busfahrt entfernt lag. Jeden Abend packten wir unsere Tische und Stühle zusammen und stellten sie morgens wieder auf. Die kulturelle Nahrung, mit der ich aufwuchs, bestand aus Shakespeare, Kipling, Kathakali (eine Form des Tempeltanzes), dem Film Meine Lieder – Meine Träume sowie malayalamischem und tamilischem Kino. Bevor ich ein Teenager war, konnte ich lange Passagen von Shakespeare rezitieren, christliche Hymnen auf die traurige malayalamische Art singen und ein Kabarett aus dem seltsamen tamilischen Film Jesus nachspielen, das darin von Maria Magdalena aufgeführt wird mit der Absicht, Jesus auf einer Party (buchstäblich) zu verführen – bevor sich die Dinge für beide zum Schlechten wenden.
Als ihre kleine Schule sich erfolgreich entwickelte, wies meine Mutter – um meine Berufsaussichten besorgt – mich an, nur noch Englisch zu sprechen.[3] Sogar in meiner Freizeit sollte ich ausschließlich Englisch sprechen. Jedes Mal, wenn man mich dabei erwischte, Malayalam zu sprechen, musste ich etwas schreiben, was man eine imposition, Strafarbeit, nannte – ich werde Englisch sprechen, ich werde Englisch sprechen –, 1000 Mal musste ich es aufschreiben. Viele Stunden und viele Nachmittage verbrachte ich damit (bis ich lernte, meine Strafarbeiten zu recyceln). Mit zehn Jahren wurde ich auf ein Internat in Tamil Nadu geschickt, das von dem britischen Helden Sir Henry Lawrence gegründet worden war, der bei der Verteidigung seiner Residenz in Folge der Belagerung von Lucknow während des »Indischen Aufstands« von 1857 ums Leben kam. Er verfasste ein Gesetzbuch auf Punjabi, das Zwangsarbeit, Kindermord und Sati, die Witwenverbrennung, verbot. So schwer es zu akzeptieren sein mag, nicht immer sind die Dinge so einfach, wie sie dargestellt werden.
Das Motto unserer Schule lautete »Never Give In«. Viele von uns Schülerinnen und Schülern glaubten (ohne wirkliche Grundlage), dass Lawrence tatsächlich gesagt hatte: »Never Give In – to the Indian Dogs«. Im Internat lernte ich zusätzlich zu Malayalam und Englisch auch Hindi. Meine Hindi-Lehrerin war eine Malayali, die uns eine Art Hindi in einer Art Malayalam beibrachte. Wir verstanden kein Wort. Wir lernten sehr wenig.
Mit 16 beendete ich die Schule und fand mich allein in einem Zug nach Delhi wieder, das drei Tage und zwei Nächte entfernt war. (Damals wusste ich noch nicht, dass ich für immer von zu Hause weggehen würde.) Ich wollte an der School of Architecture studieren. Ich war mit einem einzigen Satz in Hindi bewaffnet, an den ich mich seltsamerweise erinnerte. Er stammte aus einer Unterrichtseinheit namens Swamibhakt Kutiya, in der es um eine treue Hündin ging, die das Kind ihres Herrn vor einer Schlange rettet, indem sie sich selbst beißen lässt. Der Satz lautete: Subah uth ke dekha to kutiya mari padi thi, »Als ich morgens aufwachte, war die Hündin tot«. In den ersten Monaten in Delhi war dies mein einziger Beitrag zu einem Gespräch und meine einzige Antwort auf eine Frage, die in Hindi an mich gerichtet wurde. Als mein Malayalam einrostete, baute ich im Laufe der Jahre auf diesem bescheidenen Fundament meinen Hindi-Wortschatz auf.
Das Wohnheim der Architekturschule war offensichtlich hauptsächlich von Auswärtigen bewohnt. Meistens Nicht-Hindi-Sprechende. Bengalen, Assamesen, Naga, Manipuri, Nepalesinnen, Sikkimesen, Goaner, Tamilen, Malayali, Afghaninnen. Meine erste Zimmergenossin war Kaschmiri, meine zweite Nepalesin. Mein engster Freund stammte aus Orissa. Er sprach weder Englisch noch Hindi. In unserem ersten Jahr kommunizierten wir meist via geteilte Joints, Skizzen, Karikaturen und Karten, die wir auf die Rückseite von Umschlägen zeichneten – seine waren außergewöhnlich, meine mittelmäßig. Mit der Zeit lernten wir alle, uns in der Standardsprache der Universität Delhis zu verständigen – dem Universitäts-Patois – einer Kombination aus Englisch und Hindi. Dies war die Sprache meines ersten Drehbuchs, In Which Annie Gives It Those Ones, das in einer fiktiven Architekturschule in den 1970er Jahren spielte, einer Ära, in der man Dope rauchte und Schlaghosen trug. Annie war der Spitzname eines männlichen Studenten, Anand Grover, der sein Abschlussjahr zum vierten Mal wiederholte. »Giving it those ones« bedeutete »das Übliche zu tun«. In Annies Fall bedeutete es, mit seiner geliebten Abschlussarbeit hausieren zu gehen. Die Arbeit beschäftigte sich mit der Wiederbelebung der Agrarwirtschaft und der Umkehrung der Land-Stadt-Migration, indem Obstbäume auf beiden Seiten der 100000 Meilen langen Eisenbahnschienen Indiens gepflanzt wurden. Warum neben Eisenbahnschienen? Weil »einfache Janta« (gewöhnliche Leute) »sowieso in der Nähe der Eisenbahnschienen scheißen, hai na? Also ist der Boden verdammt fruchtbar, yaar.« Unter der Regie von Pradip Krishen wurde der No-Budget-Film mit einem Budget gedreht, das wahrscheinlich dem Preis von Ersatz-Filmklappen für einen bescheidenen Hollywood-Film entsprach.
Unsere Werbebroschüre für den Film (der niemanden wirklich interessierte) enthielt die folgenden Zitate:
»Sie müssen den Titel ändern, denn ›Giving It Those Ones‹ hat auf Englisch keine Bedeutung.«
Derek Malcolm vom Guardian, der mitten im Film plötzlich aufwacht
»Offensichtlich, Mr. Malcolm, sprechen Sie in England kein Englisch mehr.«
Arundhati Roy, später, als sie sich wünscht, dies wäre ihr früher eingefallen
Der Film wurde nur einmal, spät abends, im staatlichen Fernsehsender Doordarshan gezeigt. Danach gewann er zwei nationale Preise – einen fürs beste Drehbuch und den anderen, meinen Lieblingspreis aller Zeiten, für den besten Film in anderen als den in Anhang VIII der indischen Verfassung aufgeführten Sprachen. (An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass wir beide Auszeichnungen 2015 zurückgaben, und zwar im Rahmen eines von Schriftstellerinnen und Filmemacherinnen initiierten Protests gegen die gegenwärtige Regierung, die unserer Ansicht nach in eine Reihe von Morden an Schriftstellerinnen und rationalistischen Denkern verwickelt war, sowie gegen den Lynchmord an Muslimen und Dalits am helllichten Tag durch einen Bürgerwehrmob. Es half nichts. Das Lynchmorden dauert an, und wir haben keine nationalen Auszeichnungen mehr, die wir zurückgeben könnten.[4])
Das Drehbuchschreiben – ich habe zwei geschrieben –, brachte mir bei, Dialoge zu verfassen. Und es lehrte mich einen sparsamen und ökonomischen Stil. Doch dann begann ich mich nach Fülle zu sehnen. Ich verspürte ein Verlangen, über die Landschaft meiner Kindheit zu schreiben, über die Menschen in Ayemenem, über den Fluss, der die Landschaft durchströmte, über die Bäume, die sich in den Fluss senkten, über den Mond, den Himmel, die Fische, die Lieder, das History House und die namenlosen, lauernden Schrecken. Ich ertrug den Gedanken nicht, etwas zu schreiben, das wie ein Drehbuch begann: »Szene 1. Außen. Tag. Fluss.« Ich wollte ein entschlossen visuelles, aber nicht verfilmbares Buch schreiben. Dieses Buch entpuppte sich als Der Gott der kleinen Dinge. Ich schrieb es auf Englisch, doch ich imaginierte es sowohl auf Englisch als auch auf Malayalam, die Landschaften und Sprachen, die in den Köpfen der siebenjährigen Zwillinge Esthappen und Rahel aufeinanderprallen