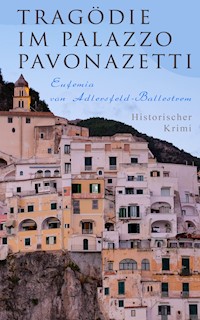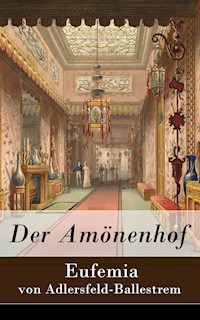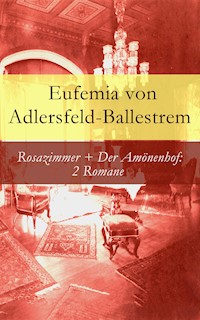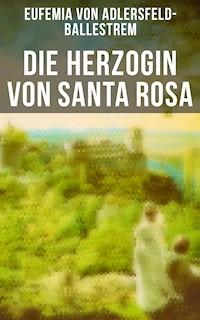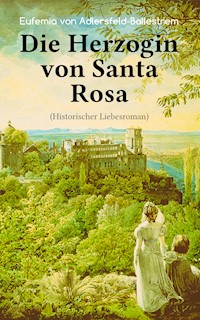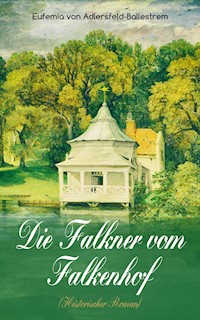Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In dem historischen Krimi 'Der grüne Pompadour' von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem taucht der Leser in die Welt des 18. Jahrhunderts ein, genauer gesagt in das prächtige Schloss Versailles. Der Roman verbindet geschickt Spannungselemente eines Kriminalromans mit historischen Details und bietet somit ein fesselndes Leseerlebnis. Durch von Adlersfeld-Ballestrems präzisen Schreibstil und die sorgfältige Rekonstruktion der damaligen Gesellschaftsstrukturen erhält der Leser einen authentischen Einblick in die Lebenswelt dieser Zeit. Das Buch bietet somit nicht nur Spannung, sondern auch historische Bildung und literarische Qualität. Die Autorin Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem war eine erfahrene Schriftstellerin, die sich insbesondere auf historische Romane spezialisiert hatte. Durch ihre akribische Recherche und Liebe zum Detail gelingt es ihr, die Leser in vergangene Zeiten zu entführen und sie mit ihren Geschichten zu begeistern. Ihr fundiertes Wissen über die Epochen, die sie behandelt, macht sie zu einer Expertin auf dem Gebiet historischer Literatur. 'Der grüne Pompadour' ist ein Muss für alle Liebhaber historischer Romane, die an Spannung, Faszination und historischer Genauigkeit interessiert sind. Eufemia von Adlersfeld-Ballestrems Werk ist ein Meisterwerk des historischen Krimis und ein fesselndes Leseabenteuer, das den Leser auf eine Reise in vergangene Zeiten mitnimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der grüne Pompadour
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Ich hasse alle sogenannten Wohltätigkeitsveranstaltungen. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß ich ihre Zweckdienlichkeit durchaus in Abrede stellen will – im Gegenteil: wenn man zur Linderung irgend eines Elends einer größeren, ja großen Summe bedarf, dann sind sie ein notwendiges Übel. Aber wenn man bedenkt, daß von fünfzig Mitwirkenden kaum zehn sich auch nur annähernd des Zweckes bewußt sind, für den sie oft tagelang kokettieren, intrigieren, sich amüsieren – doch nein, ich will keine Moralpredigt halten, sondern die ebenso geheimnisvolle wie merkwürdige Geschichte des grünen Pompadours erzählen, und überdies muß ich schon gestehen, daß eine solche Predigt entschieden an Wert einbüßen würde, wenn ich's gleich sage, daß mein Haß auf alle Wohltätigkeitsbasare einen sehr persönlichen Hintergrund hat.
In meinen Leutnantstagen, da lag meiner Stellungnahme gegen dergleichen Veranstaltungen ein anderes Motiv zugrunde: ich war ein armer Teufel und besaß die Mittel nicht, Phantasiesummen für Gegenstände von äußerst zweifelhaftem Wert auszugeben, und dann – dann erhielt ich einmal auf einem Wohltätigkeitsbasar einen Schlag, den ich für einen Todesstoß hielt, der aber nur eine Wunde war, an der ich ein paar Jahre krankte und die immer noch nicht ganz zur Ruhe kommen will.
Die Sache ist mit ein paar Worten erzählt und gehört durchaus zu dieser Geschichte. Ich war mit Lili v. Lahr, der einzigen Tochter der immer noch schönen und stattlichen Majorswitwe verlobt, die in der Gesellschaft eine Rolle spielte, denn wo eine Geige gestrichen wurde und eine festliche Veranstaltung stattfand, da stand sie immer mit an der Spitze der Bewegung. Man muß es ihr lassen, sie verstand ihre Sache; sie war energisch, organisatorisch hochbegabt, aber – lassen wir das. Lili und ich waren nur heimlich verlobt. Sie hatte nichts, ich ebensoviel, und da fand denn die kluge Mama, daß es bis zu meinem Aufrücken ins höhere Gehalt eine »ewige« Verlobung geben würde, unter der ihre Tochter zu leiden hätte. Ich sah das schließlich auch ein, Lili fügte sich wie immer dem stärkeren Willen ihrer Mutter. Jetzt weiß ich's übrigens, daß diese überhaupt nur zugestimmt hatte, um Zeit zu gewinnen, sich nach einem besseren Schwiegersohn umzusehen, und der fand sich bald, denn Lili war nicht nur lieb und gut, sie war auch eine Schönheit von jener zarten, durchsichtigen Art, für die sich so viele begeistern.
Um es kurz zu machen: bei einem Wohltätigkeitsbasar, bei dem Frau v. Lahr ihrer Gepflogenheit gemäß eine Rolle spielte, eröffnete sie mir mit ein paar sehr scharfen Worten, daß ich ihre Tochter nicht durch meine beständige Gegenwart kompromittieren möge und daß sie die Verlobung überhaupt für aufgelöst betrachte, weil Lilis ganze Jugend darunter leiden müßte. Ich erwiderte etwas heftig, daß ich Lili selbst darüber befragen würde, und tat es auch, trotzdem Frau v. Lahr eine Aussprache mit allen Mitteln zu verhindern suchte, aber ich konnte es leider nicht verhindern, daß sie dabei war und für das weinende Mädchen das Wort führte.
Gott allein weiß, wie sehr ich sie geliebt habe, meine schöne aber leider so widerstandslose Lili, die ihrer Mutter gegenüber keinen Willen hatte und vor ihr in einer Furcht lebte, die ich zwar nicht begriff, deren Resultat ich aber greifbar vor mir hatte. Das war sozusagen »zwischen den Schlachten« dieser furchtbaren Basartage, an denen das arme, gequälte Wesen in griechischer Tracht, schön wie ein Traum aussehend, in einem Zelte stehen und Blumen verkaufen mußte. Am dritten Tage früh erhielt ich des Rätsels Lösung: die Verlobungsanzeige Lilis mit dem Grafen Meersburg, dem steinreichen Majoratsherrn. Er hatte ihr schon lange in seiner faden Weise den Hof gemacht, aber ich hatte nur lächelnd zugeschaut, weil ich ja meiner Sache so ungeheuer sicher war.
Am Nachmittage ging ich, vernichtet, empört, zum äußersten gereizt, wie ich war, auf diesen furchtbaren Basar und sah Lili bleich wie der Tod in ihrem Zelte stehen, neben dem sich Graf Meersburg, dieser blasierte Sproß eines uralten, zur Neige gehenden Hauses, die Hände in den Hosentaschen, auf einem Stuhle rekelte – ich hätte den Kerl erwürgen können. Endlich fand sich in dem ganzen tollen Treiben doch ein Augenblick in dem ich mich Lili nähern konnte. Ich machte ihr keine Vorwürfe, denn ich sah, wie sie litt, und daß sie durchaus nicht wie eine glückliche Braut aussah. Ich sagte nichts wie »Lili!« zu ihr, und da sah sie mich mit ihren großen, dunklen, traurigen Augen an.
»Schilt mich nicht,« bat sie leise. »Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Mama war so hart, so erbarmungslos, und ich – ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht. Ich hab' dich geliebt, ich liebe dich immer noch und werde dich ewig lieben.«
Ich wußte das, ohne daß sie mir's erst zu sagen brauchte, denn Lili war, obwohl sie keine Kraft hatte zum Kampfe, nicht von der Art, die ihr Herz ändert.
Wenn ich nur kein so armer Teufel gewesen wäre!
»Ich werde dir treu bleiben in Zeit und Ewigkeit,« flüsterte ich mit erstickter Stimme, »und wenn du mich jemals brauchen solltest –«
Da sah sie mich groß an mit ihren traurigen Augen, die nicht mehr weinen konnten. »Ich werde dich rufen,« sagte sie fast feierlich. Es klang wie ein Versprechen, das mir durch Mark und Bein ging.
So trennten sich unsere Wege.
Um dem Teufel sein Recht zu geben; Frau v. Lahr hat vielleicht damals nicht ganz so eigennützig gehandelt, wie es scheinen mag. In ihrer Seele trug sie wohl zu lebhaft eingeprägt den Schrecken ihrer eigenen, mittellosen, hartbedrängten Existenz mit der künstlich zur Schau getragenen äußeren Eleganz, die in sich das größte Elend der täglichen kleinen und kleinlichen Sorgen, den Kampf ums Dasein barg. Wie viele solcher Existenzen gibt es nicht! Sie wollte vielleicht ihrem einzigen Kinde den Jammer ersparen, den sie selbst durchzumachen hatte, aber sie vergaß nur eines dabei: das Herz ihres Kindes. Herzen lassen sich durch Geld und Gut nicht zur Ruhe bringen.
Die Ironie des Schicksals spielte auch bei uns ihre wohlbekannte Rolle, denn kaum war Lili Gräfin Meersburg geworden, da machte ich eine Erbschaft von einer wunderlichen alten Tante, die jedermann für arm gehalten hatte, und die mir nun ein Vermögen hinterließ, das zwar nicht fürstlich, aber doch groß genug war, um mich zu einem sehr wohlhabenden Manne zu machen. Zuerst war ich so entrüstet über diese Schicksalsironie, daß ich das Geld gar nicht nehmen wollte; als ich aber erfuhr, daß die Erblasserin in diesem Fall die Summe zur Errichtung eines Katzenasyls bestimmt hatte, da besann ich mich und nahm es doch, zog die Uniform aus und gönnte mir den Luxus, von dem ich immer geträumt: in Muße mein Lieblingsstudium der Kunstgeschichte zu treiben, zu reisen und die Welt zu sehen.
Aus dem armen Leutnant Fritz Eichwald war nun ein unabhängiger Rentner und Rittmeister a. D. geworden, der es aber nicht unter seiner Würde fand, eifrig zu studieren und die Hörsäle zu besuchen, was übrigens seinen Neigungen besser entsprach, als Rekruten zu drillen und Felddienst zu üben.
Ich zog mich nicht etwa ganz vom geselligen Lehen zurück – o nein, aber ich vermied, was mir niemals Spaß gemacht: Bälle, Generalabfütterungen und – Wohltätigkeitsbasare. Ich blieb auch in schriftlicher Verbindung mit mehreren meiner früheren Regimentskameraden und erfuhr aus solcher Quelle, daß Frau v. Lahr sich bald nach der Hochzeit ihrer Tochter selbst wieder vermählt hatte – mit irgend einem Großindustriellen. Womit der sein Geld verdiente, hatte ich nicht erfahren oder ich habe es vergessen. Es war mir auch ganz gleichgültig; aber ich wußte aus eigener Erfahrung, wie es tut, wenn man jeden Groschen erst zehnmal umdrehen muß, ehe man ihn ausgibt, und darum gönnte ich ihr das Glück, wenn's eines ist, der Sorge ums tägliche Leben enthoben zu sein. Wenn ich ihr nur nie wieder begegnete, dann mochte sie meinetwegen Kaiserin von China werden.
Von Lili hörte ich so gut wie nichts mehr. Die Universitätsstadt, in der ich lebte, Heidelberg, lag durch das ganze Deutsche Reich getrennt von den Meersburger Besitzungen – ich fragte nicht nach ihr oder scheute mich vielmehr, nach ihr zu fragen, und sie mußte sich wohl in ihr Geschick gefunden haben und zufrieden, vielleicht sogar glücklich sein, denn sie rief mich nicht.
Wenigstens durch kein Wort, keine Zeile, keine Botschaft.
Aber so ungefähr zwei Jahre nach unserer Trennung fing ich an von ihr zu träumen, was ich bisher niemals getan. Erst war's nur ein leises Vorüberhuschen ihres Bildes, wie ich es kannte, dann wurden die Umrisse schärfer, und ich sah sie im Schlafe so deutlich vor mir, daß ich sie wachend danach hätte malen können. Aber das war eine ganz andere Lili, als ich sie gekannt: schön und liebreizend zwar, aber doch so bleich und so leidend, mit einem Ausdruck im Blick, den ich mir nicht deuten konnte. Schließlich verging fast keine Nacht, ohne daß mir von ihr träumte, und wenn ich abergläubisch gewesen wäre, hätte ich wohl glauben können, sie riefe mich durch das Medium des Traumes. Aber diese stete Wiederholung derselben Träume kam wohl daher, daß ich mich beim Schlafengehen immer schon fragte, ob ich sie heute nacht wiedersehen würde.
Einmal aber – es war im dritten Jahre nach unserem Scheiden – träumte mir in einer Herbstnacht so lebhaft von ihr, daß ich mir das Datum dieses Traumes am nächsten Morgen in meinem Kalender anzeichnete. Ich sah sie in einem weißen, lang herabfließenden Kleide, das wie ein japanischer Kimono geschnitten und mit goldgestickten Borten besetzt war, um den Kopf mit dem weichen dunklen Haar hatte sie ein weißes Spitzentuch geschlungen, von dem ein Zipfel in ihre Stirn hereinhing. Sie war blaß wie der Tod, ihre großen dunklen Augen umzogen bläuliche Ringe. Sie hob den linken Arm in die Höhe und streifte mit der rechten, durchsichtigen Hand den weiten Ärmel des goldbordierten Kimono zurück, daß der überschlanke Arm bis zum Ellbogen frei wurde. Und sie sah mich an, und ihre Lippen formten Worte, die ich nicht verstand.
Dieser Traum wiederholte sich genau in derselben Weise von Zeit zu Zeit; während ich sonst eine Erinnerung an irgendwelchen Anzug, in dem ich sie sah, beim Wachen nie erhalten hatte, war mir dieser elegante, aus weicher, weißer Seide gemachte Kimono so lebhaft im Gedächtnis geblieben, daß ich das Muster der goldenen Borten hätte zeichnen können. Arme Lili – ich hätte sie jetzt auch in solch' kostbares Gewand hüllen können!
Später – es war kurz vor Weihnachten – sah ich im Lesesaal der Universitätsbibliothek die eben neu erschienenen Gothaischen Taschenbücher, gemeinhin Grafen-, Hof- und Freiherrenkalender genannt, liegen, und da kam mir's zum ersten Male in den Sinn, den Artikel »Meersburg« aufzuschlagen. Der Artikel war kurz. Neben den historischen Notizen über den Ursprung des Hauses stand nur ein einziger Name noch, der des Majoratsherrn Hermann Graf v. Meersburg und Altenbergen, vermählt am 15. Mai 1903 mit Lili v. Lahr, geb. 1. Mai 1883, gest. 18. September 1906.
Ich starrte wie im Traume auf dieses Datum und wiederholte es mir wieder und wieder, ohne es zu verstehen. Gestorben am 18. September – Lili tot!
Der Kalender entfiel meinen eiskalten Fingern und machte die stillen Leser verwundert mißbilligend aufsehen. Lili tot! Und am 18. September! Aber das war ja das Datum, an dem ich in jener Herbstnacht von ihr geträumt, sie zum ersten Male in dem weißen Kimono gesehen hatte!
Wie ein Schlafwandelnder ging ich aus dem Lesesaal fort und nach Hause. Lili tot! Lili tot! Das war das einzige, was ich denken konnte, und wenn ich in den nächsten Tagen, die ich in meiner stillen Stube verlebte, auf das Ticken der Wanduhr hörte, dann sagte der rastlose Pendel immer nur: Lili tot – Lili tot!
Ich kam schließlich aber doch darüber hinweg. Es ist merkwürdig, was der Mensch ertragen kann, ohne daß es ihn tötet.
Ich ging auch wieder aus und in Gesellschaft – o ja. Die Leute hätten schließlich doch gefragt, warum ich mich zurückziehe, und die richtige Antwort hätte ich ihnen ja weder geben können noch auch wollen. Also heulte ich mit den Wölfen weiter, und wenn ich aus einer recht großen Gesellschaft kam, in der ich mich so einsam fühlte wie auf einer wüsten Insel, dann freute ich mich darauf, von Lili zu träumen. Es gelang nicht immer, aber doch oft, und dann sah ich sie immer in dem weißen Kimono, von dem sie den linken Ärmel aufstreifte.
Als der Karneval im vollen Gange war, wurde ich von einer Dame, deren Gastfreundschaft ich manche angenehme Stunde zu verdanken hatte, zum Besuch eines Basars aufgefordert, der in diesen Tagen für ein abgebranntes Dorf abgehalten werden sollte. Sie rechnete bestimmt auf mein Erscheinen – mit wohlgefüllter Börse natürlich. Ich bot ihr diese für den guten Zweck an und bat sie, von meiner Person abzusehen, die dabei ganz nebensächlich und überflüssig wäre, aber sie behauptete, keine Geschenke nehmen zu wollen; die Leute, die für den Zweck beisteuerten, sollten für ihr gutes Geld gute Ware zu entsprechenden, festen Preisen und daneben einen hübschen Anblick haben. Da sie im Ausschuß wäre und dabei etwas zu sagen hätte, sei dafür gesorgt worden, daß dieser Basar keine privilegierte Räuberhöhle, sondern eine anständige Kaufgelegenheit würde; den Verkäufern wäre verboten worden, Phantasiepreise zu fordern. »Und,« schloß sie, »wir werden eine Bude haben, in der nur Sachen im Empirestil verkauft werden, vielleicht reizt Sie das, der Sie für diesen Stil ja eine so besondere Liebhaberei haben. Freilich sind die Gegenstände meist Imitationen, aber nur wirklich wertvolle und künstlerische. Übrigens haben sich auch einige echte Sachen darunter gewagt, von denen sich um des guten Zweckes willen Leute getrennt haben, die keinen großen Wert darauf legen. Es muß auch solche Käuze geben!«
Die imitierten Empiregegenstände, die im Kunstgewerbe jetzt den Markt überschwemmen und so gemein geworden sind wie Brombeeren, reizten mich nicht, und über die »echten« hegte ich meine stillen Zweifel; aber ich schuldete der so freundlich Zuredenden manchen Dank und sagte ihr darum meinen Besuch zu. Ich wunderte mich über mich selbst, daß ich diese Schwäche haben konnte und nicht doch lieber versuchte, mich mit ein paar blauen Lappen zugunsten des guten Zweckes loszukaufen. Aber so oft ich mich deshalb auch an den Schreibtisch setzte, ebenso oft ließ ich's wieder, und innerlich reichlich schimpfend, aber dennoch, ging ich am ersten Basartage dem dazu bestimmten Lokale zu und war wirklich überrascht, wie nett und originell man den Wohltätigkeitsunfug diesmal gestaltet hatte. Ich fand auch das Empiremagazin bald genug; man hatte ihm ein ganzes, großes Zimmer gewidmet, weil ja auch Möbel zum Verkaufe kamen, und die in Empiretracht gekleideten Verkäuferinnen zeigten mir nur zu willig und beflissen die wenigen »echten« Stücke. Ich erstand unter diesen für einen hohen, aber immerhin nicht unvernünftigen Preis ein zierliches Kommodchen aus Rosenholz – der frühere Besitzer mußte ein Vandale gewesen sein, daß er sich von diesem Möbel trennen konnte – ließ ein Täfelchen mit dem Worte »Verkauft« an dem Schlüssel befestigen und in dem Gefühl, nun meine Pflicht getan zu haben, dachte ich daran, mich wieder und zwar so schnell als möglich zu drücken.
In diesem Augenblicke, da ich auf schnöde Flucht sann, kam wie ein Wirbelwind ein kleines, zierliches Persönchen in das Zimmer, das der frühen Stunde wegen noch fast menschenleer war, hereingeschossen, warf einen kostbaren, langen und schmalen orientalischen Schal, den es um die Schultern trug, ab und rief lustig und atemlos: »Ihr habt doch noch nichts ohne mich verkauft? Ich konnte nicht früher kommen, denn eines der Kreuzbänder an meinen Schuhen platzte ab und riß wie Schafleder. Wir mußten erst nach neuen Bändern schicken, und bis die angenäht waren, dauerte es eine Ewigkeit. Ich bin vor Ungeduld fast zum Fenster 'rausgehupft – –«
Sie hielt aus Mangel an Atem ein, aber es langte doch noch zu einem lustigen Lachen, das so herzerfrischend klar und natürlich klang, daß ich einfach auf dem Flecke, auf dem ich stand, stehen blieb und mir dies lebendige Empirepersönchen ansah, wie ich selbst mein Kommodchen nicht betrachtet hatte, trotzdem dessen Marmorplatte noch rosiger war, als die weichen Pfirsichwangen dieses Kindes. Aber die blauen, richtig kornblumenblauen Augen in dem süßen Gesichtchen leuchteten noch mehr als die glänzenden Messingbeschläge des Kommodchens, und weil der Mensch doch, genau wie die Dohlen und Raben, sich vom Leuchtenden angezogen fühlt – kurz und gut, ich habe nie etwas Reizenderes gesehen, als dieses junge Mädchen, das von der Schwelle, auf der die Backfische stehen, eben heruntergetreten sein mochte. Höchstens achtzehn Jahre war sie alt klein, fein, zierlich, wie ein Lichtelf, in ihrem weißen, gestickten Musselinkleidchen über hellblauer Seide, hellblaue Bänder von dem Gürtelband, das unter den Armen die kurze Empiretaille abschloß, herabflatternd, ein ebensolches Band in dem lichten Blondhaar, das um das feine Gesichtchen mit dem süßesten Munde in wirren Locken flatterte und jenen goldbraunen Schein darüber hatte, wie man ihn über einem reifen Ährenfeld kurz vor der Ernte sieht. Kein Schmuck, kein Ring, kein Armband suchte diesen Liebreiz zu heben, nichts als weißer, gestickter Musselin über hellblauem Taft, hellblaue Bänder, goldblonde Haare, strahlende blaue Augen, eine Haut wie Pfirsichblüte.
»Nichts verkauft hätten wir? Freilich haben wir verkauft!« wurde ihr lachend erwidert. »Dort, das Kommodchen zum Beispiel, in das Sie so verliebt sind!«
»Das Kommodchen!« rief sie aus und schlug zwei kleine Händchen mit ganz rosigen Fingerspitzen zusammen. »Und ich habe gestern noch an mein Alterchen geschrieben und gefragt, ob ich's nicht kaufen dürfte. Mein Kommodchen! Solche – solche – solche – Niederträchtigkeit! Wer ist denn das Ungeheuer, der 's verschlungen hat?«
»Es steht vor Ihnen, gnädiges Fräulein,« sagte ich, einen Schritt näher tretend und Flucht Flucht sein lassend.
»Geschmack haben Sie wenigstens, das muß Ihnen der Neid lassen, wer immer Sie auch sonst sind,« erwiderte sie ohne die mindeste Spur von Verlegenheit und machte dazu einen Knicks, der entschieden noch ein Überbleibsel der Backfischzeit war.
»Ich nehme das Kompliment mit Dank an – wer immer ich sonst auch sein mag,« sagte ich, mich meinerseits verbeugend. »Und zum Beweis meiner Aufrichtigkeit verzichte ich feierlich zu Ihren Gunsten auf die Kommode.«
»Das fehlte noch!« rief sie. »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Aber konnte Ihr Geschmack nicht auf einen anderen echten Gegenstand fallen? Zum Beispiel auf das grüne Scheusal in meiner Abteilung? Mit dem bleibe ich doch so sicher sitzen, wie zwei mal zwei gleich vier ist!«
»Nun vielleicht kann ich mein Verbrechen wieder gut machen, indem ich mir das grüne Scheusal, was immer es auch ist, ebenfalls noch beilege,« schlug ich vor.
»Wollten Sie das wirklich?« jubelte sie. »Nein, wenn das mein erster Verkauf hier wäre! Nachdem ich zehnmal gewettet habe, daß mir das Ding auf dem Halse bleibt. Aber Sie werden sich bedanken – und außerdem ist's ja ein Damengegenstand.«
»Das ist einerlei. Ich kaufe das grüne Scheusal, und wenn's nur für die Katze wäre,« erklärte ich feierlich.
»Hat man je schon solch' eine Großmut erlebt?« rief sie mit ihrem hellen Kinderlachen. »Aber nun schnell zum Geschäft, eh's Ihnen wieder leid wird!« Sie lief auf die Wand des Zimmers zu, an der ihre Abteilung sich befand. »Da hängt's in seiner ganzen Pracht. Und wenn Sie's gesehen haben, dann bleiben Sie gefälligst, wie Turandot sagt, »Ihrer Sinne Meister.«
Damit deutete sie auf einen grünen Pompadour, der an einem Nagel an der Wand hing und mir unbegreiflicherweise auf meinem Rundgang entgangen war; ich muß geradezu mit Blindheit geschlagen gewesen sein, diesen Gegenstand übersehen zu haben, der so echt »Empire« war wie nur irgend möglich: ein ziemlich umfangreicher Beutel, Ridikül oder Pompadour genannt in dem die Damen damals wie auch heute noch, besonders in den französischen Ländern, alles das mit sich führten, was man bei einem Ausgang, im Konzert oder Theater sonst in den Kleidertaschen trägt; aber die Machart, der Stoff, aus dem er hergestellt war . . .
Um einen ovalen, festen Boden bauschte sich ein etwas verblichener und abgenutzter, aber kostbarer Brokat in starren Falten zur Tasche aus und wurde oben durch eine doppelte grünseidene Schnur zusammengezogen, deren Schlingen vor hundert Jahren von Gott weiß welchem mehr oder minder schönen Frauenarm getragen worden waren. Der Brokat zeigte auf seinem moosgrünen Grunde von schillerndem Atlasgewebe ein Muster, das aus versetzten halbgeschlossenen, ovalgeformten goldenen Lorbeerkränzen mit silbernen Schleifen bestand, und in jedem dieser Lorbeerkränze war ein goldenes »N« mit einem französischen Kaiserkrönchen darüber eingewirkt. Und einen solchen Stoff konnte mein kleines Empirepersönchen ein »Scheusal« nennen!
»Der Himmel verzeihe Ihnen Ihre üble Meinung von diesem Pompadour, gnädiges Fräulein. Der Kenner kann so weit nicht gehen,« versicherte ich ihr, den Beutel vom Nagel nehmend und die Schnur auseinanderziehend, so daß ich auch noch den schweren, wenn auch etwas verschlissenen, altrosa Atlas bewundern konnte, mit dem er gefüttert war. Dabei erfaßte mich eine derartige Leidenschaft für diesen Zeugen einer längstverklungenen Zeit, daß ich's mit Gewißheit wußte: ich mußte ihn besitzen um jeden Preis!
Ob es aber an der Luft des jetzt doch durchaus noch nicht überfüllten Raumes lag, oder an mir selbst, weiß ich nicht, kurz, als ich den Beutel in den Händen hielt, überkam es mich wie ein Schwindel, ich fühlte, wie mir der Schweiß auf die Stirn trat, wie etwas mir die Kehle zuschnürte. Es ging rasch vorüber, aber es blieb mir eine leichte Benommenheit und eine Sehnsucht nach frischer Luft. Ich hörte nicht recht, was die junge Dame mir erwiderte, ich sah sie nur lachen.
Sie nahm mir den Pompadour aus der Hand, wickelte ihn fein säuberlich in weißes Seidenpapier ein und machte ein sehr wichtiges Gesichtchen dazu. »Ich gebe Ihnen meinen Segen,« versicherte sie, mir das Paket überreichend. »Nehmen Sie das Scheusal und seien Sie glücklich in seinem Besitz. Es kostet übrigens nur zwanzig Mark.«
Ich legte ihr das Goldstück in die kleine, rosige Handfläche, die wie das Innere einer Muschel aussah.
»Und die Kommode?« fragte ich dabei. »Wenn gnädiges Fräulein sie noch mögen, so zahlen Sie den Preis noch einmal an die Basarkasse, die die Summe wohl nicht ungern nehmen wird.«
»Womit Sie mir die Kommode eigentlich schenken,« unterbrach sie mich.
Daran hatte ich nicht gedacht und widersprach energisch.
»Nein, nein, daraus wird nichts. Hin ist hin!«
Natürlich konnte ich nicht weiter in sie dringen. Ich nahm also das Paket unter den Arm, bedankte mich und stellte mich nun auch noch gebührend vor.
»Eichwald? Das ist ein hübscher Name!« sagte sie harmlos, frei und frank. »Er klingt so kräftig und gesund. Ich mag gern was kräftig und gesund ist. Ich heiße Ilse Möller.«
Es kam mir ganz natürlich vor, daß sie Ilse hieß; sie konnte gar nicht anders heißen, und ich dachte dabei unwillkürlich an die Ilse, die so lustig, sprudelnd und vor Jugendlust schäumend vom Brocken herabspringt ins Ilsetal im Harz.
Ich ging nun auch heim, wie ich mir's vorgenommen, ohne mich weiter um die sonstigen »Attraktionen« des Basars zu kümmern. Meine Pflicht für die leidende Menschheit hatte ich getan und dabei noch entschieden gewonnen. Ich dachte aber gar nicht einmal an die reizende kleine Kommode, sondern nur an den grünen Pompadour, den ich unterm Arm trug. Kaum erwarten konnte ich es, ihn in näheren Augenschein zu nehmen, wobei ich das sonderbare, widerspruchsvolle Gefühl hatte, ihn unterwegs beim Überschreiten der Neckarbrücke in den Fluß schleudern zu müssen. Ich mußte entschieden krank sein, denn derartige Launen, die sich besser für eine Weltdame paßten, die nicht wußte, was sie wollte, gehörten durchaus nicht zu meinen sonstigen Untugenden. Im Gegenteil – ich pflegte die Leute, die ihnen unterworfen waren, eigentlich recht abfällig zu beurteilen.
Zweites Kapitel
Als der Pompadour daheim vor mir auf dem Tische stand, denn der feste Boden und der starre Brokat erlaubten das, da fing mich sofort ein halb verlorenes Erinnern zu quälen an. Wo hatte ich nur das Ding, wo diesen Stoff schon gesehen? Den Stoff vielleicht in einem der französischen Schlösser, in denen man noch viele Möbel und Vorhänge aus diesen Brokaten sehen kann mit dem gekrönten »N« im Lorbeerkranze, dieser redenden Erinnerung an den gewaltigen, den großen Napoleon, der sein Monogramm nicht nur dort, sondern allenthalben der Geschichte aufgedrückt hat, aber den Beutel selbst, diesen Beutel – hatte ich ihn nicht von einem weißen, vollen Frauenarm herabhängen gesehen? Phantasie natürlich, nichts als Phantasie, angeregt durch die Umgebung, in der ich ihn erstanden! Und doch, und doch – – vor dem grünen Pompadour saß ich und sann dieser Erinnerung nach, die mich nicht mehr loslassen wollte, bis mir der Kopf schmerzte. Aber es half nichts: der Schleier, der über diesem halb verwischten Bilde lag, wollte sich nicht heben lassen, und je mehr ich mich abquälte, desto dichter wurde er, desto verschwommener erschienen die Umrisse, aus denen nur das Greifbare, der Beutel vor mir, herausragte. Es war sonderbar: was ich auch tat, oder tun wollte, was ich auch begann, immer schob sich der grüne Pompadour dazwischen und nahm mir alle meine Gedanken. Es war, um darüber verrückt zu werden.
In der nächsten Nacht träumte mir wieder von Lili. Ich sah sie in dem weißen Kimono an dem Tische stehen, auf dem in meinem Schlafzimmer der Beutel lag. Sie sah ihn mit großen, entsetzten Augen an und streckte abwehrend beide Hände aus, dann wandte sie sich nach mir um und machte die mir so bekannte Bewegung des Zurückstreifens ihres linken Ärmels und sagte etwas – ich sah es an ihren Lippen, daß sie sprach, aber ich konnte es nicht verstehen, so sehr ich mich auch anstrengte; es war, als ob eine weite Ferne ihre Worte verschlänge.
Nun muß ich aber sagen, daß ich sonst für gewöhnlich nicht zu träumen pflegte, noch weniger den Träumen irgendwelche Bedeutung beilegte, wenn ich ja auch im ganzen eine träumerische Natur war, die in den Soldatenrock wenig paßte. Ich habe übernatürlichen Dingen niemals nachgesonnen, mich nie damit beschäftigt und hatte auch für die Leute kein Verständnis, die es taten. Als ich aber am Morgen erwachte, da wollte mir die Beharrlichkeit, mit der dieser eine Traum mich verfolgte, doch sehr seltsam erscheinen, um so mehr, als ich am Abend vorher gar nicht an Lili gedacht hatte. Aber freilich, das Unterbewußtsein, wie William Walker Atkinson es nennt und es als die Quelle der Träume und Visionen physiologisch in das kleine Gehirn verlegt, arbeitet, vielen unbewußt, im Schlafe weiter.
Schließlich sind das alles auch nur Vermutungen, Versuche zu einer befriedigenden Lösung des Rätsels der Träume, und man muß sich damit zufrieden geben, bis – nun, bis wir da angelangt sind, wo es keine Rätsel mehr gibt.
Ich gab mich also mit dem Versuch zufrieden, aber dafür ließ mir das Rätsel des grünen Pompadours keine Ruhe. Es kann einen geradezu plagen, wenn man eine Erinnerung sucht, und weiß sie doch nirgends unterzubringen, wenn man einen Schatten haschen will, und er flieht vor einem her.
Am Abend, nachdem ich mich den geschlagenen Tag förmlich damit abgehetzt hatte, diesem Schatten nachzujagen, da kam mir wie ein Blitz die Erleuchtung; doch es war ein Licht, das nicht leuchtete, und das scheinbar gelöste Rätsel gab mir nur ein neues auf. Ich sah den grünen Pompadour wieder da, wo ich ihm zum ersten Male begegnet war: auf einem Diplomatenball in Berlin, als ich vor fünf Jahren als »Bärenführer« zu einem Prinzen kommandiert gewesen, dessen erlauchter Vater der Chef meines Regiments war, und wovon die Erinnerung in Gestalt des glänzenden, ausländischen Ordens ja noch heute in meinem Knopfloche weiterlebt. Dort sah ich den grünen Pompadour am Arme einer wundervollen Frauengestalt hängen, die im Kostüm der Kaiserin Josephine, wie wir es von dem Gerardschen Porträt der ersten Gemahlin Napoleons I. kennen, durch die Säle schritt und die allgemeine Neugierde erregte, weil diese Gestalt alle anderen überragte und weil das Kostüm so unzweifelhaft »echt« war. Ich sah sie jetzt wieder ganz deutlich vor mir: das Unterkleid von vergilbtem Atlas mit gesticktem Devant, darüber eine Schleppe von dem gleichen Stoff, aus dem der Pompadour war – richtig, der Stoff mit den vielen gekrönten »N« in den silberbeschleiften, goldenen Lorbeerkränzen war's, der diese Schleppe so auffallend machte. »Ein alter Vorhang- oder Möbelstoff« hatte man damals gemeint, während man der auffallenden Maske nachschaute und sich die Köpfe zerbrach, wer in aller Welt sie sein mochte. Um den blendendweißen Hals trug sie eine Reihe von Irissteinen, die durch die Kaiserin Josephine in Mode gekommen waren, lange Ohrgehänge von dem gleichen schönen Regenbogenquarz und auf dem genau dem Gerardschen Original nachfrisierten Haare statt des Diadems von Steinen ein solches von goldenen Lorbeerblättern. Das Gesicht konnte ich nicht sehen, denn es war durch eine schwarze Maske verborgen, und als das Zeichen zur Demaskierung gegeben wurde, da war diese imposante »Kaiserin Josephine« plötzlich verschwunden.
Ich war mitsamt meinem Prinzen auch im Gefolge dieser wundervoll imitierten Majestät gewesen, erstens, weil ich das für meine Pflicht hielt, und dann, weil der Stoff ihrer Schleppe und der Schmuck, der zweifellos echt war, mich reizte. Ich habe immer eine Schwäche für dergleichen gehabt. Ich redete sie auch einmal an und erhielt von einer leisen, tiefen Altstimme eine Antwort. Was sie und ich sagten, ist indessen meinem Gedächtnis entschwunden, also wird's wohl nur irgend eine Banalität gewesen sein – was man bei solchen Gelegenheiten eben redet; aber ich weiß noch ganz genau, daß mich dabei aus der schwarzen Maske ein paar Augen ansahen, die einen merkwürdigen, phosphoreszierenden Glanz hatten, wie Glimmer, der im Dunkeln leuchtet, oder wie Katzenaugen.
»Haben Sie die merkwürdigen Augen gesehen? Ordentlich unheimlich!« flüsterte mir ein Bekannter zu.
Jedenfalls wußte kein Mensch, wer diese »Kaiserin Josephine« war oder sein konnte, keine Dame der in Frage kommenden Kreise hatte solch auffallend rotes Haar, aber man entschied, daß es eine Perücke sein müßte, um jedes Erkennen vollkommen unmöglich zu machen. Ich erlaubte mir, anderer Meinung zu sein. Totes Haar oder gefärbtes hat niemals einen solchen metallischen Glanz wie dieses, das an poliertes Kupfer erinnerte und sogar das satte Gold der Lorbeerkrone darin matt erscheinen ließ. Aber es mußte eine Dame der Gesellschaft sein, denn wie wäre sie sonst auf diesen Maskenball gekommen, wie hätte sie sonst Eintritt dazu erlangen können? Der Diener, der die Karten der Eingeladenen abnahm, erklärte, die ihre wäre ganz in Ordnung gewesen, hätte das Monogramm des Botschafters getragen, aber auf welchen Namen sie lautete, wußte er nicht; das war auch schwer zu wissen bei der großen Zahl der Eingeladenen. Wie gesagt, im Augenblick der Demaskierung war die »Kaiserin Josephine« wie vom Erdboden verschlungen gewesen, und ihr Rätsel blieb noch für längere Zeit das Gespräch unseres Kreises.
Wie kam nun der grüne Pompadour auf den Wohltätigkeitsbasar? Nun, das würde sich wohl mit Leichtigkeit feststellen lassen, denn man mußte doch wissen, wer ihn gestiftet hatte. Sinnend betrachtete ich den in damaligen Zeiten unentbehrlichen Toilettengegenstand von allen Seiten. Der feste Boden des Beutels, ein Oval von acht zu zehn Zentimeter im Durchmesser, war sauber mit grünem Seidenstoff bezogen. Der Stoff war dick und schwer und mit doppelter Fadenreihe eingezogen. Bei genauerer Untersuchung kam ich auf den Gedanken, daß der Boden überflüssig hoch gearbeitet sei. Ich zog die Schnüre oben auseinander – sie waren durchweg von Seide und darum noch so gut erhalten – und drehte den Beutel um, dessen Futter stellenweise arg mitgenommen war durch den Gebrauch. Der altrosa Atlas überzog innen die obere Seite des Bodens, der hier leicht gewölbt war, meiner Ansicht nach unnützerweise, denn dadurch mußten kleinere Gegenstände ins Rollen gebracht werden und konnten sich in den dicken Falten verlieren. An der einen Seite dieses gewölbten Ovals war ein doppelt genommenes rosa Seidenbändchen wie eine Schlupfe eingeklebt oder genäht, und ohne diesem Bändchen irgendwelche Bedeutung beizulegen, einfach, wie man etwas spielend in die Hand nimmt, faßte ich diese Schlupfe mit zwei Fingern und zog sie aufwärts. Da gab der gewölbte Boden plötzlich nach und öffnete sich wie ein Schachteldeckel, der auf der Rückseite mit Scharnieren festgemacht ist.
Diese Entdeckung vertrieb mit einem Male die müßige Spielerei, die ich bisher halb unbewußt getrieben, indem ich den grünen Pompadour so eingehend untersuchte. Unwillkürlich zog ich den Atem ein, wie man tut, wenn man sich auf der Schwelle von etwas Unerwartetem befindet, und ich mußte mich erst sammeln, ehe ich den Deckel vollends zurückklappte, um zu sehen, ob und was der verborgene Raum enthielt. Ich war ganz sicher, daß er etwas enthalten mußte und scheute mich fast, es zu sehen, denn was es auch war – es gehörte einer fremden, unbekannten Person, und die Diskretion ist in jedem anständigen Menschen zu stark entwickelt, als daß er ohne Überlegung die Grenze überschreitet, die ihn vom Eindringen in ein Gebiet trennt, das nicht das seine ist.
Aber ich überlegte, daß dieser Beutel zweifellos freiwillig dazu hergegeben worden war, um Dem verkauft zu werden, der den Preis dafür zahlte und bar auf den Tisch legte. Das hatte ich getan. Der Beutel gehörte also mir nach aller Form des Rechtes, und wenn ich etwas darin fand, das vergessen oder übersehen worden war, so war ich verpflichtet, es an mich zu nehmen, um es dem wiederzuerstatten, der vielleicht nicht beabsichtigt hatte, das darin Vergessene mit dem Beutel fortzugeben.
Zu diesem Schlusse gekommen, schlug ich den Deckel des Bodens auf und fand in dem hohlen Raume zwischen ihm und dem Boden so fest geklemmt, daß die Gegenstände sich nicht rühren konnten, zwei Dinge, die der frühere Besitzer dort jedenfalls aus guten Gründen verborgen hatte. Zuoberst ein flaches, ovales Büchschen, eine sogenannte Bonbonniere aus Gold oder Vermeil von wundervoller Arbeit, dessen Deckel fast ganz durch einen schöngeschliffenen Irisstein gebildet wurde, der in der künstlerischen Ziselierung und den bauchig vorspringenden Seiten des Büchschens eingebettet lag. Warum diese schönen Steine total aus der Mode gekommen und aus den Werkstätten der Juweliere verschwunden sind, habe ich nie begreifen können. Sie haben dasselbe irisierende Farbenspiel wie die Opale, nur in wasserhellem Grunde, sie sind Edelsteine, so gut wie ihre halbtransparenten, vornehmen Verwandten – und doch verschmäht man sie. Als zur Zeit des großen Napoleon in Frankreich einmal ein größeres Lager dieser Steine gefunden und geschliffen wurde, nahm die Kaiserin Josephine sich ihrer an und ließ sich einen Schmuck davon machen, der eine gewisse Berühmtheit erlangt hat und in allen Büchern über Edelsteine erwähnt wird; aber der Stein verschwand mit ihr. Seit einigen Jahren findet man in den Basaren, namentlich in der Schweiz, Imitationen dieses schönen Steines, gefärbtes Glas oder Kristall, die wohl eine Idee von den echten geben, aber auch nur eine solche, denn das sanfte und doch wieder feurige Spiel der Regenbogenfarben in dem wasserhellen echten Iris erreichen sie niemals.
Also ein solcher Stein schmückte den Deckel des Büchschens, das ich in dem verborgenen Gelaß des grünen Pompadours fand. Der glatte, goldene Boden war mit einer französischen Marquiskrone und dem Monogramm A. O. graviert. Gott weiß, wie lange dieses kleine Kunstwerk schon hier versteckt war! Es gehörte sicherlich der Empirezeit an. Als ich es aufnahm, schien mir's, als bewegte sich darin etwas leise, kaum bemerkbar – vielleicht war es noch halb mit »Cachous« gefüllt, oder mit winzigen Pfefferminzzeltchen. – Nein, es enthielt, noch zu dreivierteln seines Raumes, winzige farblose Kristalle, halb zu Pulver zerbröckelt, für die ich keinen Namen hatte und die etwa zu kosten ich mich wohl hütete. Wer weiß, was es war.
Der zweite Gegenstand, der unter diesem niedlichen und auch kostbaren Büchschen lag, war ebenso wertvoll, aber zu meiner Überraschung ganz modern: eines jener zierlichen Notizbüchelchen mit federndem goldenen Deckel oder Einband, wie elegante Damen es mit Portemonnaie und anderen Utensilien an der Gürtelkette tragen, drei zu fünf Zentimeter groß, mit einem Sprengringe zum Anhängen versehen; die obere Seite des massiv goldenen Deckels war auf der oberen linken Ecke mit einem Adelskrönchen und dem Buchstaben »N« darunter in kleinen Diamanten inkrustiert. Das sagte viel und doch wieder nichts, aber vielleicht fand sich innen ein Name, eine Adresse, und schon der Kostbarkeit der beiden gefundenen Gegenstände wegen war ich verpflichtet, die Indiskretion weiter zu betreiben und das Büchelchen zu öffnen. Es enthielt, wie ich vermutet, ein auswechselbares Heft mit weißen Blättern, die zum größten Teil mit einer zierlichen Handschrift in lateinischen Lettern, die jede abgesetzt und für sich standen, in Blei beschrieben waren. Zitate waren's, mit Quellenangabe. »Macbeth« stand auf dem ersten Blatt, »Macbeth« auf dem zweiten, dem dritten, dem vierten. Also alle aus »Macbeth« in Schillers Übersetzung des grausigen Shakespeareschen Dramas. Kein Name, keine Adresse, keine sonstige Notiz, die einen Anhalt hätte bieten können.
Nachdem ich mich davon überzeugt, las ich die Zitate der Reihe nach, in der ich sie hier wiedergebe, denn sie gehören zu dieser Geschichte. Aber dessen wurde ich mir erst später ganz klar.
1. Du bist zu sanft Geartet, um den nächsten Weg zu gehen.
2. Der Versuch Und nicht die Tat vernichtet uns.
3. Du fürchtest Dich, in Kraft und Tat derselbe Zu sein, der du in deinen Wünschen bist.
4. Du möchtest gern das haben, was dir zuruft: Das muß geschehn, wenn man mich haben will! Und hast doch nicht die Kühnheit es zu tun. O eile, eile her! Damit ich meinen Geist in deinen gieße – –
5. Komm, laß uns Den blut'gen Vorsatz mit der schönsten Larve Bedecken. Falsche Freundlichkeit verhehle Das schwarze Werk der heuchlerischen Seele.
6. Wie töricht, das ein traurig Bild zu nennen!
7. Schlafende und Tote Sind nur Gemälde; nur ein kindisch Auge Schreckt ein gemalter Teufel – –
8. Man muß dergleichen Taten hinterher Nicht so beschau'n. Das könnt uns rasend machen.
9. Auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück nicht fallen. Was Getan ist, ist getan und bleibt's.
10. Dein Gebein ist marklos. Dein Blut ist kalt; du hast nicht Kraft zu sehn In diesem Aug', mit dem du mich anstarrst.
11. Arabiens Wohlgerüche alle Versüßen diese schöne Hand nicht mehr.
12. Ich hab' zu Nacht gegessen mit Gespenstern Und voll gesättigt bin ich von Entsetzen.
13. Weit besser wär' es, bei den Toten sein, Die wir zur Ruh' geschickt, uns Platz zu machen, Als fort und fort in ruheloser Qual Auf dieser Folterbank der Todesfurcht Zu liegen – – –
Mit einem Empfinden wachsenden Grauens, das mir kalt durch die Glieder kroch, las ich diese Zitate. Zwar versuchte ich mir einzureden, daß es vielleicht eine Schauspielerin war, die sich aus ihrer Rolle der Lady Macbeth diese Stellen notiert hatte, um sie durch ein besonderes Studium zu ihrer vollen, grausigen Geltung zu bringen, aber die Zitate 10, 12, und 13 sind Stellen, die Macbeth selbst spricht. Nun, am Ende hatte sie die Rolle mit dem Darsteller des schuldbeladenen Schottenkönigs studiert und seinen besonderen Nachdruck auf diese Worte gewünscht oder vorgeschlagen. Indes, das wollte mir nicht recht einleuchten, der Gedanke schien mir nicht annehmbar, schien der Wahrscheinlichkeit zu entbehren, ich wußte nicht recht, warum, aber die Annahme, daß zwischen den Zeilen dieser Zitate aus einer langverklungenen Zeit sich eine Tragödie aus der gegenwärtigen verbarg, wollte mir nicht aus dem Sinn.
Ich warf mich die ganze Nacht im Bette herum, um darüber nachzugrübeln, ohne doch eine Lösung finden zu können. Aber ich mußte sie finden, ich mußte, es ließ mir keine Ruhe.
Ich schalt mich selbst darüber aus. Was ging's mich an? War ich ein Untersuchungsrichter? War ich ein Detektiv, dem man diese Dinge in die Hand gegeben, damit er ihrem Ursprung, ihrer Bedeutung nachforschte?
Es half nichts. Je weiter diese lange, verwachte Nacht ihrem Ende zurückte, desto dringender, fieberhafter wurde das Verlangen in mir, eine Detektivarbeit zu tun, die kein Mensch von mir verlangte, die mich nichts, gar nichts anging, mich nur Zeit und Geld kosten würde für nichts und wieder nichts. Zudem war ich gerade sehr beschäftigt mit meinen Studien; ich durfte kein Kolleg versäumen, wenn ich noch meinen Doktor machen wollte, um mich dann als Privatdozent an einer Universität niederzulassen. Das war mein Ziel. Und nun mußte mir der Zufall diesen verwünschten grünen Pompadour in den Weg werfen!
Drittes Kapitel
Am Vormittag, als ich wußte, daß der Basar zum dritten und letzten Tage seines Daseins wieder eröffnet wurde, ging ich also zum zweiten Male freiwillig dahin und fand die Räume schon recht ausgeleert, da die meisten Käufer die kleineren Gegenstände, wie ich den grünen Pompadour, gleich mitgenommen hatten. Aber es blieb immer noch genug abzusetzen, und ich fand alles mit der Zubereitung der berüchtigten »Krabbelsäcke« beschäftigt, durch deren Hilfe – zehn Pfennig der Griff – man die absolut unverkäuflichen kleineren Gegenstände loszuwerden pflegt.
Im Empirezimmer fand ich die kleine Ilse Möller mit der Ausführung eines Solotanzes beschäftigt. Sie hatte nämlich alle Gegenstände ihrer Abteilung verkauft und feierte diesen glücklichen Umstand auf die erwähnte Art. Ich sprach sie sofort an, allein sie wußte nicht, wer der Geber des grünen Pompadours war, denn sie weilte nur auf Besuch in dieser Stadt. Ebensowenig konnten mich die anderen Verkäuferinnen aufklären, und nachdem ich noch ein paar Minuten gezögert, um – ja wirklich, um Ilse Möller noch lachen zu hören, suchte ich meine Freundin vom Ausschuß auf und fand sie auch endlich im Bureau des Basars unter Rechnungen und Listen vor.
Sie kannte den Geber des grünen Pompadours, denn er stammte aus ihrer eigenen Kollekte. Es war der Assessor v. Nemsky beim Landgericht.