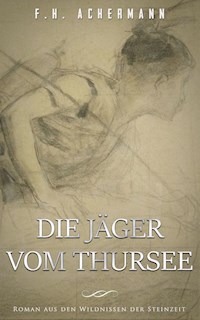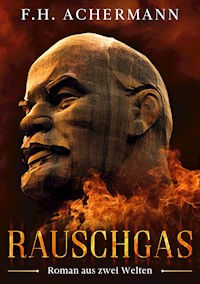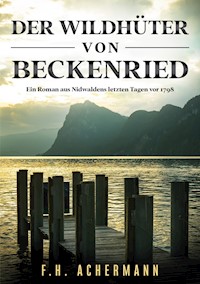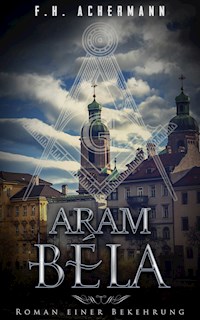Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem verrufenen Kohlenberg in Basel steht des Henkers düsteres Haus. Aber es ist nicht sein Eigentum: Seine Vorgänger haben darin gehaust, und seine Nachfahren werden es nach ihm beziehen. Noch düsterer wirkt der Mann selber; wie ein unheimlicher Schatten drückt sich der Ehrlose an den Wänden und Mauern entlang nach dem Kohlenberg, schlüpft dort scheu durch die halb geöffnete Tür und, wie er den Riegel der Wohnstube zurückschiebt, bückt er sich wie unter einem Bettelsacke, ehe er über die Schwelle ins abendliche Dunkel des engen und niedrigen Raumes tritt. Den gewaltigen Zweihänder, auf dessen handbreitem Blatt die Kreuzigung mit Maria und Johannes samt der Inschrift: "Got syg dyner Sel gnedig" einziseliert ist, stellt er in einen schmalen Schrank, wo noch Daumenschrauben, Zwickzangen, Halsgeigen, Fußeisen, Handschellen, Galgenstricke, Mundbirnen ihrer Bestimmung harren. Als Henker steht er zuunterst auf der gesellschaftlichen Leiter, doch als ein vornehmer Patrizier sich an seiner Tochter vergeht, kann er das nicht hinnehmen... "Der Henker von Basel" ist eine Erzählung F.H. Achermanns, die 1931 erschien. Die Neuausgabe durch Carl Stoll enthält ausserdem die folgenden Erzählungen, welche schon zu Lebzeiten des Autors Teil des Buches waren: * Das Bild Murillos * Jennis Tunga, der Menschendieb * Diplomaten * Die Parade der Toten * Schweigendes Sterben * Ein reelles Heiratsgesuch * Der tanzende Geist der Tundra * Bei geschlossenen Türen * Pioniere der äußersten Wildnis * Sepp und Wastl erobern einen Fesselballon * Auf Leben und Tod * Schweizerische Löwenjäger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Henker von Basel
TitelVorwort des HerausgebersDer Henker von BaselDas Bild MurillosJennis Tunga, der MenschendiebDiplomatenDie Parade der TotenSchweigendes Sterben - Eine Erzählung aus der Mord-MandschureiEin reelles HeiratsgesuchDer tanzende Geist der TundraBei geschlossenen TürenPioniere der äußersten WildnisSepp und Wastl erobern einen FesselballonAuf Leben und Tod!Schweizerische LöwenjägerImpressumTitel
Der Henker von Basel
und andere Erzählungen
F.H. Achermann
Neu herausgegeben von
Carl Stoll
Copyright © 2019, Carl Stoll
All rights reserved.
Vorwort des Herausgebers
Liebe Leserin, lieber Leser,
Es freut mich ganz besonders, mit dem Band «Der Henker von Basel» eine Sammlung von Erzählungen eines Autors zu präsentieren, mit dem zwei Generationen junger Männer in der Schweiz gross geworden ist. Es handelt sich um die Generationen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Generationen, welche zu einem guten Teil zwei Weltkriege erlebt haben. Franz Heinrich Achermann war für sie das, was für dieselbe Generation Karl May in Deutschland war.
F.H. Achermann, selbst Geistlicher, konnte seine eigene Weltanschauung und seine Werte durch spannende und unterhaltende Geschichten seinen jungen Lesern vermitteln. Damit wurde er im kleinen Schweizer Markt zu einem Bestsellerautor.
Wer seine Werke heute liest, wird in manchen Fällen feststellen, dass die Werte und Vorstellungen Achermanns aus einer anderen Zeit stammen. Insbesondere seine Missions-Erzählungen zeigen ein (zu seiner Zeit sehr verbreitetes) Bild, wonach geradezu Heiligen gleiche Missionare die sowohl geistig wie kulturell unterentwickelte Bevölkerung ferner Länder zum «wahren Glauben» bringen musste und dazu nur allzu gern auch zum Märtyrer wurde.
Auch das in zwei der vorliegenden Geschichten aufgezeigte Bild des feigen und kindlichen Schwarzen (er nutzte in seinem Text noch das Wort «Neger», was der Herausgeber aber konsequent ersetzt hat) scheint uns zum Glück inzwischen fremd zu sein. Und trotzdem: Es war mir wichtig, auch diese eher kontroversen Erzählungen im Buche zu belassen (es handelt sich nur um wenige), weil sie interessante Zeitdokumente darstellen.
Geschichten wie die des «Henkers von Basel» oder auch die wundervolle Knacknuss um den Ausbrecherkönig von Luzern machen die Erzählungen des Bandes zu einem wundervollen Lesegenuss voller Abenteuer und Gefühle, häufig gewürzt mit viel Humor.
Viel Spass und Freude bei der Lektüre!
Der Herausgeber
Carl Stoll
Der Henker von Basel
Nach den vielen, die mit dem Verbrecher während der Prozedur zu tun bekamen — den Stadtknechten und den Wachtmeistern, dem Folterer, den Inquirenten, den Anklägern, den Urteilern, dem Vogt, dem Schultheiß, dem Freiamtmann, dem Beichtvater, dem «Brüderlein» — war der letzte, dem er in die Hände fiel, der Nachrichter (= Scharfrichter, Henker, d. V.).
Dieser Beamte hat eine durchaus ungewöhnliche Stellung. Er gilt als ehrlos und durch sein Gewerbe, das auch die Besorgung krepierter Tiere umfasst, beschimpft; aber auch als schwer sündig. Will er sein Amt niederlegen, so muss er sich bekehren und öffentlich Buße tun für sein Handeln. Er wohnt abseits auf dem Kohlenberg, bei dem Gesindel. Seine Person und seine Ehre gelten auch dem Rate nichts, dem er doch dient; er wird nicht von diesem gewählt, hat keinerlei Berührung mit ihm, steht ausschließlich unter dem obersten Ratsknecht (heute etwa soviel wie Polizeiinspektor, d. V.), dem ja auch die Totengräber und im 15. Jahrhundert die Juden unterstehen: dieser ernennt ihn, entlässt ihn, beerbt ihn, leiht ihn aus der Stadt, andern zu dienen. Bei alledem ist er nie und nirgends entbehrlich; auch wenn die Stadt unter ihrem Banner ins Feld rückt, muss der Henker mitziehen. damit Übel und Ungehorsam sofort gestraft werden können: ebenso bei großen Kirchweihbesuchen. Wie wichtig dieser Mann ist, zeigt sich auch darin dass ihn die Nachbarn Basels gelegentlich brauchen, wenn sie selbst ohne Henker sind; sie lassen ihre Delinquenten in Basel abtun oder den Basler Nachrichter zu ihnen kommen. Als Besoldung hat der Nachrichter einen Wochenlohn, außerdem für jede Verrichtung Bezahlung nach Tarif. (Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel.)
Auf dem verrufenen Kohlenberg in Basel steht des Henkers düsteres Haus. Aber es ist nicht sein Eigentum; seine Vorgänger haben darin gehaust, und seine Nachfahren werden es nach ihm beziehen.
Noch düsterer wirkt der Mann selber; wie ein unheimlicher Schatten drückt sich der Ehrlose an den Wänden und Mauern entlang nach dem Kohlenberg, schlüpft dort scheu durch die halbgeöffnete Tür und, wie er den Riegel der Wohnstube zurückschiebt, bückt er sich wie unter einem Bettelsacke, ehe er über die Schwelle ins abendliche Dunkel des engen und niedrigen Raumes tritt.
Den gewaltigen Zweihänder, auf dessen handbreitem Blatt die Kreuzigung mit Maria und Johannes samt der Inschrift: «Got syg dyner Sel gnedig» einziseliert ist, stellt er in einen schmalen Schrank, wo noch Daumenschrauben, Zwickzangen, Halsgeigen, Fußeisen, Handschellen, Galgenstricke, Mundbirnen ihrer Bestimmung harren. Zu diesen düsteren Dingen hängt er auch den Köcher mit Stutzmesser und Nackenschere. Nun reckt er seine gewaltigen Glieder müde und behaglich, greift nach dem Ofenlädchen und setzt mit Hilfe von Zunder, Flint und Kuder eine Messingfunzel in Brand. Dann nimmt er sich aus der Tiefe des noch halbwarmen Ofenschachtes eine Schüssel mit Apfelmus hervor und setzt sich damit an den Tisch: mit einem selbstgefertigten Holzlöffel schneidet er zuerst die Kruste durch, die Zeit und Wärme seit Mittag gebildet haben, streicht den Bart nach allen Seiten aus, um den Mund freizulegen, und fängt dann mit großer Genugtuung und ohne Hast zu essen an.
Und das flackernde Lichtlein wirft sein zuckendes Schattenbild an die Wand: Sein langer, spitzer Bart scheint dort wie eine ellenlange Zunge über die wulstige Unterlippe herabzuhängen und im Takte des Kauens nach irgendetwas zu fahnden. Und wenn man ihn, den Gilg Urner, nicht in Wirklichkeit kennen würde, so müsste man aus seinem Schattenbilde schließen, dass er nach hinten einen Schleier trage, wie eine Karmeliternonne; es ist aber nichts anderes als seine gewaltige Mähne, die wild und ungepflegt, wie die Mähne eines Ackergauls, auf seine breiten Schultern fällt; denn nach Gesetz und Herkommen darf der Nachrichter weder Schere, noch Kamm, noch Rasiermesser gebrauchen; er soll schon äußerlich und aus weiter Ferne als Ehrloser kenntlich sein.
Plötzlich hebt er sein Haupt und lauscht: Draußen in der lehmgestampften Küche scheint sich etwas zu regen.
«Mägdi!», ruft er mit Grabesstimme; aber es ist nichts Hartes darin.
Und herein kommt . . .
Was kümmert sich die Natur um die Ehrlosigkeit der Menschen! Das «Mägdi», das dort auf der Schwelle steht, ist etwas so Liebliches, dass auch die Frau des großen Maximilian mit ihr das Gesicht getauscht und wohl noch einige Gulden und Steine für die Augen extra zugeschoben hätte!
Auch das ist ein großer Trost im Leben des armen Mädchens: Selbst die Reiche kann sich mit ihren Millionen kein anderes Gesicht und zuletzt, ganz am Ende, nicht eine Stunde des Lebens kaufen.
«Was, Vater?», fragt sie aus ihrem Hinterhalt.
«Bring einen Becher Arlesheimer[1] — nein, zwei! Der Folterer kommt noch!»
«So — ja, gleich!»
Und noch ehe sie wieder zurück ist, kommt der andere, der Folterer, zur Tür hereingehumpelt; von Wuchs und Natur ist er das gerade Gegenteil vom Henker: Untersetzt, lahm — wohl von Bicocca her! — kahl wie eine Kanonenkugel, macht er mit seinem magern breiten Kopfe, den vorstehenden Backenknochen und den hochgerissenen Nasenlöchern den Eindruck eines tanzenden Gerippes aus dem Totentänze von Holbein. Er ist aber zuverlässig, ehrlos wie sein Meister und ehrlich bis auf die Knochen. Aber eine Leidenschaft hat er — anscheinend nur eine: Während des Folterns muss er ein Stück Zucker im Munde haben, indes sein Meister vor Schlag und Schnitt sich einen Becher Muttenzer leistet.
«Du kommst vom Eselsturm?», fragt der Nachrichter.
«Ja! »
«Das Werkzeug und Geschirr versorgt?»
«Ja, ein Stadtknecht hat mir geholfen.»
«Und gewaschen?»
«Auch.»
«Und gut abgetrocknet? Das ist beim Eisen fast die Hauptsache, und der Oberstknecht ist scharf darauf; soll leicht Blutvergiftung geben, sintemal beim Mösch[2] — sonst nichts?»
«Nein … doch!»
«Was?»
«Die Jaghünd[3] machen schlechte Witze!»
«Mindere Gspässe? Donnerwetter, etwa gegen mich?»
«Nein, das nicht!»
«Gut für sie, zum Donnerschlag! Gegen wen denn?»
«Gegen die Magdalena!»
«Gegen — gegen — die ...?» Urner greift sich mit der ganzen Faust in den Bart, dass es rauscht wie im Walde vor dem Gewitter.
«Sie sagen, dass der Junker Väli Offenburg am Verrücktwerden herummache!»
«Der Väli, der junge Schützenvenner? Was soll's mit ihm?»
«Sie sagen, dass ihn eine Magd beobachtet habe, wie er mit Vorbedacht die Nähte seines Vennerkleides aufgerissen habe!»
«Wozu das? Was soll das gegen unser Mägdi?»
«Er reißt seine Kleider auf — sagen sie — um dieselbigen vom Mägdi wieder zusammennähen zu lassen!»
«Blut und Hallsbeyn! Gönnen die tollen Jaghünd dem Kinde das Verdienst nicht?»
«Es ist nicht das! Aber sie sagen, dass die Magdalena dabei noch ein sehr schönes Trinkgeld bekomme ...»
«Und dann —?»
«Man sagt auch ...»
«Wer sagt?»
«Der Pfister Baschi hat gestern …»
«Was sagt er?»
«Dass der Junker jede Woche Jahreswäsche halte, um das Meitschi[4] bei sich haben zu können, ferner, dass ebenderselbige …
«Hallseysen und Streckeysen! Mägdi! Mägdi!»
«Ja.»
Schon steht sie unter der Tür:
«Was hat's gegeben?»
«Komm' her! Da her zu mir! So! Wo warst du heute — bis vorhin?»
«In der Rittergasse. Hab' ich gewaschen!»
«Bei wem?»
«Bei der Frau von Offenburg!»
«So! Wann warst du das letzte Mal dort?»
«Am Freitag.»
«So, hm! Fritz, trink' aus! Du kannst gehen! Geh' nach dem Eselsturm und bring' dem Felder noch einmal Mus!»
Der Folterer steht auf:
«Soll er auch Brot haben?»
«Frag' den Oberstknecht!»
«Gut' Nacht Globt syg Jesus Christ!»
«In Ewigkeit, Amen — fall' nicht über den Tritt!
So, Mägdi, wir sind allein: Was hast du mit dem Junker, dem Väli?»
Da greift sie errötend nach dem Schürzenzipfel:
«Ihr meint den Schützenvenner?»
«Ich denke! Um drei oder vier kann es sich nicht handeln!»
«Was soll's mit ihm sein, Vater?»
«Heraus damit — Mägdi! Mach' mir keine Scheingefechte! Was habt ihr für ein Boten und Hüzen miteinander? Mach' jetzt nicht den Muttigrind[5]! Mägdi!»
«Vater! Ich — ich — weiß nichts anderes …»
«Als ...? Mägdi! Willst du heute zum ersten Mal deinem Älteren nicht alles sagen?»
«Vater! Ich — ich … Er ist so gut zu mir und macht sich so gemein[6]!»
«Er ist einer vom Adel, ein Junker, und du die Tochter des Ehrlosen!»
«Er hat gesagt, dass er nichts darum gebe, um diese Standesunterschiede. Er ist gar weit in der Welt herumgekommen!»
«Ja, er war auf der Gstudierig — in Strassburg und im welschen Land. Und du kannst waschen, nähen und Holz spalten, wenn's sein muss. Du wohnst auf dem Kohlenberg: Er hat ein Herrenhaus in der Rittergasse, und man sagt, dass er bald ins Siebnergericht gekiest[7] werden wird!»
«Ja, das sagt man!»
«Mägdi — Mägdi! Bist du noch brav?»
«Ja, Vater!»
«Ich glaub's — ich weiss es! Hör', Mägdi, ich will dir noch etwas sagen: Sieh' her! Wenn ich hier mein Mus gegessen habe, so versorg' ich das Becki und nehm' den Löffel wieder zu mir: So tun die armen Leute. Wenn die Herren gespeist haben, so lassen sie das Geschirr liegen und gehen davon ... hast du mich verstanden?»
«Ja, Vater!»
«Gut' Nacht, Mägdi!»
Und die Schicksalssterne gehen ihre Bahn!
Am Tage vor Sankt Wolfgang kniet vor dem Vesperbilde des Steinenklösterleins ein blondes Mägdlein in namenloser Seelenqual — bis in den dunklen Abend hinein. Da tritt eine schwere Gestalt durch den Nebengang bis an den Marienaltar und fasst die Schluchzende beim Handgelenk: «Komm', Mägdi!» Und er lässt ihre Hand nicht mehr los bis auf den Kohlenberg — und rings herum zischelt das scheue Getier der Nacht:
«Die Ehrlose! Die Magdalena Urner — das Henkermineitli!»
Mit der Linken öffnet der Nachrichter die zwei Türen und zieht seine Tochter in die dunkle Stube hinein:
«So, jetz red'!»
Da geht ein zitterndes Aufschluchzen durch die schwankende Gestalt: «Vater! Er hat mir Gewalt angetan!»
«So, aber du hast ihn gerngehabt?»
«Ja, Vater!»
«Dann bist auch du schuld! Und die Gewalt ... hm — ich weiss nicht!»
«Er hat mir die Heirat versprochen!»
«So, hat er! Und nun?»
«Er hat mir heute gesagt, dass ihm Stand und Amt diese Hochzeit verbieten — so gern er wollte!»
«So ungefähr — ja — so etwa hab' ich's mir gedacht! Nun, Mägdi, kommst du an den Lasterstein!»
Ein herzzerreißendes Wimmern zittert durch das verrufene Haus.
«Tu doch nicht so, Mägdi! Ich hab' dich dennoch lieb — noch gleich lieb. Und ich werde dich selber in den Pranger stellen, Mägdi, kein anderer soll dich herumreissen! Ich werde dabeistehen, bis es vorüber ist, und wenn einer ein dummes Maul macht, so schlag' ich ihm ins Gesicht. Vor mir haben sie Respekt.»
«O Vater! »
«Wir sind ja ohnehin ehrlos! Gut, dass die Mutter tot ist.»
Ein röchelnder Schrei würgt sich über ihre trockenen Lippen.
«Vater — gute Nacht!»
Um Mitternacht erwacht der Nachrichter auf seinem Schrägen: Es hat an seine Türe geklopft.
«Was ist's?», fährt er auf.
Da geht die Türe auf, und herein tritt mit weit geöffneten Augen eine weiße Gestalt.
«Vater, hört ihr's?»
«Was, Mägdi?»
«Sie läuten die Seelenglocke!»
«Du teupelst[8]. Geh' doch ins Bett, Mägdi — geh' nur!»
«Gut' Nacht! Horch, jetzt wieder! Nein, es ist nichts, ade, Vater!»
«Ade wohl, Mägdi!»
Und der harte Mann will weinen und kann es nicht!
Am Morgen ruft der Nachrichter, zum Ausgang gerüstet, nach dem Haferbrei. Die «Mägdi» antwortet nicht. Da geht er nach ihrer Schlafstätte.
Gaden und Schrägen sind leer.
Am folgenden Nachmittag melden die Stadtknechte, dass bei Hüningen eine Frauenleiche gelandet ist; in der folgenden Nacht holen der Nachrichter und der Folterer die Leiche auf dem Henkerkarren nach dem Kohlenberg und bahren sie dort auf.
Bis am Morgen hält der Nachrichter bei flackerndem Talglicht seinem Kinde die Totenwache.
In der folgenden Nacht wacht der Folterer.
Der Nachtwächter hat eben Eins gerufen; da erhebt sich der Totenwächter, horcht ängstlich in die nächtliche Stille und beugt sich dann über die Tote.
Ehrfürchtig streift sein Mund die Lippen des Mägdleins.
Im Leben war sie ihm zu fern; die toten Lippen haben seinen Kuss geduldet ... aber jäh fährt er auf: unter der Tür steht der Nachrichter:
«Folterer! Du hast sie auch lieb gehabt!»
«Im Geheimen und in Ehr'. Gott ist mein Zeuge!»
«Gut! Du wirst mir helfen!»
«Zu allem, Urner!»
«Deine Hand darauf!»
«Hier!»
Am Abend von Allerheiligen stehen in einer leeren Ecke des Friedhofes von St. Peter der Nachrichter und der Folterer vor einem aufgeworfenen Grabe; daneben die Bahre mit der verhüllten Leiche. Der Rat hat weder Sarg noch Geläute bewilligt. Da kommt durch den dämmernden Friedhof noch ein Dritter: das «Brüderlein», der alte, vergichtete Barfüßermönch, der sonst die Verbrecher zum Tode begleitet. Wie er aber sein Gebetbuch öffnet, legt ihm der Nachrichter die schwere Hand auf den Arm:
«Wartet noch!»
«Warum? Kommt noch wer?»
«Nein, aber wir warten, bis es Allerseelen einläutet, dann hat sie auch ein Grabgeläute! Brüderlein!»
«Ja!»
«Ist das Mägdi jetzt — in der Hölle?»
«Urner! So wahr mir Gott helfe, ich glaube, nein! Sie hat bereut, gesühnt und — ihre letzte Tat war nicht bei guten Sinnen.»
Da weint der Henker von Basel.
Und — jetzt läuten die Glocken vom Münster, von ganz Basel, und aus weiten, weiten Fernen rufen die Glocken der Aussengemeinden:
Qui Marian abolvisti Et latornem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti
Requiem aeternam dona ei, Domine
Et lux perpetua luceat ei.
Am Tage vor der Richterwahl geht der Nachrichter zum Richter Spar und klopft bescheiden an seine Türe.
«Was wollt Ihr, Urner?», fragt der Ratsherr in halbamtlicher Gnade.
«Ich wollte nur fragen, ob Ihr das Neueste schon wißt?»
«Was meint Ihr?»
«Das — von meiner Tochter selig!»
«Das ist doch längst nicht mehr das Neueste!»
«Ich meine: wen es angeht!»
«Doch den Junker, den Valentin! Das pfeifen die Spatzen. Warum war sie so leichtfertig ...!»
«Und glaubte einem Junker. Ade!»
«Aber was ...?»
Urner ist schon fort, auf dem Wege zum Richter Meltinger. Nach langem Warten im Vorzimmer kommt er dort zu seinem Anliegen:
«Ich wollte nur fragen, ob Ihr wegen meiner Tochter auf dem Laufenden seid?»
«Dass sie ins Wasser...»
«Nein, wer sie ins Unglück gebracht hat?»
«Fragt doch nicht so! Doch der Junker, der Väli. Aber ich will nichts gesagt haben. Seid Ihr etwa deshalb gekommen, um mir das zu sagen?»
«Nein! Ich bin gekommen, um das zu fragen. Ade, Herr Richter!»
Und fort ist er!
Ratsherr Meltinger schaut ihm durch den geöffneten Läufer[9] nach:
«Wenn der nicht spinnt ...!»
Und so geht der Henker Gilg Urner zu allen sechs Richtern.
Der Siebente soll noch gewählt werden.
Und er wird gewählt: Junker Valentin Offenburger ist vom Rate zum Siebnerrichter ernannt worden und feiert den Ehrentag mit seinen Freunden und geneigten Honoratioren bis in die tiefe Nacht hinein.
Doch die unsichtbare Hand der Toten schreibt ihm um Mitternacht das Meine Tekel, Phares an die Wand des geschmückten Saales.
Gerade um Mitternacht überreicht ihm sein Knecht ein Brieflein: Ein Mann wartet im unteren Zimmer.
«Wer ist's?», fragt der Weingerötete ungeduldig.
«Ich kenne ihn nicht. Er sagt, es sei dringlich und amtlich.»
«Gut! Freunde, lasst Euch nicht stören! Etwas Amtliches. Ich werde gleich wieder da sein.»
Im unteren Zimmer steht ein großer, breitschultriger Mann.
Aber Junker Valentin kennt ihn nicht; denn Gilg Urner, der Nachrichter von Basel, hat sich Haupt und Bart geschoren, bis auf den weit ausfahrenden Schnurrbart.
«Was wollt Ihr? »
«Herr Richter, Ihr müsst noch als Zeuge Eures Amtes walten. Der Wagen wartet draußen!»
Voll Verwunderung und Erwartung tritt der neue Richter in den Gang hinaus und bis unter die Haustür: Dort vor dem Herrenhause steht ein Henkerkarren. Da scheinen ihm doch ein Zweifel zu kommen:
«Wer seid Ihr?»
«Ich bin der Henker von Basel!»
Starr wie eine Bildsäule steht der Richter da, und noch ehe seine schneeweißen Lippen sich zu einer Frage geöffnet haben, ist sein Kopf von einem derben Sack umschlungen, fühlt er Halseisen und Handschellen, fühlt sich wie ein Stück Schlachttier auf den Karren geworfen. Hohl rattert das Knarren der Räder durch die holperigen Gassen, rattert an den dunklen Wänden empor, da und dort einen verschlafenen Bürger ans Fenster rufend.
«Sie haben wieder einen!», sagen sie und gehen wieder ins warme Bett.
Droben auf dem Kohlenberg reißt ihn der Henker in die düstere Stube herein, macht Licht und nimmt dem Gefangenen das Kopftuch weg.
«Wer bist du?», fragt dann der Nachrichter.
«Ich bin der Junker Valentin von Offenburg, Richter der Sieben, und wenn Ihr mich nicht sofort ...»
«Dann ist's der Richtige!», schneidet Gilg Urner jedes Wort ab. «Folterer, setz' dich auf den Richterstuhl! Ich bin der Ankläger, und hier ist der Angeklagte. Heute wird der Richter gerichtet.»
«Das Gericht ist nicht zünftig und nicht vollständig!», knirscht der Angeklagte zwischen Wut und Todesangst.
«Was fehlt noch?»
«Die Zeugen!»
«Sie werden nicht fehlen. Richter! Gilg Urner, der Henker von Basel, bittet um Gehör!»
Da erhebt sich der Folterer:
«Gilg Urner! Wessen beschuldigt Ihr den Siebner, Junker Valentin von Offenburg?»
«Ich beschuldige ihn der Schändung und des gebrochenen Wortes!»
«Beweist es mir!», ruft der Gefangene dazwischen.
Da öffnet Gilg Urner den Folterschrank, aber der Angeklagte lässt es nicht zur «peinlichen Frage» kommen:
«Ich leugne nicht! Aber ich verlange vor ein zünftiges Gericht gestellt zu werden — vor das Gericht der Sieben!»
«Der Sechs — wollt Ihr wohl sagen; denn Ihr zählt nicht mit ... Junker Valentin von Offenburg: das Siebnergericht ist befragt, und sechs der Herren haben das schuldig' gesprochen!»
«Eine verfluchte Lüge!»
«Sie selber werden Euch die Wahrheit bezeugen. Ich habe sie heute befragt! Einen nach dem andern! Folterer, welche Strafe steht auf Schändung?»
«Das Schandmal!»
«Und — für das gebrochene Wort?»
«Damit sich eine zünftige Bürgerschaft vor ihm hüten kann, stehe das Schandmal statt auf der Schulter mitten auf der Stirne!»
«Hil - - -!» Der Schrei wird von der Mundbirne, die im Munde zu vier Teilen aufspringt, erwürgt.
Der Henker bringt den rotglühenden Baslerstab, der Folterer schiebt sich ein Stück Zucker in den Mund, bläst das Eisen ab, und nur ein Zischen, ein Räuchlein, ein würgendes Stöhnen ist das Resultat der Exekution ...
Am Morgen wird der neugewählte Richter gefunden. Die Richter des Richters aber sind verschwunden.
Nur jedes Jahr am Allerseelentage, wenn die Basler ihre Toten besuchen, sieht man in der Dämmerung auf dem St. Petersfriedhof in einer leeren Ecke zwei Männer stehen, einen hohen, breitschultrigen und einen untersetzten Lahmen. Der Große ist glattrasiert, der Kleine trägt einen riesigen Bart.
Auch sie beten für eine Tote.
[1] Wein aus Arlesheim, einem Ort bei Basel
[2] Messing
[4] Dt. «Mädchen»
[5] Dt.: „sei nicht starrsinnig / trotzig“
[8] Dt.: «phantasierst»
[9] Kleines Fenster
Das Bild Murillos
Es war in der Maienzeit unseres Lebens, da wir die roten Mützen schwangen. Eine fröhliche Schwefelbande saß am Stamme der «Semper fidelis» im Hotel «Union». Auch das Wahrzeichen von Luzern, der unsterbliche Zyböri[1], verherrlichte unsere Korona. Mir zur Rechten saß, bescheiden und unscheinbar, mein Freund «Latro», der Mediziner, der bereits sein zweites «Prope» glänzend hinter sich hatte. Ein Talent allerersten Ranges, war er im Umgang beinahe unbeholfen, gab auch vielleicht zu wenig auf sein Äußeres, während andere, die mir noch näher standen, den letzten Fransen für einen modernen Brustlatz zu opfern bereit waren.
Es mochte vielleicht zwei Uhr sein — nachmittags, selbstverständlich. Auf vier Uhr waren wir unbefiederten Sänger zu einer Familie Meinhart geladen und hatten daraufhin die Ausgaben für ein Mittagessen als Luxusartikel betrachtet.
Während wir also hier im Schützengraben des Königs Gambrinus zur Vertilgung des Feindes Alkohol die letzten Patronen verschossen und General Inderbitzin mit dem vornehmen Ladygesichte von seinem Generalquartier aus die Operationen leitete, wurde ich ans Telephon gerufen. Unser «Latro» begleitete mich, wohl in der richtigen Ahnung, dass die Anfrage von Meinharts komme; denn er schwärmte in seiner Art still und schüchtern für die schöne «Hildy». Und seine Ahnung täuschte ihn nicht, leider nicht; denn das an und für sich nichtssagende Gespräch nahm folgenden Verlauf:
«Hier Hagen!»
«Hildy Meinhart — Salü! Seid Ihr gut beisammen?»
«Selbstverständlich!»
«Wir erwarten Euch also bestimmt um vier Uhr. Aber gelt, Hagen, den — den Kesselflicker bringst du nicht mit?»
«Welchen — Kesselflicker?»
«Frag noch so einfältig! Hast doch sicher bemerkt, wie mich der Kerl das letzte Mal angeschmachtet hat!»
«Wer?», fragte ich ahnungslos.
«Bist heute wieder mal schwerfällig! Du weißt doch, was auf lateinisch «der Straßenräuber» heißt? Passt ausgezeichnet für diesen «Latro»! Wenn er doch mitkommt, so drücke ich ihm beim Abschied ein paar Rappen in die Hand für einen neuen Kragen!»
Mir gab es einen Stich ins Herz, und ich drehte mich nach meinem lieben Freunde um — Herrgott! Er hatte den andern Hörer am Ohr! Gerade hängte er ihn ein und wankte hinaus, totenblass und verschämt.
Unter der Tür drehte er sich noch einmal um:
«Hagen! Sage nichts davon, dass ich gehorcht habe, gelt!»
Sie vernahm es aber etwas später doch!
Ich versuchte den Freund nachher aufzumuntern — umsonst: Er war zu tief getroffen. Allerdings, eine Hildy Meinhart war nicht der Charakter, meinen «Latro» zu verstehen, und insofern war der Vorfall eigentlich ein Glück für ihn!
Nur einmal schaute er noch auf, als ich ihm sagte, dass er sich rächen könne.
«Rächen?», fragte er gedehnt.
«Ja, Latro, rächen! Du hast Talent und Energie: Zeige der Welt und — dem blasierten Geschöpf, was du wert bist!»
Er sagte nichts, aber ich sah doch, dass sich seine Schläfen röteten.
Unsere fünf verfügten sich also pflichtgemäß zu Meinharts. Aber wir führten uns diesmal so offiziös zurückhaltend auf, dass es auffiel und der Unterhaltung ein beinahe jähes Ende bereitete. Es wehte hier Parvenü-Luft, die eine vornehme Herzlichkeit überhaupt nicht aufkommen ließ ...
* * *
Jahre sind seither verflossen; viele Schulkameraden und Couleurbrüder haben sich beinahe vergessen. Latro, der «Kesselflicker», ist Spezialist für Kinderkrankheiten geworden, und zwar einer, vor dem man mit dem Hut in der Hand stehen darf, ohne sich etwas zu vergeben.
In den letzten Ferien nun führte mich der Zufall nach einer Hochtour in sein Wirkungsgebiet. Es war einige Tage vor Mariä Himmelfahrt. Kurz entschlossen wagte ich einen Überfall in die Forelstraße. Sein Sprechzimmer war aber so voll und — beinahe hätte ich gesagt: überfüllt, dass ich in einem Konditorladen gegenüber auf den «Ladenschluss» wartete. «Wie sieht er wohl aus? Ist er verheiratet? Ist er ein Heide geworden?» Das waren meine Vorfragen zum Thema «Kesselflicker».
So um acht Uhr herum schritt ich zum zweiten Angriff: Das Sprechzimmer war leer. Kaum hatte ich mich nach der Vorzimmerliteratur ein wenig umgesehen — selbstverständlich: «Velhagen und Klasing», «Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, «Die Woche», «Davoser Sportnachrichten» u. s. f. — als mein Blick auf ein Bild an der Wand fiel: Murillos «Himmelfahrt Mariä». Sollte das wohl heißen: «Ich bin ein guter Christ, oder: Ich liebe die Kunst? Je nach den Kunden?»
Da geht die Tür auf, und — ja, dort steht er, Latro, der «Kesselflicker»! Wenn er mir sonstwo begegnet wäre, so würde ich ihn wohl kaum auf den ersten Blick erkannt haben; sein flotter Schnurrbart über dem vornehmen «Freimaurerknebel»[2] gab ihm etwas betont Männliches, wie denn überhaupt die ganze Zimmereinrichtung eine kraftvolle Vornehmheit atmete. Ein Moment des verwunderten Anstaunens und ... da waren wir wieder die Alten. Arm in Arm gehen wir ins Wohnzimmer hinauf, und da merke ich sofort an den herumstehenden Photographien, dass er noch ledig ist; denn eine Frau hätte wohl als eifersüchtiger Gott keine anderen Götter neben sich geduldet. Was mich aber überraschte, das war das Bild über dem Lehnstuhl: wieder Murillos Bild! Er mochte meine Verwunderung wohl bemerkt haben; denn beim Einschenken erklärte er mir:
«Dieses Bild erinnert mich an die — furchtbarste Stunde meines Lebens.»
«Mach's billig, Latro! Du erschreckst mich ja! Warst du vielleicht in Lebens- oder gar Todesgefahr? Oder handelt es sich um eine Verlobung?»
«Spaß beiseite, Hagen! Prost! Und nun lass dir erzählen:
Es war an Mariä Himmelfahrt vor fünf Jahren. Als noch unbekannte Größe mit spärlicher Praxis durfte ich es wohl wagen, den Nachmittag zu verbummeln und wollte ausgehen — ganz allein, selbstverständlich. Kaum war ich auf der Straße, als vor meiner Bude ein Auto anfuhr. Ihm entstieg eine vornehme Dame mit den Anzeichen eines — ich möchte fast sagen — beginnenden Wahnsinns auf ihren schönen Zügen. Auf ihren Armen hielt sie ein Kind von etwa zwei Jahren. Das blaurot angelaufene Gesichtchen, der tonlose, bellende Husten, verbunden mit pfeifender Atemnot und Erstickungsanfällen ließen mich über die Situation keinen Augenblick im Zweifel: letztes Stadium des Krupps. «Herr Doktor, retten Sie mein einziges Kind!», stöhnte die Dame mir entgegen, und da — erkannte ich sie: Hildy Meinhart! Du kannst dir meine Überraschung oder vielmehr Verfassung denken! Hildy Meinhart, die hier an einen Industriellen verheiratet ist! Sie erkannte mich nicht mehr; denn sie hatte mich kaum so tief im Gedächtnis wie — ich sie! Doch, da gab es weder Erwägungen, noch Phantasien der Erinnerung; denn das Leben des Kindes konnte nur noch nach Minuten zählen!
«Warum gingen Sie nicht sofort zu Professor Marnoff?»
«Ich komme von dort! Ist selber mit einer längeren Operation beschäftigt. Er wies mich an Sie!»
Unterdessen waren wir in meiner Privatklinik angekommen, und nach einer kurzen Untersuchung begriff ich den Herrn Professor von seinem Standpunkt aus: Hier waren keine Lorbeeren mehr zu holen. Nur noch ein entscheidender, oder vielmehr ein verzweifelter Schnitt auf Leben und Tod, Tracheotomie — mit wenig Hoffnung für das Leben — war hier möglich. Sollte ich die furchtbare Verantwortung übernehmen?
«Herr Doktor! Mein Kind! Mein einziges Kind!»
Schon setzte ich die Lanzette an; als ich aber noch einen Blick in das von wahnsinniger Angst verzerrte Antlitz dieses Weibes warf — da fing meine Hand zu zittern an — ich konnte den Schnitt nicht tun!
«Herr Doktor!», schrie, nein, raste sie jetzt in einem wahren Krampfanfalle der Todesangst; denn sie hatte mein Zaudern bemerkt. Ich fuhr mir über die schweißige Stirne: Herrgott im Himmel! Was wird sie sagen, wenn ich die Operation nicht ausführe? Was wird sie denken, wenn ich ihr sagen muss: Das Kind ist mir unter dem Messer geblieben? Denn Herkunft wird sie jetzt sicher vernehmen. Wie ein zertretener Wurm wand sie sich auf dem Sofa. Weißt du, Hagen, was ich jetzt tat? Hagen, es gibt zweierlei Ärzte: die einen haben auf der Universität den Glauben ihrer Kindheit verloren, die andern sind durch das Studium der Natur Gläubige geworden. Kann da der Grund des Unglaubens in der Wissenschaft liegen?»
«Latro, für dieses offene Wort danke ich dir!»
Ich musste meinem alten Latro die Hand reichen; ich konnte nicht anders!
«Hagen! In jenem fürchterlichen Augenblick fühlte ich so recht meine Machtlosigkeit, meine Abhängigkeit von einem Höhern, und — betete! Ich schickte die Mutter hinaus und sattele meine Hände, allein vor dem Allmächtigen, die Lanzette zwischen den Fingern und den Blick auf das konvulsivisch zuckende Kind gerichtet. Und draußen betete auch eine, laut stöhnend: Mein Gott! Nur das nicht — strafe mich nicht so! Und dann ...»
«Und — dann?»
«Warte einen Augenblick!» Der Arzt ging ans Telefon und rief einen Namen. Ich achtete nicht darauf, sondern glaubte, dass er irgendeinem Patienten Weisung erteilte; noch nie in meinem Leben war ich so gespannt auf das Ende einer Geschichte gewesen wie gerade jetzt.
Und da kam er wieder und — fing vom Wetter zu reden an! Auf keine Frage nach der Operation lenkte er ein und schien sich am Ungestüm meiner Fragen und an meinem Ärger zu weiden . . .
Plötzlich krabbelte etwas an der Türe, und herein kam ein kleiner Engel, gerade wie aus dem Bilde Murillos geschnitten, und jubelnd fliegt er meinem Latro in die Arme.
«Gib diesem Manne hier das Händchen!»
Da bemerkte ich am Halse des Kindes eine böse Narbe, und nun war mir alles klar!
«Hagen», fuhr er jetzt fort, «du kannst dir nicht vorstellen, was ich fühlte, als ich der Mutter sagen konnte: Ihr Kind ist außer Gefahr!»
«Und — was sagte sie?»
«Erst nichts! Wie gebrochen lehnte sie an der Wand und schloss die Augen, als wollte sie sich in die Wirklichkeit zurückversetzen. Dann sprach sie endlich wie geistesabwesend: Herr Doktor, verlangen Sie, was Sie wollen! Mein Mann ist reich. «
«Und ich antwortete: Das spielt hier keine Rolle, Madame! Auch einem armen Kinde würde ich die gleiche Sorgfalt gewidmet haben — für mich gibt es keine ,Kesselflicker'!»
Da sah sie mich an und — erkannte mich!»
«Und?»
«Und — dir will ich's sagen, Hagen — da fiel sie auf die Knie und ... »
«… bat dich um Verzeihung?»
«Nein, ich verließ sie mit den Worten: Dankt jenem, der das Gebot der Liebe gab.
Die Kleine ist meine Freundin geworden; ihr verdanke ich meine jetzige Praxis!“
[1] Theodor Bucher alias Zyböri, bekannter Luzerner Volksdichter
[2] So nennt man in der Heimat des Verfassers den scharf geschnittenen Bart.
Jennis Tunga, der Menschendieb
Vor sechs Monaten hatte Pater Bero Felder an der Universität Münster i. W. mit Auszeichnung doktoriert, in asiatischer Philologie, Sanskrit, Chinesisch, Mandschurisch und deren abzweigenden Dialekten. Daneben hatte er aber auch noch — für sich, als sein Steckenpferd — vergleichende Völkerkunde belegt. Und wir werden nur zu bald sehen, welche Rolle sein Lieblingsstudium — sein «Sport», wie er es nannte — in der Vorsehung Gottes spielen wird ...