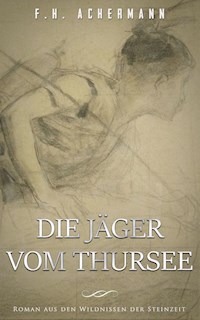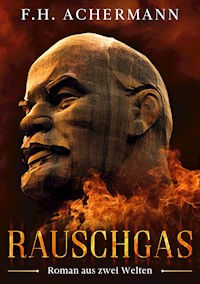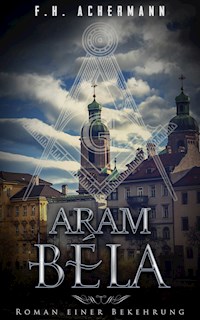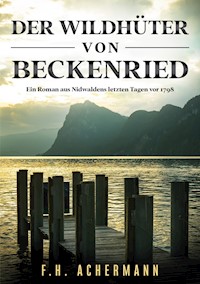
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Wildhüter von Beckenried Die Schreckenstage von Nidwalden Nach dem Fall von Bern am 5. März 1798 stellte sich kaum jemand in der alten Eidgenossenschaft den heranrückenden Franzosen entgegen und schon am 12. April des Jahres gründete sich in Aarau die Helvetische Republik. Nur fünf Kantone und zwei zugewandte Orte waren nicht vertreten. Darunter auch Nidwalden. Die Bewohner lehnten in einer Landsgemeinde am 29. August den Beitritt zum Kanton Waldstätte und zur Helvetischen Republik von Frankreichs Gnaden ab. In der Folge kam es zur Schlacht von 1600 Nidwaldnern gegen über 10'000 Feinde, bei der auch die Zivilbevölkerung nicht geschont wurde. Der Wildhüter von Beckenried von F.H. Achermann hält die Erinnerung an diese Tage unbändigen Freiheitswillens wach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Schützenfest von Beckenried
Der Mord am Schwalmis
Der Wilderer im Wandschrank
Zwei Disputationen
Eine Gemsjagd
Die Sage vom „Uri-Jäger“
Eine Verlobung
Der Bürgereid; die Franzosen kommen
Des Mörders blutige Sühne
Das Schützenfest von Beckenried
In Beckenried ist Gabenschiesset. Wie es noch heute vielerorts in der Urschweiz Sitte ist, sind der „Schützenmeister" und zwei vom Vorstand von Haus zu Haus gegangen, um für ihren Schiesset eine Gabe in Empfang zu nehmen. Und auch der Ärmste gibt etwas freudigen Herzens. Sogar das alte Holzweiblein hat schon lange seine drei Kreuzer gespart: Es hätte sich gar sehr gekränkt, wenn die „Schitze“1 nicht zu ihm gekommen wären. Viele Leute geben Naturalgaben: eine Butterballe, ein Käslein, eine Flasche Wein oder gar ein „bliemelets"2 Hirtenhemd. Aus den Barbeträgen wird der erste Preis für den Schützenkönig erworben: ein „Benz"3.
Es ist im Hochsommer 1798. Ein herrlicher Sonntagmorgen ist angebrochen; die ersten Sonnenstrahlen durchleuchten siegreich die letzten Morgennebel am Schwalmis; hoch droben an wilder Felswand erschliesst sich das Edelweiss dem Lichte, die Alpenrose blickt mit glühenden Wangen nach dem gekrönten Enzian, die Alpenlerche jubelt ihr Morgengebet — ein Tag, der die Brust befreit, wie der Jauchzer, der eben an den Schwalmiswänden verhallt.
In weiter Alpenferne schlägt hin und wieder eine Kuhglocke an, doch wird sie plötzlich übertönt vom harmonischen Geläute der neuen Kirchenglocken, die zum Hauptgottesdienste rufen. Und die Beckenrieder waren immer ein frommes Geschlecht, das mit der Zähigkeit gesunder Gebirgsvölker am Althergebrachten festhält. Heute aber gehen sie nicht gleich in ihre schöne neue Kirche, sondern stehen am Weg, um den Aufzug der Schützen zu sehen. Nur die erwachsenen „Mäili"4 bleiben nicht stehen und gehen sofort in die Kirche hinein. Sie würden sich genieren, ein Interesse an dem „Mannevolch"5 zu verraten; sie haben „diese" ja schon oft gesehen und können, wenn's grad sein muss, ein bisschen über das Gebetbuch hinweg nach rechts ... Pardon!
Da schmettert die Musik vom Dorfe her. „Sie kommen, sie kommen!", rufen die Buben, und schon biegen die Trompeter ums Eck, hinter ihnen die wehrfähige Mannschaft von Beckenried, alle in der einfach-malerischen Landestracht, d. h. hemdsärmelig, mit gestickten Hirtenhemden: Die französische Mode hat die Beckenrieder noch nicht angekränkelt. Doch, dort am Wege steht einer mit französischem Kleiderschnitt, der „Schnyderkari"; aber das muss so sein, denn als Schneider muss er das Neueste, die „Nuwoteh"6, kennen, und zudem ist er ein Aufgeklärter, der in Luzern sein Handwerk betreibt. Er ist zu seinen Verwandten hergekommen, um das Fest mitzumachen und die „rückständigen" Landsleute beim Abendtanz seine geistige Überlegenheit fühlen zu lassen. Er sollte dafür deren körperliche Überlegenheit zu kosten bekommen!
Da kommen sie heran: voran die Jungen, und an ihrer Spitze der stolze Fähnrich Hans Murer, der Sohn des Wildhüters. Wie die Erde unter ihrem Taktschritt erdröhnt! Der Schneider macht unwillkürlich einen Schritt rückwärts. Doch die Jungen haben ihn schon erblickt.
„Der Schnyderkari! Der fremd' Fitzel",7 ruft der bärtige Sennknecht von der Tschiferenegg, der Amstad Seppi.
„Bringst die achtzehn Batzen für den Totengräber?"
„Oder willst du ihm vielleicht einen französischen Rock machen für die Beerdigung deines seligen Vaters?"
Das ist allerdings nicht durch die Blume, aber der Schneider hat als Antwort nur ein erhabenes Lächeln. Was wissen diese Menschen von Fortschritt und Kommunismus!
Am Schluss marschiert der Wildhüter Murer mit der alten Garde. Dieser Mann trägt wohl keinen Spiegel in der Westentasche, sonst hätte er sicher seinen Bart ein bisschen kultiviert, der ihm wie ein abgebrauchter Stallbesen vom Kinn steht. Und doch glänzen heute seine dunklen Augen fröhlich unter den buschigen Brauen hervor. Ist doch der Gabenschiesset fast der einzige Tag im Jahr, wo er herzhaft mitmachen kann, ohne befürchten zu müssen, dass unterdessen so ein „Bleger"8 dem Wild nachstreiche: denn am Gabenschiesset sind auch alle seine „Lieben" beisammen; er würde es doch sofort bemerken, wenn so ein „Anrichiger"9 gefehlt hätte; es wäre ihm nichts anderes übriggeblieben, als auf die Streife zu gehen. Aber hinter ihm marschiert ja, wie zum Hohn, der „Murmolter", seinen Tellerhut mit dem kecken Gemsbart schon auf drei Schoppen gerichtet, und der Murmolter ist wohl der Schlimmste! Erst im vorigen Jahre hat er wegen Wilddiebereien einige Wochen abgesessen, und als er wieder herauskam, da schwur er, für sein „Sitzen" müsse der Murer einmal – „liegen"!
Der Name „Murmolter" heißt soviel wie Murmeltier, und der Wyrsch Franz trägt ihn wie einen Ehrennamen; er hört sich gern so nennen, besonders in Gegenwart des Wildhüters, der dann jedes Mal grimmig auf die Zähne beißt.
Der Wyrsch Franz kann nämlich den Pfiff des Murmeltieres täuschend genau nachahmen. Dieses possierliche Tierchen spürt den Feind oft stundenweit, besonders bei günstiger Luft. — Der durchdringende Pfiff des „Wachtpostens" warnt alsdann die ganze Familie, und wie der Blitz purzeln sie in ihre Gänge hinein, um lange nicht mehr zu erscheinen.
Dieser Umstand hatte dem Franz einst aus einer schwierigen Patsche geholfen. In den südlichen Felsabhängen der Musenalp beschlich er einen Gemsbock, der dort auf einem Felsvorsprung äste. Der Wind war günstig und das Wild ahnungslos! Noch hundert Meter weiter, dann ist der Bock sein. Schon will er die Distanz im Anschlag prüfen – da kommt – ja, wer kommt denn dort von Niederrickenbach her? Dem Gang nach ist's der Wildhüter. Er kommt näher – ja, er ist's! Erwischen soll der den Wyrsch Franz allweg nicht, aber der Bock wird Witterung bekommen. Jetzt, im Anschlag, und nicht losdrücken dürfen – entsetzliche Qual! Da kommt ihm der rettende Gedanke: Er legt den Finger an den Mund und lässt den Warnungspfiff des Murmeltieres ertönen. Grell werfen die Wände das Echo zurück; der Bock bleibt, der Pfiff muss ihm nichts Ungewohntes sein. Aber der Wildhüter stutzt! Schon will er die Höhe herankommen, da hört er den Pfiff und denkt: Das Murmeltier hat mich gewittert; es kann also keiner vor mir diesen Vormittag hier oben gewesen sein, sonst wären die Tiere nicht vor dem Loch, und – der Franz hebt sein Bein wie zum Tanz vor Freude – wahrhaftig, der alte schlaue Kracher schwenkt ab! Als der Wildhüter aber gegen die Bärfallen kommt, wendet er sich plötzlich verwundert um; denn dort, ja dort an den Tossen der Musenalp, wo er justament durchgekommen ist, ist ein Schuss gefallen, und dem Schuss folgt ein langgezogener Jauchzer. Der Wyrsch Franz war sonst nicht so unvorsichtig; aber diesmal hätte es ihn getötet, wenn er nicht hätte jauchzen können, und er weiß ja, wie der Alte sich jetzt – ärgert! Und weil das Prahlen unzertrennlich mit dem Wildern verbunden ist, so kann der Wildhüter schon am folgenden Tage in Beckenried die Frage hören, ob er den „Murmolter" auf der Musenalp erwischt habe. Seit jener Zeit nennt man den Wyrsch Franz nur noch bei seinem Kriegsnamen: „Murmolter“!
*
Bereits drücken sich die letzten Beckenrieder in die Kirche hinein; sie ist überfüllt, weil von den Nachbarorten viele Gastschützen gekommen sind; deshalb haben sich die Jungen, die Auszügler, mit ihrem Fähnrich im Chor ausgestellt, eine trotzige, lebensfrohe Schar, und doch – dem Tode geweiht!
Soeben hat Pfarrer Käslin die Kanzel bestiegen; lange wallt sein halb ergrautes Haar auf die Schultern herab. Jeder Zug seines hageren Gesichtes ist scharf gezeichnet, und doch erwecken sie in ihrer Gesamtheit den Eindruck seelenvoller Güte. Auch die feingezogene Adlernase vermag dem durchdringenden Auge den Ausdruck der Herzlichkeit nicht zu nehmen.
Während er das Evangelium vom guten Hirten vorliest, kommt noch einer herein: der Schnyderkari! Er ist nicht etwa unter dem Druck eines religiösen Bedürfnisses gekommen; darüber ist er längst hinaus! Aber er hat gehört, dass Pfarrer Käslin ein geschworener Feind der neuen helvetischen Verfassung sei, und dies will er, der Schnyderkari, jetzt konstatieren und dann vielleicht dem Kantonsstatthalter Alois von Matt in Schwyz, „seinem Freunde", Bericht und Antrag stellen. Deshalb geht er auf die Empore, wo er zuvorderst neben Wildhüter Murer und dem „Murmolter" Platz nimmt.
Nach der Vorlesung des Evangeliums setzt man sich. Lange lässt Pfarrer Käslin den starken Blick über die Anwesenden schweifen, und dann beginnt er:
„Liebes katholisches Volk!
Im heutigen Sonntagsevangelium nennt sich Christus den guten Hirten. Vertrauensvoll folgt ihm seine auserwählte Herde zur Gottesweide nach dem Berg Thabor. Gibt es wohl ein lieblicheres Bild! Wie ein Pelikan öffnet er ihnen dort sein liebendes Messiasherz, und diesem seinem Herzen entströmen die acht Flüsse der unsterblichen Liebe. Und er tränkt seine Herde aus diesen Flüssen der acht Seligkeiten. Seht, wie ihr das Herz dem Hirten entgegenschlägt, wie sie an seinem Munde hangen, wie sie von seinen Lippen Seligkeit trinken, wie sie auf seine Stimme hören ..."
Pfarrer Käslin macht eine kleine Pause, denn dort schnarcht bereits einer! Dann fährt er mit verstärkter Stimme weiter:
„Liebe, aufmerksame Zuhörer! Wie damals, so steht Christus auch heute noch vor uns als Hirte der Völker, unsichtbar freilich, doch wahrnehmbar für das Auge des Glaubens. Weil aber seine Herde eine sichtbare Vereinigung von Gläubigen ist, so hat er ihr auch sichtbare Hirten gegeben. Deshalb übertrug er sein heiliges Hirtenamt den Aposteln und ihren Nachfolgern, den Priestern. Der vom Bischof zu euch gesandte Pfarrer ist also nichts anderes als der sichtbare Stellvertreter Jesu Christi, des unsichtbaren guten Hirten, und es ist ein heiliges Gebot, auf seine Stimme zu hören; denn Christus sagt: Wer euch hört, der hört mich … wer aber die Kirche nicht hört, der sei euch wie ein Heide und öffentlicher Sünder. Wenn also euer Pfarrer zu euch spricht, so sollt ihr auf ihn hören, als ob Christus vor euch stünde."
Und da schnarcht der Zweite!
Der lange Kirchweg und die wohlig warme Lust tun ihre Wirkung. Mit einem kurzen Feldherrnblick überschaut der Prediger die Situation: da und dort nickt noch einer auf der Männerseite, während es die frommen Beckenriederinnen nur zu einem züchtigen Gähnen bringen. Er blickt auf die Empore: Dort sitzen der Wildhüter und der „Murmolter", sonst zwei erbitterte Gegner, jetzt aber friedlich und einig, denn auch sie sind beide selig eingeschlummert. Der Aufmerksamste ist der Schnyderkari, der dort zwischen ihnen sitzt, und, den Zeigefinger an der Wange, mit größtem Interesse dem Gedankengange folgt.
Pfarrer Käslin aber ist nicht nur ein meisterhafter Prediger, sondern ein noch feinerer Menschenkenner. Er kennt das Zauberwort, welches jetzt nicht nur schlafende, sondern sogar tote Nidwaldner erwecken kann. Mit scheinbar ruhig verhaltener Stimme setzt er nach unmerklicher Pause wieder ein:
„Den wahren guten Hirten erkennt man also an seiner Sendung durch den Bischof; Christus warnt deshalb auch vor falschen Hirten, vor falschen Propheten, und nie klang diese Warnung ernster als in unseren Tagen; die Stimme des guten Hirten wird heute übertönt von jenen Propheten Luzifers, welche in gleissnerischem Redeschwall das neue Evangelium von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verkünden: Der alte Väterglaube hat sich überlebt; der Franzose bringt euch das wahre Licht des Völkerglückes ...“
Da ist es, als hätte die ganze Versammlung einen Peitschenhieb erhalten; die Schläfer zucken auf, Hunderte von dunklen Augen richten sich auf den kühnen Ankläger der französischen Kultur, und auf den gefurchten Stirnen liegt ein heiliges Wetterleuchten.
Nur der Schnyderkari bewahrt seine unerschütterliche Ruhe: mit der Würde eines Hochschulprofessors zieht er sein Notizbuch aus der Busentasche; denn er kann lesen und schreiben. Feierlich öffnet er dieses sein Geheimarchiv und schreibt auf die erste leere Seite: „Pohlidig10 auf der Kantzell" . . . Kaum aber ist der verheißungsvolle Titel geschrieben, so fliegt das Buch auch schon in einem weiten Bogen über die Brüstung und drunten dem Totengräber auf die Glatze. — Der Murmolter hat den Streich geführt: Er kann zwar nicht lesen, ist aber zu klug, um die Absicht des Schnyderkari nicht zu begreifen. Dieser schneidet eine empörte, hoheitsvolle Miene und wendet sich mit einem vernichtenden Blick an den Angreifer:
„Diese bodenlose Frechheit" ... Er will auffahren, kommt aber nicht weit; denn der Murmolter fasst ihn am „Chittelsecken“11 und zieht ihn mit einem Ruck zurück, dass die Bank kracht:
„Bist still, chäibe Bleger dui, oder sell di verwirge, der Tiifel het der Schmutz scho ibertoh ..."12
„Im Namen der helvetischen Freiheit . . .", will der Schneider mit verhaltener Wut protestieren, wird aber im selben Moment auf der anderen Seite wie von einer Schmiedezange vom Wildhüter am Arme gepackt, dass die geharnischte Resolution in einem leisen Seufzer erstirbt.
„Willst ds' Muil halte . . . oder!"13
Der Wildhüter deutet mit dem Finger auf den Weg, den das Buch gemacht hat!
Da schneidet der unglückliche Schnyderkari ein Gesicht wie ein Kind, das baden soll, und setzt sich schweigend zwischen die zwei schrecklichen Menschen. Er bleibt fortan schön brav; denn er weiß: Die Nidwaldner sind unberechenbar, wenn sie losbrennen. Und hier sitzt er zwischen den zwei Schlimmsten!
Pfarrer Käslin hat den Vorgang beobachtet: Der Murmolter hatte ihm vor zwanzig Jahren in der Sonntagschristenlehre manchen Verdruss gemacht. Während seines Vortrages hatte er gewöhnlich um Kaninchen gehandelt, Schlagringe probiert, Messer geschliffen und Pistolen geladen — aber den heutigen Streich will er ihm mit dem Mantel der Liebe zudecken.
In einer halben Minute hat sich das Schneiderdrama abgespielt, und als ob nichts geschehen wäre, nimmt der Prediger den Gedanken wieder auf:
„Das Wort von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist aber eine dreimal verfluchte Lüge des Höllenhundes. Liebe Pfarrkinder, als euer Hirte habe ich nicht nur das Recht, euch die Wahrheit zu sagen, sondern auch die Pflicht, euch dieselbe zu beweisen:
Schon das Breve unseres Hl. Vaters Pius des Sechsten vom 10. März 1791 sagt ausdrücklich, dass die vom französischen Nationalkonvent vorgeschützte Freiheit und Gleichheit dahin ausgehe, die katholische Religion zugrunde zu richten. Die helvetische Verfassung, welche uns die Franzosen aufzwingen, verficht die gleichen schismatischen Grundsätze wie die Französische Revolution. Ihr wisst, dass die Lehren der neuen Verfassung niedergelegt sind in dem saubern Büchlein von Peter Ochs in Basel. Nun wohl, dort heißt es: ‚Alle Gottesdienste sind erlaubt, wenn sie die öffentliche Ordnung nicht stören und weder Oberherrschaft noch Vorrang behaupten wollen.
Das heißt mit andern Worten: Die Religion Jesu Christi darf sich nicht über die Irrlehren erheben und steht auf gleicher Stufe mit dem Heidentum. Und wie nach der neuen Verfassung die Glaubens- und Gewissensfreiheit aufzufassen ist, zeigt folgende Stelle: ‚Die Polizei hat ein wachsames Auge auf die Gottesdienste und hat das Recht, sich über ihre Lehrsätze und Pflichten, zu welchen sie anhalten, zu erkundigen.‘
Die Freiheit besteht also darin, dass unsere Gottesdienste von der Polizei beaufsichtigt und verboten werden können. Diese Polizei tritt sogar an Stelle des Papstes; denn ‚Ochsens höllisches Büchlein' verlangt, ,dass Verhältnisse einer Sekte mit einer fremden Obrigkeit', d. h. der Papst, ,weder auf Staatssachen, noch auf den Wohlstand und die Aufklärung des Volkes einen Einfluss haben'. Die neue Freiheit besteht also in der Bevogtung durch die Polizei, die Gleichheit in der Gewaltherrschaft französischer Einbrecher und die Brüderlichkeit in der Beraubung der niedergeworfenen Völker bis aufs Blut!
Liebe Nidwaldner! Zwei Stunden von hier, dort auf dem Rütli drüben, tagten einst unsere Väter. Sie beschlossen damals, die fremden Vögte zu vertreiben und schwuren im Angesichte des Allmächtigen, mit ihrem Herzblut einzustehen für ihre angestammten Rechte und Freiheiten. Und wenn dann ein Feind nahte, um seine freventliche Hand nach ihrem heiligen Ahnengut auszustrecken, dann flammten auf unsern Bergen die Höhenfeuer auf, die Glocken läuteten und die Harsthörner bliesen zum Sturm! Da griff der Gemsjäger zur Armbrust und der Senne zum Morgenstern! Unsere Ahnen wollten lieber bluten als fronen, und der Allmächtige hat sie nie verlassen, wenn sie vor blutiger Schlacht zu ihm riefen. Liebe Pfarrgenossen! Heute geht es um mehr als um politische Rechte und Freiheiten! Heute geht es um unsern heiligen Glauben! Und nun, Nidwaldner, wollt ihr die neue Verfassung anerkennen? Die anderen Kantone haben sie angenommen, sogar Obwalden! Wir sind die letzten und der Feind ist hundertmal stärker. Wenn wir unserer Ahnen würdig sein wollen, so gibt es nur eine Antwort: Wir dürfen nicht! Lieber bluten als fronen! Gott schütze Nidwalden! – Amen!"
So spricht Pfarrer Käslin; seine Schläfen haben sich gerötet, seine Gestalt ist gewachsen und seine Augen leuchten; er scheint jünger geworden zu sein; die Männer aber schauen zu ihm auf wie junge Adler, welche von ihren Alten die Atzung erwarten; dort auf der Empore aber ist der Murmolter noch während der Predigt aufgestanden; lang und hager ragt er über den andern empor, und zwischen den halbgeöffneten Lippen sieht man die zusammengebissenen Zähne; neben ihm kauert der Schnyderkari wie ein Häufchen menschlicher Gebrechlichkeit.
Noch einmal spricht der Seelsorger: „Wir dürfen nicht hassen; beten wir für unsere Feinde ein Vaterunser!"
Und sie beten; aber es klingt wie Zähneknirschen! Nach dem Gottesdienst zieht man zur Schühen- wiese, und bald krachen die ersten Schüsse; die Bewaffnung ist keine einheitliche: Die einen bedienen sich der neuen Geradezuggewehre mit glänzenden Messinggarnituren, Kaliber 3 ½ Lot (= zirka 60 Gramm). Andere schießen mit Bergmusketen und Doppel-Hacken; sogar die Gewehre mit Luntenschlößern sind noch nicht ganz ausgestorben. Die Kenner, und dazu gehören vor allem die Jäger, bevorzugen die Zielstutzen. Man schießt sogar auf eine Distanz von hundert Schritten. Die Scheibe ist durch zehn Kreise in elf Felder eingeteilt; das äußerste Feld aber zählt nicht, sodass Nummer zehn der Kernschuss ist; dieser wird mit einem roten Fähnchen angezeigt.
Neben dem Schützenstande schießen auch die Knaben mit Armbrust und Bogen. Auch sie haben ihren Gabentempel: Äpfel, Backwerk, Süßholzstengel, Hosenträger, Hegelimeßer14 und als ersten Preis einen fetten Küngel.15
Kein Tingeltangel und kein Karussell stört die Idylle. Nur der Wirt vom „Mond" hat hinter dem Schützenstand seine Bretterbude aufgeschlagen, um die Schützen mit dem „Allernotwendigsten" zu versehen. Seine schöne Tochter Klara ist ohne Zweifel die Hauptattraktion; denn vor ihrem Ausschank sieht es aus wie an einem Bienenkorb, obschon sie schon „vergeben" ist; der hübsche Fähnrich Murer gedenkt sie in drei Wochen endgültig zum – Kaffeemahlen anzustellen! Sie muss denn auch manchen Scherz einstecken, und doch würde mancher „vornehme" und in allen Umgangsformen gewandte Lasse16 von diesen derben Älplern lernen können, wie man in derartigen Fällen scherzen kann, ohne die bekannte Glocke zu läuten.
Soeben kommt ein wettergebräunter Geselle von der Tschiferenegg daher, nimmt sie bei der Hand und nach Art französischer Salonjünglinge drückt er einen ritterlichen Kuss darauf, so dass das hübsche Händchen in dem schauerlichen Urwalde ganz verschwindet; dann seufzt er mit schmachtender Stimme: „Schellenöhr, Mammersell!"17
Die Klara geht fröhlich auf den Artikel ein und sagt mit gnädig herablassender Handbewegung:
„Bongschur, Tschifermichl! Wulewu Bränz?"18
Da lässt sich der alte Schwerenöter auf das linke Knie nieder und die linke Hand auf die Brust gepresst, die rechte theatralisch ausgestreckt, deklamiert er feierlich:
„Wui, wui, Bätziwaßer!"19 Der Tschiferenmichel spricht nämlich schon sieben Worte Französisch, während die Klara ziemlich gut „welscht".
„De quelle bouteille?20“, fragt sie nun.
Da ist der Tschisereneggmichel am Ende seiner diplomatischen Laufbahn; aber er hat die bezeichnende Geste der Klara richtig gedeutet und entgegnet prompt:
„Egaliteh!"21
Es ist etwa nachmittags vier Uhr, als der junge Fähnrich zum Schuss kommt. Jeder hat fünf Schüsse zu tun; das Maximum wäre also fünfzig Punkte; er erreicht 45, also durchschnittlich eine 9, ein ganz ausgezeichnetes Resultat, bis jetzt die Höchstzahl.
Die Klara erglüht vor Freude, als sie das „Bravo" der Jäger hört; denn diese wollen unbedingt den höchsten Preis; das wurmt aber den „Murmolter" ganz gewaltig; er hat sich gerade bei der Klara einen Schnaps zu Gemüte geführt, als er den Rummel hört. Die kluge Klara will ihm noch einen gratis einschenken, aber schon ist er fort und drängt sich grimmig durch die Umstehenden nach dem Stande.
„Wie viel Punkte?", fragt er kurz.
„Fünfundvierzig", sagt der Schützenmeister.
„Chani eppe grad schiesse?"22
„Ja!"
Da untersucht er seine Büchse mit zärtlicher Sorgfalt, zieht den Hahn aus und setzt sich in Positur; der Schuss kracht.
„Acht!"
„Nid schlächt; aber so längt's nid!", spottet ein Emmeter Jäger. Schweigend lädt der Murmolter wieder. Der zweite Schuss ist eine 10! Neben ihm steht der junge Murer, scheinbar ganz ruhig, und doch schlägt sein Puls schneller.
„So längt's!", meint er mit scheinbarem Wohlwollen; aber s'ist ihm nicht so ernst! Die Klara aber stellt sich auf ein leeres Fässchen, um die Schüsse Murmolters zu beobachten. Etwas abseits vom Schießenden unterhält sich der alte Wildhüter mit einem Älpler, als ginge ihn die Sache nichts an.
Inzwischen hat der Murmolter wieder geladen; er scheint ein ganz anderer geworden zu sein; die spielende Leichtigkeit, womit er das schwere Gewehr aufnimmt und kurz stillhält, lässt auf eine außergewöhnliche Kraft schließen. „9!", meldet der Zeiger aus dem dritten Schuss. Die Spannung wächst. Die Klara verschüttet ein Glas „Bränz". „9!", melden ihr die Umstehenden noch einmal beim vierten Schuss.
Nun schaut auch der alte Murer hin, scheinbar ohne Interesse, die Klara aber zählt leise: „Acht, achtzäche, siebenezwänzg, sächsedrissg! Mit eme Nini ischer bimeich Schlich!"23
Da kracht es! Klara presst die Hand aufs Herz. „Jetz miend sie am Aend no schtäche!" Aber wie aus einem Munde tönt es vom Stand her:
„Es Zächni!"24
Hans Murer ist vom Wilderer „abgeschossen!"
Da kommt der Wilderer daher, ruhig und stolz; Klara schenkt ihm mit zitternder Hand ein, noch bevor er bestellt hat; der Murmolter hatte sich vor zwei Jahren bei der Klara einen Korb geholt; wer kann es ihm vergönnen, wenn er jetzt vor ihr in froher Genugtuung seinen Schnurrbart auswirbelt! Aber „Hochmut kommt vor dem Fall!", sagt der Franzose; denn da kommt der alte Murer dahergeschlarpt.
„Will lüege, eb i oi no eppis chenn!"25, brummt er fast gelangweilt und greift nachlässig zum Stutzen; selbstverständlich hätte er nicht geschossen, wenn sein Sohn Höchster geblieben wäre!
Wie seine buschigen Brauen beim Zielen zusammenrücken!
„Zäche!", hört der Murmolter rufen, aber er bleibt ruhig.
„Zäche!", tönt es zum zweiten Male!
Jetzt wird es für ihn Zeit. Er trinkt aus und geht im Sturmschritt nach dem Kampfplatz; er kommt gerade in dem Augenblicke, wo der Wildhüter losdrücken will; in diesem Moment führt der Murmolter den Finger an den Mund und – lässt den Pfiff des Murmeltieres ertönen! Man sieht zwar nicht, dass der Wildhüter zuckt, aber der Zeiger meldet eine 8! Der Alte schaut den Wilderer nur ruhig an und sagt – nichts. Umso unwilliger aber sind die andern.
„Schäm di, Murmolter", sagt der Schützenmeister, „das hält i nid gloibt, dass d' so niidig wärisch!"26
Und der Murmolter schämt sich, was ihn aber sichtlich viel Mühe kostet.
Und der Wildhüter schießt:
„Zäche!", jubeln seine Freunde. Da hält es den Murmolter nicht mehr:
„Muirer, wemmer täile?", ruft er hastig.
„Nein!", ist die ruhige Antwort, und bedächtig stößt er die Kugel in den Lauf.
„Acht sind Schlich!", sagt der Schützenmeister. Kaum hat er das gesagt, so kracht der letzte Schuss. Alles starrt nach der Scheibe; man hält den Atem an; doch, warum sucht der Zeiger so lange an der Scheibe herum? War's ein Fehlschuss? Man schaut auf Murer: der steht ruhig da, auf sein Gewehr gestützt, und brummt behaglich:
„Miend ehm halt e Brille schicke!"
Und da reißt der Zeiger die Scheibe aus dem Boden und kommt mit ihr daher gesprungen: der
Schuss sitzt genau im Mittelpunkt; deshalb hat er ihn nicht gleich beachtet. Nun geht's aber los! Achtundvierzig Punkte! Man bringt dem Kunstschützen ein dreifaches johlendes Hoch; der Tschiferenegg-Michel aber raunt dem Murmolter ins Ohr:
„Gäll, Molter, hättisch nit so viel selle suisse! Der Muirer heb hitt no nid gha!"
Die Klara merkt den Ausgang am Gejohle der Jäger, und ihre Schelmengrübchen kommen wieder zum Vorschein; mit diesem Ausgang ist sie auch zufrieden!
Nun kommt nur noch ein einziger Schütze, und was für einer!
„Kaspar Imbühl!", ruft der Schützenmeister.
Ein schöner, bärenstarker Mensch von etwa dreißig Jahren tritt vor.
Mit viel Umständlichkeit setzt er eine Flinte instand und bindet sich dann ein Nastuch schräg über das linke Auge.
Verwundert betrachtet man ihn.
„Hesch Chopfweh?", fragt der Michel.
„Näi, i cha nid äis Oig uifmache und's ander zueche!"27, sagt er gelassen.
Man kann kaum das Lachen zurückhalten und der Michel macht ein Gesicht, als ob er ein Monokel zuklemmen müsste.
Der erste Schuss kracht. Eine Erdscholle fliegt hoch in die Luft! Am Boden aber zeigt sich eine Furche, die in ihrer Verlängerung etwa sechs Schuh neben die Scheibe hinzeigt. Man windet sich vor Lachen.
„Patz ui'f, Chasper, dert het der Muiser imene Miher grichtet.28 Tatsächlich entdeckt man dort die Markierung einer Mausefalle. Der Kasper aber lädt mit der größten Seelenruhe wieder. Während er noch zielt, ruft der Michel mit lauter Stimme:
„Zaiger, flieh, 's schiesst äine!"
Die Warnung ist nicht nötig, denn der Schuss geht nicht los; der Schütze schüttet frisches Pulver auf und legt wieder an, mit dem gleichen Misserfolg. Da reicht ihm der Wildhüter seine eigene Flinte und bohrt den Schuss aus: zuerst kommt der Pfropfen, dann das Pulver und zuletzt die Kugel!
„Herrgott vo Seelisberg! Dem sett mer d'Rüete gäh! Do chene d'Franzosen uifpasse, wämmer dere Wändrohrfierer händ!"29, knurrt der Alte in den Bart hinein.
Der neue Tell schießt wieder: am Apfelbaum neben der Scheibe hängt ein blühender Zweig nieder und der ganze Ast schwankt ...
Erst der fünfte Schuss sitzt in der Scheibe, aber im äußersten „leeren" Feld. Wenn man dem hochgewachsenen Burschen in die blitzenden Augen sieht, so würde man so etwas nicht für möglich halten.
Mit der Produktion Imbühls ist das Schießen abgeschlossen. Man verzieht sich langsam nach der Wirtschaft zum „Mond", wo die Preisverteilung und der unvermeidliche Schützentanz das Fest beenden sollen.
Der Wildhüter hat den bekränzten Bock gleich beim Kragen genommen und heimgeführt. Dort stellt er denselben neben seine drei Geißen, welche den neuen Ankömmling verwundert betrachten. Auch die zwanzigjährige Braunkuh wirft ihm einen futterneidischen Blick zu.
Nachdem der Alte gemolken hat, geht er selbstverständlich in den „Mond" zurück, wo der „Orchesterverein" von Beckenried bereits konzertiert. Er besteht aus einer sechssaitigen Gitarre, welche ihre Töne einem ungeschmierten Wagenrad abgelauscht zu haben scheint, einer Geige und einer Trompete, welche unter Artaxexes dem Zweiten in der Schlacht bei Kunaxa 401 v. Chr. verloren gegangen war. Doch eines muss man anerkennen: der Takt stimmt; denn alle drei Spieler markieren ihn mit den Stiefelabsätzen, eine Methode, welche sogar die alte Schnapsflasche auf dem „Musikpodium" zum Tanzen anregt. Den einfachen Nidwaldnern aber klingt es wie Engelstöne.
Als der Wildhüter den Saal betritt, fliegt gerade sein „Junger" mit der Klara an ihm vorüber, unter trotzigem Jauchzen den Boden stampfend; ein herrliches Paar in unberührter Jugendfrische, keusch wie die knospende Alpenrose. Die Bartstoppeln des Alten bewegen sich merklich um die Mundwinkel, wohl, um nach außen ein wohlgefälliges Lächeln anzudeuten. Alles tanzt. Siebzig-, Achtzigjährige, wie heute noch an
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: