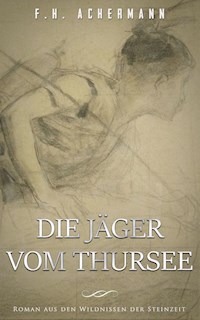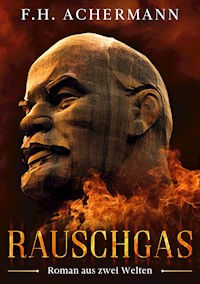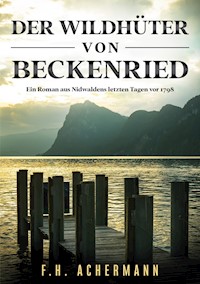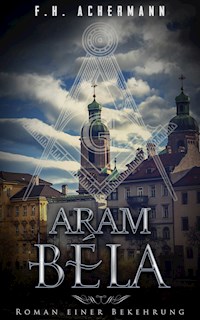Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Knortzigen ist eine kleine Gemeinde im Kanton Luzern. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Die Bauern arbeiten hart, die Politik ist konservativ und die Politiker kümmern sich um die Anliegen ihrer Wähler. So hat es zumindest den Anschein. F.H. Achermann, der selbst in St. Erhard aufwuchs und in Sursee die weiterführenden Schulen besuchte, entlarvt in diesem Roman die beschworene Wohlanständigkeit und schaut hinter die Kulissen. Der alte Bauer Xaveri wird sterben. Seinen Hof hat er längst an den genauso geizigen wie ehrgeizigen Bruder übergeben. Doch er will nicht sterben, bevor er sichergestellt hat, dass sein unehelicher Bub, den er mit einer längst entlassenen Magd gezeugt hat, versorgt ist. Aus diesem Grund setzt er ein Testament auf, in dem er den Ruedi, der nichts von seiner Abkunft weiss, als Erbe eines Betrages einsetzt, der es diesem erlaubt, ein Studium zu machen. Den Schulmeister von Knortzigen, seinen Freund, setzt er als Testamentsvollstrecker ein. Als Xaveri schliesslich stirbt, unterschlägt sein Bruder das Testament und diskreditiert den Lehrer, der schliesslich sogar um seine Anstellung fürchten muss. Wird sein Betrug gelingen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Schulmeister von Knortzigen
Der Schulmeister von KnortzigenVorwort des HerausgebersEin Geheimnis wird gebeichtetAuf dem GarihofVon Gespenstern und vom TodZweitens: der GeizVom Politisieren und von einem BegräbnisDie Wiederholungsschule und ein BubenglückDer Revoluzzer und ein TodfeindEine Ammannwahl in KnortzigenDer zweite Wahlgang und seine VorgefechteMit Ross und Wagen — falsch gestimmt!Des Schulmeisters Segen und SiegKlappentextImpressumDer Schulmeister von Knortzigen
Eine Erzählung aus der Heimat
F.H. Achermann
Neu herausgegeben von
Carl Stoll
Vorwort des Herausgebers
Liebe Leserin, lieber Leserin,
Franz Heinrich Achermann ist den meisten Lesern als «Schweizer Karl May» mit Büchern wie «Der Totenrufer von Hallodin», «Der Schatz des Pfahlbauers», «Kannibalen der Eiszeit», «Auf der Fährte des Höhlenlöwen» oder als Autor von Studentenromanen wie «Nie kehrst Du wieder, goldene Zeit» bekannt. Diese Werke machten den Schweizer Schriftsteller zum Bestseller-Autor.
«Der Schulmeister von Knortzigen» brachte es allerdings nie zu grossen Auflagen. Der Autor, selbst katholischer Geistlicher, hält darin seinen Zeitgenossen einen allzu klaren Spiegel vor.
«Der Schulmeister von Knortzigen» ist im besten Sinne des Wortes ein Sittengemälde der bäuerlichen Gesellschaft im ländlichen Luzern (und wohl nicht nur da), wo Anständigkeit, Konservativismus, Kirche und Ehre von den reichen Bauern mit stolzgeschwellter Brust dargestellt werden, während sie auf der anderen Seite mit ihren Mägden uneheliche Kinder zeugen, ihre Knechte schlagen und ihnen nur gerade so viel zu essen geben, dass ihre Arbeitsleistung nicht leidet.
War die «gute alte Zeit» wirklich so gut, wie manche immer behaupten? Franz Heinrich Achermann zeigt in seinem Roman «Der Schulmeister von Knortzigen» ein Portrait einer Gesellschaft, wie er sie unmittelbar aus seiner Umgebung und seiner Tätigkeit als Geistlicher kennt. Heute, mit Abstand gelesen, hat das Buch das Potential, unsere Vorstellungen zurechtzurücken. Es gewinnt insbesondere durch die Schweizerische Diskussion zu «Verdingkindern» Aktualität.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem gelungenen Portrait!
Der Herausgeber
Ein Geheimnis wird gebeichtet
Im Bären zu Knortzigen sitzt Lehrer Lang bei einem Kreuzjaß[1]. Sein Partner ist der Bühlmann Xaveri[2] vom Garihof, ein alter Junggeselle.
Die Gegner sind der Jucher Hans und der Liechtsteiner Siegmund aus Oberkirch, die nach einem Kuhhandel hier eingekehrt sind.
Diesen beiden Jaßtigern sind die Knortziger nicht gewachsen; denn der Siegmund hat jede gespielte Karte im Gedächtnis, und der Hans flucht mit einem Selbstbewußtsein, dass der gutmütige Xaveri immer mehr in sich zusammensinkt und der Lehrer sich umsieht, ob die Kinder schon ins Bett gegangen seien.
Wie Hansens Faust zum letzten Mal auf den Tisch donnert, ist das Schicksal der beiden Knortziger entschieden. Sie müssen den Liter Schaffhauser, der einen süßlichen Beigeschmack hat, bezahlen.
Die beiden Oberkircher aber wischen sich die blonden Schnurrbärte und wünschen den beiden Besiegten ein baldiges Wiedersehn.
Der Xaveri hat an seinem Glase kaum genippt; denn er ist magenkrank. Nun steht er auf.
Wie Lehrer Lang hinter ihm über die Stiege geht, fällt ihm auf, dass der Xaveri, wie man sagt, nichts mehr in den Kleidern hat.
„Ich komm noch ein Stück mit dir," sagt der Lehrer zu seinem Jugendfreund. „Wie geht's dir, Xaveri?"
„War gestern bei Dr. Käppeli!"
„Was meint er?"
„Er sprach von Magenverschluss!"
Der Lehrer bleibt unwillkürlich stehen, so betroffen ist er von dieser Nachricht. Er kennt den Verlauf und das Ende dieser furchtbaren Krankheit: Hungertod! Nun ist ihm der Zustand seines Freundes klar. Er kann nichts mehr oder nur noch unbedeutende Flüssigkeiten zu sich nehmen.
„Xaveri! Weißt du, wie — diese Krankheit — hm, eh — verläuft?"
„Ja, Gottfried! Der Käppeli gehört nicht zu den Komplimentemachern: Ich muss — sterben! Gottfried."
Er nimmt den Lehrer bei der Hand. Dieser glaubt ein unterdrücktes Schluchzen gehört zu haben.
„Xaveri, nimm's nicht so schwer! Wir alle müssen einmal sterben!"
„Ja, ja! Aber es fragt sich eben nur wann!"
„Wer weiß", versucht der Lehrer zu trösten, „vielleicht kannst du noch lange leben!"
„Nein, Gottfried!" jammert der Xaveri, wieder stillstehend. „Ich glaube, ich habe heute den letzten Jass gemacht!“
„Xaveri! Was denkst auch! An dem ist's doch noch nicht, glaub' ich!"
„Ich weiß, was ich weiß! Der Totengräber hat mich heute gar so schön gegrüßt und…", mit zitternder Stimme sagt er das Geheimnisvolle, „auf unserer Eiche hat mir letzte Nacht der Totenvogel gerufen! Ich bin sicher, dass … was ist das dort?"
„Wo?"
„Dort, im untern Suhrental?"
„Ah — ja! Das ist eine Brunst — dort brennt es!"
„Wo mag's wohl sein?"
„Wenn's im untern Suhrental brennt, so ist's in der Regel in Triengen!", lächelt der Lehrer.
„Wird wohl wieder eine alte Schaubhütte sein. Sie werden bald ein neues Dorf bekommen, wenn sie so fleißig brennen lassen wie bisher!"
„Leider!", seufzt der Schulmeister. „Bald wird im Kanton Luzern das letzte Alemannenhaus verschwunden sein!"
„Ist nicht sehr schad!"
„Da sind wir nicht ganz einig, Xaveri! So ein Alemannenhaus ist einer der letzten und ehrwürdigsten Zeugen aus alter Zeit! Diese verachteten Schaubhütten sind sozusagen die letzten Nachkommen ihrer Urahnen aus der Alemannenzeit und gehören zu den letzten Zeugen des alten Heidentums. Alte Leute wissen zu erzählen, dass zum Beispiel noch in St. Erhard Pferdeschädel an den Dachfirsten gehangen haben, und dass jedes Schaubhaus sein sogenanntes 'Gespensterstübli' gehabt habe, in das die Geister des Heidentums verbannt waren. Niemand durfte diesen kleinen Raum betreten! Es knüpften sich Sagen und abergläubische Geschichten daran!"
„Gottfried", flüstert der Xaveri mit verhaltenem Atem, „wir haben auch noch ein solches Stübli! Aber wir gehen furchtlos hinein; nur in der Fronfasten und in der Streggelennacht nicht, oder wenn der Törst gejagt hat."
„Ja, der Garihof ist auch noch alemannisch, wenigstens in der Dreiteilung seines Grundrisses: in der Mitte die Wohnung und zu beiden Seiten die vorstehenden Ställe. Der oberste Stock aber ist modernisiert, und auch das Dach ist bereits mit Eternit verhunzt!"
„Ver — hunzt? Das darfst du meinem Bruder, dem Fridli, nicht sagen … schau dort, wie die Röte steigt!"
„Es muss ein größerer Bau sein, wahrscheinlich mit Heueinlagen. So eine Brunst um Mitternacht hat etwas unheimlich Schönes an sich, etwas Höllisches — Xaveri, frierst du?"
„Nein, aber — Gottfried, ich möchte dir etwas sagen — weißt, bevor ich — man weiß ja nicht… "
„Sprich dich aus, Xaveri!"
„Gottfried, ich hab' — aber gelt, nur zu dir gesagt — ich hab' noch etwas gut zu machen!"
„Dann, Xaveri, hm, dann musst halt den 'Heer' kommen lassen!"
„Ich glaube, der kann mir auch nicht helfen. Zuerst das andere, und dann den Pfarrer."
„Hm, hast du etwa… du hast doch kein Unrecht gut zu machen, Xaveri? Das würde dir nicht gleichen!"
„Und doch, Gottfried, du hast's erraten!"
„Brauch ich das zu wissen?"
„Ja, du bist mein bester Freund; du musst es wissen und mir einen guten Rat geben."
„Gern, wenn ich kann!"
„Du kannst es; du kennst solche Sachen."
„Dann von der Leber weg, Xaveri! Dein Vertrauen soll nicht enttäuscht werden!"
„Unser Ackerbub, der — Ruedi Steiger — du, Gottfried, ich kann dir's fast nicht sagen!"
„Was ist mit ihm?"
„Das ist mein Bub!"
Der Lehrer glaubt nicht recht gehört zu haben. Der Ruedi, einst sein Liebling, der Sohn dieser Jammergestalt?
„Xaveri! Eher könnt ich glauben, dass die Brunst dort unten nur zufällig entstanden sei, als dass du — Xaveri, du — ist es dir wirklich ernst?"
„Leider — leider!"
„Nun, das ist jetzt nicht mehr zu ändern!"
„Aber ich möchte doch noch etwas gut machen, bevor — es zu spät ist."
„Wie meinst du das?"
„Dem Buben etwas sicherstellen; er soll nach meinem Tode nicht mehr armengenössig sein!"
„Xaveri, das ist brav von dir!"
„Wollte schon lange etwas tun; aber der Fridli und die Frau — du kennst sie ja! Ich bin ja auch huuslig, aber die zwei würden sich für fünf Rappen ein Hebeisen im Leibe krümmen lassen!"
„Du denkst an ein Testament?"
„Ja! Ich hab' an Gülten zwölftausend Franken und an Sparkasseneinlagen achttausendsiebenhundert Franken. Dieses Geld, das ich selbst erspart habe, will ich dem Ruedi vermachen. Er kann damit etwas werden. Den Rest mögen sie zum Eigenen tun! Wie macht man ein Testament — ohne dass sie etwas davon merken?"
„Wenn's der Gemeindeschreiber macht, so wird es kaum geheim bleiben."
„Komm mir nicht mit dem! Der würde die Hälfte für sich wollen."
„Dann gehst du halt zu einem Advokaten in die Stadt, zum Beispiel am Dienstag: Da merkt's niemand, weil Wochenmarkt ist."
„Du hast recht! Am nächsten Dienstag geh' ich!"
„Hast du einen verschließbaren Schrank?"
„Natürlich! Vor dem Tode kommt mir niemand dahin! Hier hab' ich den Schlüssel!"
„Dann ist alles in Ordnung. Gute Nacht, Xaveri!"
„Schlaf wohl! — Gelt, es bleibt noch unter uns?"
„Versteht sich!" Sie trennen sich.
Am südlichen Horizonte liegt ein heller Streifen, fast wie Morgenrot; und doch ist's erst Mitternacht.
Der Xaveri kennt das Zeichen: Bald wird's Föhn geben.
Und richtig!
Noch hat er den Bründlerwald nicht erreicht, da rauscht und kracht es schon in den Tannenwipfeln; die wuchtigen Stöße blasen in seine leeren Kleider, dass er ordentlich gegen den Wind ankämpfen muss und dabei taumelt wie einer, der schwer geladen[3] hat.
Da steht er still und horcht.
Was war das?
Aus der Ferne klang es wie das langgezogene Heulen eines großen Hundes.
In wahrer Todesangst drängt der Xaveri gegen den Wind an und zieht den Kragen hoch.
Plötzlich taumelt er gegen einen Kirschbaum, der am Wege steht, und hält sich daran fest. Todesschrecken kriecht über seinen Rücken, seine Augen werden feucht, und seine Kinnladen schwabbeln wie nach einem kalten Bade; das Heulen kommt näher ...
Der Törst[4]!
Und da heulen die gesträubten Kronen der Tannen im Anries, krachen die schwankenden Stämme und etwas Keuchendes fährt vorüber.
Der Xaveri setzt zum Klettern an und — fällt wie ohnmächtig nieder.
Er sieht noch mit fiebernden Augen die Meute von jagenden Hunden, und auf dem vordersten sitzt der sagenhafte Törst mit Hörnern und fliegendem Mantel. Dann weiß er nichts mehr; nur das Heulen und Fauchen rast in seinen Ohren weiter.
Die Ohnmacht geht allmählich in Schlummer über und er träumt, er liege im Bette.
Da wird er gerüttelt und erwacht.
Im ersten Augenblick glaubt er, man habe ihn wie gewöhnlich zum Morgenessen wecken wollen, aber da vor ihm steht der Meisterknecht, der Radi, mit der Sturmlaterne, und nun weiß er, dass das Erlebte kein Traum, sondern fürchterliche Wahrheit gewesen ist.
„Radi, wer hat dich geschickt?"
„Ich musste im Stalle wachen; der Singel will kalbern, und als der Föhn zu keiben anfing, da kam die Frau und sagte, ich solle dir entgegengehen. Was hat's gegeben?"
„Radi, der Törst!", keucht der Xaveri mit tränenden Augen.
„Aha, der Törst hat gejagt? — Ist's mir doch gewesen, als hält' ich den Keib gehört!"
„Da unter dem Chriesbaum ist er durchgefahren!"
„Xaveri! Kommt heim, gebt mir den Arm!"
Noch hat das Paar den Garihof nicht ganz erreicht, da schaut der Radi, immer noch unter dem Eindruck von Xaveris Erlebnis, nach dem Waldrande und stösst vor Schrecken beinahe einen Schrei aus: aus dem Anries springt ein gewaltiger Hund auf sie zu und — leckt dem Meisterknecht die Hand.
„Potz Donner — der Bismark!", jubelt der Radi und führt den Xaveri heim.
[1] Jassen / der Jass – Schweizerisches Kartenspiel – existiert in verschiedenen lokalen Varianten
[2] In manchen Gegenden der Schweiz ist es noch heute gebräuchlich den Nachnamen vor den Vornamen zu stellen
[3] Umgangssprachlich für «viel getrunken»
[4] Das wilde Heer
Auf dem Garihof
Am folgenden Morgen steht der Xaveri nicht auf; aber am Dienstagmorgen rumort er schon um sechs Uhr in seiner Kammer herum. Man wundert sich weidlich, dass er heute im Sonntagsgewand antritt.
„Was ist los?", fragt der Fridli hinter dem Tische.
„Möchte noch einmal in die Stadt, bevor ich ganz bettlägerig werde."
„Das Billet hat, glaub' ich, wieder aufgeschlagen", bemerkt der Bauer so nebenhin. Da lächelt der Xaveri schmerzlich:
„Ich esse dann um so weniger!"
Der Bauer schaut herum nach seinem Bruder, um in dessen Gesichte zu forschen, ob das ein Hieb sein sollte.
Doch nein, der Gedanke lag ja so nahe, und der kranke Xaveri schaut so sehnsüchtig nach den dreinhauenden Knechten am Tische, dass es einem ordentlich ans Herz greift.
„Könntet mir eine neue Geißel heimbringen — auf meine Rechnung", sagt nach einer Pause der Meisterknecht Radi.
„Sollst sie umsonst haben — für den letzten Sonntag", entgegnet der Kranke mit wohlwollender Stimme.
Der Bauer schaut wieder umher, etwas verwundert.
Während Ruedi, der nimmersatte Acker- und Milchbub, noch rüstig nach der Röstiplatte langt, macht der Bauer schon das Kreuz, und da muss auch der Letzte seine Waffen strecken, um das Gebet wenigstens mitzuleiern.
Dann geht es in die Erdäpfel, und der Xaveri macht sich auf den Weg in die Stadt. —
Wie er am Abend zurückkehrt, ist er ziemlich aufgeräumt.
Er trägt die neue Geißel geschultert, und daran hängen zwei Päcklein für die Kinder des Bruders; da hat der Bauer nichts dagegen; denn der Xaveri ist in solchen Dingen praktisch: Für den dreizehnjährigen Fridli bringt er ein Paar Unterhosen und für das elfjährige Bäbeli ein blaues, wollenes Tschööpli.
Dem Ackerbub gibt er hinterrücks ein Paar wollene Strümpfe.
„Da hast auch etwas, Ruedi! Bist auch ein armer Bub!"
„Der gute Xaveri!", denkt der Bub.
Die neunzehnjährige Thildi hat er nicht bedacht; denn die führt ein böses Maul.
Wie der Fridli beim Nachtessen vom Mus (Mehlsuppe) herausschöpft, fragt er so nebenbei den Xaveri, der auf dem Ofenbänkli sitzt:
„Was gelten junge Säue in der Stadt?"
„Vier- bis fünfwöchige so sechzig und siebzig."
„Und das Futter so rar! — Das Mus ist wieder zu dick; Thildi, trag ab und gib diesen Brei den Säuen. Bring die Erdäpfel!"
Der Ackerbub rettet noch, was zu retten ist, und gibt dann die Waffen ab. Der Radi nimmt nochmals heraus. Er darf sich das leisten.
Nun geht's ans Erdäpfelschälen. Dazu gibt's abgerahmte Milch, und weil die Erdäpfel dieses Jahr etwas trocken sind, hat Frau Mathilde der Milch etwas Brunnenwasser zugesetzt. Das löscht den Durst am besten.
Wie diese Arbeit getan ist, werden noch eine Stunde lang Äpfel zum Dörren geschnitzt. Unterdessen haben sich das Bäbeli und der kleine Fridli zum Götti Xaveri auf den Kachelofen geflüchtet.
Nun gibt's Gespenstergeschichten und dazu noch den heimeligen Duft von dörrendem Obst.
Der Götti erzählt mit feuchten Augen sein Erlebnis mit dem Törst, von der Kegelbahn im Schlosskeller zu Tannenfels, wo die Kegel Menschengebeine sind und die Geister nachts mit Schädeln als Kugeln arme Seelen auskegeln — von der Kellerstiege im Schloss Mauensee, in der immer ein Tritt fehlen muss, sonst würde er in der Nacht mit Krawall wieder herausgeschlagen.
Aber eine besondere Feierlichkeit befällt den Xaveri, wenn er von den Bründligen erzählt, von den brennenden Totengerippen, die droben am Bürer Gschweich herumfahren, um die Marchsteine[1] abzuwandeln, welche sie in ihrem Leben versetzt haben; von den armen Seelen, die zur Strafe als Irrlichter über den Wassergräben umherfahren, weil sie einst unberechtigt das Wasser nachts auf ihre Bünten[2] laufen liessen.
„Ja, Kinder, hütet euch vor dem ungerechten Gut! Es tut selten…"
„Geht jetzt ins Bett!", mahnt der Bauer etwas ungeduldig.
„Götti, nur noch eins!", betteln die beiden.
„Gut! Aber das ist etwas Unheimliches!", kündet der Xaveri an, indem er die Pfeife ausklopft.
„Es war vor etwa hundert Jahren, in der Schaubernmühle; da hörte der Knecht jeden Abend vom Walde her rufen: „Bring mer au ne Haue — bring mer au ne Haue!' Und diese Stimme kam präzis um Mitternacht. Aus Gwunder[3] geht nun der Knecht einmal hin, mit einer
Haue auf der Schulter. Wie er ans Anries kommt, steht plötzlich ein Bründliger[4] vor ihm und sagt: ‚Grab hier diesen Marchstein aus!' Der Knecht tut es. Wie er damit fertig ist, weist der Bründlige auf eine andere Stelle: 'Setz ihn hier.' Der Knecht gehorcht wortlos. Wie er auch damit fertig ist, sagt der Bründlige: 'Nun bin ich erlöst! Hättest du ein lautes Wort gesprochen, so wärest du jetzt tot, und ich müsste weiter wandeln, vielleicht noch hundert Jahre lang. Ich will dir danken in Ewigkeit; gib mir zum Abschied deine Hand.' — 'Die geb' ich dir nicht,' sagt der Knecht. — 'Warum nicht?' fragt der Bründlige. — 'Weil ich mir die Hand verbrennen könnte!' — 'So reiche mir den Hauenstiel!' Der Knecht gibt ihm statt der Hand den Hauenstiel und geht, indem er für den Bründligen noch fünf Vaterunser betet. Am Morgen sieht er, dass in den Hauenstiel fünf Finger eingebrannt sind."
Die Kinder ziehen ihre Füße an, und da der Bismark unter dem Ofen einen Schnauf tut, fahren sie zusammen.
Sie getrauen sich nicht allein ins Bett, und wie sie am Geisterstübli vorbeigehen, schaudern sie zusammen.
Bis um zehn Uhr hat man in der Stube eine große Pyramide Schnitze gerüstet.
Knechte und Ackerbub erheben sich gähnend, um die Strohbetten aufzusuchen.
Der Ackerbub hat ein mit Spreu gefülltes; denn er nässt noch ins Bett und kriegt deshalb oft das Znüni eingestellt und dafür Schläge.
„Thildi, wart noch!", ruft der Bauer seiner blonden Ältesten nach.
„Was gibt's?", näselt sie zurück.
„Wart noch, sag ich! Was war das für ein Mensch, der da gestern Abend ums Haus gestrichen ist?"
Da spielt ihr zuerst ein leises Rot um die Ohren, aber sofort ist sie gefasst und fragt mit namenlosem Erstaunen:
„Gestern Abend? Wie soll ich daaas wissen?"
„Du weißt es schon! Und ich weiß es auch: es war der Bieri Chlaus — der Entlebucher!"
„So, so! Hm, meinetwegen! Ich hab' ihn nicht bestellt!"
„Aber ich werde ihn gelegentlich abbestellen, und zwar mit einer Depesche aus Buchenholz!"
„Meinetwegen! Vielleicht bekommen dann beide ihr Teil!"
„Dafür lass mich sorgen und den Bismark!
Ich habe schon gesehen, dass du am letzten Sonntag nach der Kirche bei ihm gestanden bist. Wenn das noch einmal vorkommt, so geb' ich dir die Rute!"
„Dann lauf ich davon! Ich habe nichts mit ihm!"