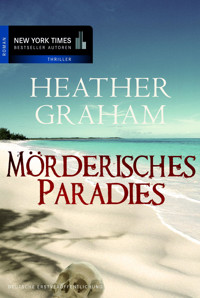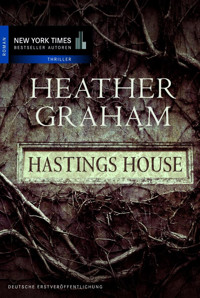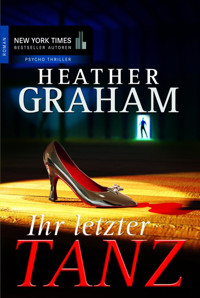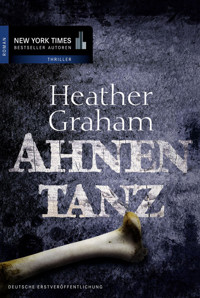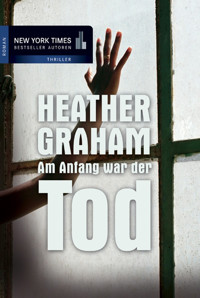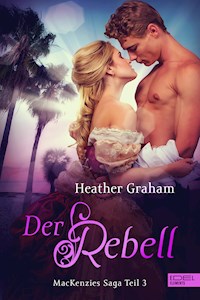5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irland und Frankreich im 9. Jahrhundert. Dänische Eroberer sind in die Heimat der Gräfin Melisande eingefallen. Bei ihrer Rückkehr nach Frankreich findet die schöne Aristokratin ihr Schloss in den Händen der dänischen Armee. Mit ihren violetten Augen und dem leuchtend schwarzen Harr ist sie eine Herausforderung für jeden Krieger. Aber nur einer kann ihr Herz erobern: der Wikinger Conar, der Herr der Wölfe ...
Weitere historische Liebesromane von Heather Graham bei beHEARTBEAT: "Die Gefangene des Wikingers" und "Die Normannenbraut".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
VORWORT DER AUTORIN
PROLOG DAS BLUT DES WOLFS
I DER KAMPF UM DIE GRÄFIN UND DAS LAND
1
2
3
II VORHER…
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
III DANACH – BELAGERUNG DER HERZEN
20
21
22
EPILOG
Über dieses Buch
Irland und Frankreich im 9. Jahrhundert. Dänische Eroberer sind in die Heimat der Gräfin Melisande eingefallen. Bei ihrer Rückkehr nach Frankreich findet die schöne Aristokratin ihr Stammschloß in den Händen der dänischen Armee. Mit ihren violetten Augen und dem leuchtend schwarzen Harr ist sie eine Herausforderung für jeden Krieger. Aber nur einer kann ihr Herz erobern: der Wikinger Conar, der Herr der Wölfe…
Über die Autorin
Heather Graham wurde 1953 im Dade County in Florida geboren. Ihre Reisen durch Afrika, Asien und Europa inspirierten sie dazu, Schriftstellerin zu werden. Ihr erster Roman wurde 1982 veröffentlicht, seitdem hat sie etwa 150 Romane geschrieben, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Heather Grahams Titel stehen regelmäßig auf den US-amerikanischen Bestsellerlisten.
Heather Graham
Der Herr Wölfe
Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Malsch
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1993 by Heather Graham.
Titel der Originalausgabe: Lord of the Wolves
Für die Deutsche Erstausgabe:
Copyright © 1994 by Wilhelm Heyne Verlag, Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Allies Interactive | Digiselector | Artem Furman | Oxana Gracheva
E-Book-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-3669-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
VORWORT DER AUTORIN
Schon immer liebte ich historische Romane, und meinen ersten schrieb ich nach der Lektüre eines Buchs über die Geschichte Irlands. Meine Mutter, die aus Dublin stammte, hatte es mir geschenkt. Darin fand ich faszinierende Informationen über den Wikingerprinzen Olaf den Weißen, der ins Reich des großen irischen Königs Aed Finnlaith eingedrungen war. Aed hielt den Angriffen stand. Während der Kämpfe führte er einen Waffenstillstand herbei, indem er seine Tochter mit Olaf vermählte.
In einem anderen Geschichtsbuch fand ich ebenfalls Hinweise auf jene Ereignisse, und meine Begeisterung wuchs. Mein Wikinger war geboren, heiratete seine irische Prinzessin, und so entstand mein erster historischer Roman »Die Normannenbraut«.
Ich genoss meine Forschungsarbeit, und ich wusste zu schätzen, was man im Rückblick so klar erkennen konnte – die Wikinger hatten tatsächlich die Meere beherrscht, weit und breit geraubt und geplündert, aber den eroberten Gebieten auch sehr viel gegeben. Letzten Endes fanden viele nordische Seefahrer in diesen Ländern eine neue Heimat. Und im Laufe der Jahre verschmolzen sie mit den Völkern, die sie einst gepeinigt hatten.
Olaf der Weiße kam mit seinen Wikingertruppen nach Irland. In England wurden sie von Alfred dem Großen bekämpft. Und so schenkte ich Olaf und seiner irischen Prinzessin einen Sohn, der in »The Viking’s Woman« an diesem Krieg teilnahm, auf Alfreds Seite! Danach wollte ich die Familie nicht verlassen, denn ich hatte Olaf lieb gewonnen, auch seine Frau und die zahlreichen Nachkommen, die das Erbe der wilden Seefahrer, aber auch der großartigen Zivilisation Irlands in sich trugen. In »Herr der Wölfe« wagt sich ein Sohn aufs Meer und schlägt seine Schlachten im Ärmelkanal. Es waren stürmische Zeiten. Viele Länder bekämpften einander, und die größten Herrscher suchten Bündnisse mit den Wikingern oder warben sie an, um mit ihnen gegen ihre Feinde vorzugehen. Ich hoffe, Melisande und Conar werden Sie in jene fast mythische Epoche zurückführen, wo die Welt grausam und schön zugleich war.
PROLOGDAS BLUT DES WOLFS
Die irische Küste, Schottland, a. d. 865
Wie erstarrt stand der große Junge da, die Seele von heißem Zorn erfüllt. Goldblond, viel stärker, als es seinen Jahren entsprach, hielt er den Windböen stand, die ihn peitschten, und schien sogar neue Kraft aus ihnen zu schöpfen. Die Mutter hatte sein Verhalten getadelt und ihm vorgeworfen, er führe sich auf wie ein Wikinger.
Nun, er war ein Wikinger.
»Schau aufs Meer, mein Sohn!« Der König umfasste die Schultern des Jungen. »Betrachte die weißen Schaumkronen und stell dir unsere Schiffe darauf vor. So viele stolze, starke Schiffe, die allen Stürmen da draußen trotzen können! Sieh die großen Drachen an den Bügen, mein Sohn, die gefletschten Zähne, die wilden Grimassen! Und bewundere das erlesene Schnitzwerk! Wir sind die Herren der Meere, das lässt sich nicht leugnen.«
Lächelnd blickte ihm der Junge in die Augen. »Wir sind Wikinger, Vater, und wir segeln immer noch in Wikingerschiffen.«
»Es sind die besten, was dir jedermann bestätigen kann. In dieser Welt werden wir oft angegriffen, wenn wir auch Bündnisse eingehen, und so brauchen wir starke Schiffe.«
Nachdenklich runzelte der König die Stirn. »Allerdings, wir sind Wikinger – oder in gewisser Weise Norweger und in anderer Dänen. Manchmal ist es unklug, deine Mutter daran zu erinnern, mein Sohn.«
Der Junge grinste. Ja, seine Mutter war mit jedem Zoll eine irische Prinzessin. Sie hatte ihre Kinder die großen Gesetze der irischen Gastfreundschaft gelehrt, die Brehon-Gesetze, die viel zur Zivilisation des Volkes beigetragen hatten. Und sie sorgte dafür, dass sie alle in Kunst und Geschichte unterrichtet wurden, in Sprachen und Religion. Aber er wusste nicht, ob die Wikingerherkunft seines Vaters sie wirklich so sehr störte. Mochte der König, ein großartiger Mann, auch in dieses Land eingedrungen sein – er hatte dafür gekämpft, zum Wohle des Volkes.
Nun hatte sie ihn zu seinem Vater geschickt. Er war in Schwierigkeiten geraten, denn Leith hatte ihm das neue Schwert weggenommen, eine prachtvolle Waffe, von seinem Großvater geschnitzt.
Leith bekam immer alles. Zumindest sah es so aus. Aber er war ja auch der älteste Sohn, der Erbe des Königs. Eines Tages würde er hier herrschen, in diesem reichen, schönen grünen Land, das sie alle so liebten. Das wusste Conar, und er verstand es. Er liebte seinen Bruder sogar, der zum Nachfolger des Königs ausgebildet wurde, älter, klüger und würdevoll war – und wie die Mutter sehr nachdenklich und sanftmütig. Aber heute hatte er versucht, ihm das Schwert zu entreißen und einen Wutausbruch entfacht.
Was am allerschlimmsten war, der Zwischenfall hatte sich in der Kapelle während des Gottesdienstes ereignet. Die Mutter umfasste Conars Hand und führte ihn hinaus ins Freie, die smaragdgrünen Augen voller Zorn.
»Leith wollte mir das Schwert wegnehmen!«, erklärte er, das Kinn trotzig hochgereckt. Natürlich hätte er Reue zeigen müssen. Er liebte seine Mutter innig, und es bedrückte ihn, wann immer er sie enttäuschte. Doch er würde nicht klein beigeben. »Das Land gehört ihm! Dubhlain gehört ihm!« Hoch schwenkte er das kleine hölzerne Schwert in die Luft, nachdem er es vor dem Zugriff des Bruders gerettet hatte. »Und ich werde seine Rechte gegen jeden Eindringling verteidigen, auch wenn es mich mein Leben kostet!«, schwor er leidenschaftlich. »Aber dieses Schwert, Mutter, gehört mir!«
Wie selbstsicher, stolz und entschlossen er ist, dachte die Königin. Schmerzlich krampfte sich ihr Herz zusammen, denn trotz seiner Jugend erkannte sie plötzlich, wie sehr er seinem Vater glich. Stets würde er seine Brüder und Schwestern und sein Heimatland lieben und ehren. Aber das genügte ihm nicht. Er würde sich nach anderen Dingen sehnen und dafür kämpfen. Sie biss sich auf die Lippen.
O ja, er trat in die Fußstapfen des großen Wolfs von Norwegen, so wie einige ihrer Söhne, doch keiner ähnelte ihm so stark wie Conar. Er besaß goldblondes Haar, hochgeschwungene Brauen, und schon in jungen Jahren ein markantes Gesicht.
Auch das kalte nordische Blau seiner Augen hatte er vom Vater geerbt. Sein Blick konnte jeden Betrachter fesseln. Er hielt sich kerzengerade, bereits fast so groß wie die Mutter, breitschultrig, mit ausgeprägten Muskeln. Und er hatte oft genug bewiesen, wie eisern er seinen Willen durchzusetzen verstand.
Wieder hob er das hölzerne Schwert, das er so energisch zurückerobert hatte. »Ich bin ein jüngerer Sohn, Mutter«, fügte er ungeduldig hinzu. »Trotzdem lasse ich mir nicht alles wegnehmen!«
»Du bist der jüngere Sohn eines Königs, der in der ganzen zivilisierten Welt wohlbekannt ist«, erinnerte sie ihn. »Und ...«
»Dieser Welt werde ich meinen eigenen Stempel aufdrücken!«, unterbrach er sie.
Erbost schüttelte sie den Kopf. »Heute benimmst du dich einfach schauderhaft! Wie ein Wikinger!«
»Mein Vater ist ein Wikinger, Mutter.«
Sie seufzte tief auf und versuchte, ihr Temperament zu zügeln. Schon einmal hatte sie es nur mühsam bändigen können. Musste sie zum zweiten Mal eine so schwere Prüfung bestehen? »Ein sehr irischer Wikinger, mein Sohn. Gezähmt vom Land, gezähmt von ...«
»Von dir?«, fragte er spitzbübisch.
Sie zog die Brauen hoch, dann lachte sie. »Nein, das bezweifle ich. Und wage bloß nicht, so etwas zu sagen! Er ist ein Wikinger, aber zivilisiert. Er liest sehr viel, denkt über alles nach, und er ist bereit zu lernen, was man über die Eigenheiten eines Volkes wissen sollte.«
»Trotzdem wird er stets ein Wikinger bleiben.«
»Schön und gut, mein junger Herr Wolf. Dein Wikingervater ist zu den Klippen gewandert, also geh mit deiner Klage zu ihm!« Als er die Schultern straffte, von neuem Zorn erfasst, und sich abwandte, rief sie ihm nach: »Mein Sohn!« Da drehte er sich um, und sie beteuerte mit sanfter Stimme: »Ich liebe dich.«
Seine Wut ließ nach, und er erwiderte ihr Lächeln. Dann war er durch das Burgtor gelaufen, über die grünen Wiesen zu den hoch aufragenden Klippen, wo er seinen Vater antraf.
Da stand der große Krieger, seinen gestiefelten Fuß auf zerklüftete Felsen gestützt, und starrte über das Meer hinweg.
»Vermisst du die Seefahrt, Vater?«
Der König musterte ihn gedankenverloren. »Niemals, mein Sohn, denn ich habe meinen Platz im Leben gefunden.« Er holte tief Luft. »Man beschuldigt uns Wikinger vieler Untaten, und einige haben wir tatsächlich begangen. Aber ich kam nicht hierher, um dieses Land zu verwüsten. Sicher, ich nahm es in Besitz, aber nur, um etwas Neues aufzubauen. Ich gab ihm Kraft, und mir gab es ...«
»Ja, Vater?«
»Schönheit und Frieden. Diesen Ort nenne ich mein Zuhause, und er schenkte mir vor allem deine Mutter.«
Der Junge lächelte. Er stand neben seinem Vater, einen Fuß im Rehlederstiefel ebenfalls auf den Fels gestellt. Die Arme vor der Brust verschränkt, ließ er seinen Blick über das Meer schweifen. Es faszinierte ihn, ebenso wie die Sagen von den Göttern seines Vaters, den großen Kriegern, die in Walhall tafelten, vom zornigen Odin, der auf seinem achtbeinigen Pferd am Himmel dahinsprengte.
»Es kann wundervoll sein, das Meer zu erkunden«, bemerkte sein Vater leise, »etwas Neues zu suchen, das Schwert zu schwingen, seinen rechtmäßigen Platz zu finden.«
Conar begegnete den Augen des Königs. »O ja, ich werde über die Meere segeln!«, gelobte er leidenschaftlich, warf den blonden Kopf in den Nacken und zeigte mit seinem Holzschwert zum Reich der Götter empor, die das Volk seines Vaters verehrte, zu Odin und Thor, zu Sturm, Donner und Blitz. Sein Umhang flatterte im Wind. Die Augen geschlossen, sog er die salzige Luft tief in seine Lungen. »Ich werde über das Meer segeln«, wiederholte er in sanfterem Ton. »Und ich werde meinen rechtmäßigen Platz auf dieser Erde finden und dort herrschen. Ich werde das Gesetz sein und den Menschen Frieden bringen. Auf den Thron von Dubhlain kann ich meinem Vater nicht folgen, aber ich will stets beweisen, dass ich sein Sohn bin. Man wird mich den ›Herrn der Wölfe‹ nennen. So wie den großen Wolf von Norwegen. Glaub mir, Vater, ich werde für das Recht kämpfen ...«
»Und für das, was dir gehört?« Belustigt fiel ihm der König ins Wort, doch er bezweifelte nicht, dass der Junge seine Ziele erreichen würde.
»Und für das, was mir gehört! Immer! Wenn man ein Land besitzen will, muss man dafür kämpfen, nicht wahr?«
»Das stimmt, mein Sohn«, bestätigte der König lächelnd. »Und man kann es auch durch eine Heirat gewinnen.«
»Also heiraten oder kämpfen ...« Nachdenklich runzelte Conar die Stirn.
Sein Vater lachte. »Und manchmal ist das ein und dasselbe.«
Der blonde Junge schaute wieder aufs Meer. »Ich werde meinen rechtmäßigen Platz erringen, so hart ich auch darum kämpfen muss – gegen andere Männer oder gegen meine Frau.«
Ein Blitz zerriss den Himmel, und der König blickte nach oben. Mergwin würde dies ein Omen nennen, dachte er. Ein sonderbares Gefühl ergriff ihn – kein Unbehagen, aber irgendetwas, das ihn warnte. Ohne sich umzudrehen, wusste er, dass der alte Mann hinter ihm stand, den Jungen beobachtete und dann den Himmel.
Der König seufzte. »Also gut, Zauberer, was wollt Ihr mir sagen?«
Gekränkt wandte sich Mergwin zum König. Sein langes, weißes Haar und der Bart wehten in der frischen Brise. »Ich bin kein Zauberer, Olaf von Norwegen.«
»Ja, ich weiß, Ihr seid ein Druide und Runenmeister«, entgegnete Olaf müde. Der Junge schenkte dem Greis ein Lächeln, dann starrte er wieder auf die wild bewegten Wellen.
»Verspottet Ihr mich?«, fragte Mergwin. »Nach all den Jahren, König von Dubhlain?«
»Dann sprecht!«, forderte Olaf ihn auf. »Einmal habt Ihr prophezeit, Leith würde ein langes, glückliches Leben führen und weise herrschen. Bei Erics Geburt saht Ihr heftige Stürme voraus. Und was sagt Ihr über Conar?«
»Ich weiß nicht recht, mein Herr ... Was soll ich tun? Ein Lamm schlachten und zu den alten Göttern beten? Aber wie dieser Junge bin ich ein halber Ire und ein halber Norweger. Heute erblicke ich den Norweger in ihm. Schließt die Augen, großer König, stellt Euch den künftigen Mann vor!«
Dazu brauchte Olaf die Augen nicht zu schließen. Deutlich genug sah er seinen Sohn als Mann vor sich, hochgewachsen und majestätisch, goldblond, voll sehniger Kraft, ein Krieger, der allen Feinden trotzen würde, Göttern oder Menschen.
»Ja, mein Herr, dieser Sohn wird auch auf Reisen gehen«, weissagte Mergwin leise. »Er wird mächtig sein, stark und klug und segeln ...«
»Wohin?«, fragte der König.
Der Druide zögerte und runzelte die Stirn.
»Seine Fahrt wird ihn nach Süden, über die Meeresenge führen, und wenn er findet, was er gesucht hat, wird er es sofort beanspruchen.«
»Und dann?«
»Dann wird er kämpfen müssen, um es zu behalten. Das Land und sie! Es wird nicht einfach sein. Riesige Horden werden sich ihm in den Weg stellen und Schlachten entfesseln, wie man sie noch nie erlebt hat.«
»Sie? Mergwin, wer ist sie?«
Der alte Mann zuckte die Achseln und betrachtete den Jungen, der so stolz und hoch aufgerichtet dastand, die blauen Augen auf die See gerichtet. Seufzend wandte er sich wieder an den König von Dubhlain. »Kein Opferlamm nach alter Druidenart, nicht wahr, mein Herr? Nein, nein, das wäre falsch.« Er umklammerte einen Beutel, der am Gürtel seiner Robe hing, und schüttelte ihn leicht. »Bedenkt, mein König, dass ich so bin wie dieser Sohn, teils Wikinger, teils Ire, und deshalb erfüllt mich so große Kraft. Also muss ich für einen Wikingerjungen die Wikingerrunen lesen.«
Ein Wikinger! Olaf senkte die Lider. Plötzlich wusste er, dass Conar wie ein echter Wikinger die Meere überqueren und ferne Gestade ansteuern würde. Und dort würde er eine Frau finden, bekämpfen und heiraten, und beider Leben aufs Spiel setzen, immer wieder ...
Er hatte sich für seine Söhne Ruhe und Frieden gewünscht. Aber sie lebten nicht in einer friedlichen Welt. Als er den Jungen anschaute, sah er sich selbst und erkannte, dass er ihn ziehen lassen musste, sosehr ihn das auch bekümmern mochte.
Mergwin bückte sich, öffnete den Beutel und verstreute die kunstvoll geschnitzten hölzernen Runen auf dem Felsboden. Der Wind heulte, wieder zuckten Blitze am Himmel. »In der Tat«, verkündete der Druide leise, »wie sein Vater wird er Herr der Wölfe heißen.« Er sah, wie der König seinen Sohn anstarrte und dann die Symbole auf den kleinen hölzernen Quadraten betrachtete und fügte lächelnd hinzu: »Das Wetterleuchten hat es bestimmt, so als hätte Odin selbst die Worte an den Himmel geschrieben.«
»Hm ...« Olaf verschränkte die Arme vor der Brust. »Und sagt mir bitte, alter Mann, was hat Odin sonst noch an den Himmel geschrieben? Wohin wird er segeln? Wer ist diese Frau?«
»Geduld, mein Herr, Geduld!« Boshaft grinste Mergwin und warf einen kurzen Blick auf den hochgewachsenen Jungen, der auf den Klippen stand. »Lasst uns die Runen lesen, Wolf von Norwegen. Auf Wikingerart – für einen Wikingerprinzen ...«
»Und die Frau?«, fragte der Wolf.
»Ja, die Frau. Sie ist sehr schön ...«
»Aber gefährlich?«
»Wie ein Gewittersturm!«, stimmte Mergwin belustigt zu, dann erlosch das Lächeln in seinen Augen, seine Stimme nahm einen ernsten, nachdenklichen Klang an. »O ja, wilde Stürme werden toben, Feinde erheben sich zu Tausenden, und um ihnen allen zu trotzen, muss das Paar einen besonderen Sieg erringen ...«
»Über wen?«
Mergwin strich über seinen Bart. »Ich glaube, über sich selbst.«
»Lest weiter!«, befahl der König. Und so wurde an der zerklüfteten, windgepeitschten Küste die Zukunft prophezeit ...
IDER KAMPF UM DIE GRÄFIN UND DAS LAND
1
An der französischen Küste, Frühling, a. d. 885
»Melisande! Melisande! Seine Schiffe sind hier!«
Rastlos war sie umhergeeilt. Aber bei diesen Worten blieb sie wie erstarrt inmitten des Turmzimmers stehen, von widersprüchlichen Gefühlen erfasst. Angst und Freude kämpften in ihr. Sie hatte nicht geglaubt, dass er kommen würde. Aber Marie de Tresse, die jenseits der offenen Tür an der hölzernen Brustwehr stand, zerstreute alle Zweifel. Er hielt sein Versprechen, dass er sich holen würde, was ihm gebührte.
Melisande warf das kunstvoll gewirkte Kettenhemd, das sie prüfend betrachtet hatte, zu Boden und stürmte hinaus. Sie warf nur einen kurzen Blick in Maries angstvolles Gesicht, dann beugte sie sich über die Brüstung und blickte aufs Meer hinaus.
Ja, tatsächlich, er segelte heran. An einem solchen Tag war er zum ersten Mal hierhergekommen. Vor einer halben Ewigkeit! Suchte er sie nur immer in so furchtbaren Zeiten auf? Wollte er ihr helfen oder sie völlig vernichten?
Mit diesen Fragen wollte sie sich heute nicht belasten. Er ist gekommen, um sich zu nehmen, was er für sein Eigentum hält. Plötzlich wurde ihr heiß und kalt zugleich. Sie berührte ihr Gesicht, das sich wie Feuer anfühlte – und die Hand wie Eis. O Gott, er kam zu ihr ...
Ein heftiges Zittern durchströmte ihren Körper. Als würde es nicht schon genügen, dass tausend Dänen unter dem Befehl des verhassten Geoffrey vor ihrer Tür lauerten. Nein, nun musste auch noch er hier herfahren. Nach so langer Zeit. Aber vielleicht hatte er vieles vergessen.
Und vielleicht erinnerte er sich an alles.
Wie lächerlich! Vor den Dänen graute ihr längst nicht so wie vor ihm! Und warum? Wegen der Dinge, die sie getan hatte – die ihn hierher führten. Bald würde er an Land gehen. Sie erkannte bereits sein Schiff und sah seine Gestalt.
Es war ein außergewöhnliches Schiff mit riesigem Drachenbug. Er stand an Deck in derselben stolzen Haltung wie bei der ersten Begegnung – einen Fuß gegen das Ruder gestemmt, die kraftvollen Arme vor der muskulösen Brust verschränkt. Ein purpurroter Mantel, an der Schulter von einer Spange zusammengehalten, die ein altes keltisches Emblem zeigte, flatterte hinter ihm. Und der Meereswind peitschte durch sein dichtes Haar, golden wie die Sonne.
Seine Augen sah sie noch nicht, doch das war auch gar nicht nötig. Nur zu gut entsann sie sich dieser erstaunlichen Farbe. Ein strahlendes Blau. Himmelblau, meeresblau, intensiver als Kobalt, heller als Saphire. Diese Augen konnten durch sie hindurchschauen, bis in die Tiefen ihrer Seele.
Hastig drehte sie sich um, als sie die tiefe spöttische Stimme hörte. Ragwald stand hinter ihr, alt wie der Mond, nörglerisch wie ein Fischweib. Mahnend hob er einen Finger. »Meine Dame, einen Pakt mit einem solchen Mann könnt Ihr nicht missachten!«
»Ich habe keinen Pakt mit ihm geschlossen. Das habt Ihr getan.«
»Um unser Leben zu retten!«, erinnerte er sie würdevoll. »Und es sieht so aus, als würdet Ihr den Mann wieder brauchen. Andererseits ist der junge Herr vielleicht wütend und nicht in der Stimmung, Euch beizustehen, eh?«
»Ragwald, Ihr ...«, begann Melisande und wollte ihm erklären, er sei der Ratgeber und sie die Gräfin, und deshalb stehe es ihr zu, das letzte Wort zu sprechen. Doch sie verstummte und biss sich auf die Unterlippe. Eine andere Gefahr drohte ihr noch unmittelbarer. Als sie von ihrem Aussichtspunkt oberhalb der Festungsmauer hinabblickte, sah sie ihre Männer bereits im Kampfgetümmel.
Seltsam, wie sich manche Dinge entwickelten ... Das Heer, das sie jetzt bekämpften, hatten sie sich an jenem Tag zum Feind gemacht, als er zum ersten Mal hierhergekommen war. Und jetzt tobte die Schlacht erneut, während seine Schiffe über das Meer segelten.
Sonderbar, dass es ein grauer Tag voller flammender Blitze und grollendem Donner war – neigte er dazu, in Begleitung solcher Stürme einzutreffen, als gehörte er zu jenen Göttern, die ihren Zorn in Gestalt feuriger Blitze umherschleuderten?
»Was wird geschehen?«, fragte Ragwald nachdenklich. »Ist er hier, um uns zu vernichten – oder wieder zu retten? Ein norwegischer Wikinger, der sich auf diese dänischen Wikinger stürzen wird?«
Warum leben wir in einem so gesetzlosen Land, überlegte Melisande wehmütig. Wie gern hatte sie die Geschichten ihres Vaters über den großen König Charlemagne gehört, über dessen Liebe zu den Künsten, zur Astrologie, zum Frieden!
Aber Charlemagne war tot wie ihr Vater. Seine Regentschaft lag schon fast hundert Jahre zurück, und seither hatte sich vieles verändert. Jetzt herrschte Charles der Dicke in Paris – doch dort hielt er sich nicht auf, sondern irgendwo in Italien, und die Dänen verwüsteten die Küste, auf dem Weg nach Rouen.
Wieder einmal hatten sich Melisandes Feinde mit den Dänen verbündet, um zu erobern, was rechtmäßig ihr gehörte.
Schon früher war sie gezwungen worden, sich mit diesen Horden auseinanderzusetzen. Nach dem Tod ihres Vaters vor einigen Jahren hatte sie gelernt, ihre Tränen zu unterdrücken, wenn sie einen Mann durch das Schwert sterben sah. Sie hatte gelernt, vor dem Kriegsgeschrei nicht zu erzittern, und – was ihr am schwersten fiel – nicht davonzulaufen. Nur sie allein war übrig geblieben, um ihr Volk zu lenken und zu leiten. Auch das hatte sie gelernt. Nicht, dass er das jemals gewusst hätte. Aber seit jener ersten Begegnung war so viel Zeit verstrichen, so vieles geschehen, was ihn vermutlich drängte, seine kräftigen Hände um ihren Hals zu legen. Beinahe glaubte Melisande, sie zu spüren.
Dieser Gedanke ließ sie frösteln, und eine eigenartige Schwäche erfasste sie. Sie hatte gelobt, nichts von ihm zu wollen. Trotzdem brauchte sie nur an ihn zu denken, und schon stockte ihr der Atem.
Genau das war ihre Schwierigkeit! Denn sie wagte nicht, ihm zu zeigen, wie es in ihrem Herzen aussah. Niemals durfte er erfahren, dass die Gedanken an ihn ihre Tage ausfüllten.
Vor allem jetzt konnte sie sich keine Schwäche erlauben. Sie musste sich sogar verbieten, an sich selbst zu denken, seine Berührung zu fürchten, zu verabscheuen, herbeizusehnen, ihn zu hassen, zu lieben, zu verachten, von ihm zu träumen ...
Plötzlich erkannte sie, in welch ernsthafte Schwierigkeiten ihre Männer gerieten. Von der Brustwehr aus sah sie die wechselnden Positionen der Krieger, ahnte bereits die Niederlage, die ihnen noch nicht bewusst war. »Heiliger Jesus!«, rief sie. »Ich muss da hinaus, sofort, Ragwald! Unsere Streitkräfte werden auseinandergetrieben. Schaut doch!«
Bestürzt hielt er ihren Arm fest. »Nein! Lasst den Wikinger angreifen! Eine der beiden Seiten wird siegen, die Dänen oder die Norweger. Das sollen sie unter sich ausmachen. Ihr bleibt diesmal hier, in Sicherheit!«
Sie riss sich los, zunächst ärgerlich, dann voll tiefer Sorge. Ragwald liebte sie. Und in diesen dunklen Tagen fand man nur selten Liebe. »Muss ich Euch daran erinnern, mein lieber Ratgeber? Ihr wart es, der mich zuerst da hinausgeschickt hat, in einer Rüstung. Ich bin die Gräfin, und ich werde hier die Stellung halten. In einem Punkt habt Ihr Recht, sie sollen die Schlacht unter sich austragen. Aber ich muss unsere Männer aus der Falle führen, die sie zu verschlingen droht.«
»Wartet!«, rief Ragwald. »Seht doch, die Schiffe legen an!«
»Ich kann nicht warten. Schaut, Ragwald!« Sie zog ihn zum Rand der Brustwehr und zeigte zur Küste hinab.
Ihr Vater hatte eine außergewöhnliche Festung mit dicken Außenmauern erbaut, wie man sie seit den Angriffen der Wikinger bevorzugte. Melisandes Schloss lag auf einem Berggipfel, oberhalb eines sicheren Hafens. Die meisten anderen Burgen bestanden aus Holz, aber ihr Vater hatte die großen Vorteile von Steinen erkannt. Sie fingen kein Feuer. Innerhalb der hohen Wälle fühlte man sich geschützt. Ein großer Hof bot Menschen und Tieren Platz, den Schmieden, den Ställen für die großen Streitrösser, den Werkstätten und Küchenräumen.
Zu beiden Seiten der Festung erhoben sich bewaldete Klippen, und die Brustwehr bot eine unbegrenzte Aussicht. Allein durch die günstige Lage konnte die Burg auch dann dem Feind standhalten, wenn nur wenige Krieger zurückblieben, um sie zu verteidigen. Auch jetzt wusste Melisande, den weit reichenden Ausblick zu nutzen. »Seht doch, Ragwald, da sind Philippe und Gaston! Ihre Truppen werden auseinandergesprengt, und in der Hitze des Gefechts merken sie es gar nicht. Ich muss gehen.«
»Nein, Melisande!«, widersprach Ragwald. Als sie an ihm vorbeilaufen wollte, umklammerte er wieder ihren Arm. Sie schaute ihm in die Augen, und zum ersten Mal sah er Angst darin flackern.
Angst? Melisande fürchtete nichts und niemanden. Nur den Wikinger, dachte er. Schon immer. Er erzürnt und fasziniert sie gleichermaßen. Vielleicht ist sie jetzt vernünftig genug, ihn zu fürchten – und zu beten, er möge gekommen sein, um sie zu schützen. Obwohl sie ihm in jeder Hinsicht getrotzt hatte. Und jetzt will sie das Schwert ergreifen und in die Schlacht reiten ...
»Tut das nicht!«, warnte er sie und hielt sie fest.
»Ich muss!« Ihre Stimme klang heiser und voller Verzweiflung. Ihre Augen spiegelten heftige, widerstreitende Gefühle wider.
»Nein ...«, begann er, doch da hatte sie seine Hand bereits abgeschüttelt, rannte die Brustwehr entlang und in den Turm. »Melisande!« Das Echo ihres Namens wehte zu Ragwald zurück wie ein lang gezogener Klageschrei.
Sie hörte nicht auf ihn. Unglücklich ging er an der Brustwehr auf und ab, am höchsten Punkt der Festung. Er schaute in den Hof hinab, zu den Außenmauern, den Wiesen jenseits der Tore, über das Meer hinweg.
Wenig später entdeckte er Melisande, und sein altes Herz schlug ihm bis zum Hals hinauf. Sie saß auf ihrem Streitross Warrior, in ihrer vergoldeten Rüstung, die er vor so vielen Jahren zum ersten Mal gesehen hatte, als sie in den Krieg gezogen war.
Ragwalds Blick wanderte zu den Wikingerschiffen, die am Strand lagen. Er beobachtete, wie der Anführer seinen kegelförmigen Kriegshelm aufsetzte. Pferde wurden von Bord geführt, darunter der majestätische Thor, ein riesengroßer Hengst, muskulös, behände und geschmeidig wie sein Herr.
Der Wikinger benötigte keine Erklärungen. Seine Männer standen bereit, um sich in den Nahkampf an der Küste zu stürzen oder sich auf die Rücken ihrer Wikingerpferde zu schwingen, die schon so viele gefährliche Seereisen überlebt hatten.
Ohne Zögern eilten sie ins Kampfgetümmel ebenso wie Melisande. Die zitternden Finger um die Brustwehr geklammert, beobachtete Ragwald, wie sie in einiger Entfernung von den Neuankömmlingen ihr Schwert hochschwang und ihren Streitkräften bedeutete, sich neu zu formieren. Die Dänen, im Verein mit den verräterischen fränkischen Verbündeten, waren in der Überzahl. Tausend Angreifern standen vielleicht zweihundert Verteidiger gegenüber.
Und wie Ragwald gehört hatte, sollten noch mehr eintreffen. Viele tausend. Einem Gerücht zufolge wollten sie Paris belagern.
Aber jetzt konnten sie sich nicht um die Hauptstadt kümmern. Melisande hatte ihre Truppen um sich versammelt, und er hörte ihre durchdringende Stimme. Sie befahl ihnen, den Rückzug hinter die Festungsmauern anzutreten. Dann gab sie den Wachtposten im Inneren der Burg ein Zeichen. Große Kessel mit siedendem Öl wurden herangeschleppt, um sich auf die Eindringlinge zu ergießen, sollten sie den heimischen Kriegern folgen.
Das Tor öffnete sich. Angeführt von Melisande, stürmten die Verteidiger hindurch.
»Greift an!«, schrie Philippe zu den Männern hinauf, die auf der Außenmauer standen.
Ragwald schloss die Augen, hörte wilde Schmerzensschreie. Die ersten Angreifer wurden vom kochendheißen Öl, das auf sie herabfloss, zurückgeworfen.
Als er die Lider wieder hob, sah er Melisande hoch aufgerichtet auf Warrior sitzen. Sie war in den Hof geritten, umringt von ihren Männern. Wie sie diese Schlachten hasst, dachte er bekümmert. Sie verabscheut den Krieg seit dem Tag, an dem ihr Vater starb. Seither liebt sie den Frieden. Und wenn sie eine Niederlage erleidet?
Nun, was geschehen würde, wenn die Dänen siegten, verstand sich von selbst. Sie würden rauben und plündern, morden und vergewaltigen.
Geoffrey würde sich die Festung und das Land aneignen, sobald seine Verbündeten dachten, sie hätten ihren Teil der Beute erhalten. Ein schlimmes Schicksal würde auf Melisande warten.
Und wenn der Wikinger den Sieg errang? Dann würde sie ihr Los ebenso fürchten, aber ihr Volk würde weiterleben und die Burg stehen bleiben.
Was immer auch auf Melisande zukommen mochte, ihre Leute würden es begrüßen, wenn der Wikinger die Dänen schlug. Es gäbe keinen Raub, keine Plünderung, keine Vergewaltigung, keinen Mord. Das wusste Melisande, und sie würde ihr Schicksal hinnehmen, ohne Rücksicht auf die Folgen, die sie persönlich betrafen.
»Gebt uns Gräfin Melisande!« Der Schrei erklang außerhalb der Mauern. »Dann wird Frieden herrschen!«
Ragwald schaute von der Brustwehr des Turms hinab und konnte deutlich erkennen, was geschah. Geoffrey selbst hatte die Forderung gestellt. Er war Melisande nachgeritten, doch nun schreckte er vor den Wachtposten zurück, die auf den Außenmauern standen und ihn mit ihrem tödlichen siedenden Öl bedrohten. Er saß auf seinem Streitross, das Gesicht vor Wut verzerrt. Vor ihm drängten Melisandes Männer durch das Tor. Bald würde seine Verstärkung eintreffen und die Verteidigung vor neue, noch schwierigere Aufgaben stellen. Einige Feinde würden fallen, andere den Durchbruch schaffen.
Nur zwanzig Schritte trennten Melisande von ihren Gegnern, aber auch der dicke steinerne Wall. Noch war das Tor nicht verschlossen und verriegelt. Und das siedende Öl würde die Dänen nicht mehr lange fernhalten – nicht, wenn ein so kostbarer Preis in ihrer Reichweite lag.
»Das war Geoffreys Stimme!« Philippe zügelte sein Pferd neben Melisande. »Der verdammte Bastard! Er verlangt dasselbe wie zuvor sein Vater.«
Im Gegensatz zu Ragwald konnte Melisande die Truppen jenseits der Mauern nicht sehen. Aber das Geschrei und die Hufschläge der ungeduldigen Streitrösser hörte sie deutlich genug. Immer mehr Feinde versammelten sich vor den Wällen, bald würden sie das Tor stürmen, in unbezwingbarer Vielzahl.
»Die Mauern werden fallen!«, drohte Geoffrey. »Alle Männer da drinnen müssen sterben! Melisande, ihr könnt uns nicht standhalten! Ihr seid in der Minderzahl!«
»Das war ich!«, rief sie zurück. »Jetzt nicht mehr!«
»Ja, der Wikinger ist im Anmarsch. Aber kann er euch rechtzeitig retten? Einige deiner Männer habe ich hier draußen in meiner Gewalt, Melisande! Die nahmen wir fest, als sie zu fliehen versuchten. Wenn das heiße Öl uns versengt, wird es auch deine Leute treffen. Und soeben berührt ein Dolch den Hals eines deiner Krieger!«
Melisande schaute zu Ragwald hinauf, der hoch oben auf der Brustwehr des Turms stand und Geoffrey beobachtete. Neben dem feindlichen Anführer umklammerte ein Däne den Arm eines Gefangenen und drückte ihm eine scharfe Klinge an die Kehle. Der alte Mann erwiderte Melisandes Blick und las in ihren Augen, dass sie die Wahrheit wissen wollte. Da nickte er.
Rasch wandte sie sich zu Philippe. »Ich muss hinaus. Mir bleibt nichts anderes übrig ...«
»Viele Männer fallen in der Schlacht, Herrin. Nur um das Schicksal eines einzigen Kriegers willen ...«
»Philippe! Wenn der Feind vorrückt, werden wir noch viel mehr Männer verlieren. Deshalb muss ich hinausreiten und mich ausliefern ...«
»Nein!«, schrie Philippe.
Entschlossen lenkte sie ihr Pferd zum Tor. Sie verabscheute und hasste Geoffrey mehr als sonst jemanden auf der Welt. Bei dem Gedanken, sich einem so verachtenswerten Feind auszusetzen, krampfte sich ihr Herz zusammen.
Sein Vater hatte ihren getötet, um die Festung einzunehmen. Plötzlich überkam sie ein großes Unbehagen. Nein, sie konnte nicht zu Geoffrey reiten. Auf keinen Fall. Der Wikinger wartete dort draußen, und wenn er jemals erfuhr, dass sie sich freiwillig in die Hände des Feindes begeben hatte, ganz gleichgültig unter welchen Umständen ... Sie musste Zeit gewinnen.
Und so zügelte sie Warrior, blickte wieder zu Ragwald hinauf, zu den Wachtposten auf den Außenmauern. Die meisten standen in grimmiger Bereitschaft neben den Ölkesseln, doch die besten Bogenschützen zückten ihre Waffen. Melisande zog den Blick einer dieser Männer auf sich. »Könnt Ihr den Feind treffen, der einen unserer Krieger bedroht?«
»O ja, Herrin!«
Sie nickte. »Dann tut Euer Bestes.« Nun wandte sie sich zu einem ihrer Hauptmänner, die an der Brustwehr standen. »Sobald unser Mann frei ist, lasst das Tor öffnen und bedeutet unseren Leuten da draußen, möglichst schnell hereinzukommen – selbst wenn sie einige Feinde mit sich ziehen. Dann lasst das Tor sofort wieder schließen! Beeilt Euch!«
Der Bogenschütze legte einen Pfeil an und zielte. Gleichzeitig hörte sie den Schrei des Hauptmanns. »Herein mit euch, Männer!« Das Tor schwang auf, ein wildes Kampfgetümmel drängte herein.
»Schließt das Tor!«, befahl sie.
»Melisande!«, rief Ragwald vom Turm herab. »Haltet ihnen stand! Jetzt sind seine Krieger auf unserer Seite!«
Und dann vernahm sie einen erstaunten, wütenden Ruf. Geoffreys Stimme, dachte sie voller Genugtuung. Der Wikinger hatte ihren Feind erreicht ...
Schwerter klirrten, und sie erkannte das grausige Geräusch von Stahl, der sich durch Kettenhemden bohrte.
»Nein, Melisande!«, rief Ragwald. Auf seinem Beobachtungsposten sah er, was ihr entging. Ja, der Wikinger war gekommen, und Geoffrey trat den Rückzug an. Hastig entfernte er sich vom Schlachtfeld, ließ seine Männer und zahlreiche Dänen zurück, die den Kampf fortsetzten.
Der Wikinger hatte sein Heer geteilt. Eine Hälfte stürmte vor, um Melisandes Kriegern beizustehen, die andere kämpfte im Hintergrund. Zahlenmäßig war die erste Schar den Dänen nicht gewachsen. Er hatte beabsichtigt, die Festungswache zu verstärken, die Schlacht innerhalb der Mauern weiterzuführen.
Doch Melisande hatte das Tor verschlossen, sie sperrte seine Männer aus.
»Allmächtiger, hilf uns!«, betete Ragwald und warf einen kurzen Blick zum Himmel hinauf, dann beobachtete er wieder den Kampf. Vielleicht konnte er noch auf Rettung hoffen, denn jetzt sah er den Krieger, der ihnen zu Hilfe eilte.
Man nannte ihn den Herrn der Wölfe, ebenso wie seinen Vater zuvor. Jetzt wusste Ragwald, warum. Obwohl der Mann scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten gegenüberstand, zeigte er unglaubliche Fähigkeiten und bewundernswerten Mut. Sein Schwert schnellte von einer Seite zur anderen, während er mitten ins Getümmel ritt. Er streckte die Feinde nieder, noch ehe sie erkannten, wovon sie getroffen wurden. Die Dänen stießen Berserkerschreie aus, und manche griffen ihn an mit Schaum vor dem Mund. Aber einer nach dem anderen fiel, von seiner unbesiegbaren Kraft geschlagen. Immer mehr Männer traten ihm in den Weg. Er rief etwas, was Ragwald nicht verstand, doch dann sah der alte Mann, wie der Befehl ausgeführt wurde. Während die meisten Wikinger weiterkämpften, stürmten einige mit einem Rammbock auf das Tor zu, das ihnen den Zugang zum Hof versperrte.
»Melisande!«, schrie Ragwald, aber der Schlachtenlärm übertönte seine Stimme. Auch die Gräfin erteilte ihre Befehle. Rasch wandte er sich von der Brustwehr ab und lief die Turmtreppe hinunter, in die große Halle. Draußen im Hof brachten sich Männer, Frauen und Kinder, Kühe, Enten und Schweine in Sicherheit und flüchteten zu den hinteren Mauern. Mütter packten ihre Kinder, Bauern versuchten, ihr kostbares Vieh zu schützen. Ein Esel wieherte, Hühner gackerten und flatterten ziellos umher.
In seinen alten, weiten grauen Umhang gehüllt, wirkte Ragwald wie ein großer, gespenstischer Vogel, als er zu Melisande und ihren Kriegern eilte. Sie stiegen gerade von den Pferden, um die Mauern zu bemannen. »Er ist da!«, rief der alte Mann. »Jetzt will er die Festung mit einem Rammbock stürmen! Ihr habt ihn ausgeschlossen!«
Er sah das Grauen in ihren Augen. Nein, ihn hatte sie nicht aussperren wollen. »Lasst die Wikinger ein!«, schrie sie – zu spät.
Der massive hölzerne Rammbock durchbrach die Mauer neben dem Torpfosten. O ja, Conar wusste zu kämpfen.
Sie sah, wie Philippe der neuen Horde entgegenritt, die nun hereinstürmte.
»Ruft ihn zurück!«, befahl Ragwald hastig.
»Er würde nicht gehorchen.«
»Sagt ihm, Ihr würdet ihn brauchen – dann kommt er. Eurem irischen Wikinger soll kein Krieger als erster entgegentreten. Der Herr der Wölfe wird wissen, dass ich nicht das Schwert ziehen werde. Schnell, beordert Philippe zu Euch!«
»Philippe!«, schrie Melisande. Sofort kehrte der Reiter zu ihr zurück. Jetzt erkannte sie, wie klug Ragwalds Rat gewesen war.
Beide Arme erhoben, rannte er zu der eingestürzten Mauer und kletterte über das Geröll. Es sah so aus, als wollte ihn einer der Wikinger niederstrecken, und ein Schrei blieb in Melisandes Hals stecken. Er ritt über den Schutt auf seinem großen ebenholzschwarzen Hengst heran, mit jenem Helm, der seine Miene verbarg, und die Augen umso eindringlicher erscheinen ließ.
»Der Feind ist geschlagen!«, verkündete Philippe. »Geoffrey flieht mit seinen Männern!« Erleichtert lachte er.
»Einige sind hier in der Festung gefangen. Jetzt muss ich Euch rasch wegbringen, Gräfin, und den Kampf beenden – jetzt, da wir erneut angegriffen werden ...«
»Nein, Philippe«, unterbrach sie ihn leise. »Ragwald steht dem Wolf gegenüber.«
»Also bleibt uns die Grausamkeit der Dänen erspart!«
Melisande schwieg. In diesem Augenblick glaubte sie, dass es keinen grausameren Krieger gab als den Wikinger, der so selbstsicher und stolz in ihre Festung ritt. Der Mann mit den durchdringenden blauen Augen und den felsenharten Schultern. Der gekommen war, um alles zu beanspruchen, stets tat, was ihm beliebte, und keinen Widerstand duldete ... Schuldgefühle bedrückten ihr Herz.
Ja, sie schuldete ihm einiges, für eine andere Schlacht, vor langer Zeit ausgefochten. Doch er war gut bezahlt worden, und nur der alberne Pakt, den Ragwald damals mit ihm geschlossen hatte, verursachte diese neue Begegnung. Ein Geschäft, das mich damals vielleicht gerettet hat, erinnerte sie sich.
Doch das alles spielte keine Rolle. Melisandes Gewissensbisse, die einen Sturm in ihr entfachten, konnten die Angst nicht verdrängen.
Wie immer in seiner Nähe, vermochte sie ihr Zittern nicht zu bezwingen, ebenso wenig den Schauer, der über ihren Rücken rann. Oder die Hitze, die ihr Blut entflammte ...
Was macht es für einen Unterschied, fragte sie sich. Ein Bastard oder ein anderer! Doch das stimmte nicht. Geoffrey war so skrupellos unbarmherzig und tückisch wie sein Vater. Und er? Nun, er wollte nichts weiter, als ihr die Kehle durchzuschneiden. Niemals würde sie seinen Hochmut ertragen. Und diese schöne, elegante blonde Frau, die ihn auf allen Reisen begleitete ... Die demütigenden Forderungen, die er an Melisande gestellt hatte ... Er verlangte einfach, was er wollte, nahm es und erteilte Befehle.
Was würde er jetzt empfinden, nachdem sie ihm getrotzt hatte? Jetzt, wo sie sich beinahe wieder in seiner Gewalt befand?
Sie schloss die Augen und versuchte, nicht an das zu denken, was ihr bevorstand. Unmöglich ... Er war hier. Erinnerungen bedrängten sie und beschleunigten ihren Herzschlag. Sie holte tief Luft, straffte die Schultern und bemühte sich, neue innere Kräfte zu sammeln. Immerhin war sie die Gräfin seit dem Tod ihres Vaters. Das Land und die Festung gehörten ihr. Und mit Gottes Hilfe wollte sie beides behalten.
»Großer Gott, meine Herrin!« Als sie Philippes Stimme an ihrer Seite hörte, öffnete sie die Augen. »Wie viele Männer er anführt!«
Auf ihren Pferden wirkten die Krieger so eindrucksvoll wie an Bord ihrer Drachenschiffe. Es sah so aus, als wären sie vom Satan persönlich geschult worden. Riesige Burschen mit Streitäxten und Schlagkeulen, mit muskulösen Armen, furchtlos, tollkühn und gefährlich.
Einmal hatten sie Melisande gerettet. Sie wusste, wie sie kämpfen konnten. Und an der Spitze des Heeres – er!
»Ich werde Euch in den Turm bringen«, murmelte Philippe, der die Ereignisse aufmerksam beobachtete. Offensichtlich mussten Geoffreys Männer sterben oder sich unterwerfen. Im Hof tobten immer noch erbitterte Kämpfe. Die Gräfin wurde nicht mehr gebraucht, um ihre Männer zu befehligen, also konnte sie sich an einen sicheren Ort zurückziehen.
»Ich bin durchaus imstande, für mich selber zu sorgen, Philippe«, beteuerte sie. »Rasch, kümmert Euch um unsere Leute!«
Ihre Entscheidung schien ihm zu missfallen, doch sie gab ihm keine Zeit zu widersprechen. Sie eilte zu den Turmstufen und stieg hinauf, so schnell es das Gewicht ihrer Rüstung erlaubte. Nun musste sie erst einmal ihre Gedanken ordnen. Wie sollte sie ihn begrüßen? War das überhaupt nötig? Gab es keine Möglichkeit, einfach davonzulaufen? Aber wollte sie das? Vielleicht war die Zeit gekommen, wo sie beide vereint werden sollten.
Eine Stufe war zerbrochen, von der Wucht einer herabstürzenden Axt getroffen. Melisande sprang über die Lücke hinweg und floh zu ihrem Turmzimmer. Dort riss sie sich hastig die Rüstung vom Körper, obwohl sie ihre eigene Feigheit verachtete. Aber sie hoffte, ihr Anblick wäre ihm auf dem Schlachtfeld entgangen und er würde nicht glauben, dass sie ihm das Tor absichtlich versperrt hatte.
Närrin, schalt sie sich. Feigling! Sie war hier die Gräfin, er nur der jüngere Sohn eines Königs, der sein Glück suchte und sich an ihrem rechtmäßigen Erbe bereichern wollte. Nein, sie brauchte weder Furcht noch Demut zu zeigen.
Zusammen mit der Rüstung hatte sie auch ihr Schwert fallen lassen. Nun hob sie es auf und schaute sich unbehaglich im Zimmer um.
Ihr Blick streifte das Bett, die kühlen, sauberen Leintücher und die Pelzdecke. Krampfhaft schluckte sie und zitterte wieder.
Hier wollte sie nicht zur Rede gestellt werden. Sie eilte hinaus zur Brustwehr und schaute in den Hof hinab. Ihr Herz drohte stehenzubleiben, als sie seinem Blick begegnete. Hitze und Kälte, Feuer und Eis ...
2
Conar MacAuliffe saß auf seinem großen Schlachtross und erwiderte ihren Blick. Endlich, dachte er. Da stand sie, die kleine Furie, hoch oben an der Brustwehr, in ihrer ganzen Schönheit. Er konnte es kaum erwarten, sie zwischen seine Finger zu bekommen. Umgeben vom Kampfgewühl, das allmählich erstarb, schaute er zu ihr hinauf. Durch die Rauchwolken, die von brennendem Öl und Flammenpfeilen aufstiegen, betrachtete sie ihn. Nie zuvor hatte ihn jemand so verächtlich angesehen, und er fragte sich, warum sie das wagte – jetzt, wo er sein Recht auf die Festung unter Beweis gestellt und gesiegt hatte.
Sie zitterte nicht. Vielleicht fühlte sie sich in Sicherheit, weil sie weit genug von ihm entfernt war, obwohl er sie mühelos mit wenigen Schritten erreichen konnte. Er brauchte nur abzusteigen und die steinerne Turmtreppe hinaufzustürmen.
Aber seine Nähe schien sie nicht zu erschrecken. Hochnäsig starrte sie herab, und er musterte sie prüfend. So lange hatte er sie nicht gesehen. Sie war eine ungewöhnliche Frau, sehr groß für ihr Geschlecht. Wenn sie ihm gegenüberstand, würde sie den Kopf kaum heben müssen, um ihm in die Augen zu sehen. Ihr üppiges, prachtvolles schwarzes Haar schimmerte wie eine mondlose Nacht. Leicht gewellt wie Vogelgefieder lag es auf ihrem Rücken. Ihr Gesicht leuchtete hell wie Elfenbein mit rosigen Wangen und schön geschwungenen roten Lippen. Allen Göttinnen oder christlichen Engeln konnte sie das Wasser reichen.
Doch man musste sie wohl eher mit den Göttinnen vergleichen, denn einige waren bekannt für ihr wildes Temperament und ihre Launen. Keinesfalls konnte man sie als Engel bezeichnen. Der würde sich freundlich und gütig zeigen, ohne diesen herausfordernden, vernichtenden Blick. Unbeugsamer Stolz straffte ihren Rücken. Nein, Demut zählte nicht zu ihren Tugenden, das wusste Conar längst.
Sie hatte sich nicht verändert und unterschied sich kaum von dem Kind, das ihm vor so langer Zeit begegnet war. Am Tag ihres Triumphes, den sie mir verdankt, erinnerte er sich und unterdrückte ein Grinsen. Aber das waren andere Zeiten gewesen. Damals hatten sie ihre Streitkräfte vereint und den Sieg errungen. Jetzt hatte sie seine Hilfe in Anspruch genommen und ihm das Tor verschlossen. Aber er war durch die Mauer gestürmt, und nun sollte sie ihm nicht noch einmal entrinnen. Weder Arglist noch Kampfkraft oder Zorn würden ihr nützen.
Lächelnd versuchte er, die Farbe ihrer Augen auszumachen, die er so gut kannte. Er klappte das Visier seines Helms hoch, wollte ihr sein Gesicht zeigen und fragte sich, ob dieser Anblick den Trotz aus ihrer Miene verbannen würde. Das geschah nicht.
Geschmeidig schwang er sich vom Rücken seines zuverlässigen Hengstes und tat den ersten Schritt. Dass er immer noch sein Schwert umklammerte, merkte er erst, als er das Gewicht des Stahls spürte. Auch Melisande hielt ihre Waffe in der Hand, trug aber die Rüstung nicht mehr, die sie vor dem Kampf angelegt hatte. Langsam näherte er sich dem Eingang zum Turm. Sie neigte sich ein wenig vor, um ihn zu beobachten. Die Farbe ihres Kleides, ein sanfter Malventon, unterstrich den pechschwarzen Glanz ihres Haars.
Warum hatte sie die Rüstung abgestreift? Weil sie glaubt, ich hätte sie draußen nicht bemerkt, überlegte er belustigt. Nie wieder würde er sie übersehen, und das musste er ihr klarmachen, neben einigen anderen Dingen.
Wieder betrachtete er ihr Kleid, den fließenden Stoff, der sich jeder Bewegung anpasste. Sie beugte sich noch weiter vor, und dann sah sie ihn nicht mehr, als er die Treppe hinaufrannte. Wenig später stand er ihr gegenüber, an der Stelle, wo eine Stufe zerbrochen war.
Zur Frau herangereift, war sie noch schöner als in seiner Erinnerung. Ihr Gesicht bildete ein vollkommenes Oval, mit hohen Wangenknochen und einem zierlichen, bezaubernden Kinn – obwohl sie es viel zu hoch emporreckte. Auch dem Reiz der vollen Lippen tat der zornige, verkniffene Zug keinen Abbruch. Doch dies alles wurde von den großen, weit auseinanderstehenden Augen überstrahlt.
Solche Augen gab es kein zweites Mal. Oberflächlich betrachtet, wirkten sie blau, manchmal auch malvenfarben wie das Kleid, das sie jetzt trug. Doch nun flackerten sie in dunklem Violett, wild wie der Nachthimmel, wenn die alten Götter zürnten, wenn ein Gewitter drohte, Blitze aufflammten und Donnerschläge krachten. Diese Augen konnten sogar den mächtigen Odin herausfordern und kannten keine Angst vor der Sterblichkeit.
Die Augen einer Siegerin ... Aber der Sieger hieß Conar, und sie war die Beute, mochte sie seinen Blick auch noch so kühn erwidern.
Er biss die Zähne zusammen. Plötzlich fand er ihre Nähe schmerzlich.
Schon vor langer Zeit hatte sie die Macht besessen, Männer in ihren Bann zu ziehen. Der alte Ragwald war kein Narr gewesen, als er sie damals an die Spitze des Heeres gestellt hatte. Im ganzen Bereich der Christenheit kannte Conar keine schönere Frau, und außerhalb ebenso wenig. Aber nicht nur ihre Schönheit wirkte unwiderstehlich. Sie strahlte noch etwas anderes aus, das ihn bei der ersten Begegnung zu dem Entschluss veranlasst hatte, sie in ein Kloster zu schicken. Etwas, das seine Träume verfolgte, in dunkler Nacht und am helllichten Tag – etwas, das ihn zu oft aus dem Schlaf gerissen und in Schweiß gebadet hatte. Etwas, das ihn mit heißem Verlangen und wilder Vorfreude erfüllte. Vielleicht wusste sie selbst nichts von der betörenden Sinnlichkeit, die ihre Bewegungen, ihren Blick, sogar den Hass in ihren Augen prägte.
Er hatte sie bereits berührt, kannte alle faszinierenden, subtilen Züge ihrer Weiblichkeit. Und dieses Wissen war ein Fieber, das ihn stets begleitete und immer neue Sehnsucht weckte.
Niemals würde sie ihm verzeihen, wer er war. Doch das spielte keine Rolle. Nicht heute Nacht, auch nicht in ferner Zukunft. Mit leiser Stimme brach er das Schweigen. »Wie liebenswürdig du mich begrüßt, Melisande – nach unserer langen Trennung ...«
»Nur zu gern hätte ich dir einen noch wärmeren Empfang bereitet, mein teurer Wikinger. So viele brennende Pfeile flogen umher. Schade, dass es uns nicht gelang, dein kaltes nordisches Herz zu erhitzen!«
»Ich bin verletzt, Melisande, tief verletzt.«
»Oh, ich wünschte, es wäre so«, flüsterte sie.
»Eigentlich sollte man erwarten, du würdest dich zumindest bemühen, Höflichkeit zu heucheln. Nach allem, was du getan hast, wäre es mein gutes Recht, meine Finger um deinen schönen Hals zu legen – und zwar nach deinen Gesetzen. Vielleicht möchtest du andere Worte gebrauchen, um mich zu begrüßen?«
Sie lächelte sanft, aber in ihren Augen glühte immer noch heller Zorn. »Dein Wunsch sei mir Befehl.«
Auf sein Schwert gestützt, brach er in lautes Gelächter aus. »Das meinst du nicht ernst, Melisande. Aber bald werden solche Worte aus der Tiefe deines Herzens kommen. Dafür will ich sorgen, das verspreche ich dir.«
»Versprich nichts, was du nicht halten kannst, Wikinger.«
»Wenn ich etwas verspreche, halte ich es immer. Und wie ich dich vielleicht erinnern darf – ich wurde in Dubhlain geboren.«
»Du fährst auf Wikingerschiffen übers Meer ...«
»Weil es die besten sind.« Seine Augen verengten sich, seine Stimme nahm einen harten Klang an. »Wie ich höre, wolltest du dich unserem alten Feind Geoffrey unterwerfen.«
Ihr Atem stockte. Sie hatte nicht gewusst, wie offenherzig ihre Männer mit ihm sprachen, wie rückhaltlos sie auf seine Macht vertrauten. »Ich ...«, begann sie und unterbrach sich, als sie seine Wut spürte. »In Wirklichkeit hatte ich das nicht vor. Verdammt, begreifst du denn nicht? Ich versuchte, Menschenleben zu retten.«
»Wenn du noch einmal auf solche Gedanken verfällst ...«
»Was wird dann geschehen?«
»Ich werde nicht zögern, dich auszuziehen und halb totzuprügeln.«
»Niemals würdest du das wagen.«
»Möchtest du mich beim Wort nehmen?«
»Und wenn Geoffrey mich besessen hätte?«, fragte sie kühl, obwohl in ihren violetten Augen immer noch ein wildes Feuer brannte.
»Nun, dann müsste ich mir gründlich überlegen, ob es sich lohnen würde, dich zurückzugewinnen. Aber du bist meine Beute, nicht seine. Ja, ich hätte dich Geoffreys Klauen unter allen Umständen entrissen. Was mir gehört, lasse ich mir nicht stehlen.«
»Du brauchst mir niemals irgendeinen Gefallen zu tun. Und hättest du auf meine Bitte gehört, wäre es nie soweit gekommen.«
»Hättest du meine Warnung beachtet, wärst du nicht in Gefahr geraten.«
»Aber dieses Schloss wäre ...«
»Dieses Schloss besteht nur aus Holz und Stein.«
»In diesen Wänden aus Holz und Stein leben Menschen!«, rief Melisande.
»Ich traf gerade noch rechtzeitig hier ein!« Wütend fluchte er und wich ihrem Blick aus. Wieder einmal wäre er fast zu spät gekommen. Mühsam rang er nach Fassung. Im Grunde war er ihr nichts schuldig gewesen.
»Dann ...« Sie musste mit sich kämpfen, um in ruhigem Ton zu sprechen. »Dann wirst du also eine Weile hier bleiben?«
»O Melisande ...« Langsam verzogen sich seine Lippen zu einem Lächeln. »Kein Wort des Dankes, nachdem ich dir im allerletzten Augenblick doch noch zu Hilfe geeilt bin? Nur die kühle Frage, wie lange ich bleiben will? Hoffentlich nicht zu lange, was? Sicher wärst du jetzt glücklicher, hätte ein lodernder Dänenpfeil meine Brust durchbohrt. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen.«
»Ja, das ist allerdings bedauerlich«, wisperte sie, dann verbesserte sie sich hastig. »Danke, dass du gerade zur rechten Zeit hierher gesegelt bist. Aber welchen Unterschied, macht das schon? Ein Wikinger oder ein anderer ...«
Zum Teufel mit ihr! Viel zu gut wusste sie, wie sie ihn mitten ins Herz treffen konnte. Er biss die Zähne zusammen und zwang sich, sein Temperament zu zügeln. »Nun, sollte ich beschließen, mit Geoffrey oder irgendeinem dänischen Jarl zu verhandeln, muss ich wenigstens nicht befürchten, es könnte dich kränken, wenn ich deine glorreiche Person zum Tausch gegen diese oder jene Vergünstigung anbiete.«
Endlich hatte er sie dazu gebracht, die Beherrschung zu verlieren. Er sah wilden Zorn in ihren Augen aufflammen. Blitzschnell hob sie ihr reich verziertes Schwert, doch seine Geistesgegenwart – in zahllosen Schlachten erprobt – befähigte ihn, den Angriff ebenso rasch zu parieren. Für eine kleine Weile bebten die aneinandergepressten Klingen in der Luft, und er erwiderte Melisandes Blick, drohend und voller Wut. Plötzlich begann sie zu schreien. Ihr Fuß war auf der zerbrochenen Stufe ausgeglitten. Sie ließ das Schwert fallen, suchte Halt an der Wand, berührte aber nur glatten Stein.
Conar schleuderte seine Waffe zu Boden und fing Melisande auf, ehe sie stürzen konnte. Seine starken Arme umschlangen ihre Taille und pressten sie an seine Brust. Mühsam rang sie nach Luft, warf den Kopf in den Nacken, und all die stürmischen Gefühle, an die er sich so gut erinnerte, brannten in ihren Augen.
Unwillkürlich lächelte er. Gleichgültig, wie oft er sie schon gerettet hatte, sie hasste ihn. Aber er entsann sich auch noch anderer Dinge – wie es gewesen war, ihre seidige Haut und die Vollkommenheit ihres Körpers zu spüren. Heißes, schmerzhaftes Verlangen erfasste ihn, doch jetzt fehlte ihm die Zeit, seinen Wünschen nachzugeben. »Du kleine Närrin! Nur um mir eins auszuwischen, würdest du dich selber umbringen. Nun, ich muss dich warnen. Heute fand nur ein Scharmützel statt, ein kleines Vorspiel künftiger Kämpfe, und so wahr mir Gott helfe ...«
»Du glaubst doch gar nicht an Gott!« Verzweifelt grub sie die Finger in seine Arme, die sie noch fester umfingen, und versuchte ihn wegzuschieben, wenn sie auch wusste, wie sinnlos ihre Gegenwehr war.
Er schüttelte sie unsanft. »Meine Liebe, wir werden jetzt eine gemeinsame, geschlossene Front bilden. Du hast eine halbe Stunde Zeit, um dich vorzubereiten. Dann wirst du mich unten im Burghof in aller Form willkommen heißen und wir beide werden meine Männer und deine Leute grüßen. Es dürfte noch genug Todesfälle geben. Dazu sollst du keinen Beitrag leisten.«
»Niemals habe ich das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt«, entgegnete sie ärgerlich. »Ich war das Opfer.«
»Arme, kleine Märtyrerin ...«
»Lass mich los!«
»Was für ein verlockender Vorschlag! Möchtest du die Treppe hinunterfallen? Welch ein Jammer wäre es, soviel Schönheit zu zerstören! Aber sei versichert, Melisande, ich werde dich niemals loslassen.«
»Fürchtest du nicht, ich könnte dich in der Nacht erstechen?«, fragte sie verächtlich und bekämpfte noch immer die Kraft seiner Arme.
Er fühlte, wie aufreizend sich ihre Brüste hoben und senkten, hörte den verführerischen Klang ihrer atemlosen Stimme. Lächelnd neigte er den Kopf zu ihr. »Wenn ich heute Nacht mit dir fertig bin, wirst du dich nicht mehr rühren können, das schwöre ich dir.«
Bei diesen Worten wurde sie blass, erholte sich aber sofort wieder von ihrem Schrecken und trat gegen eine ungeschützte Stelle an seinem Schienbein. Beinahe hätte er einen Schrei ausgestoßen, beherrschte sich aber gerade noch rechtzeitig und sprang mit ihr auf die nächsthöhere Stufe. Zu seiner bitteren Belustigung klammerte sie sich lieber an ihn, als einen Sturz in den Tod zu riskieren.
Nach wenigen Schritten erreichte er das Turmzimmer und warf sie aufs Bett. Er sah, wie heftig ihr Puls an ihrem schönen weißen Hals pochte, und fragte höhnisch: »Ist das möglich, Melisande? Du fürchtest die Berührung eines Wikingers? Vielleicht erinnerst du dich gut genug. Verspürst du Angst oder Sehnsucht? Vorfreude oder Grauen? Keine Angst, im Augenblick finde ich keine Zeit für deine zärtlichen Arme. Aber eine lange Nacht erwartet uns ...«
»Schurke!«, würgte sie hervor. »Du beschwörst die Hölle herauf, die uns beide verschlingen wird ...«
Entsetzt verstummte sie, als er sich auf den Bettrand setzte und sie wieder in seine Arme riss. »Himmel oder Hölle, meine Teure, vielleicht ein bisschen was von beidem ... Ich bezweifle, dass ich dir unerträgliche Qualen bereiten werde. So oder so, ich bin hier der Herr, und ich nehme mir mein Recht, auf Wikingerart.«
»Oh, du Ungeheuer!«, schrie sie. »Du Bastard ...«
»Ich kann es kaum erwarten, wieder bei dir zu liegen. Heute Nacht wirst du mir nicht entfliehen, Melisande.«