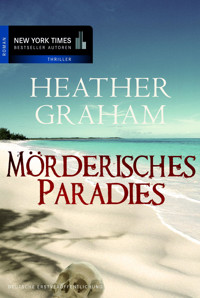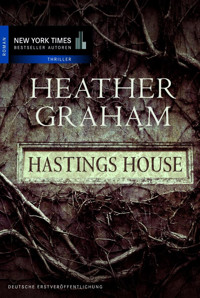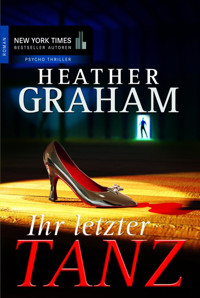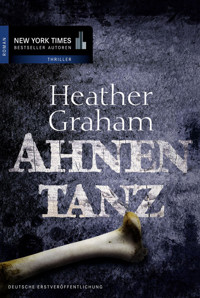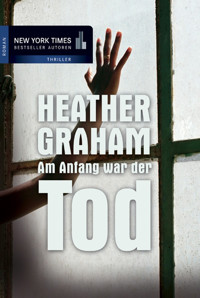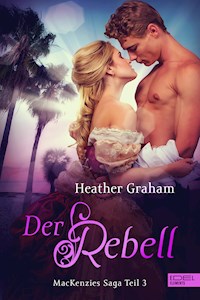5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rhiannon, die Nichte des Königs, ist verzweifelt: Um den Waffenstillstand zwischen den feindlichen Lagern zu besiegeln, wird sie an den Wikinger Eric verschachert. Als der kampferprobte Krieger die wilde Schönheit sieht, ahnt er sofort, dass sie die Herausforderung seines Lebens wird und dass er zum ersten Mal Gefahr läuft, einen Kampf zu verlieren ...
Weitere historische Liebesromane von Heather Graham bei beHEARTBEAT: "Der Herr der Wölfe" und "Die Normannenbraut".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Über dieses Buch
Rhiannon, die Nichte des Königs, ist verzweifelt: Um den Waffenstillstand zwischen den feindlichen Lagern zu besiegeln, wird sie an den Wikinger Eric verschachert. Als der kampferprobte Krieger die wilde Schönheit sieht, ahnt er sofort, dass sie die Herausforderung seines Lebens wird und dass er zum ersten Mal Gefahr läuft, einen Kampf zu verlieren.
Über die Autorin
Heather Graham wurde 1953 im Dade County in Florida geboren. Ihre Reisen durch Afrika, Asien und Europa inspirierten sie dazu, Schriftstellerin zu werden. Ihr erster Roman wurde 1982 veröffentlicht, seitdem hat sie etwa 150 Romane geschrieben, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Heather Grahams Titel stehen regelmäßig auf den US-amerikanischen Bestsellerlisten.
Heather Graham
Die Gefangene des Wikingers
Aus dem amerikanischen Englisch von Julia Edenhofer
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1990 by Heather Graham.
Titel der Originalausgabe: THE VIKING’S WOMAN
Für die Deutsche Erstausgabe:
Copyright © 1991 by Wilhelm Heyne Verlag, Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Allies Interactive | Digiselector | Artem Furman | Michael Rosskothen
E-Book-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-3667-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Er war während eines Unwetters empfangen worden, in einer Nacht, die von Zorn und Leidenschaft bestimmt wurde.
Und er war geboren worden, als ein Blitz über den Himmel zuckte, und es schien so, dass es die Stürme waren, die auch künftig sein Leben bestimmten sollten.
Ein fürchterlich greller Blitzschlag zerriss den Himmel, und Erin, Königin von Dubhlain, keuchte und stieß einen Schrei aus. Heißer, gnadenloser Schmerz durchzuckte sie. Sie biss sich auf die Lippen, denn sie war sich sicher, dass die Geburt gut gehen würde, und sie wollte weder die, die sich um sie versammelt hatten, noch ihren Gebieter und Ehemann, den König, ängstigen. Der Schmerz wurde stärker, erreichte seinen Höhepunkt und verebbte langsam wieder. Sie atmete tief ein. Sie schloss die Augen und brachte es fertig zu lächeln, indem sie sich an die Nacht erinnerte, bei der sie sicher war, das Kind empfangen zu haben. Sie waren zu weit hinausgeritten und waren weit entfernt von der Stadtmauer, draußen bei den Höhlen, vom Sturm überrascht worden. Sie hatte sich über Olaf geärgert – an den Grund erinnerte sie sich nicht mehr. Aber Ärger war für sie beide nie ein Hinderungsgrund gewesen und war es auch nicht in dieser Nacht. Die keuchenden, hitzigen Worte hatten lediglich die Heftigkeit angestachelt, mit der ihre Leidenschaft aufloderte.
Sie konnte sich noch gut an alles erinnern. Er hatte etwas gebrüllt, dann gelacht und sie in die Arme gerissen. Sie hatte zurückgebrüllt, aber dann im süßen und wilden Angriff seines Kusses ihren Wortwechsel vergessen. Mitten im wütenden Sturm hatte er sie zu Boden geworfen, und während der Donner krachte, hatten sie zusammen das Leben erschaffen, das sich jetzt in ihr regte. Ein geliebtes Leben, denn sie liebte ihren Gebieter abgöttisch. Sie konnte sich sehr genau an das Aussehen ihres Wikinger-Gatten an diesem Tag erinnern. An seine kobaltblauen Augen, die sonst zu zärtlich blickten und an diesem Tag vor Begierde glühten. Und sie erinnerte sich voller Zärtlichkeit an die Kraft seiner Arme, die Glut seiner Küsse, die Berührung seiner Hände. Sie hatte das Lodern seines Körpers ganz tief in ihr wie das Zucken des Blitzes empfunden.
»Oh, mein Gott«, schrie sie auf, als eine weitere Schmerzwelle sie überspülte und Furcht sie packte. Die Geburt von Leith war sehr schwer für sie gewesen. Sie hatte darum gebetet, dass das zweite Kind leichter kommen würde. Aber jetzt brannte wieder der Schmerz in ihr und gab ihr das Gefühl, entzweigerissen zu werden.
Sie fühlte die sanfte Hand ihrer Mutter auf der Stirn. »Warum, Mutter?«, flüsterte sie. »Warum muss das so schmerzhaft sein?«
Maeve lächelte sie zärtlich an und versuchte, nicht zu besorgt zu wirken. »Es ist nicht einfach, mein Liebling, die Nachkommen des Wolfs zu gebären.« Maeve blickte auf. Da stand er, unter der Tür, der Wolf der Norweger, der König von Dubhlain. Er blickte sie und Erin an, und dann schritt der hochgewachsene, stattliche, blonde König an die Lagerstatt seines Weibes.
»Hier bin ich, Prinzessin. Kämpfe für mich. Schenk mir einen zweiten Sohn.«
Sie lächelte. Er dachte an ihre zerbrechliche Schönheit und an die Stärke, die sich darunter verbarg. Ihre Augen schimmerten in tiefem Smaragdgrün, genauso unergründlich und grenzenlos wie die Stärke in ihr, diese Stärke, die sein Herz gefangen genommen hatte. Diese Stärke, die auch alle ihre Kinder besitzen würden. Es war die Leidenschaft, die allen von der Grünen Insel innewohnte, und es war die Kraft der nordischen Seefahrer.
Sie berührte sanft seine Hand, froh darüber, dass er gekommen war. »Dieses Mal wird es ein Mädchen!« Sie rang sich ein Lächeln ab.
Er schüttelte ernst den Kopf. »Nein, ein Sohn.«
»Ein Sohn?«
»Ja, Mergwin sagte es mir.«
»Oh!« Sie keuchte, aber er war an ihrer Seite, und sie schaffte es, nicht zu schreien. Sie verschränkte ihre Finger mit den seinen und bezog ihre Kraft aus ihm. Abermals durchfuhr sie ein brennender Schmerz, aber jetzt seufzte sie erleichtert auf, denn das Kind hatte sich schon fast den Weg ans Licht der Welt erkämpft. »Es kommt!«, rief sie aus.
Olaf hatte ihr bei der Geburt des ersten Kindes beigestanden und wusste, wie er sie halten musste. Und dann war das Kind geboren, und Maeve versicherte ihr, dass es tatsächlich wieder ein Junge war.
»Und ist er hübsch?«, fragte sie.
»Über alle Maßen«, beruhigte Olaf sie. Erins Mägde rieben das Kind schnell ab und reichten es seiner Mutter. Erin riss erstaunt die Augen auf, als sie die Größe des Babys sah. »Wieder blondes Haar!«, murmelte sie und Olaf lachte und küsste ihr feuchtes, ebenholzfarbenes Haar. »Ich fürchte, mein Liebling, dass du auf eine Tochter warten musst, vielleicht hat sie dann mitternachtsschwarzes Haar«, neckte er sie.
Sie jammerte einen scherzhaften Protest. »In einem solchen Augenblick sprichst du mit mir über weitere Kinder?«
»Sobald du körperlich dazu in der Lage bist«, flüsterte er ihr lachend ins Ohr, und beide fühlten ihre tiefe Zuneigung.
»Und seine Augen ...«
»Sind blau, wie die seines Vaters«, antwortete Maeve mit einem Seufzer. Sie zwinkerte Olaf zu und beide betrachteten das Kind.
»Die Farbe kann sich ändern«, meinte Erin.
»Leith hat irische Augen«, erinnerte er sie.
»Natürlich können Augen ihre Farbe ändern«, stimmte Maeve ihr zu.
»Nun, aber diese werden es nicht.« Olaf war sich ganz sicher. Die Augen des Kindes blickten hellwach, seine kleinen Fäuste schlugen auf die Bettlaken, sein Mund stand offen, und seine Stimme klang äußerst befehlend. »Nun, der Kleine weiß genau, was er will«, meinte Olaf.
»Wie sein Vater«, stimmte Erin ihm zu. Sie liebte ihren zweiten Sohn bereits aus ganzem Herzen. Sie lehnte sich zurück und führte seinen suchenden Mund an ihre Brust. Das Baby griff sofort zu, klammerte sich fest und fing auf der Stelle mit einer Bestimmtheit und Kraft zu saugen an, dass Erin erschrocken Luft holte und dann lachte.
Olaf bemerkte, dass Erin die Augen zufielen. Ihre dichten, schwarzen Wimpern lagen wie dunkle Halbmonde auf ihren Wangen. Maeve folgte seinem Blick und nickte. Er wollte das Kind sanft hochheben, aber Erin erwachte sofort wieder. Ihre Augen öffneten sich voller Panik. Fest packte sie das Baby. »Nein, lass ihn!«, wisperte sie, und er wusste, dass sie Angst hatte. Es war noch nicht lange her, dass Leith, ihr Erstgeborener, von Friggid, dem Dänen, Olafs Feind, entführt worden war. Friggid war jetzt tot – Olaf hatte ihn getötet –, aber Erin hatte die Angst noch nicht überwunden, dass Leith, oder jetzt ihr neuer Sohn, ihr abermals entrissen werden könnte.
»Ich bin’s doch nur, mein Liebling«, beruhigte er sie. »Ich möchte ihn dir abnehmen, damit deine Mägde dein Bettzeug wechseln und deine Mutter dich waschen kann.«
Ihre leuchtenden Augen schlossen sich wieder. Ihr Lächeln war bezaubernd und friedlich. »Eric«, murmelte sie. »Er soll Eric heißen. Leith nach meinem Bruder. Eric nach deinem.«
Olaf war erfreut. »Eric«, stimmte er ihr zärtlich zu.
Er trug sein neugeborenes Kind zum Fenster und blickte auf seinen Sohn hinab. Das Haar des Babys war dick und fast weiß, seine Augen, immer noch weit offen, waren tatsächlich nordisch blau. Der Knabe war groß, sehr groß sogar.
»Du wirst ein hübscher Kerl werden«, murmelte Olaf.
»Und ein guter Wikinger«, ertönte eine neue Stimme.
Olaf fuhr herum und starrte einen sehr alten Mann an, der den Raum betreten hatte. Mergwin. Ein Mann, sowohl alt als auch alterslos, ein Wikinger und Druide, das Kind eines nordischen Runen-Meisters und einer sagenhaften irischen Priesterin eines alten Druiden-Kults. Er hatte Ard-ri gedient, dem Hoch-König von Irland, Erins Vater, und obwohl er immer noch dem Ard-ri diente, war er sehr oft bei seinem Lieblingskind unter Aed Finnlaiths Kindern, bei Erin von Dubhlain. Er stand ihr völlig loyal gegenüber und damit auch Olaf.
Für Mergwin galten die Gesetze von Zeit und Raum offenbar nicht. Er war aus seinem Heim in den Wäldern gekommen, obwohl ihn niemand geholt hatte. Er hatte einfach gewusst, dass das Kind an diesem Tag geboren werden würde.
Wieder wurde der Himmel von Blitzen durchzuckt. Der Schein warf ein seltsames Licht auf Mergwins Gesicht und seinen bodenlangen Bart. Das Licht fiel auch auf das Kind, und es schien in den Armen seines Vaters zu glühen.
»Ein Wikinger?« Olaf grinste, schüttelte den Kopf und deutete auf sein schlafendes Weib. »Sag das nicht zu laut«, warnte er Mergwin. »Seine Mutter wäre darüber gar nicht erfreut.«
Mergwin berührte das Gesicht des Knaben. Das Baby griff nach dem Finger des Druiden und drückte ihn mit aller Kraft.
»Leith ist Ire, wie seine Mutter. Durch und durch. Eines Tages, Lord der Wölfe, wird er seinem Vater folgen und ein guter König von Dubhlain werden. Aber dieser hier, Eric – du hast ihm einen Wikinger-Namen gegeben, Mylord.«
Olaf runzelte die Stirn. Er fühlte, dass von dem Druiden eine Warnung ausging, und drückte seinen Sohn noch fester an seine breite Brust, als könnte er ihn damit vor der Zukunft beschützen.
»Was willst du damit sagen, du alter Schwarzseher?«
»Der Wolf sollte es besser wissen, als mich anzuheulen«, antwortete Mergwin ruhig. Er hielt inne, holte tief und langsam Atem. »Dieses Kind, Lord Wolf, ist dein Kind. Ein Wikinger. Und wie sein Vater wird auch er über die Weltmeere segeln. Er wird in viele Schlachten verstrickt werden, und sein Schwert wird sehr gut darin sein, jeden Angriff zu parieren. Und mit seiner Klugheit und der Geschicklichkeit seines Schwertarms wird er viele besiegen. Er ...«
»Was er?« Olafs Stimme klang angespannt, denn obwohl er das Kind in seinen Armen bereits liebte, war Eric doch sein zweiter Sohn. Und wenn er dazu bestimmt sein sollte, Dubhlain zu regieren, bedeutete das Gefahr für seinen Bruder Leith.
Mergwin, der Olafs Unbehagen fühlte, schüttelte den Kopf. »Sein Schicksal liegt in einem anderen Land. Er wird sehr ernsthaften Gefahren gegenübertreten müssen.«
»Aber er wird diese Gefahren besiegen!«, stellte Olaf mit Nachdruck fest.
Mergwin starrte ihn an. Sie belogen sich niemals.
»Er wird von Odin regiert. Er wird in Donner und Sturm über die Meere segeln, und genauso ungestüm wird sein Herz erobert werden. Wenn er erwachsen ist, wird Dunkelheit herrschen ... aber ...«
»Sag es!«
»Es wird auch Licht geben.« Mergwins Gesicht war ernst, und Olaf, der Lord der Wölfe, wusste nicht, ob er nun zu dem Christen-Gott beten sollte, den er um seiner Frau willen angenommen hatte, oder zu Loki und Odin und Thor, den Göttern seiner Vergangenheit.
Er würde zu allen beten. Er biss die Zähne zusammen, und seine Muskeln spannten sich. Mergwin befürchtete, dass der große Krieger seinen Sohn zerdrücken könnte.
Mergwin befreite den Knaben aus Olafs Armen. Die Wärme des Babys drang in ihn ein, und er schloss die Augen. »Nun, er wird seinem Vater sehr ähnlich werden. Wegen seiner leidenschaftlichen Natur wird er ständig in Gefahr geraten, aber ...«
»Aber was?«, drängte Olaf.
Obwohl Mergwin lächelte, blieben seine Augen düster. »Bilde ihn gut aus, Lord Wolf. Lehre ihn, Schlachten zu schlagen, und lehre ihn, klug und schlau zu handeln. Sorge dafür, dass sein Schwertarm stark und sein Gehör fein wird. Er wird ein Wikinger werden, und er wird einem schrecklichen, verschlagenen Feind gegenübertreten müssen.«
Mergwin hielt inne. Das Kind blickte ihn mit den Feuer-und-Eis-Augen seines Vaters an. Der Kleine betrachtete ihn, als würde er verstehen, was der Druide gerade für ihn geweissagt hatte. Mergwins Lächeln vertiefte sich.
»Er ist mit Mut geboren worden, mit Stolz. Mit dem unbezwinglichen Geist seiner Mutter und der Kraft und der Willensstärke seines Vaters. Gib ihm Klugheit und Erfahrung, Olaf. Dann lass ihn gehen, denn wie sein Vater auch, muss er selbst seine Bestimmung finden.«
Olaf runzelte die Stirn. »Keine Rätsel, Druide.«
»Ich spreche nicht in Rätseln, ich sage dir alles, was ich weiß. Lass ihn gehen, und er wird seine Dämonen besiegen. Und dann ...«
»Dann?«
»Nun, dann wird er vielleicht, Mylord, den Sieg davontragen. Denn wie sein Vater, wird auch er ein Weib mit Odins Stärke kennen lernen. Der Stärke des Sturms, der Stärke des Blitzes, der Stärke des Donners. Ihr Wille wird den seinen ständig herausfordern. Sie wird ihn in Gefahr bringen, und doch wird sie ihm auch die Erlösung bringen. Sie wird eine ungestüme und streitsüchtige Füchsin sein. Ihre Schönheit wird unvergesslich sein, aber ihr Hass tiefer als das Meer, das ihrer beider Heimat trennt. Aber, Lord der Wölfe, der Sieg wird ihnen gehören, wenn der Wolf die Füchsin zähmen kann.«
»Oder«, fügte Mergwin nachdenklich und mit einem feinen Lächeln hinzu, das er vor seinem Wikinger-Lord verbarg, »wenn die Füchsin den Wolf zähmen kann!«
1. Kapitel
Der Bug des ersten Drachenschiffs erschien zur selben Zeit am Horizont, als der erste Blitz über den Himmel zuckte und der erste ohrenbetäubende Donnerschlag dröhnte.
Und dann wimmelte es plötzlich von Drachenschiffen, die in ängstlichen Herzen Panik aufflammen ließen. Gewaltig und wild schaukelten sie wie sagenhafte Bestien auf dem Wasser und brachten mit sich die Angst vor Verwüstung und Gemetzel.
Die Blutrünstigkeit der Normannen war an der sächsischen Küste von England wohlbekannt. Jahrelang hatten die Dänen das Land verwüstet, und die gesamte Christenheit hatte gelernt, beim Anblick der flinken Drachenschiffe, dieser Geißel zu Lande und zu Wasser, innezuhalten und zu zittern.
An diesem Tag kamen die Schiffe aus dem Osten, aber kein Mann und keine Frau, die die Flotte der Wikinger-Schiffe sah, dachten auch nur einen Augenblick über diese Seltsamkeit nach. Sie sahen die unzähligen Wappenschilde, mit denen die Schiffe vom Bug bis zum Heck bedeckt waren, und sie sahen, dass der Wind, und nicht die Ruderer, die Schiffe wie den Zorn Gottes persönlich heranfegte. Rot und weiß hoben sich die Segel der Wikinger vom bleischweren Himmel ab und trotzten dem tobenden Wind.
Rhiannon war in ihrer Kapelle, als der erste Alarm gegeben wurde. Sie betete für die Männer, die in Rochester gegen die Dänen kämpfen sollten. Sie betete für Alfred, ihren Cousin und König, und sie betete für Rowan, den Mann, den sie liebte.
Sie hatte nicht erwartet, dass an ihrer Küste Gefahr drohen könnte. Die meisten ihrer Männer waren mit dem König gegangen, um gegen die im Süden versammelten Dänen zu kämpfen. Sie war praktisch schutzlos.
»Mylady!« Egmund, ihr betagter aber treuester Krieger, der schon lange im Dienste ihrer Familie stand, fand sie in der Kirche kniend. »Mylady! Drachenschiffe!«
Einen Augenblick lang dache sie, er hätte den Verstand verloren. »Drachenschiffe?«, wiederholte sie.
»Am Horizont. Sie segeln direkt auf uns zu!«
»Aus dem Osten?«
»Ja, aus dem Osten.«
Rhiannon sprang auf, lief durch die Kapelle und dann die Stufen zu der hölzernen Brüstung hinauf, die das Herrenhaus umgab. Sie eilte die Brüstung entlang und starrte auf das Meer hinaus.
Sie kamen. Genauso wie Egmund es gesagt hatte.
Übelkeit stieg in ihr auf. Vor Panik und Todesangst fing sie fast zu weinen an. Ihr ganzes Leben lang hatte sie gekämpft. Die Dänen waren wie ein Schwarm Heuschrecken über England hergefallen und hatten Blutvergießen und Terror mit sich gebracht. Sie hatten ihren Vater getötet. Nie würde sie vergessen, wie sie ihn gehalten und versucht hatte, ihn wieder zum Atmen zu bringen.
Jetzt fielen sie sogar über ihr Zuhause her, und sie hatte niemand, um es zu verteidigen, weil ihre Männer mit Alfred gegangen waren. »Mein Gott!«, stieß sie hervor.
»Lauft, Mylady!«, beschwor Egmund sie. »Nehmt ein Pferd und reitet wie der Wind zum König. Wenn Ihr wie der Teufel reitet, könnt Ihr ihn morgen erreichen. Nehmt Euren Bogen und eine Eskorte mit, ich werde diese Festung ausliefern.«
Sie starrte ihn an und lächelte dann langsam. »Egmund, ich kann nicht weglaufen. Du weißt das.«
»Ihr könnt nicht bleiben!«
»Wir werden nicht kapitulieren. Kapitulieren bedeutet ihnen nichts – ganz egal, ob man kämpft oder nicht, sie verüben die gleichen Gräueltaten. Ich werde bleiben und kämpfen.«
»Mylady ...«
»Ich kann vielleicht viele von ihnen töten oder verwunden, Egmund. Du weißt das.«
Das wusste er tatsächlich; sie konnte es in seinen Augen lesen. Sie war eine bemerkenswerte Bogenschützin. Aber als er sie ansah, wusste sie auch, dass er immer noch das kleine Mädchen sah, das er jahrelang beschützt hatte.
Doch der alte Egmund sah sie keineswegs als Kind, sondern als Frau, und er hatte Angst um sie. Rhiannon war atemberaubend schön mit ihren betörenden silberblauen Augen und ihrem Haar in der Farbe eines goldenen Sonnenuntergangs. Sie war sowohl Alfreds Cousine als auch sein Patenkind. Auf seine Veranlassung hin hatte sie eine hervorragende Ausbildung genossen. Sie konnte sanft und zärtlich wie ein Kätzchen sein, aber sie konnte auch saftig auf die losen Reden der Männer herausgeben und mit ihnen lachen und war fähig, ohne große Mühen die riesigen Ländereien zu verwalten, die sie geerbt hatte. Sie wäre für jeden Wikinger eine lohnenswerte Beute, und Egmund konnte den Gedanken daran nicht ertragen.
»Rhiannon! Ich flehe Euch an! Ich habe Eurem Vater gedient ...«
Mit zwei Schritten stand sie neben ihm, schenkte ihm ein warmes, herzliches Lächeln und nahm seine beiden knorrigen Hände in die ihren. »Liebster Egmund! Um der Liebe Gottes willen, ich kann mir diesen Angriff aus dem Osten zwar nicht erklären, aber ich werde nicht kapitulieren. Und ich werde nicht zulassen, dass du hier für mich stirbst! Ich werde fliehen, wenn ich nichts mehr ausrichten kann. Du weißt genau, dass ich als Tochter meines Vaters jetzt nicht gehen kann, ehe ich nicht ein paar dieser Barbaren zur Hölle geschickt habe! Rufe Thomas und stelle fest, wie viele Männer uns noch zum Schutz zur Verfügung stehen. Warne die Leibeigenen und die Pächter. Schnell!«
»Rhiannon, Ihr müsst Euch in Sicherheit bringen!«
»Sorge dafür, dass mir mein Bogen und der Köcher mit den Pfeilen gebracht werden. Ich werde die Brüstung nicht verlassen, das schwöre ich!«, versprach sie ihm.
Da Egmund wusste, dass jedes weitere Wort sinnlos war, eilte er die Holzstufen hinunter und rief seine Befehle. Die gewaltigen Tore wurden umgehend geschlossen, die wenigen Krieger, die geblieben waren, bestiegen ihre Pferde, und die einfachen Bauern suchten sich Heugabeln und andere Geräte zur Verteidigung. Alle sahen entsetzt aus.
Die Brutalität der Wikinger war wohlbekannt.
Ein Junge brachte Rhiannon Pfeil und Bogen. Sie starrte auf das Meer hinaus. Der Himmel war noch grauer geworden, und der Wind tobte so heftig, als würden die Elemente den Schrecken vorhersagen, der bald über die Festung hereinbrechen würde. Sie sah die Schiffe und zitterte. Sie schloss die Augen und versuchte krampfhaft, sich nicht an die früheren Blutbäder der Wikinger zu erinnern. Sie hatte durch die Dänen so viel verloren, und nicht nur sie, ganz England. Auch sie hatte Angst, und doch musste sie kämpfen. Gefangen genommen oder getötet zu werden, ohne gekämpft zu haben, kam für sie nicht in Frage.
Der Angriff ergab keinerlei Sinn. Alfred hätte eigentlich etwas von den Bewegungen der Dänen wissen müssen. Er hätte sie warnen müssen.
Die Schiffe kamen immer näher. Himmel und Meer schienen nicht die Macht zu haben, sie aufzuhalten.
Rhiannon versagten vor Furcht fast die Beine ihren Dienst. Die Schiffe hatten schon fast das Ufer erreicht. Allein die Buge mit ihren scheußlichen Drachengesichtern genügten, um den meisten Menschen Angst einzuflößen. Die Seeleute hatten immer noch nicht angegriffen. Rhiannon betete darum, dass ihre Krieger zuerst eine Breitseite mit Pfeilen abfeuern konnten. Vielleicht konnten sie einige der Eindringlinge töten, ehe die Wikinger die Festung erreichten. Sie schloss die Augen für ein kurzes Gebet: Lieber Gott, ich habe Angst, steh mir bei!
Sie öffnete die Augen wieder. Auf dem Führungsschiff konnte sie einen Mann stehen sehen. Er war groß und blond und glitt über die aufgewühlten Wellen, ohne die Balance zu verlieren, die Arme hatte er über der Brust verschränkt. Offensichtlich war er einer der Anführer, von beeindruckender Größe, mit breiten Schultern, schmalen Hüften, ein muskelbepackter Krieger von Walhalla. Wieder überlief sie ein Angstschauer, dann zog sie einen Pfeil aus dem Köcher. Entschlossen spannte sie ihren Bogen.
Ihre Finger zitterten. Noch nie hatte sie versucht einen Menschen zu töten. Jetzt musste sie es tun. Sie wusste, was die Wikinger den Männern und Frauen bei ihren Überfällen antaten.
Ihre Finger wurden kraftlos und erneut überlief sie ein Schauer. Ihr Mund wurde trocken; und eine erschreckende Hitze breitete sich in ihr aus. Sie schloss die Augen und holte tief Luft, und als sie sie wieder öffnete, verstand sie nicht mehr, was über sie gekommen war. Doch der Wind schien ihr zuzuflüstern, dass der goldblonde Wikinger ein Teil ihres Schicksals sein würde.
Ungeduldig schüttelte sie dieses Gefühl ab und schwor, dass sie nun nicht mehr zittern würde. Es war schwierig, auf einen Menschen zu zielen mit dem Vorsatz, ihn zu töten, doch sie musste sich nur an den Tod ihres Vaters erinnern.
Wieder prüfte sie ihren Bogen, und jetzt waren ihre Finger bemerkenswert ruhig. Töte den Anführer, hatten ihr Vater und Alfred ihr oft genug gesagt, und die Männer hinter ihm werden sich in alle Winde zerstreuen. Dieser blonde Riese war einer ihrer Anführer. Sie musste ihn töten. Und das war es, was das Geflüster von Schicksal zu bedeuten hatte.
Eric von Dubhlain hatte keine Ahnung, dass seinem Leben in diesem Augenblick von irgendjemand Gefahr drohen könnte. Er war nicht gekommen, um Krieg zu führen, sondern auf Grund einer Einladung von Alfred von Wessex.
Eric stand groß und mächtig und kraftvoll da, hob sich wie ein goldener Gott gegen den dunklen Himmel ab, einen Stiefel fest gegen den Bug gestemmt. Der Wind zauste sein Haar, und es leuchtete genauso golden wie die Blitze, während seine Augen von glänzendem Kobaltblau waren. Seine Gesichtszüge waren männlich markant und von unversöhnlicher Schönheit. Er hatte hoch angesetzte, breite Backenknochen, seine Augenbrauen überwölbten in perfektem Bogen die Augen, sein Kinn war hart. Sein breiter und empfindsamer Mund war fest geschlossen, als er das Ufer betrachtete. Sein Bart und Schnurrbart waren sorgfältig geschnitten und gepflegt, die Farbe war rötlicher als die seines Haupthaares. Seine Haut hatte einen attraktiven Bronzeton. Er trug einen karmesinroten Umhang, der mit einer Saphir-Brosche zusammengehalten wurde. Er brauchte keine kostbare Kleidung, um seine noble Herkunft zu demonstrieren. Allein seine Statur und sein Selbstvertrauen brachten die Menschen zum Zittern. Für Frauen jeder Rasse und Herkunft war er eine aufregende, anziehende Erscheinung. Er war mit außergewöhnlicher Muskelkraft gesegnet, die in der Breite seiner Schultern, dem gewaltigen Umfang seiner Brust und in der Stärke seiner Oberschenkel lag. Sein Bauch war flach und hart. Seine Beine, mit denen er ohne Schwierigkeiten das harte Schlingern des Schiffes ausglich, waren gestählt von vielen Jahren auf See und vom jahrelangen Reiten, Rennen, Kämpfen und dem gesamten Leben eines Wikingers.
Doch er war keinesfalls der typische Wikinger, denn er war ein Kind zweier Rassen, der irischen und der normannischen. Sein Vater, der große Lord der Wölfe, regierte als König in der irischen Stadt Dubhlain. Olaf, der König von Dubhlain, war früher auch ein richtiger Wikinger gewesen. Aber er hatte sich in das Land und in sein irisches Weib verliebt, und er hatte einen ungewöhnlichen Friedensvertrag mit Erics Großvater geschlossen, dem großen Ard-ri oder Hoch-König von Irland. Erics Großvater mütterlicherseits, Aed Finnlaith, regierte immer noch in Tara über alle irischen Könige, und weit weg, im eisigen Norwegen, regierte der Vater von Erics Vater als Oberhaupt der Normannen. Eric hatte eine umfassende Erziehung genossen. Er hatte in großen Klöstern bei irischen Mönchen studiert, und er hatte alles über den Gott der Christen und Christus gelernt, über das Schreiben und über die Literatur. Von Mergwin, dem Druiden, hatte er gelernt, den Bäumen, dem Wald und dem Wind zuzuhören.
Aber er war der zweite Sohn. Er war mit seinem Vater und mit seinem älteren Bruder in die Schlacht gezogen, und er liebte seine irischen Verwandten, aber er war auch genauso stolz auf seine nordische Abstammung. Auch seine nordischen Onkel hatten ihn auf viele Reisen mitgenommen, dort hatte er eine ganz andere Art der Erziehung genossen.
Die eines Wikingers.
Er war zivilisiert aufgezogen worden, denn viele Menschen betrachteten diese Zeit als das »goldene« Zeitalter von Irland.
Er war aber auch mit jenen Raubzügen aufgewachsen, durch deren Wildheit die Wikinger in ganz Europa und Asien und sogar in Russland berühmt geworden waren. Es gab keine besseren Navigatoren als die Normannen. Es gab auch keine wilderen Kämpfer. Und es gab keine brutaleren Männer als sie.
Heute kam Eric nicht, um zu kämpfen. Obwohl er in seiner Jugend mit den besten Kämpfern als Wikinger über die Meere gezogen war, hatte er auch eine andere Vorliebe kennen gelernt, die für das Land.
Eric war damals auf See geschickt worden, als er noch ein Knabe gewesen war. Er befand sich in Begleitung seines Onkels, nach dem er benannt worden war. Mit den besten Männern seines Großvaters väterlicherseits hatte er endlose Meere, Flüsse und Landstriche überquert. Er war auf dem Dnjepr gesegelt, hatte die Tore von Konstantinopel durchschritten und hatte die Lebensgewohnheiten moslemischer Prinzen kennen gelernt. Er hatte sich Wissen über verschiedene Kulturen und Völker angeeignet, und er hatte zahllose Frauen gehabt, die er entweder erobert oder eingetauscht hatte. Ein Wikinger zu sein war seine Lebensauffassung gewesen. Es war das, was er tat, und das, was er darstellte.
Die Veränderung war weder schnell noch einfach gekommen. Es war eher wie das langsame Schmelzen des Schnees im Frühling gewesen, das nach und nach in sein Herz und in sein ganzes Sein eindrang.
Es hatte an der Küste von Afrika begonnen, wo sie gegen den Kalifen von Alexandria gekämpft hatten und die Menschen gekommen waren, um mit Gold für ihr Leben und ihre Freiheit zu bezahlen.
Sie war ein Geschenk gewesen.
Ihr Name war Emenia, und sie wusste nichts von Boshaftigkeit und Hass. Sie hatte ihm alles über den Frieden beigebracht. Er hatte nur Gewalt gekannt, und sie hatte ihn Zärtlichkeit gelehrt. Ihr waren die meisten der exotischen Arten der Liebeskunst im besten Harem des Landes beigebracht worden, aber es war die süße Schönheit ihres Herzens, ihre absolute Hingabe an ihn, die ihn dazu gebracht hatten, sie zu lieben. Sie hatte riesige, mandelförmige Augen und Haar, das so schwarz war wie die Nacht und ihr weit über den Rücken fiel. Ihre Haut hatte die Farbe von Honig, und sie schmeckte auch danach und nach anderen, süßen Gewürzen, und sie hatte nach Jasmin gerochen.
Sie war für ihn gestorben.
Der Kalif hatte Verrat im Sinn gehabt. Emenia hatte davon gehört und versucht, ihn zu warnen. Später hatte er erfahren, dass die Männer des Kalifen sie bei ihrem wundervollen schwarzen Haar gepackt hätten, als sie durch die Hallen des Palastes zu ihm eilen wollte.
Sie hatten sie umgebracht, um sie am Reden zu hindern, sie hatten ihr die Kehle durchgeschnitten.
Eric war vorher niemals das gewesen, was die Wikinger einen Berserker nannten – einen Kämpfer, der grundlos und ohne zu überlegen mordet, nur auf Grund einer wilden Lust am Tod. Eric glaubte, dass ein kühler Kopf in einer Schlacht mehr nützte, und hatte nie Geschmack daran gefunden, sinnlos zu töten.
Aber in dieser Nacht war er zum Berserker geworden.
Er hatte sich auf die Suche nach ihren Mördern gemacht, allein, voller Wut, und hatte die Hälfte der Leibwache des Kalifen hingemetzelt, bis sich der Herrscher ihm zu Füßen warf und beschwor, dass er niemals Emenias Tod angeordnet hatte, nur den von Eric. Indem er sich an Emenias Liebe zum Leben und Frieden erinnerte, hatte Eric es irgendwie geschafft, dem Kalifen nicht die Kehle mit dem Schwert aufzuschlitzen. Er hatte von Neuem den Palast geplündert und hatte dann an ihrem geliebten Körper gewacht; dann hatte er dem heißen, kargen Land den Rücken gekehrt.
Das war schon so lange vorbei. Viele kalte Winter und viele neue Sommer waren seitdem ins Land gegangen, und zu allen Jahreszeiten hatte es wieder Gewalttätigkeiten gegeben. Doch daneben hatte er entdeckt, dass Emenia in ihm etwas Ähnliches wie einen ständigen Wunsch nach Frieden geweckt hatte, und sie hatte ihm auch einiges über Frauen beigebracht.
Eric war sowohl Ire als auch Wikinger. Und so wie sein Vater sich seine Heimat vom Land abgerungen hatte, so wollte auch Eric das Gleiche tun.
Sie waren alle Kämpfer. Sogar seine sanfte, schöne irische Mutter hatte einen unbezähmbaren Stolz. Sie hatte es sogar einmal gewagt, blanken Stahl gegen den Wolf zu erheben. Heute lachte sie darüber, aber Mergwin wurde es nie müde, die Geschichte zu erzählen.
Olaf von Norwegen war nach Irland gesegelt, um Eroberungen zu machen. Für die Iren und für ihren Ard-ri war er ein ungewöhnlicher Eroberer gewesen, der sich zwar Land aneignete, aber dafür nur wenig Menschenleben aufs Spiel setzte; der alles wieder aufbaute, sobald er das Land, das er sich angeeignet hatte, befriedet hatte. Es kam zum Patt zwischen dem nordischen Eindringling und dem irischen Hoch-König. Erin und Dubhlain waren der Preis, den sein Vater für den Frieden bekam. Erics Mutter, die einmal versucht hatte, Olaf gefangen zu nehmen, als er verwundet war, war über diesen Handel entsetzt. Damals war sie zwar dem Wolf entkommen, als er den Spieß umdrehen und sie gefangen nehmen wollte, aber es war ihr nicht möglich, dem Willen ihres Vaters zu entkommen.
Eric lächelte, wenn er an seinen Vater dachte.
Olaf hatte Irland viel mehr gegeben, als er genommen hatte. Er hatte Aed Finnlaith gedient und mit ihm gegen Friggid, den grimmigen dänischen Eindringling, gekämpft. Und während dieses Kampfes war er selbst ein Ire geworden.
Als es darauf ankam, Heim und Familie zu beschützen, hatten Olaf und seine irische Braut eine Liebe entdeckt, die genauso tief brannte wie ihre Leidenschaft.
Erics Lächeln wurde grimmig. Er war sich sicher, dass ihm der Hass auf die Dänen angeboren war. Und er war gebeten worden, hier in England gegen sie zu kämpfen.
Alfred, der Sachsen-König der Engländer, hatte ihn darum gebeten.
Rollo, Erics Kampfgenosse und seine rechte Hand, sprach ihn plötzlich von hinten an: »Eric, das ist aber ein seltsames Willkommen.« Rollo, der so massig war wie eine alte Eiche, deutete von hinten über Erics Schulter auf das Ufer. Eric runzelte die Stirn. Wenn das ein Willkommen sein sollte, dann war es wirklich reichlich merkwürdig. Die großen, hölzernen Tore gegenüber des Hafens wurden geschlossen. Auf den Palisaden nahmen bewaffnete Männer ihre Positionen ein.
Kalte Wut stieg in Eric empor, und seine Augen glitzerten in tiefblauem Zorn. »Das ist eine Falle!«, murmelte er leise.
Und so schien es tatsächlich zu sein, denn als seine Schiffe in den Hafen einliefen, konnte er das heiße Öl riechen, das erhitzt wurde, um es von den Mauern der Festung auf sie zu gießen.
»Bei Odins Blut!«, brüllte er angesichts dieses Verrates, und Wut trübte seinen Blick. Alfred hatte Boten zum Hause seines Vaters gesandt. Der englische König hatte ihn um sein Kommen gebeten, und jetzt das. »Er hat mich hinters Licht geführt. Der König von Wessex hat mich verraten.«
Bogenschützen tauchten auf der Brüstung auf. Sie zielten auf die einlaufenden Seefahrer. Eric fluchte abermals, kniff die Augen zusammen und hielt inne.
Irgendetwas fing das Licht der Blitze ein. Er stellte fest, dass auf der Brüstung eine Frau stand, und dass das goldene Aufblitzen von ihrem Haar verursacht wurde, das weder blond noch rot oder haselnussfarben war, sondern einen feurigen Ton hatte, der irgendwie eine Mischung aus allen drei Farben war.
Sie stand zwischen den Bogenschützen und rief Befehle.
»Bei Odin! Und bei Christus und allen Heiligen!«, fluchte Eric abermals.
Ein Pfeilhagel flog ihnen entgegen. Eric konnte dem Pfeil, den die Frau auf ihn abschoss, kaum ausweichen. Doch er duckte sich, und der Pfeil polterte harmlos gegen den Bug. Von verwundeten Männern waren Schreie zu hören. Eric presste voller Wut die Kiefer aufeinander. Dieser Verrat machte ihn krank.
»Wir werden jetzt gleich anlegen«, warnte Rollo ihn.
»Das ist in Ordnung!«
Eric wendete sich seinen Männern zu, seine Augen und seine Haltung zeigten den eisig-blauen Anflug arktischen Zorns. Er hatte gelernt, mit Selbstkontrolle zu kämpfen und zu gewinnen, und er gab sich nie seinen Gefühlen hin. Sie waren stets nur an der schreckenerregenden Kälte seiner Augen und am Zusammenpressen seiner Zähne zu bemerken.
»Wir sind gebeten worden, hier zu kämpfen! Gebeten worden, einem rechtmäßigen König zu helfen!«, rief er seinen Männern zu. Er wusste nicht, ob seine Worte bis zu den anderen Schiffen drangen, aber sein Zorn würde es. »Wir sind verraten worden!« Er stand ganz still und hob dann sein Schwert. »Bei den Zähnen Odins und bei dem Blute Christi! Beim Hause meines Vaters, wir werden uns nicht verraten lassen!«
Er hielt inne.
»Seid Wikinger!«
Der Ruf erhob sich und brüllte gegen den Wind an.
Die Schiffe landeten. Rollo zog seine doppelschneidige Axt, die fürchterlichste Waffe der Wikinger. Eric zog sein Schwert. Er hatte ihm den Namen Vengeance, die Rache, gegeben, und genau das hatte er vor, Rache zu nehmen.
Die Kiele der Wikingerschiffe kratzten über den Sand, und Eric und seine Männer sprangen in ihren pelzbesetzten Stiefeln in das seichte Wasser. Ein Horn ertönte, und der Kriegsschrei begann zunächst als Ruf, um dann in ein Gänsehaut erzeugendes Trillern überzugehen. Die Wikinger waren da.
Plötzlich öffneten sich die Tore der Festung. Reiter erschienen. Sie waren, wie Erics irische und norwegische Männer, mit den tödlichen, zweischneidigen Streitäxten bewaffnet, mit Piken und Schwertern und Kriegskeulen. Aber sie waren keine Gegner für die überwältigende Wut der Wikinger und Erics abgrundtiefen Zorn.
Eric kämpfte niemals wie ein Berserker. Sein Vater hatte ihm vor langer Zeit beigebracht, dass man seinen Ärger unter Kontrolle halten und eiskalt handeln musste. Und so focht er kalt und gnadenlos, tötete den ersten Angreifer und stieß ihn vom Pferd. Die Angreifer kämpften tapfer, und inmitten des Schlachtgetümmels dachte Eric, was das Ganze für eine erschütternde Verschwendung von Menschenleben sei. Es gab nur ein paar professionelle Kämpfer, offensichtlich Männer aus der Truppe des Königs, so genannte »Carls«.
Die meisten aber waren einfache Bauern, Pächter und Leibeigene, die mit Hacken und Pickeln und was sie sonst noch an Gerätschaften hatten finden können, kämpften.
Sie starben schnell, und ihr Blut tränkte die Erde. Immer mehr Wikinger saßen auf eroberten Pferden, immer mehr Männer von Wessex lagen tot im Dreck.
Und immer mehr Schreie ertönten. Eric saß inzwischen auf einem Fuchs, den er einem der Gefallenen abgenommen hatte, und schwang sein Schwert namens Rache. Er warf den Kopf zurück und ließ den blutgerinnenden Schlachtruf des Königlichen Hauses von Vestfald ertönen.
Blitze zuckten über den Himmel, und Regen setzte ein. Die Männer schlitterten und glitten im Schlamm aus, und doch ging der Kampf immer weiter. Eric lenkte sein Pferd zu den Toren. Er wusste, dass Rollo und seine Gruppe ihm folgen würden. Über ihnen standen immer noch die Bogenschützen. Doch Eric beachtete den fliegenden Tod nicht und befahl, dass vom Schiff ein Rammbock geholt werde. Trotz der Pfeile und des siedenden Öls, das von oben auf sie gekippt wurde, wurde die Barriere schnell durchbrochen. Die Wikinger ergossen sich in die Stadt. Es folgte ein heftiger Kampf Mann gegen Mann, und jeder Augenblick brachte Erics Männer dem Sieg näher. Er rief in englischer Sprache, dass die Männer ihre Waffen niederlegen sollten. Jetzt begann die Plünderung – man führt nicht einen derartigen Haufen von Kriegern über das Meer, lässt sie kämpfen, und erwartet dann, dass sie dafür keine Belohnung haben wollen. Aber Erics Wut begann zu verebben, und seine Blutgier verschwand. Er konnte nicht verstehen, warum Alfred, der weit und breit als großer Kämpfer und weiser König bekannt war, ihn derartig betrogen haben sollte. Es ergab einfach keinen Sinn.
Immer mehr Männer legten ihre Waffen nieder, viele der Gebäude gingen in Flammen auf. Die Brüstung wurde niedergerissen, und der Festungswall war praktisch nur noch eine Ruine. Eric befahl Rollo, sich um die Überlebenden zu kümmern. Sie würden seine Sklaven werden. Als er Hilferufe hörte, lenkte er sein Pferd herum. Er wusste, dass seine Männer jetzt über die Mädchen und Frauen der Stadt herfielen.
Er galoppierte zum niedergerissenen Festungswall. Ein paar seiner Männer umkreisten ein dunkelhaariges Mädchen, das nicht älter als sechzehn Jahre war. Ihr Kleid war zerrissen, und sie schrie und jammerte voll verzweifelter Angst.
»Hört auf!«, befahl Eric. Er saß auf seinem großen Gaul und blickte auf die Szene hinunter. Sein Ton war ruhig, aber zwingend, und seinem Befehl folgte sofortiges Schweigen. Als jeder, außer dem schluchzenden Mädchen, still war, ließ er seinen eisigen Blick über alle wandern und sagte dann: »Wir sind hier in eine Falle gelockt worden, aber ich muss immer noch herausfinden, warum. Ich verbiete Euch, diese Leute, ob Mann oder Frau, zu missbrauchen oder zu misshandeln, denn ich beanspruche sie und diesen Ort für mich. Wir werden die Reichtümer der Stadt mitnehmen und sie unter den Männern gerecht aufteilen. Aber es wird niemand ermordet, und die Felder werden nicht verwüstet, denn wir werden dieses Stück Land an der Küste von Wessex in Besitz nehmen.«
Das Mädchen hatte die norwegische Sprache, in der er gesprochen hatte, nicht verstanden, aber es schien zu begreifen, dass ihm Gnade gewährt worden war. Und so rannte es schlitternd und taumelnd durch den Dreck zu ihm, immer noch mit Tränen in den Augen, und küsste Erics Stiefel.
»Nicht, Mädchen ...«
Er fasste ungeduldig nach ihrer Hand und sprach jetzt in Englisch. Sie blickte mit ihren dunklen Augen zu ihm empor, und er schüttelte abermals den Kopf. Er winkte Hadraic zu sich, einen seiner Hauptmänner, damit er sich um sie kümmere.
In dem Augenblick, in dem der Wikinger-Hauptmann seinem Befehl gehorchte, klang ein Schwirren durch die Luft. Das Pferd wieherte und fiel zu Boden, und Eric machte sich klar, dass der Pfeil eigentlich ihm gegolten hatte. Während das Pferd zu Boden ging, ließ sich Eric schnell aus dem Sattel gleiten und starrte die Gebäude an, die brennenden und die unversehrten. Ein Wutschrei ging durch die Reihen seiner Männer. Und schon flog ein zweiter Pfeil. Ein brennender Schmerz durchzuckte Erics Oberschenkel, in den der Pfeil gefahren war. Er warf den Kopf zurück, biss die Zähne zusammen, und langte nach dem Pfeilschaft. Seine Männer rannten auf ihn zu. Er ging hinter dem sterbenden Pferd in Deckung und stoppte sie mit einer Handbewegung. Schwitzend und zitternd packte er den Schaft und zog daran. Ein durchdringender Schmerzensschrei entrang sich seiner Kehle, dann war der Pfeil draußen. Blut floss über seine Hände, und Schwärze drohte über ihm zusammenzuschlagen. Sekundenlang befürchtete er, dass er bewusstlos im Schlamm zusammenbrechen würde.
Doch die Wut belebte ihn wieder. Er riss ein Stück seines Umhangs ab, verband die Wunde, und kam taumelnd wieder auf die Beine. Seine Zähne waren fest zusammengepresst, und seine eisigen Augen glitten übe die Umgebung. Hinter seinem Rücken lag ein zweistöckiges Gebäude. Es brannte nicht, und im zweiten Stock gab es ein Fenster, aus dem ein Meuchelmörder gut auf ihn hätte zielen können.
»Nicht so schnell, Eric ...«, rief ihm Rollo zu. Aber Eric hob eine Hand und schüttelte den Kopf. »Nein, ich will diesen hinterhältigen Meuchelmörder finden und ihm seinen Lohn geben.« Dann deutete er auf das gestürzte Pferd. »Habt Gnade mit diesem Tier und erlöst es von seinen Schmerzen.«
Er marschierte auf das Gebäude zu, nicht achtend der Gefahr, dass ein weiterer Pfeil abgeschossen werden könnte. Wut trübte jetzt seinen Blick, aber er wusste, dass niemand hinter dem Fenster kauerte. Wer auch immer ihn angegriffen hatte, würde jetzt sein Heil in der Flucht suchen, aber es würde kein Entkommen geben.
Er stürmte in das Gebäude. Es war ein schönes Herrenhaus, mit einer großen Eingangshalle und mehreren Wappenschildern an den Wänden. Mitten im Raum war ein großer Feuerplatz mit einem nach oben offenen Kamin. Durch den Kamin fielen Regentropfen zischend auf die Steine, die den Feuerplatz umgaben.
Eric drehte sich um und betrachtete die Treppe.
Sein Angreifer ging sicher davon aus, dass er die Treppe nehmen würde. Der Mann versteckte sich zweifellos hier irgendwo und wartete darauf, ihm in den Rücken fallen zu können, sobald er sich umdrehte.
Eric ging nicht zur Treppe.
Er besah sich den Raum und entdeckte einen schön gedeckten Tisch mit Platten und Bechern und Kannen mit Ale und Met. Hinkend stolperte er mit seinem verletzten Bein darauf zu und nahm einen tiefen Schluck Met.
Er wartete, und nach einiger Zeit wurde sein Warten belohnt. Während er durch die Halle zu einer Vorratskammer blickte, sah er unter einem Tisch, der mit einem Tuch verhängt war, eine kaum wahrnehmbare Bewegung. Unauffällig bückte er sich, um sein Messer aus der Scheide am Stiefel zu ziehen. Langsam näherte er sich dem Vorratsraum. Er bewegte sich so, als hätte er kein bestimmtes Ziel. Dann riss er blitzschnell das Tuch vom Tisch und bereitete sich darauf vor, den Mann darunter zu überwältigen.
Er fluchte, als ihm eine Mehlwolke ins Gesicht flog und ihn blendete. Ein hastiges Geräusch machte ihn sicher, dass der Mann zu fliehen versuchte. Er ignorierte den Schmerz in seinem Bein und in seinen Augen, und warf sich auf den fliehenden Mörder. Seine Hände schlossen sich um einen Arm und er drückte den Mann ohne Schwierigkeiten zu Boden. Schwer ließ er sich auf seinen Angreifer fallen und hob schnell das Messer, bereit ihm den Tod zu geben.
Dann hörte er den Schrei einer Frau und sah, dass er die Frau gefangen genommen hatte, die er schon auf der Brüstung gesehen hatte, das Wesen mit dem feurigen Haar und den tödlichen Pfeilen. Eric hielt inne.
Zitternd lag sie unter ihm und verbiss sich einen weiteren Schrei, ärgerlich darüber, dass sie überhaupt geschrien hatte. Ihre Augen waren voller Tränen, die sie aber nicht weinen würde. Die Iris war blaugrau, fast silbern, und obwohl ihre Haarfarbe diese seltsame Mischung aus Sonne und Feuer war, wurden ihre Augen von mitternachtsschwarzen Wimpern umsäumt. Sie war sowohl wunderschön als auch aufregend. Ihre Haut war zart, mit einer Tönung wie cremiges Elfenbein und genauso weich wie ein Rosenblatt. Nach Atem ringend lag sie unter ihm, ihre Brüste hoben und senkten sich. Ihre makellosen Umrisse waren durch die weiche, straffgespannte Wolle ihrer pelzbesetzten Tunika zu erkennen. Er betrachtete gerade die zarten Kurven ihres Mundes, als sie plötzlich die Lippen öffnete und ihn anspuckte.
Er lehnte sich zurück, seine Schenkel umklammerten fest ihre Hüften, und mit einer schnellen Bewegung brachte er sein Messer an ihre Kehle. Er sah, wie sich ihr Puls beschleunigte, dann schluckte sie. Er wischte sich die Spucke aus dem Gesicht und reinigte seine Hand an ihrer Brust. Er fühlte, wie sie zurückzuckte und wurde sich ihrer überwältigenden, geschmeidigen Weiblichkeit unter dem Kleidungsstück bewusst.
»Ihr habt mich schwer verletzt, Madame«, sagte er zu ihr in ihrer Sprache. Er sprach leise. Sie schien seine Tödlichkeit zu spüren, und doch schien ihr das egal zu sein.
»Ich wollte dich eigentlich töten, Wikinger«, antwortete sie leidenschaftlich.
»Dann allerdings habt Ihr voll danebengeschossen«, verspottete er sie. Er strich mit dem Messer über ihre Wange und ließ die eiskalte Klinge wieder auf ihre Kehle fallen. Er fühlte, wie sie zitterte, und drehte die Klinge weg. Er erhob sich und zog sie auf die Beine. Das Ergebnis dieser Bemühung war, dass seine Wunde wieder zu bluten anfing. Es wurde ihm schwarz vor Augen. Er hätte diese Wunde von seinem Leibarzt säubern und verbinden lassen sollen, ehe er sich dem Feind stellte. Ganz egal, ob dieser Feind aus zehn Männern mit Schwertern und Kriegskeulen bestand oder aus diesem feuerhaarigen jungen Luder. Sie wusste, wie man einen Bogen spannte, und ein Blick in ihre silbrigen Augen versicherte ihm, dass sie nur auf ein Anzeichen von Schwäche wartete. Sie zitterte zwar, aber ihre Augen glühten weiterhin voller Hass.
Ganz plötzlich stieß sie ihm voller Wut und Bösartigkeit das Knie in den Unterleib. Der Atem blieb ihm bei dem schneidenden Schmerz fast stehen, es wurde ihm wieder schwarz vor Augen, aber er ließ sie nicht los. Er krallte weiterhin seine Finger um ihr Handgelenk, und als er auf der Suche nach einem der Stühle an der Festtafel zurückstolperte, zog er sie mit sich. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und zwang sie dabei vor sich auf die Knie. In diesem Augenblick hätte er sie am liebsten umgebracht. Er wünschte sich, sie so hart zu schlagen, dass ihr Genick brach. Er rang keuchend nach Luft und zwang sich, die Augen zu öffnen. Einen Moment lang, der so kurz war, dass er schon fast dachte, er hätte ihn sich eingebildet, sah er reine, nackte Angst in ihren Augen, wie bei einem Fasan, der sich in einer Falle gefangen hatte. Der Ausdruck verschwand schnell, und er beherrschte sich so weit, dass er sie nicht schlug. Doch er war sich sicher, dass sie das Ausmaß seines Zorns erkannt hatte, denn jetzt fing sie verzweifelt an, gegen seinen Griff anzukämpfen, um sich zu befreien. Er ertappte sich dabei, dass er diese Rangelei fast vergaß, weil er so in ihren Anblick versunken war. Sie war von ungewöhnlicher Schönheit, mit zarten, wundervoll modellierten Gesichtszügen, einem langen, geschwungenen Hals und dem aufregenden Goldgespinst ihres schimmernden Haares. Offensichtlich war sie von vornehmer Herkunft: das feine Leinen, die zarte Wolle und der Pelz, den sie trug, waren Beweise für ihren hohen Stand.
Er betrachtete sie zu lange. Sie wartete nur darauf, dass sich sein Griff etwas lockerte. Sie biss ihn in die Hand, er ließ ihr Handgelenk los, packte dafür aber ihr Haar und lächelte grimmig, als sie vor Schmerz aufschrie. Sie war zwar sehr schön, aber sie war auch flink und hinterlistig – und unübersehbar sein Feind. Er zog sie dicht an sein Gesicht, seine Augen bohrten sich wie gnadenlose Klingen in die ihren. »Was ist hier geschehen?«, fragte er sie.
»Was geschehen ist?«, erwiderte sie. »Ein Haufen blutgieriger Krähen kam vom Meer her gesegelt.«
Er verstärkte seinen Griff und zog sie noch näher heran. »Ich wiederhole, Lady, was ist hier geschehen?«
Tränen hingen an ihren Augenlidern. Sie krallte sich an seine Finger, und ihre Hand rutschte an seinem Blut ab. Unbeabsichtigt hatte sie seine Schwachstelle entdeckt, und sie schlug ihn sofort auf den verwundeten Oberschenkel.
Sterne explodierten vor seinen Augen. Sein Griff lockerte sich. Er war dabei, ohnmächtig zu werden. Er zwang sich dazu, nach vorne zu fallen, um sie unter sich zu begraben. Er kämpfte darum, bei Bewusstsein zu bleiben, und sie rollten zusammen über den Boden. Ihre Beine verhakten sich ineinander, und eine Bewegung seines Schenkels riss ihre Tunika in voller Länge auf. Voller Wut und Angst stieß sie einen Schrei aus. Überrascht von völlig unerwarteten Gefühlen, ließ Eric seine raue Kriegerhand über ihr nacktes Fleisch gleiten. Er stellte fest, dass es sich zart und seidig anfühlte. Sie keuchte und würgte und kämpfte wie eine Wilde, und seltsamerweise fühlte er, wie Begierde in ihm entbrannte, denn ihre Schenkel waren warm und geschmeidig. Die ganze Zeit über hatte er nicht an Fleischeslust gedacht, nicht einmal dann, als er die Schönheit ihrer Augen festgestellt oder die erotische Berührung ihres Haares gefühlt hatte. Aber jetzt, bei ihren Brüsten, die er unter seinem Kettenhemd fühlte, und seiner Hand, die er gegen das zarte Fleisch der Innenseite ihres Schenkels presste, stieg plötzlich heiße Begierde in seinen Lenden auf.
Er biss die Zähne zusammen und sah, dass sie ihre Augen alarmiert aufriss. Sie versuchte sich herumzurollen, sie fluchte und kämpfte wie eine Wildkatze. Sie zerkratzte ihn mit ihren Nägeln, bis er ihre Handgelenke packte, sie über ihrem Kopf auf den Boden presste und sie mit seinen eisigblauen Augen anstarrte.
Er hatte Rollo befohlen, dicht hinter ihm zu bleiben, aber wo, in Walhallas Namen, war der Kerl jetzt? Eric brauchte ihn. Seine Kraft nahm mit jeder Sekunde weiter ab, und er hatte eine gewaltige Menge Blut verloren. Er hatte gegen zahllose Männer gekämpft und nie auch nur einen Kratzer davongetragen, aber dieses Luder mit den silberblauen Augen hatte ihn fast fertiggemacht. Ein kleiner Seufzer entfuhr ihr. Sie bewegte ihre Augen, um ihn nicht anzustarren, und er sah, dass sie sich in die Unterlippe biss.
»Dafür wirst du sterben!«, stieß sie plötzlich wütend hervor.
»Dafür? Für was denn genau, Mylady? Dafür, dass ich an Eurer Küste gelandet bin, oder dafür, dass ich mich geweigert habe zu sterben, trotz Eurer Schießkünste? Oder dafür, dass ich Euch so berühre ...?« Er verlagerte sein Gewicht, kämpfte gegen die Dunkelheit, die über ihm zusammenzuschlagen drohte, und ließ seine Finger sanft über das bloße Fleisch der Innenseite ihres Schenkels gleiten.
Zornesröte stieg in ihr Gesicht, vielleicht auch andere Gefühle, und er lachte. Dann durchfuhr ihn wieder der Schmerz. Sie hatte ihn mit ihrem verdammten Pfeil getroffen, hatte ihn getreten, gebissen und mit den Nägeln zerkratzt; und er war ein Narr, wenn ihm nicht klar war, dass auch ein schöner Feind ein tödlicher sein konnte. Er stählte sich gegen ihre Schönheit und gegen die wilde Begierde, die der erbitterte Kampf und die Begegnung mit ihrem zarten, nackten Fleisch in ihm entfacht hatten.
»Habt keine Angst, englische Hexe«, versicherte er ihr spöttisch, und ließ seine Hand ohne Scham über ihre Schenkel gleiten, gefährlich nahe der Stelle, an der ihre Beine sich trafen. »Ihr seid weder freundlich, noch zärtlich, noch aufregend, Mylady. Ich habe lediglich vor, Euch entweder zu töten oder zu versklaven, das ist alles. Wenn ich eine Frau begehre, dann ist sie genau das – eine ganze Frau, verlockend und verführerisch. Fordert mich nicht heraus, Madame, denn wenn ich Euch nehme, würde das tatsächlich gewissenlose Barbarei sein.«
»Was sonst kann man von einem Wikinger erwarten als Barbarei und Tod?«, entgegnete sie ihm.
Er knirschte mit den Zähnen, um den neuerlichen Wunsch, sie zu schlagen, niederzukämpfen. Er zwang sich dazu, leise zu lächeln. Lieber Gott, wo war Rollo? Er sah alles durch einen roten Nebel, aber selbst durch diesen Nebel war sie wunderschön ... und tödlich. Strähnen des feuriggoldenen Haares hatten sich um sie beide geschlungen, Haar, das so fein wie Frühlingsblumen war, so zart wie Wolken der feinsten Seide. Ihre blaugrauen Augen waren weit offen und bezaubernd, wenn man einmal von dem Ausdruck reinsten Hasses in ihnen absah.
Ihre Brüste hoben und senkten sich so heftig, dass sie fast aus dem Ausschnitt ihrer Tunika heraussprangen. »Vielleicht sollte ich Euch doch nehmen«, flüsterte er. Als er mit seinen Knöcheln ihre Wange berührte, drehte sie heftig den Kopf weg. Seine Finger wanderten über ihre Kehle, wölbten sich über ihrer Brust und liebkosten die sanften Hügel. Sein Daumen bewegte sich in rhythmischen Kreisen über ihre Brustwarze, die sich unter seiner Berührung versteifte. Sie holte tief Luft und warf den Kopf hin und her. Als sie ihn anblickte, waren ihre Augen weit offen und glänzend.
»Nein ... Wikinger!«, fauchte sie.
Er runzelte die Stirn und fragte sich, warum sie ständig auf seiner Wikinger-Abstammung herumhackte, wo er doch aus Irland gekommen war. Nicht, dass er die Beleidigung oder irgendeine Beleidigung seines Vaters oder der Abstammung seines Vaters dulden würde. Aber er war aus dem Land seiner Mutter gekommen.
Er hörte auf, sie zu necken, sein Zorn nahm wieder überhand. Er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. »Ich will wissen, was hier passiert ist!«, forderte er grollend.
Einen Augenblick lang starrte sie ihn völlig ruhig an. Er ließ ihre Handgelenke los und langte nach dem Messer, das außer Reichweite gefallen war. Er wollte es gerade in die Scheide stecken, als ihn wieder ein Schwächeanfall packte. Erneut strömte frisches Blut aus seiner Wunde.
Er kämpfte darum, bei Bewusstsein zu bleiben, seinen Kopf wieder klar zu bekommen. »Nein, Mylady«, begann er, »Ihr werdet mir jetzt sagen, wer der Lord dieses Ortes hier ist, und warum ...« Er brach ab. Alles drehte sich um ihn. Er lehnte sich nach vorne, versuchte die Dunkelheit wegzudrängen.
Er würde sterben. Der große Krieger, der Abkömmling des Wolfes, würde sterben, weil dieses junge Luder ihn töten würde, sobald er in Ohnmacht fiel.
»Oh!« Er fühlte, wie sie sich unter ihm bewegte. Sie stieß ihn herunter, und eine todesähnliche Lethargie überkam ihn. Sie kniete über ihm, starrte ihn an, sah das blaue Eis seiner Augen. Sie griff nach dem Messer. Seine Finger schlossen sich darum, aber jetzt war die Bewusstlosigkeit nicht mehr weit. Sie zerrte an seiner Hand, die die Klinge hielt. Er hörte ihre keuchenden Atemzüge, die hart und schnell und verzweifelt klangen. Sie hatte vor, ihn zu ermorden. Sie brauchte die Waffe.
»Mylord! Wo seid Ihr?«
Endlich kam Rollo. Pferdehufe klapperten auf dem Boden, hielten dann inne und Eric wusste, dass Hilfe im Anmarsch war. Fest umklammerte er das Messer.
Das Mädchen stand auf, die Ader an ihrer Kehle pulsierte heftig. Dann wendete sie sich zur Flucht.
Eric zwang sich aufzurichten, mit dem Messer in der Hand. Sie lief in die Halle und drehte sich dann um.
Einen Augenblick lang hatte er in dem Nebel, der ihn umgab, ihren Anblick vor Augen, eingebrannt in das sterbende Tageslicht. Großgewachsen und schlank und königlich, ihr glänzendes Haar umwogte sie wie eine atemberaubende, goldene Wolke.
Sie sah das Messer und seinen eisigen Blick und keuchte, den Rücken an die Wand gepresst. Er hielt ihr Leben in seiner Hand.
Sie wussten beide, dass er sie hier und jetzt töten konnte. Stattdessen zielte er sorgfältig und warf das Messer so, dass es nur durch ihr Gewand ging und den Stoff an die Wand heftete. Er traf das Gewand genau links von ihrem Herzen.
Er lächelte sie mit tödlicher Kälte an. »Ich bin ein Wikinger, genauso wie Ihr behauptet habt, aber Ihr lebt. Betet, Lady. Betet aus ganzem Herzen zu Eurem Gott, dass wir uns nie mehr wiedersehen.«
Ihre dichten Wimpern verbargen die Todesangst und den Hass in ihren Augen. Sie starrte ihn an, stieß einen Schrei aus, wirbelte herum, riss ihr Gewand aus der Klinge in der Wand und rannte davon.
Rollo stürmte durch die Tür herein. »Eric!«
»Hier bin ich!«, antwortete Eric. Rollo kam zu ihm, bückte sich und half seinem Anführer auf die Beine.
»Bring mich in ein Bett«, keuchte Eric, »hol meinen Arzt und bring mir einen großen Krug Ale oder Met.«
»So viel Blut!«, jammerte Rollo. »Schnell, wir müssen Eure Wunde verbinden. Ihr dürft nicht sterben, mein Prinz!«
Eric grinste Rollo grimmig an. »Ich werde nicht sterben, das schwör ich dir. Ich werde am Leben bleiben, um Rache zu nehmen für diesen Tag. Ich werde erfahren, was passiert ist, hier oder anderswo. Alfred von Wessex wird bald feststellen, dass er jetzt nicht mehr nur gegen die Dänen, sondern auch gegen die Normannen und Iren kämpfen muss.«
Hoch oben auf einem Hügel mit weißen Klippen, von dem aus man die Zerstörung der Stadt beobachten konnte, erhob sich ein junger Mann aus dem Dreck, brach durch das Laubwerk und rannte los. Mit schmerzenden Füßen jagte er auf einem alten römischen Pfad durch den Wald, bis er auf einer Lichtung auf zwei Männer zu Pferde traf. Die beiden waren Adelige aus Wessex, vornehme Lords des Königreiches. Der Ältere war in blaue Wolle und Hermelin gekleidet, der Jüngere in Waldgrün mit weißem Fuchsbesatz.
»Nun, mein Junge, erzähl mir, was passiert ist«, forderte ihn der ältere Edelmann auf.
Keuchend setzte der Jüngling zu sprechen an. »Es lief alles genau so, wie Ihr es gewünscht habt. Lord Wilton von Sussex führte die Schlacht an und fiel fast sofort den Klingen der Wikinger zum Opfer. Keiner wusste von der Einladung des Königs oder dass sich auf den Wikingerschiffen auch Iren befanden. Wilton und Egmund sind mit Sicherheit tot und können wunderbar als Verräter herhalten. Für die Stadtbewohner waren Wikinger die Angreifer. Die Stadt steht in Flammen. Die Einwohner, die nicht getötet wurden, sind gefangen genommen worden. Sie werden versklavt, die Frauen werden Huren.«
Der ältere Mann lächelte mit grausam verzogenen Lippen, und der jüngere der beiden Edelmänner fragte besorgt: »Und was ist mit den Ladies Adela und Rhiannon?«
»Adela entkam, wie es geplant war.« Der Junge machte eine Pause, da er den Zorn der beiden Männer fürchtete. »Aber Lady Rhiannon wollte die Männer nicht im Stich lassen, die ihr seit ihrer Geburt treu gedient haben; sie blieb und nahm an der Schlacht teil.«
Der jüngere Mann fing wütend zu fluchen an. Der Leibeigene fuhr schnell fort: »Sie wurde im Herrenhaus von einem der Wikinger gefangen genommen, aber etwas später sah ich, wie sie durch eine Seitentür des Hauses in die Wälder entkam.«
»Sie wurde von einem Wikinger gefangen genommen, sagst du?«
Der Jüngling nickte. »Aber sie entkam.«
»Tja ... aber noch rechtzeitig?«, beharrte der Ältere. Er blickte seinen Gefährten an, dem übel zu sein schien.
»Warum ärgerst du dich darüber? Ich bete darum, dass der Wikinger sie genommen hat, und zwar ohne Gnade! Ich verwette meinen Umhang, dass sie jetzt mein Angebot nicht mehr so verächtlich abweisen wird. Benutzt und weggeworfen von einem solchen Feind! Jetzt wird sie dankbar sein für die Krumen, die ich ihr anbieten werde.«
Der jüngere Mann blickte den älteren nicht an. »Du könntest dich täuschen«, meinte er, »sie liebt Rowan, und Rowan liebt sie. Sie wird keinen anderen akzeptieren.«
»Sie wird das machen, was ihr gesagt wird.«
»Nur der König kann ihr befehlen.«
Hartes und misstönendes Gelächter folgte auf diese Worte. »Ich bin sicher, dass ihr der König nach diesem Tag wirklich befehlen wird. Und ich bin auch sicher, dass er ihr nicht erlaubt, diesen jungen Habenichts zu heiraten. Los doch, die Tat ist vollbracht, und der Tag gehört uns. Wir müssen jetzt zum König reiten und ihm die grässlichen Neuigkeiten von den heutigen Ereignissen bringen.«
»Mylords!«, brachte sich der Jüngling, ihr Spion, in Erinnerung.
Der Ältere sah den Jungen mit verschlagenen zwinkernden Augen an: »Was willst du?«
»Meine Belohnung! Ihr verspracht mir eine Belohnung in Silber!«
»Das tat ich«, bestätigte ihm der Ältere.
Er trieb sein Pferd vorwärts, näher an den jungen Mann heran. »Bist du sicher, dass alle, deren Namen du genannt hast, auch wirklich tot sind?«
»Ich bin ganz sicher. Ich habe alle Eure Wünsche erfüllt. Ihr verspracht mir eine Belohnung.«
»So soll es sein.«
Der ältere Edelmann lächelte. Die Augen des Jünglings wurden groß vor Schreck, als er sah, dass der Edelmann nach seinem Schwert griff. Er hatte keine Zeit mehr zu schreien; sein Lebensfaden wurde zu schnell abgeschnitten. Er sank in einer großen Blutlache zu Boden.
Würgend protestierte der Jüngere: »Lieber Gott, war diese Grausamkeit wirklich nötig?«
»Ja.« Völlig unbeeindruckt wischte der Ältere das Blut von seinem Schwert. »Natürlich war das nötig. Denk an meine Worte: Wenn du Verrat begehst, mein Freund, dann lass keine Zeugen dafür zurück.«
Gefühllos lenkte er sein Pferd über den Körper am Boden. »Komm, wir reiten zum König.«
2. Kapitel
Rhiannons Herz hämmerte, ihre Beine taten weh, und ihre Lungen schmerzten so sehr, dass sie kaum mehr Luft bekam. Aber sie rannte immer weiter, hastete immer tiefer in den Wald hinein, immer weiter weg von der Stadt, die ihre Heimat und ihr Erbe gewesen war. Ihr ganzes Leben über hatte sie kämpfen müssen, aber noch nie war sie reinem Entsetzen und Verzweiflung so nahe gewesen wie heute.
Tief im Wald machte sie schließlich Rast. Sie kannte die Gegend gut und war froh, dass die Nacht hereinbrach. Sie entdeckte einen moosbewachsenen Felsbrocken und ließ sich darauf nieder, schnappte keuchend nach Luft und lauschte angestrengt, ob die Wikinger-Horde ihr auf den Fersen war. Schließlich beruhigte sich ihr Atem. Offensichtlich waren sie nicht hinter ihr her. Diese Anstrengung war sie ihnen nicht wert. Vielleicht wussten sie nicht, wer sie war; vielleicht war ihnen das egal.
Sie schauderte wieder.
Er hätte sie töten können. Und wenn er nicht so schwer verletzt gewesen wäre, hätte er sie verfolgt.