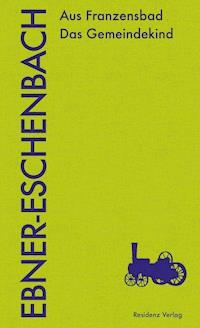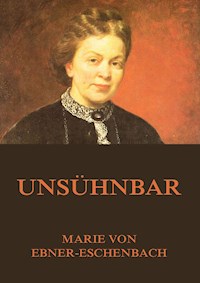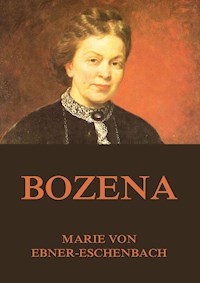Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Herr Hofrat - Marie von Ebner-Eschenbach - 1830 als Freiin von Dubsky auf Schloß Zdislavic bei Kremsier in Mähren geboren, genießt Marie eine klassische geistige Bildung, bereits mit siebzehn unternimmt sie erste literarische Versuche. Nach der Heirat mit ihrem Vetter Moritz Freiherr von Ebner-Eschenbach lebt sie bis 1856 in Klosterbruck in Mähren, danach bis zu ihrem Lebensende in Wien, wo sie 1879 eine Ausbildung als Uhrmacherin absolviert. Nach erfolglosen dramatischen Versuchen, veröffentlicht sie 1876 - ermutigt von Franz Grillparzer - den heute als eines ihrer Hauptwerke bekannten Roman über die Magd »Bozena«, der jedoch zunächst nur zögerlich Anerkennung findet. Ihren Durchbruch erreicht sie 1880 mit »Lotti, die Uhrmacherin«, der die größeren Erzählungen »Das Gemeindekind« und »Unsühnbar«, sowie die »Dorf- und Schloßgeschichten« (darin u.a. »Krambambuli«) folgen. Humanitär gesinnt schildert sie Adel wie Kleinbürgertum in so scharfsinniger wie kritischer Detailtreue. Marie von Ebner-Eschenbach ist als bedeutende Vertreterin des kritischen Realismus eine der großen Autorinnen des 19. Jahrhunderts. Von der Universität Wien zum Ehrendoktor der Philosopie ernannt und als erste Frau überhaupt mit dem Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet, stirbt sie am 12. März 1916 im Alter von 85 Jahren in Wien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PUBLISHER NOTES:
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
LyFreedom.com
Der Herr Hofrat
Eine Wiener Geschichte
»Ach, wenn Sie jetzt Ihre Manschetten ansehen wollten«, seufzte Frau Riesel, als der Hofrat die frischgedruckte Zeitung, die vor ihm auf dem Tische lag, mit beiden Händen glattgestrichen hatte.
Der Hofrat sah seine Manschetten nicht an; der kleine, hagere, etwas leberleidende Herr schnalzte ungeduldig mit der Zunge und murmelte einige für seine Hausdame sehr unverbindliche Worte.
Sie setzte sich still darüber hinaus. Das gelang ihr mit einem einzigen Schwung, und sie war dann moralisch so hoch placiert, daß keine Beleidigung sie zu erreichen vermochte.
Ihr Schweigen verdroß ihn: »Aha, Sie thronen schon wieder.«
»Das fällt mir nicht ein. Wie käme ich dazu?« Und sie hob einen Augenblick den Kopf, streckte den junonisch starken Hals, und die breite, hochgewölbte Büste trat majestätisch hervor. Dann stopfte sie ruhig und kunstvoll weiter an dem feinen Taschentuche des Hofrats, in das er gestern ein Loch gebrannt, als er ein noch glimmendes Zündhölzchen darauffallen ließ.
So vertieft in ihre Arbeit sie schien, entging der Augenblick ihr nicht, in dem der Gebieter seine zweite Tasse Kaffee geleert hatte, eine dritte eingegossen und die türkische Pfeife ihm gereicht werden mußte.
Alles das geschah; dann nahm Frau Riesel die Zeitung zur Hand und begann vorzulesen.
Sie saß an der schmalen Seite des länglichen Tisches, mit dem Rücken gegen das Fenster, auf einem Lehnsessel, der die Form eines ausgehöhlten halben Apfels hatte und den sie ganz ausfüllte. Da sie die Zeitung mit beiden Händen vor sich hinhielt, konnte der kleine Hofrat von seinem Platze mitten auf dem langen Kanapee an der Breitseite des Tisches aus nur ihre Ärmel wahrnehmen. Er widmete ihnen eine scharfe und mißgünstige Aufmerksamkeit. Aha! schwarze Wollbluse heute. Aha! Aha! tiefe Trauer – Sterbetag heute irgendeines Mitglieds der Familie Riesel.
Er wünschte die unangenehme Ungewißheit in eine noch unangenehmere Gewißheit zu verwandeln und kam auf Umwegen an sie heran.
»Sie waren in der Kirche – was?«
»Ja, Herr Hofrat, um sechs Uhr früh.«
»Bei dem Wetter. Es schneit und stürmt. Sie werden sich mit Ihren Laufereien in alle Kirchen einen Schnupfen abholen, und wenn Sie einen Schnupfen haben, dürfen Sie mir nicht in die Nähe«, sagte der Hofrat, der meistens den ganzen Winter hindurch an der gefürchteten Krankheit litt und dessen feines Näschen eben wieder von einer zarten Blauröte angehaucht war.
»Ich habe nie Schnupfen, Herr Hofrat«, sprach Frau Riesel gelassen.
Er überhörte den Einwand und kam auf den Kirchengang zurück, den er als unnötig bezeichnete.
»Nicht doch. Ich habe einer bestellten heiligen Messe beigewohnt.«
»So, so, so. Erinnerungsfeier; Sterbetag des seligen Gemahls?« »Nein, Herr Hofrat. Sterbetag meines Sohnes.«
Der Hofrat knirschte in sich hinein: Ihres Sohnes. Acht Tage hat dieses Lebewesen sein armseliges Dasein gefristet, und sie besaß die Selbstüberhebung, von einem Sohne zu sprechen.
Da begann er denn Betrachtungen über den Zeitpunkt anzustellen, in dem man anfangen könne, ein Kind männlichen Geschlechts einen Sohn zu nennen, und fuhr in dieser Gedankengymnastik so lange fort, bis Frau Riesel fragte: »Darf ich weiterlesen, Herr Hofrat?«
Er schämte sich ein wenig und sagte: »Ich bitte.«
Den Schauplatz dieser Begebenheit bildete ein geräumiges Zimmer im zweiten Stock eines alten Hauses im Herzen Wiens. Noch eines von den lieben, guten, schönen mit dicken Mauern, gehörigen Fenstervertiefungen, schweren Doppeltüren, hohen Zimmern, ein famoses Haus, in dem niemand »Helf Gott!« zu sagen brauchte, wenn der Wandnachbar nieste.
Seinem gediegenen Charakter entsprach die Wohnung des Herrn Hofrats Hügel und deren Einrichtung im reinsten Biedermeierstil. Da gab es nicht ein beim Antiquar gekauftes Stück; Schränke, Tische, Konsolen, Sofas, Sessel und Stühle waren Familienerbe und verkündeten den Ruhm ihrer Verfertiger sowie die Ordnungsliebe und den Schönheitssinn ihrer Benützer und Erhalter.
Wenn Frau Riesel ihr Wischtuch über die Hochpolitur des hellen, gefladerten Holzwerks mit den feinen Mahagoni-Intarsien gleiten ließ, meinte sie sich sanft gestreichelt zu fühlen von zarten, unsichtbaren Händen, die durch Generationen des Amtes, das sie jetzt versah, gewaltet hatten und ihr für die Sorgfalt dankten, mit der sie ihr Werk fortsetzte.
Kamilla Riesel war in diesen Räumen gelandet wie in einem Friedensport nach schweren, drangvollen Zeiten, die ihrer sehr glücklichen Jugend folgten: dem Zusammenbruch des angesehenen Kaufmannshauses, dem sie entstammte, dem Tode ihrer Eltern, nur zu bald darauf auch des geliebten Gatten, und dann das immer näher heranschleichende, häßliche, ganz gemeine Elend. Umsonst das Gebet ums tägliche Brot, um die Möglichkeit, es zu erwerben.
Wenn es nicht Sünde wäre, von einem Schicksal zu reden statt von Gottes Fügungen, Frau Riesel hätte gesagt: Das Schicksal hat sich über mich gestürzt wie ein Geier über eine Taube und mich Stück für Stück zerrissen. Aber sie sagte es nicht, sie sprach überhaupt wenig und von ihrer Vergangenheit nie.
Um so mehr dachte sie daran und auch mit einem aus Dankbarkeit und nachträglich noch leiser Beschämung gemischten Gefühl des Augenblicks, in dem die Wendung ihrer kläglichen Lebenslage sich vollzog.
Vor acht Jahren war’s, an einem frostigen Winternachmittage. Sie hatte den Erlös einer kleinen Bestellung aus einem Weißwarenlager in der Mariahilfer Straße abgeholt und dabei erfahren, daß ein neuer Auftrag nicht in Aussicht genommen sei. Mit stummem Kopfnicken, ohne etwas von ihrer Bestürzung zu verraten, verließ sie den Laden, aber der Schlag war zu hart und unerwartet gewesen, und sie blieb wie betäubt eine Weile auf der Straße stehen. Was tun? Zurückkehren in ihr armseliges Heim – wie lang noch das ihre? der jämmerliche Unterschlupf war ihr ja schon gekündigt worden – oder auf der Suche nach Arbeit neue, gewiß vergebliche Wege machen?
Sie stand mitten auf dem Trottoir, wurde von den Passanten unwillig zur Seite gestoßen, bemerkte es nicht, stand und sann und blickte starr vor sich hin und blickte plötzlich in ein Paar blaue, gütige Augen, die sich auf sie gerichtet hatten, sie voll mitleidiger Überraschung anstaunten und fragten: Bist du’s?
Es waren die lichtblauen Augen der Frau Rosa Hügel, einer ehemaligen guten Bekannten, einer von den vielen, denen Kamilla Riesel, seitdem sie ins Elend geraten war, ängstlich aus dem Wege ging. O Gott, nur keine Begegnung mit ihnen, die in Tagen des Wohlstandes ihren Verkehr gebildet, zu ihr emporgeschaut, sie oft beneidet hatten. Erschrocken wollte sie sich abwenden, aber die kleine Dame hatte sich die Frage: Bist du’s? schon beantwortet. Sie war’s. In einer Armut, die sich nicht verhehlen ließ. Dieses Sommerkleid im Winter, diese Mantille von anno eins mit den scharf gewordenen weißlichen Falten und der Hut, die Handschuhe … Großer Gott, was für ein Hut, was für Handschuhe! Aus all dem sprach das Elend.
Ja, ja, man hatte gehört: Die armen Riesels sind zugrunde gegangen; schuldlos, ohne Schaden für andre. Sehr traurig, sehr. Aber sie hatten niemand mit Ansprüchen behelligt. Vielleicht geht es ihnen gar nicht so schlecht. O des gedankenlosen Gewäsches … Nun sah Rosa, wie es der ehemaligen Freundin erging. Freundin wurde sie in dem Augenblick von ihr genannt, die im Bettlerkleide, aber in ihrer alten würdevollen Haltung vor ihr stand. Niedergekniet vor ihr wäre die impulsive Frau, wenn das auf offener Straße sich halbwegs geschickt hätte. Da sie aber nicht gleich etwas tun konnte, begann sie wenigstens sehr viel zu reden und rief, Frau Riesels Hand ergreifend: »Kamilla, muß man auf einen Zufall warten, um dich endlich zu erwischen? Was treibst du? Gehst den besten Freunden aus dem Wege, alle beklagen sich …«
Sie schwatzte, sie log, flunkerte der ins Unglück Geratenen allerlei vor von einer Teilnahme, die es weit und breit nicht gab; sie wollte die Wiedergefundene nach Hause oder – als sie die Bestürzung bemerkte, die dieser Vorschlag erweckte – wenigstens bis an ihre Tür begleiten.
Rosa Hügel war eine gut erhaltene Blondine von fünfzig Jahren. Ihre kleine, aber einst berühmt schöne Gestalt hatte eine leichte Neigung nach rechts angenommen und ihre Schlankheit, nicht aber ihre Beweglichkeit eingebüßt, eine stimmungsvolle, harmonische Beweglichkeit. Alles war rund an dieser Frau, ihre Frisur, ihr Kopf, jeder Teil ihres Gesichtes, die spielenden Gebärden der in zu enge Handschuhe gepreßten Kinderhände. Gewiß waren auch ihre Empfindungen ohne Kanten und Schärfen und ihr inneres wie ihr äußeres Wesen auf dem Wege zur Kugelform, die Fechner seinen Planetenengeln verleiht.
Sie erzählte auch von sich, von ihrem Manne, einem allgemein hochgeschätzten Ministerialbeamten, von ihren Kindern und kam endlich auf den Vetter Hofrat, der in Pension getreten sei. Kaum aber hatte sie den genannt, als sie plötzlich innehielt. Ein Einfall war ihr durch den Kopf geschwirrt, kam als guter, hilfreicher Gedanke wieder, erfreute und beglückte sie. Ihre freundlichen Augen glänzten.
»Kamilla, nein, ja – ich sage dir, es ist kein Zufall, was uns da zusammenführt, es ist ein gnädiger Wink des Himmels.«