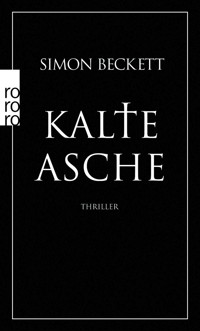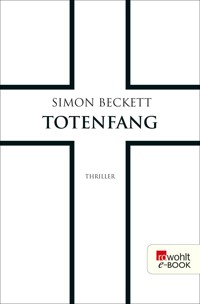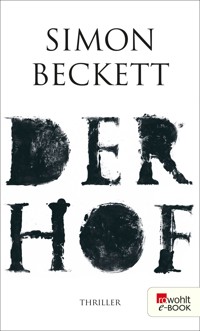
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Simon Beckett von seiner besten Seite: Psychologische Hochspannung der Meisterklasse! Ein abgelegener, heruntergekommener Hof in Südfrankreich. Es ist brütend heiß. Fliegen umschwirren die grunzenden, halbwilden Schweine, die im Dreck nach Futter stöbern. In der baufälligen Scheune liegt der junge Engländer Sean mit einem zerfetzten Fuß. Auf der Flucht vor der Polizei ist er in eine rostige Eisenfalle getreten, aufgestellt von Arnaud, dem Besitzer des Hofs, einem Eigenbrötler, der keine Fremden auf seinem Besitz duldet. Sean darf dennoch bleiben - wenn er mithilft, die maroden alten Wände neu zu mauern. Er nimmt das Angebot an, denn eine Rückkehr nach England kann er nicht riskieren - und auch wegen Arnauds Tochter Mathilde, die ihn so hingebungsvoll pflegt. Aber deren verführerische kleine Schwester ist völlig unberechenbar, ebenso wie der tyrannische Arnaud. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht, und Sean will es herausfinden. Doch die Arnauds haben ihre Geheimnisse, und der Alte setzt alles daran, dass sie niemals ans Licht kommen. Die David-Hunter-Thriller in chronologischer Reihenfolge: Die Chemie des Todes, Kalte Asche, Leichenblässe, Verwesung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Simon Beckett
Der Hof
Thriller
Aus dem Englischen von Juliane Pahnke
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein abgelegener, heruntergekommener Hof in Südfrankreich. Es ist brütend heiß. Fliegen umschwirren die grunzenden, halbwilden Schweine, die im Dreck nach Futter stöbern. In der baufälligen Scheune liegt der junge Engländer Sean mit einem zerfetzten Fuß. Auf der Flucht vor der Polizei ist er in eine rostige Eisenfalle getreten, aufgestellt von Arnaud, dem Besitzer des Hofs, einem Eigenbrötler, der keine Fremden auf seinem Besitz duldet. Sean darf dennoch bleiben – wenn er mithilft, die maroden alten Wände neu zu mauern. Er nimmt das Angebot an, denn eine Rückkehr nach England kann er nicht riskieren – und auch wegen Arnauds Tochter Mathilde, die ihn so hingebungsvoll pflegt. Aber deren verführerische kleine Schwester ist völlig unberechenbar, ebenso wie der tyrannische Arnaud. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht, und Sean will es herausfinden. Doch die Arnauds haben ihre Geheimnisse, und der Alte setzt alles daran, dass sie niemals ans Licht kommen …
Über Simon Beckett
Simon Beckett ist einer der erfolgreichsten englischen Thrillerautoren. Seine Serie um den forensischen Anthropologen David Hunter wird rund um den Globus gelesen: «Die Chemie des Todes», «Kalte Asche», «Leichenblässe» und «Verwesung» waren allesamt Bestseller. Auch «Der Hof» erreichte Platz 1 der Bestsellerliste.
Simon Beckett ist verheiratet und lebt in Sheffield.
Weitere Informationen zum Autor
Erfahren Sie mehr über Simon Beckett und entdecken Sie interessante Hintergrundinformationen und spannende Aktionen auf www.simon-beckett.de undfacebook.com/SimonBeckett.de
Inhaltsübersicht
In Erinnerung an Friederike Kommerell
Kapitel 1
Der Wagen fährt auf den letzten Tropfen. Seit Stunden keine Tankstelle, und die Tankanzeige ist tief in den roten Bereich gerutscht. Ich muss von der Straße runter, aber die Felder erstrecken sich endlos zu beiden Seiten und zwingen mich, immer weiter geradeaus zu fahren, bis der Motor den Geist aufgibt. Es ist noch früher Morgen, doch dieser Tag wird heiß und trocken. Der Wind, der durch die offenen Fenster hereinweht, bringt keine Kühlung.
Ich fahre über das Lenkrad gebeugt und rechne jeden Moment damit, dass der Motor ausgeht. Dann sehe ich eine Lücke in der grünen Barriere. Zu meiner Linken schneidet ein Feldweg eine Bresche zwischen zwei Weizenfelder. Ich lenke den Wagen von der Straße auf den holprigen Weg. Mir ist egal, wohin er mich führt, solange ich dort nur in Deckung bin. Ich erreiche ein Wäldchen. Äste kratzen an den Fenstern, als ich den Audi hineinlenke und den Motor ausschalte. Im Schatten der Bäume ist es kühler. Die Stille wird nur vom leisen Ticken des Motors und fließendem Wasser durchbrochen. Ich schließe die Augen und lehne den Kopf nach hinten. Aber ich habe keine Zeit, mich auszuruhen.
Ich muss in Bewegung bleiben.
Zuerst schaue ich ins Handschuhfach des Wagens. Ein bisschen Müll und ein fast volles Päckchen Zigaretten. Camel, meine alte Lieblingsmarke. Nichts davon könnte mich verraten. Als ich über den Beifahrersitz hinweg danach greife, bemerke ich den Geruch. Schwach, aber unangenehm. Wie Fleisch, das jemand in der Sonne liegen gelassen hat.
Etwas ist auf dem edlen Lederpolster des Beifahrersitzes verschmiert, ebenso auf dem abgewickelten Anschnallgurt, der bis in den Fußraum hängt. Das robuste Material ist an einer Stelle fast durchgerissen, und als ich mit den Fingern darüberfahre, ist da etwas Klebriges und Dunkles.
Mir wird schwindelig bei der Vorstellung, dass ich den ganzen Weg gefahren bin, während das da gut sichtbar war. Ich will möglichst schnell eine große Entfernung zwischen das Auto und mich bringen, aber so kann ich es nicht zurücklassen. Die Äste kratzen über die Tür, als ich aussteige. Ich finde den Bach, der durch das Wäldchen führt, und meine Hände zittern, als ich dort ein Taschentuch anfeuchte, das ich im Handschuhfach gefunden habe. Der Sitz lässt sich einfach abwischen, aber das Blut ist in das Material des Gurts eingezogen. Ich reibe so viel wie möglich herunter, dann wasche ich das Taschentuch im Bach aus. Wasser umschließt meine Hände wie gläserne Handschellen, als ich sie mit dem Sand vom Grund des Bachs abschrubbe. Selbst danach fühlen sie sich nicht richtig sauber an.
Ich spritze mir Wasser ins Gesicht und ziehe eine Grimasse, als es die Kratzer auf meiner Wange benetzt. Dann gehe ich zurück zum Auto, das nach der langen Fahrt von einer dicken Staubschicht überzogen ist, die den schwarzen Lack verbirgt. Mit einem Stein schlage ich die Nummernschilder aus Großbritannien herunter, dann hole ich meinen Rucksack aus dem Kofferraum. Als ich ihn heraushebe, verfängt sich ein Riemen an der Abdeckung fürs Reserverad. Darunter blitzt etwas Weißes auf. Ich schiebe die Matte beiseite, und mein Magen verkrampft sich, als ich das in Plastikfolie gewickelte Päckchen sehe.
Mit weichen Knien lehne ich mich gegen den Wagen.
Es hat ungefähr die Größe einer Tüte Zucker, aber das weiße Puder darin ist längst nicht so unschuldig. Hastig schaue ich mich um, als könnte mich jemand hier sehen. Aber hier sind nur Bäume und das beständige Summen der Insekten. Ich starre das Päckchen an und bin zu erschöpft, um diese neue Komplikation zu begreifen. Ich will es nicht mitnehmen, aber hierlassen kann ich es auch nicht. Also nehme ich es, stopfe es ganz nach unten in meinen Rucksack, knalle die Kofferraumklappe zu und gehe los.
Die Weizenfelder liegen noch verlassen da, als ich aus dem Wäldchen komme. Ich werfe die Nummernschilder des Wagens und die Schlüssel zwischen die hohen Halme, ehe ich mein Handy aus der Tasche ziehe. Es ist hoffnungslos und irreparabel kaputt. Im Gehen nehme ich die SIM-Karte heraus und zerbreche sie in zwei Teile, ehe ich die winzigen Plastikstücke in das eine Feld werfe und das Handy in das andere.
Ich wüsste ohnehin nicht, wen ich anrufen sollte.
Das graue Asphaltband der Straße flirrt und zuckt, während die Sonne höher steigt. Die wenigen Wagen, die unterwegs sind, wirken wie in der Hitze gefangen, sie scheinen sich kaum zu bewegen, bis sie plötzlich farbig aufblitzen und vorbeirauschen. Mein Trekkingrucksack, der über meinen Kopf ragt und Schatten spendet, ist wie eine persönliche Klimaanlage. Fast eine Stunde gehe ich so, bis ich das Gefühl habe, genug Distanz zwischen mich und den Wagen gebracht zu haben. Dann hebe ich den Daumen und hoffe, jemand nimmt mich mit.
Meine roten Haare sind dabei sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Ich ziehe die Aufmerksamkeit auf mich, und man sieht sofort, dass ich hier fremd bin. Als Erstes werde ich von einem jungen Paar in einem klapprigen Peugeot mitgenommen.
«Où allez-vous?», fragt er, und die Zigarette in seinem Mund bewegt sich dabei kaum.
Es kostet mich Überwindung, in die fremde Sprache zu wechseln. Ich habe Französisch in letzter Zeit mehr gehört als gesprochen. Aber das ist gar nicht der Grund für mein Zögern. Wo will ich hin?
Ich habe keine Ahnung.
«Irgendwohin. Ich reise einfach herum.»
Ich sitze auf dem Beifahrersitz, das Mädchen hat sich ohne Widerspruch auf die Rückbank gesetzt. Ich bin froh, dass der Fahrer eine Sonnenbrille trägt, denn so brauche ich meine auch nicht abzunehmen. Sie verdeckt das Schlimmste von dem Bluterguss.
Er schaut auf meine roten Haare. «Brite?»
«Ja.»
«Dein Französisch ist echt gut. Schon lange hier?»
Einen Moment ringe ich um die Antwort. Es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig hier. «Eigentlich nicht.»
«Und wo hast du es so gut gelernt?» Die Frage kommt von dem Mädchen, das sich zwischen den Sitzen nach vorne beugt. Sie ist dunkelhaarig und mollig, mit einem hübschen, offenen Gesicht.
«Früher bin ich oft hergekommen. Als ich jünger war. Und ich … Ich steh auf französische Filme.»
Danach halte ich lieber den Mund, weil ich mehr von mir preisgebe, als ich eigentlich will. Zum Glück scheint sich keiner von beiden allzu sehr für Details zu interessieren. «Ich schau ja lieber amerikanische Filme», meint er und zuckt mit den Schultern. «Wie lange bleibst du?»
«Keine Ahnung», sage ich.
Sie setzen mich am Rand einer kleinen Stadt ab. Ich greife auf meine Geldreserve in Euro zurück, um mir Baguette und Käse, eine Flasche Wasser und ein Wegwerffeuerzeug zu kaufen. Ich kaufe außerdem bei einem Straßenhändler auf dem Marktplatz eine Baseballkappe. Eine billige Nike-Kopie, aber sie spendet Schatten und hilft, meine Abschürfungen zu verstecken. Ich weiß, dass ich mich paranoid verhalte, aber ich kann einfach nicht anders. Ich will nicht mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen als unbedingt nötig.
Es ist eine Erleichterung, die Stadt hinter mir zu lassen und wieder über offenes Gelände zu laufen. Die Sonne brennt auf meinen Nacken herunter. Nach etwa einem Kilometer mache ich unter einer Reihe Pappeln halt und versuche, von dem Baguette und dem Käse zu essen. Ich bringe nur wenige Bissen herunter, ehe ich alles wieder hochwürge. Mein Magen fühlt sich wund an, und als die Krämpfe endlich aufhören, sinke ich gegen einen Baum und bin so erschöpft, dass ich einfach nur hier liegen und aufgeben will.
Aber das kann ich nicht machen. Meine Hände zittern bei dem Versuch, mir mit dem Wegwerffeuerzeug eine Zigarette anzuzünden. Ich ziehe daran. Es ist die erste seit zwei Jahren, sie schmeckt, als würde ich endlich heimkehren. Ich atme einen Teil meiner Anspannung mit dem Zigarettenrauch einfach aus und genieße es für ein paar Augenblicke, an nichts zu denken.
Nach der Zigarette stehe ich wieder auf und gehe weiter. Ich habe nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo ich bin, aber da ich ohnehin keinen Plan habe, ist das gar nicht so schlimm. Ich strecke den Daumen raus, wenn ein Auto kommt, aber das passiert nicht allzu oft. Die Straßen hier sind vor allem routes bis, also Landstraßen durchs Hinterland, die von Durchreisenden, die sich an Nationalstraßen und Autobahnen halten, eher gemieden werden. Am Nachmittag und nachdem ein Citroën und ein Renault mich mitgenommen haben, habe ich weniger als zwanzig Kilometer zurückgelegt. Die Mitfahrgelegenheiten waren nur von kurzer Dauer – Einheimische, die ins nächste Dorf oder in die Stadt wollten. Inzwischen gibt es nicht mal mehr diese. Die Straße ist so leer, dass ich glauben könnte, die Welt da draußen hätte mich vergessen. Die einzigen Geräusche sind das Schaben meiner Schuhe und das unablässige Zirpen der Insekten. Es gibt keinen Schatten, und ich bin froh über das bisschen Schutz von der Baseballkappe.
Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit gegangen bin, werden die offenen Felder von einem dichten Kastanienwald abgelöst, der mit altem Stacheldraht abgesperrt ist. Aber die Äste mit den breiten, fächerförmigen Blättern hängen weit über die Straße und bieten so wenigstens etwas Schutz vor der Sonne.
Ich lasse den Rucksack langsam von meinen schmerzenden Schultern gleiten und nehme einen Schluck aus meiner Flasche. Es sind nur noch wenige Fingerbreit darin, und das Wasser ist warm wie Blut und vermag kaum meinen Durst zu löschen. Ich hätte eine zweite Flasche kaufen sollen, denke ich. Aber ich hätte so vieles tun sollen. Jetzt ist es zu spät, um irgendwas davon zu ändern.
Ich kneife die Augen zusammen und starre die Straße entlang, die pfeilgerade verläuft und in der Hitze flirrt. Ich schraube den Deckel auf die Wasserflasche und starre weiter auf die Straße, als würde allein deshalb ein Auto auftauchen, weil ich es will. Natürlich klappt das nicht. Himmel, ist das heiß. Schon jetzt bin ich wieder völlig ausgedörrt. Ich nehme die Kappe ab und fahre mir mit der Hand durch die verschwitzten Haare. Vor einer Weile bin ich am Tor zu einem Bauernhof vorbeigekommen, erinnere ich mich. Ich kaue auf der Unterlippe und überlege. Eigentlich will ich nicht zurück. Aber meine trockene Kehle nimmt mir die Entscheidung ab. Ich habe keine Ahnung, wie weit es bis zur nächsten Stadt ist, und es ist zu heiß, um ohne Wasser weiterzugehen. Ich setze den Rucksack wieder auf.
Das Tor ist mit demselben rostigen Stacheldraht versehen, der auch den Waldrand säumt. Ein Weg verläuft vom Tor bis zu den Kastanienbäumen. Ein Briefkasten ist an einem Torpfosten befestigt, und in blassweißen Buchstaben steht darauf nur ein Wort: Arnaud. Ein altes, aber solide wirkendes Vorhängeschloss hängt an einem Schließband am Tor, aber jemand hat es offen gelassen.
Ich schaue ein letztes Mal die Straße hoch, doch da ist noch immer kein Auto in Sicht. Also achte ich auf den Stacheldraht, schiebe das Tor auf und gehe hindurch. Der Weg führt in sanftem Schwung bergauf, dann wieder hinab. Weiter hinten entdecke ich im Schutz der Bäume eine Ansammlung von Dächern. Ich folge dem Weg und gelange in einen staubigen Hof. Ein heruntergekommenes, altes Bauernhaus, das von einem wacklig wirkenden Gerüst halb verdeckt wird, steht an seinem Kopfende. Gegenüber gibt es eine große Scheune und an einer Seite einen leeren Stalltrakt, in dessen Giebel eine Uhr eingelassen ist, die nur noch einen Zeiger hat. Im Stall sind keine Pferde, nur ein paar staubige Fahrzeuge parken offenbar mehr oder weniger permanent in den offenen Türen.
Niemand ist zu sehen. Irgendwo in der Nähe meckert eine Ziege, und ein paar Hühner kratzen im Dreck. Wären die Tiere nicht, könnte man meinen, das Anwesen sei verlassen. Ich bleibe am Rand des Hofs stehen, irgendwie widerstrebt es mir weiterzugehen. Die Tür zum Bauernhaus steht offen. Ich steige die Stufen hinauf und klopfe an das rohe Türblatt. Einen Moment lang ist alles still, dann höre ich die Stimme einer Frau.
«Qui est-ce?»
Ich stoße die Tür auf. Nach der Helligkeit im Hof wirkt das Hausinnere auf mich undurchdringlich dunkel. Es dauert ein, zwei Sekunden, ehe ich eine junge Frau erkenne, die am Küchentisch sitzt. Und es dauert etwas länger, bis ich das Baby erkenne, das sie auf dem Arm trägt.
Ich hebe die leere Flasche und zögere, während ich mir die Frage auf Französisch zurechtlege. «Kann ich wohl etwas Wasser haben, bitte?»
Wenn es ihr Unbehagen bereitet, von einem Fremden gestört zu werden, zeigt sie das nicht offen. «Wie sind Sie hier reingekommen?», fragt sie ruhig.
«Das Tor stand offen.»
Ich fühle mich wie ein Eindringling, als sie mich mustert. Sie setzt das Baby in einen hölzernen Hochstuhl. «Möchten Sie auch ein Glas Wasser trinken?»
«Das wäre großartig.»
Sie nimmt die Flasche mit zur Spüle und füllt sie am Wasserhahn, ehe sie außerdem ein großes Glas füllt. Ich trinke dankbar. Das Wasser ist eiskalt und hat den erdigen Geschmack von Metall.
«Danke», sage ich und gebe ihr das leere Glas zurück.
«Können Sie das Tor hinter sich schließen?», bittet sie mich. «Es hätte nicht offen bleiben dürfen.»
«Okay. Noch mal vielen Dank.»
Ich kann ihren Blick auf mir spüren, als ich den sonnigen Innenhof wieder überquere.
Ich folge dem Weg zurück durch den Wald zur Straße. Es ist dort so still wie zuvor. Sorgfältig schließe ich das Tor und marschiere weiter. Hin und wieder drehe ich mich um und schaue, ob ein Auto kommt, aber hinter mir ist nur das von der Sonne aufgeheizte Asphaltband. Ich habe die Daumen unter die Schulterriemen meines Rucksacks gehakt, um das Gewicht etwas besser zu verteilen. Er fühlt sich schwerer an, sobald ich an das denke, was darin ist. Also konzentriere ich mich lieber darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen und an nichts zu denken.
Das Dröhnen eines Motors löst sich allmählich aus der aufgeheizten Stille. Ich drehe mich um und sehe etwas am Horizont auftauchen – ein dunkler Fleck, der in der Hitze verschwimmt. Zuerst scheint er regungslos über einer Reflexion seiner selbst zu verharren. Dann tauchen die Räder auf und werden immer länger, bis sie die Straße berühren. Ein blaues Auto hält auf mich zu.
Ich trete schon aus dem Schatten der Bäume, als ich etwas auf dem Wagendach bemerke. Im nächsten Moment begreife ich, was ich da sehe. Ich springe über den Stacheldrahtzaun und reiße mir dabei die Jeans auf. Wegen des Rucksacks lande ich ziemlich unglücklich. Ohne anzuhalten, stürze ich in den Wald, während das Motorengeräusch lauter wird. Als der Wagen fast auf meiner Höhe ist, ducke ich mich hinter einem Baum und blicke ängstlich zur Straße hoch.
Der Polizeiwagen braust vorbei. Ich lausche, ob er das Tempo verlangsamt. Aber das Motorengeräusch wird immer leiser, bis es ganz verschwindet. Ich lege den Kopf gegen den Baum. Ich weiß, dass ich überreagiere und dass die französische Polizei vermutlich kein Interesse an mir hat. Aber ich bin zu nervös, um es drauf ankommen zu lassen. Und ich kann nicht riskieren, dass sie meinen Rucksack durchsuchen.
Ich habe einen bitteren Geschmack im Mund. Blut – bei meiner Flucht habe ich mir auf die Lippe gebissen. Ich spucke aus und nehme die Wasserflasche aus meinem Rucksack. Meine Hände zittern, als ich mir den Mund ausspüle. Danach erst schaue ich mich um, wo ich gelandet bin.
Der Wald erstreckt sich auf einem abgeflachten Hügel, und in einiger Entfernung kann ich zwischen den Bäumen einen See aufblitzen sehen. Auf der einen Seite sehe ich die Dächer eines Bauernhofs, die auf die Entfernung winzig und unbedeutend wirken. Vermutlich habe ich dort nach dem Wasser gefragt. Ich bin also noch auf ihrem Grund und Boden.
Ich stehe auf und wische mir den Dreck von der Jeans. Mein T-Shirt klebt mir schweißnass am Rücken. Es ist inzwischen so heiß, dass die Luft zu backen scheint. Wieder blicke ich zu dem See hinüber und wünsche mir, ich könnte darin schwimmen. Aber das wird nicht passieren. Ich muss in Bewegung bleiben. Nach einem letzten Schluck Wasser lasse ich den Baum hinter mir, mache ein paar Schritte und schreie auf. Etwas bohrt sich schmerzhaft in meinen Fuß.
Ich sinke auf die Knie, als der Schmerz mein Bein hinaufschießt. Mein linker Fuß steckt in einem Paar schwarzer, halbrunder Kiefer. Ich versuche, mich aus der Umklammerung zu befreien, doch bei jeder Bewegung schießt erneut eine sengende Schmerzwelle mein Bein hinauf.
«Herrgott!»
Ich verharre und atme tief durch, um die Panik niederzuringen. Ich bin in eine Art Eisenfalle getreten, die unter einem Gewirr aus knorrigen Baumwurzeln versteckt lag. Sie umklammert den Spann bis hinauf zum Knöchel, und die gezackten Eisenzähne haben sich durch das dicke Leder meines Stiefels gebohrt. Sie stecken so tief in meinem Fleisch, dass ich spüre, wie die Spitzen eisig den blanken Knochen berühren.
Ich kneife die Augen fest zusammen und gebe mir Mühe, den Anblick auszublenden. «Scheiße, Scheiße, Scheiße!»
Aber das bringt mich auch nicht weiter. Ich schüttle den Rucksack ab und versuche, eine bessere Sitzposition zu finden, um die Kiefer der Falle packen zu können. Sie rühren sich keinen Millimeter. Ich stütze mich mit dem gesunden Fuß an einer Baumwurzel ab und versuche es erneut. Dieses Mal werde ich mit einem winzigen Nachgeben belohnt, aber das ist längst nicht genug. Meine Arme zittern vor Anstrengung, und die Metallrahmen bohren sich mir in die Handflächen. Langsam lasse ich wieder los und lehne mich keuchend zurück.
Ich sauge an den wunden Stellen an meinen Händen und schaue mir die Falle jetzt genauer an. Eine primitive Vorrichtung, die von ockerfarbenem Rost überzogen ist. Trotzdem kann sie noch nicht allzu lange hier liegen. Das Öl an den Scharnieren scheint noch ziemlich frisch zu sein. Beängstigend frisch, finde ich und versuche lieber nicht darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte, sondern widme meine Aufmerksamkeit der Kette, mit der die Falle im Boden verankert ist. Sie ist sehr kurz und führt zu einem Holzpflock, der zwischen den Baumwurzeln vergraben ist. Mir genügt es, mehrmals daran zu zerren, um zu wissen, dass es Zeitverschwendung ist, sie herausziehen zu wollen.
Ich sitze auf dem Boden, mein gefangenes Bein lang vor mir ausgestreckt. Mit einer Hand versuche ich, mich in eine etwas bequemere Position zu bringen, und spüre dabei etwas Feuchtes. Die Wasserflasche liegt dort, wo ich sie fallen gelassen habe. Ich reiße sie hoch, obwohl inzwischen fast alles rausgelaufen und in der trockenen Erde versickert ist. Vorsichtig nehme ich einen Schluck, schraube die Flasche zu und versuche nachzudenken.
Okay, bleib ganz ruhig. Der anfängliche Schmerz ist einem beständigen Pochen gewichen, das Zahnschmerzen ähnelt und bis in mein Schienbein strahlt. Blut beginnt, das Leder meines Stiefels zu durchnässen. Bis auf das Summen der Insekten ist der vom Sonnenlicht gesprenkelte Wald still. Ich schaue zu den Dächern des Bauernhofs hinüber. Sie sind zu weit weg. Keiner würde mich hören, wenn ich schreie. Aber das will ich auch gar nicht. Jedenfalls nicht, solange ich es vermeiden kann.
Ich krame im Rucksack nach meinem Taschenmesser. Ich weiß, dass es irgendwo da drin sein muss. Aber bei der Suche stoßen meine Finger auf etwas anderes. Ich ziehe es heraus, und der Anblick trifft mich wie ein Schock.
Die Fotografie hat Eselsohren und ist verblasst. Ich hatte keine Ahnung, dass sie noch im Rucksack war. Ich habe sogar vergessen, dass es dieses Foto gab. Das Gesicht des Mädchens ist von einem Knick fast vollständig verwischt, ihr Lächeln ist verzerrt. Hinter ihr hebt sich der strahlend weiße Brighton Pier von einem makellos blauen Himmel ab. Ihre Haare sind blond und von der Sonne ausgebleicht. Ihr Gesicht hat eine gesunde Bräune. Sie sieht glücklich aus.
Mir wird schwindelig. Die Bäume scheinen sich um mich zu drehen, als ich das Foto wieder einstecke. Ich atme tief durch und zwinge mich, jetzt nicht durchzudrehen. Die Vergangenheit ist vorbei. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich kann sie nicht ändern. Die Gegenwart bereitet mir schon genug Sorgen. Ich finde mein Taschenmesser und setze mich zurecht. Das Messer hat eine knapp acht Zentimeter lange Klinge, einen Korkenzieher und einen Flaschenöffner. Leider nichts, um ein Fangeisen zu entschärfen. Ich ramme die Klinge trotzdem zwischen beide Bügel und versuche, die Falle aufzustemmen, aber sie bewegt sich nur ein paar Millimeter und schnappt sofort wieder zu. Ich werfe das kaputte Messer beiseite und schaue mich nach etwas anderem um. In der Nähe liegt ein toter Ast. Er ist außer Reichweite, aber mit Hilfe eines anderen kürzeren Asts kann ich ihn zu mir heranziehen und schiebe dann das dickere Ende zwischen die Bügel. Das Metall gräbt sich in das Holz, aber die Falle beginnt ganz langsam, sich zu öffnen. Ich übe noch mehr Druck aus und beiße die Zähne zusammen, als die Eisenzähne ganz langsam die Umklammerung meines Fußes lockern.
«Ja! Los jetzt!»
Der Ast bricht. Die Bügel springen wieder zusammen.
Ich schreie.
Als der Schmerz nachlässt, liege ich flach auf dem Rücken. Ich richte mich auf und hämmere mit dem Ast auf den Boden ein. «Scheißding!»
Ich kann jetzt nicht länger so tun, als wäre die Situation nicht ernst. Selbst wenn ich meinen Fuß befreien kann, bezweifle ich, dass ich mit der Verletzung noch weit komme. Aber das Problem kann ich getrost vernachlässigen. Der Umstand, dass ich mich nicht aus eigener Kraft befreien kann, ist viel beängstigender.
Bist du jetzt glücklich? Das hast du dir selbst eingebrockt. Ich blende die finsteren Gedanken aus und versuche stattdessen, mich auf das viel drängendere Problem zu konzentrieren. Mit dem Korkenzieher des Taschenmessers beginne ich, um den Metallstift, der die Falle verankert, die Erde aufzugraben. Ein vergeblicher Versuch, aber wenigstens kann ich meine Wut abarbeiten, indem ich auf Boden und Wurzeln einhacke. Schließlich lasse ich das Messer fallen und sinke wieder gegen den Baumstamm.
Die Sonne steht inzwischen spürbar tiefer. Es wird noch stundenlang hell bleiben, aber die Vorstellung, die ganze Nacht hier zu liegen, entsetzt mich. Ich zerbreche mir den Kopf, was ich noch tun kann, aber mir fällt nur eins ein.
Ich hole tief Luft und schreie.
Meine Schreie verhallen ohne Echo. Ich bezweifle, dass man sie bis zu dem Bauernhof gehört hat, bei dem ich vorhin gewesen bin. Ich schreie lauter, sowohl auf Englisch als auch auf Französisch. Ich schreie so lange, bis meine Stimme heiser wird und mein Hals schmerzt.
«Ist da jemand!», schluchze ich fast und dann, leiser: «Bitte.» Die Worte scheinen von der Nachmittagshitze aufgesaugt zu werden und verlieren sich zwischen den Bäumen. Danach senkt sich die Stille wieder über den Wald.
Da weiß ich, dass ich nirgendwo mehr hingehen werde.
Am nächsten Morgen habe ich Fieber. Ich hatte in der Nacht meinen Schlafsack aus dem Rucksack gezogen und ihn über mir ausgebreitet, aber ich zittere immer noch ziemlich heftig. Mein Fuß puckert dumpf im Rhythmus meines Pulsschlags. Er ist bis weit über den Knöchel hinaus angeschwollen. Obwohl ich den Stiefel so weit wie möglich aufgeschnürt habe, ist das Leder, das inzwischen schwarz und klebrig vom Blut ist, gespannt wie eine Trommelhaut. Es fühlt sich wie ein riesiges Geschwür an, das jederzeit aufplatzt.
Beim ersten Licht des neuen Tages versuche ich wieder zu schreien, aber weil mein Hals so ausgedörrt ist, bringe ich nicht mehr als ein heiseres Krächzen zustande. Schon bald kostet selbst das zu viel Anstrengung. Ich versuche, mir andere Möglichkeiten auszudenken, um Aufmerksamkeit zu erregen. Eine Weile scheint mir der Gedanke verlockend, den Baum in Brand zu setzen, unter dem ich hocke. Ich taste sogar schon in den Hosentaschen nach dem Feuerzeug, ehe ich wieder zur Vernunft komme.
Die Tatsache, dass ich das ernsthaft in Erwägung gezogen habe, ängstigt mich am meisten. Aber dieser klare Moment ist nicht von langer Dauer. Als die Sonne aufgeht, beginnt es rasch heiß zu werden, und ich schiebe den Schlafsack beiseite. Ich bringe das Kunststück zustande, wie verrückt zu schwitzen und gleichzeitig vor Kälte zu bibbern. Ich schaue meinen Fuß voller Hass an und wünschte, ich könnte ihn wie ein gefangenes Tier einfach abkauen. Und kurz glaube ich, das wirklich zu können, und kann meine Haut und mein Blut und die Knochen förmlich schmecken, als ich in mein Bein beiße. Dann bin ich wieder bei mir, sitze mit dem Rücken an den Baumstamm gelehnt, und das Einzige, was in meinen Fuß beißt, sind die sichelförmigen Eisenbügel.
Ich verliere immer wieder das Bewusstsein, tauche in verworrene, überhitzte Phantasien ab. Irgendwann öffne ich die Augen und sehe ein Gesicht, das mich prüfend mustert. Es gehört einem Mädchen und ist wunderschön und madonnenhaft. Es scheint mit dem auf dem Foto zu verschmelzen und plagt mich mit Schuldgefühlen und Trauer.
«Es tut mir leid», sage ich oder glaube zumindest zu sagen: «Es tut mir leid …»
Ich starre das Gesicht an und hoffe auf ein versöhnliches Zeichen. Aber als ich sie anschaue, beginnt die Form ihres Schädels durch die Haut zu scheinen. Die Oberfläche schält sich ab, und darunter kommt ein Bild aus Fäulnis und Verfall zum Vorschein.
Ein neuer Schmerz überrollt mich, eine neuerliche Qual, die mich fortträgt. Aus weiter Ferne höre ich jemanden schreien. Als die Schreie verebben, höre ich Stimmen, die in einer Sprache reden, die ich zwar erkenne, aber nicht verstehe. Ehe die Worte gänzlich verstummen, kann ich einige jedoch so klar und deutlich hören wie den Schlag einer Kirchturmglocke.
«Doucement. Essayez d’être calme.»
Vorsichtig, verstehe ich. Aber es verwirrt mich, dass sie leise sein müssen.
Dann reißt der Schmerz mich vollends fort, und jenseits davon existiere ich nicht länger.
London
Das Oberlicht ist von Kondenswasser beschlagen. Regen trommelt darauf ein. Wir liegen auf dem Bett, unsere schmutzigen Spiegelbilder über uns – verschwommene Doppelgänger, die im Glas gefangen sind.
Chloe ist ganz weit weg. Ich kenne ihre Stimmungen inzwischen gut genug, um sie nicht zu bedrängen und sie in Ruhe zu lassen, bis sie freiwillig wieder mit mir spricht. Sie starrt durch das Oberlicht nach draußen, und ihre blonden Haare fangen das Licht von der Muschellampe ein, die sie auf dem Flohmarkt gekauft hat. Ihre Augen sind blau. Sie blinzelt nicht. Ich habe wieder das Gefühl, ich könnte meine Hand quer durch ihr Sichtfeld wischen, ohne eine Reaktion zu bekommen. Ich will sie fragen, worüber sie nachdenkt, aber ich schweige. Ich habe Angst, sie könnte es mir erzählen.
Die Luft im Raum ist kalt und feucht auf meiner nackten Brust. Am anderen Ende der Wohnung steht eine leere Leinwand unberührt auf Chloes Staffelei. Sie ist jetzt schon seit Wochen leer. Der Geruch von Terpentin und Ölfarben, den ich lange Zeit mit dieser kleinen Wohnung verknüpft hatte, ist verflogen und kaum mehr wahrnehmbar.
Ich spüre, wie sie sich neben mir regt.
«Denkst du auch manchmal darüber nach, wie es sein wird zu sterben?», fragt sie.
Kapitel 2
Ein Auge starrt mich an. Es ist schwarz, aber in der Mitte wird es von etwas Grauem umwölkt, das mich an grauen Star denken lässt. Mehrere Linien verlaufen von der Mitte aus wie Wellen. Irgendwo verschwinden diese Linien in der Struktur eines Holzstücks. Das Auge wird zu einem Knoten, das Graue zu einem Spinnennetz, das sich darüber wie eine staubige Decke spannt. Das Netz ist mit den Hülsen längst verendeter Insekten gespickt. Von der Spinne ist allerdings nichts zu sehen.
Ich weiß nicht, wie lange ich nach oben starre, ehe ich erkenne, dass es sich um einen Holzbalken handelt, der vom Alter dunkel und rau ist. Irgendwann danach wird mir bewusst, dass ich wach sein muss. Ich verspüre nicht den Drang, mich zu bewegen, denn ich habe es warm und bequem. Für den Augenblick genügt mir das. Mein Verstand ist leergefegt, und ich bin damit zufrieden, auf das Spinnennetz über mir zu schauen. Aber sobald ich diesen Gedanken fassen kann, verliert er schon seine Gültigkeit. Mit dem Bewusstsein kommen auch die Fragen und ein Anflug von Panik: wer, was, wann?
Wo, vor allem.
Ich hebe den Kopf und schaue mich um.
Ich liege in einem Bett und bin in einem Raum, den ich nicht erkenne. Es ist weder ein Krankenhauszimmer noch eine Arrestzelle. Sonnenlicht fällt schräg durch ein einzelnes, kleines Fenster. Der Balken, auf den ich starre, gehört zu der dreieckigen Dachkonstruktion, die sich zu beiden Seiten bis zum Boden erstreckt. Einzelne Lichtstrahlen fallen durch die Lücken zwischen den Dachziegeln. Ein Dachboden also. Eine Art Scheune, so wie’s aussieht. Ein langer Raum mit nackten Dielenbrettern und Giebeln an beiden Enden. Mein Bett befindet sich unter einem der Giebel. Sperrmüll und Möbel, die zum größten Teil kaputt sind, stapeln sich an beiden Seiten vor den nackten Steinwänden. Ein muffiger Geruch liegt in der Luft, nach Alter, Holz und Stein. Es ist heiß, aber nicht unangenehm.
Das Licht, das durch das staubige Fenster fällt, ist frisch und hell. Ich trage meine Armbanduhr, nach der es jetzt sieben Uhr ist. Als bräuchte ich nun noch eine Bestätigung, dass Morgen ist, höre ich von irgendwo da draußen das heisere Krähen eines Hahns.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin oder was ich hier soll. Dann bewege ich mich, und der plötzliche Schmerz am Ende meines Beins versetzt meinem Gedächtnis den entscheidenden Ruck. Ich werfe die Decke beiseite, unter der ich liege. Erleichtert stelle ich fest, dass mein Fuß noch da ist. Er ist in einen weißen Verband gewickelt, aus dem meine Zehenspitzen wie Radieschen hervorgucken. Ich versuche, mit den Zehen zu wackeln. Es tut weh, aber längst nicht mehr so schlimm wie vorher.
Erst dann bemerke ich, dass ich nackt bin. Meine Jeans und mein T-Shirt liegen über der Rückenlehne eines Holzstuhls, der neben meinem Bett steht. Beides ist sorgfältig zusammengelegt und sieht frisch gewaschen aus. Meine Stiefel stehen neben dem Stuhl auf dem Boden, und jemand hat sogar versucht, den beschädigten zu säubern. Aber das Leder ist von den Blutflecken dunkel, und die Risse, die von dem Treteisen stammen, kann man nicht reparieren.
Ich breite die Decke wieder über meinen Körper und versuche, mich zu erinnern. Was war passiert, nachdem ich in die Falle tappte und bevor ich hier aufwachte? Dazu will mir nichts einfallen, aber dafür drängen andere Erinnerungen sich in den Vordergrund. Im Wald bin ich auf das Treteisen getreten. Ich bin per Anhalter gefahren und habe den Wagen versteckt und bin zu Fuß weitergegangen. Und dann erinnere ich mich auch wieder an das, was mich überhaupt hergeführt hatte.
Lieber Himmel, denke ich und fahre mit der Hand über mein Gesicht, weil ich jetzt alles wieder weiß.
Der Anblick meines Rucksacks, der gegen ein altes schwarzes Schaukelpferd gelehnt ist, lässt mich zusammenzucken. Ich setze mich auf, weil ich wieder weiß, was in dem Rucksack ist. Das war zu schnell; ich schließe die Augen und kämpfe gegen eine Welle der Übelkeit. Der Raum dreht sich um mich. Als der Schwindel nachlässt, höre ich Schritte, die sich von unten nähern. Ein quietschendes Geräusch, und ein Teil des Fußbodens schwingt auf.
Ein Arm schiebt die Falltür hoch, und eine Frau kommt auf den Dachboden. Ich erkenne sie; ich bin ihr schon einmal begegnet. Sie war die Frau mit dem Baby im Bauernhaus. Was die Frage klärt, wo ich bin. Wenn auch nicht, warum. Sie zögert, als sie mich sieht.
«Sie sind wach», sagt sie.
Es dauert einen Moment, ehe ich merke, dass sie mich auf Englisch angesprochen hat. Sie hat einen harten Akzent und klingt zögerlich, doch sie spricht fließend. Ich spüre grobe, unbehauene Steine an meinem Rücken, ehe ich erkenne, dass ich unwillkürlich zurückgewichen bin. Mit einer Hand umklammere ich das verschwitzte Laken. Ich zwinge mich loszulassen. Sie bleibt in einiger Entfernung vor dem Bett stehen, das im Grunde nur eine Matratze auf den Dielenbrettern ist.
«Wie fühlen Sie sich?» Ihre Stimme ist leise und ruhig. Sie trägt ein ärmelloses Oberteil und eine abgewetzte Jeans. An ihr ist nichts Bedrohliches, aber mein Verstand ist schwerfällig wie ein altersschwacher Computer. Mein Hals schmerzt, als ich versuche zu sprechen. Ich schlucke und versuche es erneut.
«Mein Fuß …»
«Der war übel zugerichtet. Aber keine Sorge, das kommt wieder in Ordnung.»
Keine Sorge? Ich schaue mich um. «Wo bin ich?»
Sie antwortet nicht sofort. Hat sie die Frage nicht verstanden, oder muss sie sich die richtige Antwort zurechtlegen? Ich wiederhole die Frage auf Französisch.
«Sie sind auf dem Hof. Wo Sie nach Wasser gefragt haben.» Ihre Stimme ist in ihrer Muttersprache fließender, aber noch immer ist etwas Zögerliches an ihr. Als müsse sie jedes Wort genau abwägen, ehe sie es ausspricht.
«Ist das … Es sieht wie eine Scheune aus?»
«Im Haus ist leider kein Platz.» Ihre grauen Augen sind ganz ruhig. «Meine Schwester hat Sie im Wald gefunden. Sie hat mich geholt, und wir haben Sie hergebracht.»
Ich erinnere mich vage an das Gesicht eines Mädchens. Nichts von alledem ergibt irgendeinen Sinn. Mein Verstand ist noch immer ganz benommen, weshalb ich nicht genau weiß, was von meinen Erinnerungen wirklich ist und was nur dem Delirium zuzuschreiben.
«Wie lange bin ich schon hier?»
«Wir haben Sie vor drei Tagen gefunden.»
Drei Tage? Dunkel kann ich mich an Schmerzen und Schweiß, an kühle Hände und beruhigende Worte erinnern. Aber das können auch Fieberträume gewesen sein. Ich spüre den Schmerz langsam wieder erwachen. Misstrauisch beobachte ich, wie sie ein Papiertaschentuch aus der Tasche holt und daraus eine große, weiße Tablette wickelt.
«Was ist das?»
«Nur ein Antibiotikum. Die haben wir Ihnen verabreicht, während Sie bewusstlos waren. Sie hatten Fieber, und die Wunde hat sich infiziert.»
Ich schaue auf die Wölbung, die mein Fuß unter der dünnen Decke formt. Meine anderen Ängste kommen mir plötzlich bedeutungslos vor.
«Wie schlimm ist es?»
Sie nimmt eine Flasche, die neben dem Bett steht, und gießt Wasser in ein Glas. «Es verheilt. Aber Sie werden eine Weile nicht laufen können.»
Ich weiß nicht, ob sie mich belügt. «Was ist passiert? Da war eine Falle …»
«Später. Sie müssen sich jetzt ausruhen. Hier.»
Sie hält mir die Tablette und das Glas hin. Ich nehme beides und bin zu durcheinander, um einen klaren Gedanken zu fassen. Aber sie ist so ruhig und reserviert, das empfinde ich als wohltuend. Sie müsste um die dreißig sein, plus/minus ein, zwei Jahre. Sie ist dünn, doch Hüften und Brüste sind üppiger. Die dunklen Haare sind direkt über dem Nacken abgeschnitten. Gelegentlich schiebt sie sie auf einer Seite hinters Ohr. Eine Geste, die auf mich eher wie eine Angewohnheit wirkt und nicht wie Affektiertheit. Das Einzige, was an ihr wirklich außergewöhnlich ist, sind die Augen, die zwar müde und verschattet sind, aber von einem dunklen, rauchigen Grau.
Ich spüre jetzt ihren Blick auf mir ruhen. Ernst und undurchdringlich beobachtet sie mich, während ich mit etwas Wasser die Tablette schlucke. Aus dem einen Schluck wird schnell das ganze Glas, das ich durstig herunterstürze.
«Mehr?», fragt sie, als ich es absetze. Ich nicke und strecke ihr das Glas hin. «In der Flasche neben dem Bett ist frisches Wasser. Versuchen Sie, so viel wie möglich zu trinken. Und wenn der Schmerz zu schlimm wird, nehmen Sie ruhig zwei hiervon.»
Sie hält ein Tablettenfläschchen hoch. Wie aufs Stichwort beginnt mein Fuß zu pochen. Der Schmerz ist nur ein Schatten seines früheren Selbst, aber es tut trotzdem weh. Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen, doch etwas an ihren ruhigen grauen Augen lässt mich wissen, dass ich sie nicht täuschen kann.
«Woher wussten Sie, dass ich Engländer bin?»
Sie antwortet ohne Zögern. «Ich habe in Ihren Reisepass geguckt.»
Sofort ist mein Mund staubtrocken. «Sie haben meinen Rucksack durchsucht?»
«Ich wollte nur herausfinden, wer Sie sind.»
Ihr Gesichtsausdruck ist ernst, aber nicht entschuldigend. Ich versuche, nicht zu dem Rucksack zu schauen, aber mein Herz hämmert laut in der Brust.
«Ich muss jetzt gehen», erklärt sie. «Versuchen Sie, sich auszuruhen. Ich bringe Ihnen bald etwas zu essen.»
Ich nicke. Jetzt will ich eigentlich nur noch alleine sein. Ich warte, bis sie verschwunden ist und die Falltür sich hinter ihr senkt. Dann ziehe ich meinen Rucksack zu mir her. Das Schaukelpferd schaukelt leicht vor und zurück. Ich öffne den Rucksack und stecke die Hand hinein. Zuerst nichts außer Klamotten. Dann, als ich schon überzeugt bin, dass das Päckchen verschwunden ist, spüre ich unter den Fingerspitzen das leise knisternde Plastik.
Ich weiß einen Moment lang nicht, ob ich erleichtert oder entsetzt sein soll.
Das Paket scheint unberührt zu sein. Es liegt schwer in meiner Hand. Ich hätte es loswerden sollen, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich wickle es in ein T-Shirt, schiebe es bis an den Boden des Rucksacks und bedecke es mit meinen restlichen Klamotten. Dann überprüfe ich meinen Reisepass und mein Geld. Beides ist noch da, aber als ich die Hand zurückziehe, berühren meine Finger ein glänzendes Pappquadrat.
Das Foto. Ich will es mir nicht ansehen, aber ich kann nicht anders und ziehe es heraus. Ein Schmerz hat sich unter meinem Brustbein eingenistet und erwacht, als ich das lächelnde Gesicht des Mädchens im Sonnenlicht sehe. Impulsiv packe ich die Ecken des Fotos und will es in zwei Hälften zerreißen. Aber ich kann nicht. Stattdessen streiche ich die Knicke glatt und stecke es zurück in die Tasche.
Plötzlich bin ich erschöpft. Und noch verwirrter als ohnehin schon. Die Frau hat mir eigentlich nichts verraten. Besonders verwirrt mich, dass ich in ihrer Scheune liege und nicht in einem Krankenhausbett. Und verspätet fällt mir noch etwas auf. Nachdem die Frau die Falltür hinter sich zugezogen hat, habe ich ein anderes Geräusch wahrgenommen. Das dumpfe Schaben von Metall auf Holz.
Wie wenn jemand einen Riegel vorschiebt.
Mein bandagierter Fuß pocht, als ich die Beine von der Matratze schwinge. Ich ignoriere den Schmerz und stehe auf, nur um fast wieder hinzufallen. Ich lehne mich gegen die Steinwand und warte, bis der Dachboden sich nicht mehr um mich dreht. Dann versuche ich, einen ersten Schritt zu machen. Mein Fuß protestiert unter meinem Gewicht, und ich hüpfe einbeinig vorwärts, stütze mich am Stuhl ab und bringe dabei in dessen Innern irgendwas zum Scheppern. Jetzt erst bemerke ich, dass es ein Toilettenstuhl ist. Und zum ersten Mal seit dem Aufwachen bemerke ich den heftigen Druck auf meiner Blase.
Aber das wird warten müssen. Es ist offensichtlich, dass ich nicht weit kommen werde. Aber ich kann nicht zurück ins Bett, ehe ich nicht Gewissheit habe. Ich stütze mich auf den staubigen Möbeln ab und bewege mich taumelnd bis zur Luke. Ein Eisenring ist in die Bodenklappe eingelassen. Auf einen alten Sekretär gestützt, halte ich mich fest und ziehe an dem Eisenring. Die Falltür gibt leicht nach, dann steckt sie fest.
Sie ist verriegelt.
Himmel. Ich muss Panik niederkämpfen. Ich kann mir keinen Grund denken, warum ich hier oben eingesperrt bin. Zumindest keinen guten. Aber es steht außer Frage, dass ich zu schwach bin, um auch nur zu versuchen, hier rauszukommen. Selbst wenn ich etwas finde, mit dem der Riegel sich aufhebeln lässt, hat es mich schon das letzte bisschen Kraft gekostet, einmal quer über den Dachboden zu humpeln. Ich benutze den Toilettenstuhl und bin froh, mich erleichtern zu können. Dann sinke ich wieder auf die Matratze. Ich bin mit einem schmierigen Schweißfilm überzogen, und mein Kopf und der Fuß pochen gleichermaßen.
Ich nehme zwei von den Schmerztabletten und lege mich wieder hin. Doch ich bin zu aufgedreht, um schlafen zu können. Der Schmerz im Fuß lässt gerade nach, als ich von der Falltür her ein Geräusch höre. Dann schwingt sie mit einem Quietschen auf.
Dieses Mal kommt jemand anderes nach oben, ein Mädchen. Ich habe sie noch nie gesehen, aber als sie die Falltür zuklappt, tanzt das Licht auf ihrem Gesicht und weckt damit eine misstönende Erinnerung. Sie trägt ein Tablett und lächelt lauernd, als sie sieht, dass ich wach bin. Ich lege hastig die Decke über meinen Unterleib. Sie senkt den Blick und verkneift sich ein Grinsen.
«Ich habe Ihnen was zu essen gebracht.»
Sie ist noch ein Teenager, knapp zwanzig, schätze ich. Sogar mit dem verwaschenen T-Shirt und der Jeans ist sie wunderschön. Sie trägt pinke Flipflops, und der Anblick ist für mich irgendwie unpassend und zugleich merkwürdig beruhigend.
«Nur etwas Brot und Milch», sagt sie und stellt das Tablett neben der Matratze ab. «Mathilde sagt, Sie sollten lieber noch nicht so viel essen.»
«Mathilde?»
«Meine Schwester.»
Die andere Frau, schließe ich daraus. Zwischen den beiden besteht keine allzu große Ähnlichkeit. Das Haar des Mädchens ist heller, fast blond, und reicht ihr bis an die Schultern. Ihre Augen sind eine hellere Ausgabe vom dunklen Grau ihrer Schwester, und ihre Nase hat einen leichten Höcker, wo sie einmal gebrochen war. Eine winzige Unvollkommenheit, die ihre Schönheit irgendwie komplettiert.
Sie wirft mir weiterhin Seitenblicke zu und lächelt die ganze Zeit. Dabei bilden sich bezaubernde Grübchen in ihren Wangen.
«Ich bin Gretchen», sagt sie. Kein französischer Name, aber sobald sie ihn ausgesprochen hat, finde ich, dass er gut zu ihr passt. «Ich bin froh, dass Sie wach sind. Sie waren tagelang krank.»
Jetzt weiß ich, warum sie mir so bekannt vorkommt. Das madonnenhafte Gesicht, das ich während meines Deliriums gesehen habe, war gar keine Halluzination. «Du bist die, die mich gefunden hat?»
«Ja.» Sie wirkt verlegen, aber auch zufrieden. «Eigentlich war das aber Lulu.»
«Lulu?»
«Unser Hund. Sie fing an zu bellen, und ich dachte erst, sie hätte ein Kaninchen gewittert. Auf den ersten Blick sahen Sie ziemlich tot aus. Sie haben sich gar nicht gerührt, und überall schwirrten Fliegen herum. Dann machten Sie ein Geräusch, und ich wusste, Sie leben noch.» Sie schüttelt sich. «Es war ziemlich widerlich, Sie mit dem Brecheisen aus der Falle zu befreien. Sie haben sich gewehrt und lauter komische Sachen gebrüllt.»
Ich versuche, gleichgültig zu klingen. «Zum Beispiel?»
«Ach, das war nur wirres Zeug.» Sie tritt heran und stellt sich neben das Schaukelpferd. «Sie haben im Fieberwahn geredet, und das meiste war ohnehin englisch, also hab ich es gar nicht verstanden. Aber Sie haben damit aufgehört, sobald wir Ihren Fuß aus dem Eisen hatten.»
So, wie sie das erzählt, schien das alles nicht die Spur ungewöhnlich gewesen zu sein. «Wer ist wir?»
«Mathilde und ich.»
«Nur ihr zwei? Ihr habt mich ganz allein hier raufgeschafft?»
«Natürlich.» Sie zieht einen Flunsch. «Sie sind nicht so schwer.»
«Nein, aber … Wieso bin ich nicht im Krankenhaus? Habt ihr denn keinen Krankenwagen gerufen?»
«Wir haben kein Telefon.» Sie scheint das nicht besonders merkwürdig zu finden. «Außerdem weiß Mathilde, wie man sich um Wunden und solche Sachen kümmert. Papa war mit Georges unterwegs, und sie wollte nicht … Nun, wir haben es allein geschafft.»
Ich weiß nicht, was sie sagen wollte, sich aber verkniffen hat, oder wer Georges ist. Aber es gibt zu viele andere Fragen, die mir wichtiger erscheinen. «Ist Mathilde Krankenschwester?»
«Ach nein. Aber sie hat Mama gepflegt, bevor sie starb. Und sie kümmert sich auch um die Tiere, wenn sie sich verletzen. Die Sanglochons kämpfen ständig gegeneinander oder ziehen sich am Zaun Schnittverletzungen zu.»
Ich habe keine Ahnung, was ein Sanglochon ist, und es interessiert mich auch gar nicht. «Ihr habt nicht mal einen Arzt geholt?»
«Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass es nicht nötig war.» Sie klingt verärgert. «Ich weiß nicht, wieso Sie so sauer sind. Sie sollten dankbar sein, dass wir uns um Sie gekümmert haben.»
Die ganze Situation wird immer unwirklicher. Aber ich bin wohl nicht in der Position, um irgendwen gegen mich aufzubringen. «Das bin ich auch. Es ist nur … verwirrend.»
Besänftigt stützt sie sich auf das Schaukelpferd. Ihr Blick bleibt an meinem Gesicht hängen. «Was ist mit Ihrer Wange passiert? Sind Sie gestürzt, als Sie in die Falle getreten sind?»
«Oh, ich … glaube schon.» Ich habe den Bluterguss ganz vergessen. Ich berühre ihn, und der Schmerz weckt Erinnerungen, die mein Herz schneller schlagen lassen. Rasch lasse ich die Hand sinken und versuche, mich auf die Gegenwart zu konzentrieren. «Das Fangeisen sah nicht sonderlich alt aus. Hast du eine Ahnung, was es dort zu suchen hat?»
Sie nickt. «Das ist eine von Papas Fallen.»
Ich weiß nicht, was mich mehr entsetzt: die beiläufige Art ihres Geständnisses oder die Tatsache, dass es da draußen noch mehr davon gibt.
«Du meinst, du hast davon gewusst?»
«Natürlich. Papa stellt viele Fallen auf. Er ist der Einzige, der weiß, wo sich jede einzelne befindet. Aber er hat uns gesagt, wo im Wald wir lieber aufpassen sollen.»
Sie spricht es «P’paaa» aus und stößt die beiden Silben sanft wie eine einzige hervor. Die Kurzform klingt für mich ehrfürchtig und nicht kindlich. Aber was weiß ich schon; im Moment habe ich ganz andere Probleme.
«Was will er damit denn fangen? Es gibt in dieser Gegend doch keine Bären, oder?» Ich meine mich zu erinnern, schon mal von Braunbären in den Pyrenäen gehört zu haben. Das ist zwar nicht gerade in der Nähe, aber es ist im Moment die einzige halbwegs vernünftige Erklärung, die mir einfällt.
Gretchens Lachen macht diese vage Hoffnung gleich wieder zunichte. «Nein, natürlich nicht! Die Fallen sollen die Leute davon abhalten, einfach aufs Grundstück zu kommen.»
Sie sagt das, als wäre es absolut normal, fast tödliche Menschenfallen aufzustellen. Ich schaue auf meinen Fuß und kann es immer noch nicht glauben. «Das meinst du nicht ernst?»
«Der Wald gehört uns. Wenn jemand sich darin herumtreibt, geschieht es ihm ganz recht.» Sie ist jetzt kühler, fast schon überheblich. «Was haben Sie überhaupt auf unserem Grund zu suchen gehabt?»
Ich hab mich vor einem Polizeiauto versteckt. So langsam glaube ich, das wäre noch das kleinere von zwei Übeln gewesen. «Ich wollte mich erleichtern.»
Gretchen kichert. Ihre schlechte Laune ist verflogen. «Ich wette, Sie wünschen sich jetzt, es ausgehalten zu haben.» Ich bringe ein schwaches Lächeln zustande. Sie betrachtet mich, und ihre Finger fahren dabei über die raue Mähne des Schaukelpferds. «Mathilde sagt, Sie sind ein Rucksacktourist. Sind Sie hier auf Urlaub?»
«So was in der Art.»
«Sie sprechen sehr gut Französisch. Haben Sie eine französische Freundin?»
Ich schüttle den Kopf.
«Dann eine englische?»
«Nein. Wann kann ich gehen?»
Gretchen hört auf, die Pferdemähne zu streicheln. «Warum? Haben Sie es eilig?»
«Es gibt Leute, die mich erwarten. Sie werden sich Sorgen machen.»
Die Lüge klingt sogar in meinen Ohren wenig überzeugend. Sie lehnt sich zurück und stützt sich mit den Händen auf dem Schaukelpferd hinter ihr ab. Ihre Brüste drücken sich gegen das T-Shirt. Ich schaue weg.
«Sie können jetzt noch nicht gehen», erklärt sie. «Es geht Ihnen noch nicht wieder gut. Sie sind fast gestorben, verstehen Sie? Sie sollten dankbar sein.»
Das sagt sie nun schon zum zweiten Mal. Ich bin nicht sicher, ob das eine Drohung sein soll. Die Falltür ist jetzt nicht verriegelt, und einen kurzen Moment überlege ich, ob ich dorthin rennen soll. Dann werde ich von der Wirklichkeit eingeholt – Laufen ist im Moment für mich keine Option.
«Ich geh lieber zurück», sagte sie.
Das Schaukelpferd nickt heftig, als sie aufsteht. Ihre Jeans umschmiegt ihren Hintern und die Hüften, als sie sich bückt, um die schwere Falltür hochzuheben. Sie macht mehr Aufhebens darum, als eigentlich nötig wäre, und der rasche Blick, den sie in meine Richtung wirft, als sie sich aufrichtet, lässt mich glauben, dass das kein Zufall ist.
«Kannst du den Riegel offen lassen?», frage ich. «Hier oben ist kaum frische Luft.»
Gretchens Lachen ist hell und mädchenhaft. «Natürlich ist hier genug frische Luft. Wie könnten Sie sonst atmen? Sie wären ja schon tot, wenn’s nicht so wäre.»
Obwohl ich darauf warte, zucke ich doch zusammen, als ich höre, wie der Riegel wieder vorgeschoben wird.
Ich erinnere mich nicht, wie ich eingeschlafen bin. Als ich aufwache, ist der Dachboden dunkel und von Schatten bevölkert. Ich drehe meine Uhr so, dass Licht darauf fällt, und sehe, dass es schon nach neun ist. Ich lausche auf irgendwelche Geräusche von draußen, aber nichts dringt bis zu mir. Kein Flüstern, nicht mal ein Vogel oder ein Insekt.
Ich habe das Gefühl, der letzte Mensch auf Erden zu sein.
Das Tablett mit Essen, das Gretchen mir gebracht hat, steht noch neben dem Bett. Es gibt eine mit Wasser gefüllte Weinflasche, eine Schüssel mit Milch und zwei Stücke von etwas, das wie selbstgebackenes Brot aussieht. Überrascht stelle ich fest, wie ausgehungert ich bin. Die Milch ist kühl und dickflüssig und schmeckt sehr kräftig, weshalb ich vermute, es könnte sich um Ziegenmilch handeln. Ich tunke das Brot hinein und bin überzeugt, damit nicht mal ansatzweise meinen Hunger stillen zu können. Aber wer mir das Essen hergerichtet hat, weiß es besser als ich. Nach wenigen Mundvoll vergeht mir der Appetit. Ich schiebe das Tablett beiseite und lege mich wieder hin.
Für den Moment gesättigt, starre ich auf die dunklen Deckenbalken. Mein Fuß pocht wie ein Metronom. Ich weiß nicht, ob ich Patient oder Gefangener bin. Man kümmert sich anständig um mich, und wenn der Wald rund um den Hof voller illegaler Fallen ist, erklärt das, warum sie nicht das Risiko eingehen wollen, mich in ein Krankenhaus zu bringen.
Aber nachdem ich mit meinen Gedanken so weit gekommen bin, schlagen sie eine düstere Richtung ein. Ich bin noch immer in einer Scheune eingesperrt, und niemand weiß, dass ich hier bin. Was würde passieren, wenn es mir plötzlich schlechter geht? Und was wird aus mir, wenn ich mich vollständig erholt habe? Lassen sie mich dann einfach wieder gehen?
Verschwitzt und unruhig werfe ich mich auf der unebenen Matratze hin und her und versuche, eine bequeme Position zu finden. Irgendwann muss ich doch eingeschlafen sein. Ich bin wieder in dem Wäldchen und reibe an den Blutflecken auf dem Sicherheitsgurt herum. Sie gehen nicht raus, und der Gurt schlägt immer wieder gegen den Beifahrersitz. Das Schlagen wird lauter, und dann bin ich plötzlich wach und wieder auf dem Dachboden. Das Geräusch kommt von unten. Mir bleibt gerade noch genug Zeit, um zu realisieren, dass jemand die Stufen hochkommt. Dann wird der Riegel mit einem Kreischen zurückgezogen, und die Falltür fliegt auf.
Mit einem Knall fällt die Klappe auf die Dielen. Ein Mann stapft die letzten Stufen herauf und hält eine Laterne hoch. Er ist in den Fünfzigern, dick wie ein Fass, mit stahlgrauen Haaren und einem von der Sonne zerfurchten Gesicht. Im Moment ist es zu einer wütenden Maske verzerrt, während sich seine Augen auf mich richten. Ein Jagdgewehr liegt in der anderen Hand. Es ist zwar nicht auf mich gerichtet, aber alles an dem Mann lässt keinen Zweifel daran, dass sich das schnell ändern kann.
Ich setze mich auf und lehne mit dem Rücken an der Wand. Er stapft über die Dielen auf mich zu. Mathilde eilt hinter ihm die Stufen hoch.
«Lass das! Nicht!»
Er ignoriert sie. Am Fußende der Matratze bleibt er stehen und starrt mich finster an. Der gelbliche Schein der Laterne erschafft eine Höhle aus Licht um uns und taucht den Rest des Raums in tiefe Dunkelheit.
«Verschwinden Sie», knurrt er. Ihn umgibt eine Aura aus unterdrückter Wut. Als könnte er sich gerade noch bezähmen, mich nicht aus dem Bett zu zerren.
Mathilde greift nach seinem Arm. «Lass ihn doch wenigstens bis morgen früh …»
Er schüttelt sie ab, ohne den Blick von mir abzuwenden. «Verschwinden Sie», wiederholt er.
Ich habe wohl kaum eine Wahl. Ich schlage die Decke zurück und versuche so zu tun, als wäre mir meine Nacktheit egal. Dann hüpfe ich zu dem Toilettenstuhl und setze mich zum Anziehen darauf. Ich versuche, nicht vor Schmerz das Gesicht zu verzerren, als ich die Jeans über meinen verbundenen Fuß schiebe. Ich kann ihn unmöglich in einen Schuh stecken und stopfe deshalb den kaputten Wanderstiefel mit meinen anderen Sachen in den Rucksack. Nachdem das erledigt ist, stehe ich unsicher auf.
Der Mann zeigt mit dem Gewehrlauf auf die Falltür. «Los jetzt», sagt er überflüssigerweise.
«Ist ja schon gut, ich gehe», versichere ich ihm und versuche, wenigstens einen Rest Würde zu wahren.
Und das will ich wirklich. Ich bin allerdings nicht sicher, ob ich es zum anderen Ende des Dachbodens schaffe. Ich zögere, dann straffe ich mich und mache mich auf den langen Weg zur Falltür. Mathildes Gesicht ist ausdruckslos, als ginge sie nichts an, was gerade passiert.
Der Mann macht einen Schritt auf mich zu. «Bewegung.»
Ich bin nicht in der Lage, Einwände zu erheben. Ich klammere mich mit beiden Händen an den Aluminiumrahmen meines Trekkingrucksacks und schiebe ihn vor mir her. Die Entfernung zur Falltür lege ich mit vielen langsamen, schlurfenden Sprüngen auf dem gesunden Bein zurück. Mathilde und ihr Vater folgen mir. Im Schein seiner Laterne sehe ich Gretchen mit dem Baby auf den Stufen stehen. Erstaunlicherweise schläft es noch, der Kopf lehnt schlaff an ihrer Schulter. Aber sie hat die Augen weit aufgerissen und sieht verängstigt aus, als sie mir Platz macht.
Ich schiebe den Rucksack bis zu der Luke vor. Wut und Kränkung haben mich bis hierher getrieben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es die Treppe runter schaffen soll. Die sauberen Klamotten kleben schon wieder verschwitzt auf meiner Haut. Ich kann mich riechen – mein Schweiß stinkt nach Krankheit. Behutsam lasse ich mich nieder, und in der Lukenöffnung sitzend, stecke ich die Arme durch die Schulterriemen des Rucksacks. Dann schiebe ich mich vor, taste mit dem gesunden Fuß nach der ersten Stufe und verlagere mein Gewicht darauf. Ich halte mich an der Einfassung der Luke fest und empfinde ein gewisses Triumphgefühl, als ich auf die nächste Stufe hüpfe. Mir bleibt kaum Zeit, die raschen Schritte hinter mir zu registrieren, bevor mich jemand in den Rücken stößt und ich in die Dunkelheit stürze.
Die Luft wird mir aus den Lungen getrieben, als ich am Fuß der Treppe mit ohrenbetäubendem Getöse in Flaschen krache. Dann liege ich einfach nur perplex und atemlos dort, wo ich gelandet bin. Das Eigengewicht des Rucksacks drückt mich nieder. Ich versuche, mich hochzuhieven. Dann ist jemand an meiner Seite und hilft mir auf.
«Sind Sie okay?»
Es ist Mathilde. Ehe ich antworten kann, kommt ihr Vater die Stufen herunter. Das Licht von seiner Lampe flackert auf den überall verstreuten Flaschen. Hinter ihm kann ich im Schatten Gretchen erkennen. Das Baby ist aufgewacht und hat angefangen zu weinen, aber das scheint niemand zu bemerken. Wir befinden uns jetzt auf einer Art gezimmerter Galerie, die sich zwischen dem Dachboden und dem unteren Teil der Scheune befindet. Ich mache mich von Mathildes Händen los und packe einen Flaschenhals, kämpfe mich auf die Füße und stelle mich ihm.
«Bleiben Sie zurück!», schreie ich auf Englisch, weil mein Französisch mich gerade im Stich lässt. Warnend hebe ich die Flasche. Mein verletzter Fuß protestiert, als ich, um Gleichgewicht ringend, das Gewicht darauf verlagere.
Der Mann erreicht das untere Ende der Treppe. Er ist der Mittelpunkt der gelben Aura von seiner Laterne. Seine Hand umschließt das Gewehr, und er starrt die Flasche geringschätzig an. Dann macht er einen Schritt auf mich zu. Mathilde tritt dazwischen. «Lass das. Bitte.»
Ich bin nicht sicher, mit wem von uns beiden sie spricht. Aber ihr Vater bleibt stehen und starrt mich stumm und voll unverhohlenem Abscheu an.
«Ich habe doch versucht zu gehen!», schreie ich.
Meine Stimme ist wacklig. Das Adrenalin hat mich geschwächt; ich zittere. Plötzlich spüre ich das kalte Gewicht der Flasche in meiner Hand. Ich schwanke, und mir wird übel. Für einen Augenblick stehe ich wieder auf einer dunklen Straße, und eine andere Szene voller Blut und Gewalt spielt sich vor meinen Augen ab.
Ich lasse die Flasche fallen. Sie rollt über die staubigen Dielenbretter und stößt mit einem dumpfen Klackern gegen die anderen. Das Baby heult immer noch und windet sich in Gretchens Armen, aber niemand sagt ein Wort, als ich auf die nächste Treppe zuhumple. Fast augenblicklich geben meine Beine nach, und ich lande unsanft auf den Knien. Ich heule fast vor lauter Frust, aber ich habe nicht mehr die Kraft aufzustehen. Dann ist Mathilde wieder an meiner Seite und schiebt ihren Arm unter meinen.
«Ich schaffe das», behaupte ich bockig. Sie ignoriert meinen Einwand und schiebt mich gegen einen Holzbalken, ehe sie sich wieder an ihren Vater wendet.
«Er ist nicht in dem Zustand, irgendwohin zu gehen.»
Sein Gesicht wirkt hart im Laternenlicht. «Das ist aber nicht mein Problem. Ich will ihn nicht hier haben.»
Wenn Ihre Falle nicht wäre, wäre ich auch nicht hier, will ich einwenden, aber kein Laut kommt über meine Lippen. Mir ist schwindelig. Ich schließe die Augen und lehne den Kopf gegen den Balken. Ihre Stimmen wirbeln um mich herum.
«Er ist ein Fremder, darum konnte er das nicht wissen.»
«Das ist mir egal. Er bleibt nicht.»
«Ist es dir lieber, wenn die Polizei ihn abholt?»
Die Erwähnung der Polizei lässt mich den Kopf heben, aber die Warnung hat offensichtlich nichts mit mir zu tun. In meinem fiebrigen Zustand glaube ich zu erkennen, wie beide sich stumm miteinander messen. Erwachsene, die über den Kopf eines Kindes hinweg reden, das kein Wort versteht. Vermutlich wollen sie nicht, dass die Polizei von den Fangeisen erfährt, denke ich. Aber ich bin zu müde, um mich zu fragen, warum das so ist.
«Lass ihn nur für ein paar Tage bleiben», fleht Mathilde. «Bis er wieder zu Kräften gekommen ist.»
Die Antwort ihres Vaters lässt lange auf sich warten. Er starrt mich an, dann wendet er sich mit einem herablassenden Schnauben ab. «Mach, was du willst. Aber sorge dafür, dass er mir aus den Augen bleibt.»
Er geht zur Treppe. «Die Laterne», sagt Mathilde. Er zögert, und ich kann sehen, wie er darüber nachdenkt, sie einfach mitzunehmen und uns ohne Licht hierzulassen. Dann stellt er die Lampe auf den Boden und verschwindet ohne ein Wort in der Dunkelheit unter der Galerie.
Mathilde holt die Laterne und hockt sich neben mich. «Kannst du stehen?»
Als ich nicht antworte, wiederholt sie die Frage auf Englisch. Ich bleibe immer noch stumm, aber ich beginne, mich hochzuhieven. Ohne Zögern nimmt sie mir den Rucksack von den Schultern.
«Stütz dich auf mich.»
Ich will das eigentlich nicht, aber ich habe keine andere Wahl. Unter der dünnen Baumwolle ist ihre Schulter fest und warm. Sie legt einen Arm um meine Taille. Sie reicht mir bis ans Kinn.
Als wir das untere Ende der Treppe erreichen, taucht Gretchen aus dem Schatten auf. Das Baby hat ein rotes, verweintes Gesicht, aber es schaut sich eher neugierig als verstimmt um.
«Ich habe dir gesagt, du sollst mit Michel im Haus bleiben», tadelt Mathilde.
«Ich wollte doch nur helfen.»
«Ich kriege das schon hin. Bring ihn zurück ins Haus.»
«Warum soll immer ich auf ihn aufpassen? Er ist dein Baby.»
«Bitte tu einfach, was ich dir sage.»
Gretchens Gesicht verhärtet sich. Sie schiebt sich an uns vorbei, und ihre Flipflops schlappen laut und wütend auf den Stufen. Ich spüre Mathildes Seufzen mehr, als dass ich es höre.
«Komm», sagt sie erschöpft. Sie stützt mich, als wir die Treppe hochsteigen und ich zur Matratze humpele. Es dauert ewig. Ich sinke auf das Lager und bemerke nur am Rande, wie sie nach unten geht. Kurz darauf ist sie wieder da und bringt den Rucksack und die Laterne mit. Sie stellt beides neben das Bett.
«Dein Vater hat nicht gewusst, dass ich hier bin, stimmt’s?», frage ich. «Du hast es ihm nicht erzählt.»
Mathilde steht außerhalb des Lichtkreises. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen und weiß darum nicht, ob sie mich ansieht oder nicht.