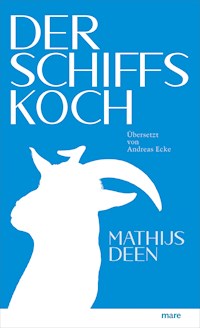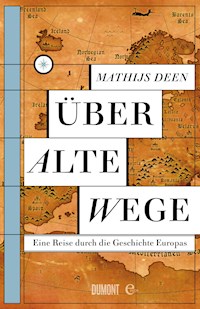Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Liewe Cupido
- Sprache: Deutsch
Es soll eine ruhige Fahrt übers Wattenmeer für Geeske Dobbenga werden, die letzte vor ihrer Pensionierung beim niederländischen Grenzschutz. Doch in der Emsmündung stößt ihr Patrouillenboot auf eine Leiche. Bevor die Flut sie wegträgt, bringen Geeske und ihre Mannschaft sie nach Delfzijl in den Niederlanden. Damit beginnen die Probleme: Der Tote war Deutscher, und sein Fundort liegt in umstrittenem Grenzgebiet. Während der Streit um die Zuständigkeit beiderseits der Grenze eskaliert und die Fragen rund um den toten Wattwanderer sich häufen, schickt die Bundespolizei See in Cuxhaven heimlich einen Ermittler nach Delfzijl: Liewe Cupido, gebürtiger Deutscher, aber auf der niederländischen Insel Texel aufgewachsen. Seine deutschen Kollegen nennen diesen eigenwilligen, schweigsamen Typen: den Holländer. Wer, wenn nicht er, könnte den Fall lösen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Mathijs Deen
DER HOLLÄNDER
Roman
Aus dem Niederländischen
von Andreas Ecke
© 2022 by mareverlag, Hamburg
Karte Peter Palm, Berlin
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann /mareverlag
Coverabbildung plainpicture/BY
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-804-5
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-674-4
www.mare.de
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Über das Buch
PROLOG
»Machen Sie eine Pilgerfahrt?«
Die Pfarrerin, die auf dem Weg vom Kirchenportal zu ihrem Wagen auf Aron aufmerksam geworden ist, bleibt stehen und betrachtet den langen, hölzernen Stock, den seine rechte Hand umklammert. Es sieht aus, als würde er sich wie ein müder Wanderer darauf stützen. Die Spitze sinkt ein wenig in den Rasen vor seinen Füßen ein. Er hat sie nicht bemerkt, als sie die Kirche verließ, er blickte am Kirchturm vorbei zu den wenigen Wolken hinauf, die von Südosten her vorüberziehen. Deshalb antwortet er auch nicht gleich, sondern starrt sie an, als hätte er sie nicht verstanden.
»Sie sehen aus, als ob Sie auf Pilgerfahrt sind, mit diesem Stab. Möchten Sie die Kirche besichtigen?«
Aron, ein kräftiger Mann in den Vierzigern, hellblaue Augen, Mehrtagebart, langes Tolstoi-Hemd, breiter Gürtel um die Taille, schüttelt den Kopf. Er zieht den Stock aus dem Rasen, und während er behutsam gegen die Spitze tritt, damit der Sand abfällt, antwortet er: »Wenn ich ein Pilger bin, dann ein Pilger des Meeresbodens.«
»Ach, Sie sind Deutscher?«
Aron schaut die Pfarrerin an. »Ich bin Weltbürger.«
Die Pfarrerin lächelt. »Ein deutscher Weltbürger.« Sie macht eine einladende Geste zum Eingang hin. »Sie sind willkommen«, sagt sie. »Die Kirche ist fast tausend Jahre alt. Ich habe die Tür aufgeschlossen.«
Doch Aron bleibt nachdenklich stehen. »Ich suche nicht den Kontakt mit Gott«, sagt er, »sondern festen Boden unter den Füßen und einen Weg zur anderen Seite. Gilt das auch als Pilgern?«
Im Turm beginnt eine Glocke zu schlagen, es ist elf Uhr. Die Pfarrerin lächelt, doch wie ihre Körpersprache verrät, kommt ihr Arons Antwort, die eigentlich nach einer pastoralen Erwiderung verlangt, nicht gelegen. Sie hat wohl angenommen, mit ein paar netten Bemerkungen werde die Sache erledigt sein, vermutlich hat sie irgendeinen Termin, möchte aber nicht unhöflich sein.
»Was führt Sie dann nach Lower Halstow?«, fragt sie, während sie auf ihren Autoschlüssel drückt. Die Warnblinker ihres Autos leuchten gehorsam auf, die Türschlösser öffnen sich klackend. Aron dreht sich halb um und nickt in Richtung des kleinen Tidenhafens, der allmählich trockenfällt. Dahinter breiten sich die Schorren und Schlickflächen der Medwaymündung aus.
»Der Meeresboden«, sagt er. »In zwei Stunden ist Niedrigwasser. Ich gehe zum Fahrwasser.« Er hebt den Stock. »Deshalb der Pilgerstab«, erklärt er. »Es ist ein Peilstock, für den Fall, dass ich unterwegs doch auf Wasser stoße.« Jetzt ist er mit dem Lächeln an der Reihe. »Wir können nicht alle übers Wasser gehen. Wir Sünder müssen uns unseren Weg durch den Schlamm suchen.«
»Really?« Die Pfarrerin macht eine besorgte Miene. »Wissen Sie, was Sie tun?«
»Es ist nicht das erste Mal.«
»Es wäre auch nicht das erste Mal, dass jemand da draußen bleibt.«
»Machen Sie sich keine Sorgen, ich vertraue weniger auf Glauben als auf gründliche Vorbereitung.«
Die Pfarrerin schüttelt den Kopf. »Ich wünsche Ihnen beides«, sagt sie. Sie holt ihr Telefon aus der Tasche, schaut aufs Display, grüßt und geht im Laufschritt zu ihrem Wagen.
Aron legt sich den Peilstock auf die Schulter. Er dreht sich um und geht von der Kirche zu dem Fußweg, der am Seedeich entlang zu den Twinney Saltings führt, den Salzwiesen des Deichvorlands. Dort wird er den festen Boden verlassen und seinen Weg übers Watt suchen. Schon seit Stunden läuft das Wasser ab, als würde jemand eine Decke ganz langsam von einem Bett ziehen.
Er weiß genau, was er tut, obwohl es unmöglich ist, alle Risiken zu vermeiden. Ein Wattwanderer geht ungebahnte oder vom Meer ausgelöschte Wege. Es ist eine Umgebung voller Unwägbarkeiten, in der die Natur das Sagen hat. Er kann bestenfalls die unvermeidlichen Risiken in Gedanken vorwegnehmen und sich darauf einstellen, damit er im Fall eines Falles die Situation beherrscht. Kein Wattwanderer kann genau wissen, wie tief ein Priel ist, denn Wind und Strömung gemeinsam können ihn in einer einzigen Nacht vertieft, verlegt oder aufgefüllt haben. Deshalb der Peilstock. Außerdem kann er nie völlig ausschließen, dass ein Unwetter aufzieht oder sein Körper ihm einen Streich spielt, weshalb er Seenotfackeln und Schmerztabletten bei sich hat. Und in diesem besonderen Fall weiß Aron nicht, ob Peter ihn anrufen wird oder nicht. Er vermutet es, kann aber nicht sicher sein. Auch deshalb hat er sein Telefon mitgenommen.
Der Wattwanderer und seine Ausrüstung, auf alles vorbereitet und doch nicht sicher. Er liebt diesen Widerspruch, er liebt es, sich am Rand zu bewegen, in der Hand den Peilstock zu spüren, den er schon seit fast zwei Jahrzehnten immer an derselben Stelle festhält. So oft er auch mit anderen im Watt unterwegs gewesen ist – am häufigsten natürlich mit Peter und Klaus –, ist ihm doch nichts und niemand so nah wie sein Peilstock, die vertraute Form in seiner Hand, die Wärme der Berührung. Peilt er einen Priel und kommt das trübe Wasser dabei nicht weiter als bis zu seiner Hand, kann er ihn mit seinem Stock durchqueren. Ist der Priel tiefer, kommt das Wasser also bis über seine Fingerknöchel oder weiter, geht es nicht. Könnte er doch auch seine Gefühle peilen, das dunkle, weitverzweigte Prielnetz seiner Seele, könnte er doch ergründen, ob er will, dass Peter anruft, oder gerade nicht.
Er ist mitten auf der trockengefallenen Schlickebene des Medway, als das Telefon klingelt. Aron atmet tief durch und nimmt ab.
»Hallo, Peter«, sagt er.
Peter erwidert den Gruß nicht, sondern kommt sofort zur Sache. Er klingt sehr aufgeregt. »Es ist so weit!« Er schreit es beinahe. »Nipptide, Wind Ost vier, vielleicht fünf, 1040 hPa. Niedrigwasser 18 Uhr. Wir gehen.«
Aron schweigt einen Moment und sagt dann: »Ich sagte: Hallo, Peter.«
»Wie, was, hallo Peter?! Es ist so weit! Hierauf haben wir gewartet, oder nicht?!«
»Ich bin auf dem Medway.«
»Was … jetzt?« Es verschlägt Peter die Sprache. Er versteht es nicht. »Auf dem Medway? In England? Du hast doch gewusst, dass die Chance bestand, oder?«
»Es ist wunderschön hier, Peter.«
Doch Peter hört nicht zu. »Du willst mir doch nicht erzählen, dass du diese Gelegenheit sausen lässt, wo sie endlich da ist?!«
»Es ist deine Entscheidung.«
»Wieso meine?« Peter klingt verärgert. »Es ist unsere, Aron.«
Aron lässt den Peilstock in seiner Hand kreisen, blickt über den Priel im Medway zu der Raffinerie auf der anderen Seite.
»Jetzt ist der Moment, Aron, darum ging es doch die ganze Zeit, wie lange haben wir darauf gehofft? Zehn Jahre oder mehr? Fünfzehn?«
»Also du gehst?«
»Wir gehen«, erwidert Peter.
Aron schließt die Augen, ballt die Faust um den Stock. »Wenn wir doch alles im Voraus wüssten«, sagt er. »Bist du sicher, dass du gehen willst?«
»Morgen 16 Uhr in Manslagt, beim Nienhof. Ich zähle auf dich, du lässt mich nicht hängen. Jetzt rufe ich Klaus an.«
Aron folgt seinen Fußspuren zurück über die Salzwiesen des Deichvorlands und am Deich entlang nach Lower Halstow. Bei der Kirche zögert er, bleibt stehen, blickt sich um. Er zieht die Surfstiefel aus und lehnt seinen Stock an den Rahmen der Kirchentür, die noch offen ist. Er tritt ein, schließt die Tür hinter sich und horcht einen Moment auf die steinerne Stille. Dann geht er zwischen den Bankreihen hindurch zum Altar, hinter dem das Sonnenlicht durch zwei große Fenster mit Glasmalereien hereinfällt. Auf dem linken Fenster ein stehender Soldat, in einer Hand ein langes Gewehr, fast wie ein Stock, der Kolben vor seinen Füßen auf dem Boden. Er blickt zum rechten Fenster, auf dem der Erlöser in himmlischem Licht badet.
Aron holt ein Feuerzeug aus der Tasche und entzündet die drei großen Kerzen, die vor dem Altar stehen.
»Er muss es nicht machen«, sagt er. »Es muss nicht sein. Ich habe es ihm gesagt.«
Dann dreht er sich um, verlässt die Kirche und geht zum Green Farmhouse, dem B&B, in dem seine Frau Maria und er ein paar Tage verbringen.
Es geht auf eins zu. Im Garten der Pension sitzt Maria, eine Decke um die Schultern, und liest. Sie blickt erst auf, als er vor ihr steht und sein Schatten die Buchseiten verdunkelt.
»Du bist zurück«, sagt sie.
Er nickt. »Peter hat angerufen.«
Maria schaut ihn an, legt schweigend ihr Lesezeichen ins Buch und klappt es zu.
»Ich lege mich kurz hin«, sagt Aron. »Ich habe nachts kein Auge zugemacht.«
»Ist gut, Liebling«, antwortet Maria. »Versuch ein bisschen zu schlafen.«
Und sie streift die Decke von den Schultern und steht auf.
1
Geeske Dobbenga weiß, dass sie der Besatzung ihr Herz ausschütten könnte, wenn sie wollte, und dieses Wissen ist wichtiger, als es tatsächlich zu tun. Die Gewissheit, dass die Männer sie verstehen würden, macht das bittere Glücksgefühl, das sie beim Auslaufen empfindet, um vieles erträglicher. Sie fühlt sich heimisch auf dem Schiff, viel mehr als bei der Brigade an Land. Obwohl sie als Opperwachtmeester einen höheren Rang hat als die anderen Grenzschützer an Bord, empfindet sie sich als Gleiche in eine kleine Gemeinschaft von Seelenverwandten aufgenommen, sobald sie die Gangway betritt und unter ihren glänzenden Militärstiefeln die Bewegung des Wassers spürt. Dieses Gefühl schließt die nautischen Besatzungsmitglieder ein, den Kapitän, den Steuermann, den Maschinisten, den Matrosen; alle wissen voneinander, was sie verschweigen, wenn das Schiff sich vom Kai löst. Beim Auslaufen wird deshalb nicht gesprochen. Alle spüren das Zittern, das durch das Schiff geht, wenn die Motoren angelassen werden, alle hören das Rauschen des Wassers an den Bordwänden, das Brummen im Maschinenraum.
»RV 180, gute Fahrt«, funkt routinemäßig die Verkehrszentrale Ems. Normalerweise bleibt es dabei, doch heute folgt eine weitere Nachricht, eigens für Geeske. »Und glückliche Heimkehr für M&M.«
Offenbar weiß sogar die Verkehrszentrale, dass sie nächsten Monat in Pension geht, dass es ihre letzte Fahrt ist. Der Kapitän, Jan Toxopeus, der diesen Scherz mit dem Mann von der Verkehrssicherung ausgeheckt hat, schaut kurz über die Schulter, um zu sehen, wie sie es aufnimmt, dass er auch ihren Spitznamen verraten hat. Sie lächelt, es stört sie nicht. Seit sie Opperwachtmeester ist, hat sie ihren Leuten eingeschärft: »Wir wissen alle, was unsere Arbeit mit sich bringt, aber wenn es schwierig wird, gelten aus meiner Sicht zwei Faustregeln: Möglichkeiten suchen und menschlich bleiben. Nennt es von mir aus Geeskes zwei Ms.«
Seitdem heißt sie M&M.
»Wir bringen sie heil und gesund nach Hause.«
Die RV 180, ein Schiff der Koninklijke Marechaussee, das im Wattenmeer patrouilliert, folgt gemächlich der langen Mole zur Hafeneinfahrt von Delfzijl. Die Windräder blicken in Richtung Sonnenaufgang, wie Sonnenblumen. Sie drehen sich langsam. Es ist fast acht, ein klarer Morgen, Altweibersommer.
Die Strömung, die an den Tonnen zerrt, verrät die einsetzende Flut. Die RV 180 hat nur geringen Tiefgang, sie kann fast überall fahren und dank ihres flachen Unterwasserschiffs trockenfallen, wenn es sein muss. Sie wurde speziell fürs Wattenmeer entworfen. Fährt sie auf der offenen See nördlich der Inseln, ist sie unruhig, ein Korken auf den Wellen. Auf dem Wattenmeer dagegen ist sie agil, stark, schnell, ein Raubtier, das über die Untiefen huscht.
Backbord voraus nähert sich das Ende der Hafenmole. Auf dem Deich an Steuerbord sieht man das Denkmal für das abgerissene Dorf Oterdum, das dem expandierenden Industriegelände von Delfzijl weichen musste. Die Grabsteine, die früher bei der Dorfkirche standen, stehen heute auf dem Deich. In der Mitte, auf einem Backsteinsockel, die Skulptur, die sie so gut kennt: eine zum Himmel hin geöffnete Hand, darin eine kleine Kirche. Geeske betrachtet sie, wie bei jedem Auslaufen. Sie hat immer versucht, die Szenerie aus Grabsteinen auf dem Deich als Mahnung zu deuten; als Dämpfer für ihr Glück. Ihr Leben lang hat ihr ein Übermaß an Gefühlen zu schaffen gemacht. Mit zunehmendem Alter ist das nur schlimmer geworden.
Sie denkt daran, dass es ihre letzte Patrouille ist, dass bei ihrem Ausscheiden auch das Schiff außer Dienst gestellt wird, dass eine Epoche zu Ende geht. Sie versucht zu ergründen, was das für sie bedeutet, aber das ist nicht leicht. Die Zeit vergeht, dagegen lässt sich nichts machen, man kann sich höchstens bemühen, sie nicht unbemerkt verstreichen zu lassen, den Becher bis zur Neige zu leeren.
Sie dürfen mich nicht anschauen, denkt sie, sie dürfen mich nicht so sehen. Sie blickt starr auf die Grabsteine.
Dann dreht das Schiff auf die Außenems hinaus. Die erste Dünung, die erste Ankündigung der offenen See. Jetzt beginnt die Arbeit, das Schweigen wird gebrochen.
»Das letzte Mal, Opper«, sagt Toxopeus.
Geeske räuspert sich. »Hoffentlich bringen wir irgendetwas mit nach Hause, aus gegebenem Anlass«, sagt sie.
Der Kapitän nickt. »Ein großes Finale.«
Die Besatzung hat diesmal keinen besonderen Auftrag: zuerst Eemshaven, an Rottumerplaat vorbei auf die offene See, vor Schiermonnikoog wieder aufs Wattenmeer zurück und ein Stück in Richtung Lauwersoog, dann gemächlich nach Westen, den Schiffsverkehr überwachen, gegebenenfalls Schiffe oder Boote anhalten, Ladung und Besatzung kontrollieren. Routineaufgaben.
Langsam fährt die RV 180 auf der Außenems Kurs Nord. An Backbord dehnt sich das trockengefallene Watt aus. Der Rand der Sandbank erhebt sich aus dem Wasser, eine kniehohe Kliffküste. Doch das Wasser steigt schnell, man sieht die bröckelnden Miniaturkliffe verschwinden.
Der Steuermann, Meeuwis Bosscher, legt einen Zahn zu. Das Heck senkt sich ein wenig, der Bug hebt sich. Geeske nimmt ein Fernglas, stellt es auf die Bohrinsel mitten auf der Sandbank De Hond ein, sucht dann den Großen Leuchtturm von Borkum, bleibt aber an einem schwarzen Fleck hängen. Auf der Sandbank liegt ein Seehund, nah an der Flutlinie.
Sie betrachtet ihn eine Weile. Es ist kein Seehund.
Sie dreht sich um und hält das Fernglas einem Kollegen hin, der hinter ihr Ausschau hält.
»Was ist das da? Kannst du das erkennen, Rob? Da drüben an der Flutlinie? Ist das ein Seehund?«
Rob nimmt das Glas und sucht, stellt die Entfernung ein. Auch der Steuermann greift nach einem Fernglas, er nimmt Gas zurück. Der Bug senkt sich, eine Bugwelle läuft am Schiff entlang und hebt es achtern leicht an.
»Das ist ein Mensch«, sagt Rob.
»Korrigierst du den Kurs, Meeuwis?« Der Kapitän übernimmt das Fernglas des Steuermanns, das Schiff dreht in Richtung De Hond. Nachdem er eine Weile durchs Glas geschaut hat, sagt er: »Sieht so aus, dass dort dein großes Finale liegt, Opper.«
»Ein Ertrunkener«, sagt Rob.
»Die Flut steigt, es bleibt nicht viel Zeit«, sagt der Kapitän.
»Passiert es also doch noch«, sagt Geeske, die in ihrer langen Dienstzeit noch nie mit einem Toten zu tun hatte. »Wir fahren hin, Rob. Ich komme mit. Machst du das RIB klar, Gus?«
»Ich will mich ja nicht einmischen«, sagt der Kapitän. »Aber ich würde einen Leichensack mitnehmen. Ihr habt höchstens eine Viertelstunde, zwanzig Minuten. Dann steht da alles unter Wasser.«
Während der Kapitän das Steuerrad übernimmt und die RV 180 noch etwas näher an die Sandbank heranlenkt, ziehen Steuermann Meeuwis Bosscher, Geeske und Rob auf dem Achterschiff Schwimmwesten an. Matrose Gus hat unter Deck einen Leichensack geholt und ihn vorn in das Festrumpfschlauchboot gelegt, das schnelle Tochterboot, das in der schrägen Wanne vor der schon geöffneten Heckklappe liegt. Die drei klettern ins Boot, der Matrose klinkt die Leine am Bug aus, und das Boot gleitet rückwärts ins Wasser. Der Motor springt an, der Steuermann wendet das Boot und fährt es zur Sandbank, wo es sich mit dem Bug auf den Rand schiebt und festläuft. Die paar Möwen, die bei dem Ertrunkenen gelandet sind, fliegen auf.
Rob steigt als Erster aus. Seine glänzenden Stiefel sinken tief in den Schlick ein. Er hilft Geeske aus dem Boot, und beide staksen zu dem Toten, der nur noch einen halben Meter von der sich nähernden Flutlinie entfernt liegt. Es ist ein Mann, er liegt auf dem Bauch. Er trägt Surfstiefel, eine lange Laufhose, ein Thermohemd und einen Gürtel um die Taille, an dem ein Messer in einer Scheide hängt. Und ein langes Seil, das sich um seine Beine geschlungen hat und mit dem Ende im Wasser liegt.
»Gott sei Dank noch nicht so lange tot«, sagt Rob.
»Fundort sichern ist nicht drin«, sagt Geeske. »Hier steht jeden Moment alles unter Wasser. Ich rufe den BK an, machst du Fotos?«
Rob geht um den Toten herum, um die Auffindesituation von allen Seiten zu dokumentieren, Geeske wählt die Nummer von Brigadekommandeur Henk van de Wal. Es ist nach neun, der Arbeitstag hat angefangen, und er nimmt nicht ab.
Während Geeske immer wieder den Freiton hört, dann den Beginn des Voicemail-Textes, erneut anruft und wartet, spürt sie im Nacken, dass die Morgensonne an Kraft zunimmt. Sie geht um den Ertrunkenen herum und sieht zum ersten Mal sein Gesicht. Eine Möwe hat in einem seiner Augen herumgepickt, aber das andere ist unverletzt und klar. Der Tote starrt in die Sonne. Es ist ein überraschter Blick, belustigt und erschrocken zugleich, als wäre er während eines Lachanfalls plötzlich von etwas überrumpelt worden und hätte keine Zeit mehr für Angst gehabt. Geeske spürt, wie sich die Wärme der Sonne von ihrem Nacken aus durch den ganzen Körper ausbreitet, als viel zu großes, unbeherrschbares Mitleid. Zum zweiten Mal an diesem Morgen werden ihre Augen feucht. Move him into the sun, sagt sie. Sie tritt in den Schlick, wie um sich selbst zur Ordnung zu rufen. »Gut, dass ich aufhöre«, sagt sie laut. »Ich bin eine Heulsuse.«
»Wer ist eine Heulsuse?« Kommandeur Henk van de Wal hat abgenommen.
»Wir haben einen Ertrunkenen auf De Hond«, sagt Geeske.
»Der Bank?«
»Ja.«
»Ein Fall für die Polizei«, sagt van de Wal.
»Dafür reicht die Zeit nicht«, erwidert Geeske. »Er liegt am Rand, die Flut steigt, wir müssen ihn da wegholen.«
»Liegt er auf unserer Seite?«
»Unserer Seite?«
»Auf niederländischem Gebiet?«
Gott nein, nicht das noch, denkt Geeske. »Kommt drauf an, wen du fragst, Henk«, antwortet sie. »Ich stelle gleich noch die Koordinaten fest, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass er aus deutscher Sicht auf deutschem Gebiet liegt.«
»Das wollen wir erst mal sehen«, sagt van de Wal.
Geeske ärgert sich, will es sich aber nicht anmerken lassen. »Wir nehmen ihn mit«, sagt sie. »Bleibt nichts anderes übrig.«
»Papiere?«
Geeske sieht, dass Rob neben dem Toten hockt und nicht mehr fotografiert. »Bist du fertig?«, ruft sie.
Rob nickt. »Schau mal, ob er Papiere hat«, sagt Geeske.
Rob dreht den Toten vorsichtig auf den Rücken, sucht in seiner Kleidung. Er findet einen Ausweis, dreht ihn um.
»Klaus Smyrna«, liest er. »Deutscher, aus Lübeck.«
»Es ist ein Deutscher«, sagt Geeske ins Telefon.
»Gut, nehmt ihn mit«, sagt van de Wal. Und dann: »Das war eine kurze letzte Patrouille, Opperwachtmeester.«
»Wir müssen ihn jetzt wirklich wegholen!«, ruft Rob.
»Ich muss los«, sagt Geeske und legt auf.
Kurz darauf wird das Tochterboot mit Geeske, Rob, Meeuwis und dem Ertrunkenen an Bord der RV 180 gezogen, und das Schiff nimmt mit schweigender Besatzung Kurs auf die Hafeneinfahrt von Delfzijl. Der Leichensack liegt auf Deck, das Seil in einem versiegelten Kunststoffbeutel darauf. Auf einem Aufkleber auf dem Sack stehen die Koordinaten: 53°24'49" N / 6°55'11" O.
Als das Patrouillenschiff gerade an den Leuchttonnen in der Hafeneinfahrt von Delfzijl vorbei ist, schwillt von Osten her das Geräusch eines Hubschraubers an. Geeske, die auf die Grabsteine von Oterdum gestarrt hat, dreht sich um, blickt nach oben.
»Sie suchen ihn schon«, sagt sie zu Rob.
2
Zwei Beamte der Inselpolizei Borkum stehen schon auf dem Tüskendör-Deich, als Peter Lattewitz als Pünktchen am Horizont erscheint. Der Eingebung, ihm entgegenzugehen, sind sie nicht gefolgt. Sie brauchen nur zu warten, er kann nirgendwo sonst hin, und die Flut treibt ihn auf sie zu.
Außerdem hat Peter, als er vor einer Stunde Kontakt mit der Polizei von Borkum aufnahm, nicht den Eindruck erweckt, eine Gefahr für sich selbst zu sein. Er klang zwar aufgeregt, aber, so sagte man sich bei der Inselpolizei, wenn irgendjemand weiß, wie man es vom Watt heil auf die Insel schafft, dann ist er es.
Wie seine Freunde Klaus Smyrna und Aron Reinhard gilt Peter als Extrem-Wattwanderer der ersten Stunde, der Pionierarbeit im Erkunden neuer Routen geleistet und die Grenzen des Möglichen verschoben hat. Gemeinsam hat das Wattführertrio sämtliche Inseln des Wattenmeers zu Fuß erreicht, vom dänischen Langli bis zum niederländischen Texel – Letzteres von Vlieland aus.
Nur nicht Borkum.
Diese schwer zu erreichende Insel, der Mount Everest der Wattwanderer, wollte sich nicht erobern lassen, und das nagte an ihnen. Zumal einem niederländischen Duo schon in den Siebzigerjahren die Wattquerung von Manslagt nach Borkum gelungen war. Der einzige Trost war, dass die Niederländer die Zeit um Hochwasser herum auf halber Strecke zwischen dem Festland und Borkum in kleinen, mitgeschleppten Schlauchbooten verbracht, also den Kontakt mit dem Boden für einige Stunden unterbrochen hatten. Das machte ihren Versuch nach Ansicht von Peter, Klaus und Aron ungültig. Ein richtiger Wattwanderer verbringe die Zeit um Hochwasser in einem an Stangen aufgehängten Netz, meinten sie. Weil die drei langen Bambusstangen im Wattboden stecken, ist der Bodenkontakt nicht unterbrochen wie beim Aufenthalt in einem dümpelnden Boot.
Doch nun ist Klaus tot, und Peter ist eine langsam näher kommende Gestalt auf dem Watt, in der Hand den Peilstock, suchend, irrend wie ein Prophet, der vom Weg abgekommen ist. Das auflaufende Wasser ist ihm auf den Fersen. Und die Polizeibeamten beobachten, warten. Pauline Islander, Reporterin der Borkumer Zeitung, kommt auf dem Deich angeradelt, steigt ab und geht zu ihnen. Sie kennen sich, sagen »Moin« und blicken zu dritt auf die Schlickebene, auf der sich der Wattwanderer abmüht.
Hoch über allem ist der Hubschrauber zu hören, der eine Zeit lang über dem Watt geschwebt hat, jetzt aber langsam der Außenems in Richtung offene See folgt.
»Das ist er?«, fragt Pauline und deutet mit dem Kopf zu Peter hin.
»Das ist er«, sagt Jürgen, der Revierleiter.
»Ich hab’s im Funkscanner gehört. Sein Kumpel ist ertrunken? Welcher? Klaus oder Aron?«
»…«
»Und wo ist der dritte?«
»…«
»Er hat euch angerufen? Oder wie war das?«
»Wir reden erst mit ihm«, antwortet Jürgen endlich. »Danach kannst du Fragen stellen.«
»Keine Sorge, ich schreibe noch nichts, ich hab nur überlegt, was wohl passiert ist.« Sie nimmt ihren Rucksack ab und holt ein Notizbuch heraus. »Schöner Morgen«, sagt sie. »Das Watt schimmert fast golden, seht ihr?«
Doch die Polizeibeamten schauen zum Hubschrauber hinauf, der jetzt über die Insel fliegt, vermutlich zurück nach Cuxhaven. Dann meldet sich Jürgens Handfunkgerät. Er gibt Pauline mit einer Geste zu verstehen, dass sie Abstand halten soll, entfernt sich dann selbst ein wenig und kehrt kurz darauf zurück.
»Die Niederländer haben ihn gefunden«, sagt er.
Pauline schaut auf ihre Armbanduhr und macht eine Notiz.
Auf den letzten hundert Metern schwappt das Wasser schon bis über Peters Fußknöchel. Die Flut hat ihn eingeholt, eine Unvollkommenheit, die er unter normalen Umständen als unverzeihlich empfunden hätte. Aber die Umstände sind nicht normal. Er steigt den Deich hinauf, legt den Peilstock ins Gras, nimmt den Rucksack ab und setzt sich, um die Surfschuhe auszuziehen.
»Ich bin fertig«, sagt er. Er legt die Stirn auf die Knie, dann die Hände auf den Kopf. So sitzt er eine Weile da. Seine Beine sind bis über die Knie von Schlamm bedeckt.
»Was ist passiert?«, fragt Pauline. »Wie geht es Ihnen?«
Doch die Polizeibeamten scheuchen sie weg. »Bitte stehen Sie auf«, sagen sie zu Peter. »Wir unterhalten uns in der Dienststelle weiter. Sie haben gesperrtes Gebiet betreten.«
Peter blickt auf, als wüsste er einen Moment nicht, wo er ist. Dann lässt er sich aufhelfen, hebt den Rucksack und den Peilstock auf und geht barfuß und leicht humpelnd hinter Jürgen her. Der andere Polizist, der Hans heißt, hat die Schuhe genommen. Im Vorbeigehen schaut Peter kurz Pauline an. Er hat Tränen in den Augen. »Er war wie ein Bruder für mich«, sagt er.
»Gehen Sie bitte weiter«, sagt Jürgen.
Doch Peter bleibt stehen und blickt noch einmal zurück. »Helen«, sagt er. »Helen, wie um Himmels willen ist das möglich.«
»Ich bin Pauline, nicht Ellen, wir haben uns vor ein paar Jahren mal gesprochen«, sagt Pauline. »Ellen ist meine Kollegin.«
Peter sieht sie an, schüttelt den Kopf und dreht sich wieder um. »Er war ein Bruder«, sagt er. »Niemand wird mir glauben.«
»Wenn Sie sich nicht fernhalten, muss ich Sie festnehmen«, sagt Jürgen zu Pauline. Aber sie ist schon stehen geblieben.
Sie notiert Peters Äußerungen, dreht sich dann um und blickt übers Watt. Es schimmert nicht mehr golden, der Moment ist vorbei, was bleibt, ist ein gewöhnlicher Tag an der Südküste von Borkum. See bis zum Horizont, ein Kutter auf dem Weg nach Greetsiel, nichts Besonderes.
3
Der amtliche Leichenbeschauer steht schon in Delfzijl auf dem Kai, als die RV 180 anlegt. Hager, aufrecht, reglos wie ein wartender Reiher beobachtet er das Festmachen, in der rechten Hand den Arztkoffer, die linke in der Jacketttasche. Erst als die Gangway scheuernd auf den Kai geschoben wird und der Matrose an der Reling einen Schritt zurücktritt, um ihm Platz zu machen, setzt er sich in Bewegung. Er ist von einer Wolke aus Schweigen umgeben, was an seinen regelmäßigen Begegnungen mit dem Tod liegen mag. Menschen gehen zur Seite, wenn er sich nähert, er hat immer Platz, ohne etwas dafür tun zu müssen.
Er steigt an Deck, kniet sich neben den Leichensack, zieht Handschuhe an, und dann, so behutsam, als wollte er die Ruhe des Ertrunkenen nicht stören, öffnet er den Reißverschluss. Die Umstehenden halten den Atem an und sehen zu, wie er ein Lämpchen aus der Arzttasche holt und dem Toten ins unverletzte Auge leuchtet.
»Möwen«, sagt Geeske.
Der Arzt nickt, schaut, schaltet das Lämpchen wieder aus und legt es zurück. Er öffnet den Leichensack ein Stück weiter und drückt erst sanft, dann etwas fester auf den Brustkorb. Ein wenig Wasser rinnt aus den Mundwinkeln des Toten.
Eine Verletzung am rechten Ohr erregt die Aufmerksamkeit des Arztes. Die Umgebung des Ohrs ist blutunterlaufen, als hätte den Mann dort ein harter Stoß oder Schlag getroffen. Der Arzt nimmt eine Brille aus einer Jacketttasche und betrachtet die geschädigte Stelle aus der Nähe. Sein Blick wandert vom Ohr über den Hals zum halb geöffneten Mund. Er nimmt einen Spatel und blickt vorsichtig in die Mundhöhle. Dann steht er auf und zieht die Handschuhe aus.
»Der Mann scheint durch Ertrinken ums Leben gekommen zu sein«, sagt er, »aber es bleiben offene Fragen. Ich werde jedenfalls keine natürliche Todesart bescheinigen.« Er schließt den Arztkoffer. »Sie sind hier zuständig?«, fragt er Geeske. Und ohne die Antwort abzuwarten, erklärt er: »Der Verstorbene hat wenig Wasser in der Lunge, was nicht unbedingt etwas bedeuten muss, aber es schadet nicht, darauf hinzuweisen. Die Verletzung am Ohr verdient ebenfalls eine nähere Untersuchung. Sie können meinen Bericht noch heute Vormittag erwarten.« Damit ist er fertig, denn er dreht sich grußlos um, betritt die Gangway und verlässt das Schiff. In schnurgerader Linie verlässt er das Hafengelände. Möwen fliegen vor ihm auf.
4
Borkumer Zeitung, 28. 09. 15. 11:00
Wattführer Klaus Smyrna zwischen Krummhörn und Borkum ertrunken. Peter Lattewitz von Inselpolizei vernommen.
Aron Reinhard nicht dabei. Helikopter BPol sucht über Watt. #Wattwandern #Borkum #Smyrna @Wattewitz @WattAron
5
Es ist eine Stunde vor Hochwasser. Die Ampeln der Schleuse Leysiel springen auf Grün, und die GRE 42 tuckert langsam auf die Schleusentore zu, die sich ebenso langsam für sie öffnen. Lode Föhrmann, der schon seit Jahren nicht mehr fischt, seinen Kutter aber trotzdem nicht verkauft, hat die eigenartige Gewohnheit angenommen, von Zeit zu Zeit die Nacht auf dem Watt zu verbringen. Er lässt sein Schiff auf dem Kopersand, einer Sandbank südöstlich von Memmert, trockenfallen. Kurz vor Sonnenuntergang stellt er achtern seine Staffelei auf, und sobald das Licht der tief stehenden Sonne die Konturen der Dünen von Memmert hervorhebt, fängt er an zu malen.
Er kommt nie sehr weit, aber darum geht es ihm auch nicht. Die Sonne verschwindet unter dem Horizont, der Moment ist vorbei, das Bild bleibt unvollendet. Er räumt seine Malsachen wieder weg.
Dann setzt er sich aufs Deck, horcht und schaut zum Himmel hinauf, um die Sterne erscheinen zu sehen. So sitzt er eine Weile da, sehr klein in der Nacht, umringt von dem leisen Blubbern, das trockenfallende Sandbänke und wühlende Wattwürmer verursachen. Malen ist sehen, hat er vor ein paar Jahren zu Pauline gesagt, die ihn für die Borkumer Zeitung eine Nacht lang begleitete. Wenn ich nicht male, sehe ich nicht richtig hin. All die Jahre bin ich nur gefahren, immer hinter den Krabben her, nie hatte ich genug Ruhe, um nur mal hinzusehen. Und kurz bevor ich das Fischen aufgab, hab ich mich auf einmal gefragt: Wenn man nicht richtig hingesehen hat, ist man dann überhaupt da gewesen? Wann ist man irgendwo wirklich da?
Es war eine Reportage geworden, die nach anderthalbtausend Wörtern abrupt, mitten im Satz, aufhörte. Sie musste sich ihrem Chefredakteur erklären. »Verstehst du denn nicht?«, fragte sie. »Föhrmann malt seine Bilder auch nie fertig, aber gerade darauf kommt es ihm an. Er sagt es doch selbst! Dass das Leben nie fertig ist und dass es ihm genau darum geht.«
Pauline Islander – trotz ihres Nachnamens Import vom Festland – war öfter so originell, dass nicht alle Leser verstanden, was sie meinte. Kein Wunder, dass sie sich mit diesem Spinner aus Greetsiel gut versteht, dachte der Redakteur. Aber gut, die Leser wunderten sich bei Pauline allmählich über nichts mehr. Deshalb ließ er sie machen. Leben und leben lassen, lautete seine Insulaner-Devise.
Und so erschien der Artikel in der Borkumer Zeitung, unfertig und mit der rätselhaften Überschrift: Bild fertig? Ende und aus. Einige der unvollendeten Bilder wurden sogar in der Borkumer Kulturinsel ausgestellt; fünfundzwanzig Aquarelle, immer die Vogelinsel Memmert in abnehmendem Licht, immer aus der gleichen Perspektive. Föhrmann selbst kam nicht zur Eröffnung auf die Insel. Das ist nicht mein Ding, schrieb er Pauline.
Und nun fährt er gemächlich in die Schleuse ein und hebt die Hand, um durch die offene Tür des Ruderhauses den Schleusenwärter zu grüßen, der von seinem erhöhten Posten aufs Achterschiff hinunterblickt. Dort liegt ein Rucksack. Und als er auf den Monitor der Schleusenkamera schaut, hat er den Eindruck, dass Lode nicht allein im Ruderhaus steht. Ob das so ist, kann er wegen der spiegelnden Scheiben nicht sehen. Ausgelaufen ist Lode allein.
Als die GRE 42 eine halbe Stunde später im Hafen von Greetsiel anlegt, nähert sich auf dem Kai der Hafenmeister. Lode verlässt das Ruderhaus und wirft ihm eine Festmacherleine zu. Der Hafenmeister fängt sie auf, legt sie um einen Poller und schaut neugierig an Bord, während Lode die Leine festzieht und belegt.
»Die Schleuse hat gesagt, du hättest jemand an Bord genommen«, sagt er.
Lode antwortet nicht. Er geht aufs Vorschiff und wirft eine weitere Festmacherleine auf den Kai. Nachdem auch sie auf dem Kai und an Bord belegt ist, kehrt er ins Ruderhaus zurück und schaltet den Motor aus. Das kleine Schiff vibriert und verstummt. Der Hafenmeister beobachtet Lode, der wieder herauskommt, das Ruderhaus abschließt und an Land steigt.
»Die Schleuse hat gesagt, du hättest jemand an Bord«, sagt er noch einmal.
»Ich hab gehört, was du gesagt hast«, sagt Lode. Zusammen blicken sie eine Weile auf den festgemachten Kutter.
»Siehst du jemand?«, fragt Lode endlich.
»Nein«, antwortet der Hafenmeister.
»Dann ist auch keiner da.«
Und damit ist die Sache erledigt.
6
Ein Rettungswagen hat den Toten vom Hafen zum Delfzicht-Krankenhaus gebracht, wo er im Kühlraum aufgebahrt liegt, bis entschieden ist, wer sich seiner annehmen wird. Die Sandbank De Hond liegt westlich des Fahrwassers der Außenems, in einem Gebiet, dessen Zugehörigkeit zu den Niederlanden oder Deutschland nicht geklärt ist. Die Niederlande betrachten alles westlich des Fahrwassers als niederländisches Territorium; Deutschland dagegen vertritt den Standpunkt, seine westliche Grenze verlaufe näher am niederländischen Seedeich entlang, und in diesem Fall wären die Bänke De Hond und De Paap zum größten Teil deutsch. Die Grenzfrage ist nie gelöst worden, immerhin haben die beiden Länder aber 1960 Übereinstimmung darüber erzielt, dass sie sich uneinig sind, und arbeiten in dem umstrittenen Gebiet im Geiste guter Nachbarschaft zusammen. Mit Ausnahme eines Scharmützels zwischen Groninger Reusenfischern und ostfriesischen Konkurrenten sind nennenswerte Probleme ausgeblieben. Doch nun liegt Klaus Smyrna im Kühlraum des Delfzicht-Krankenhauses, ein toter Deutscher, von niederländischen Grenzschützern auf De Hond gefunden, mitten im umstrittenen Gebiet.
Brigadekommandeur Henk van de Wal hält den Fall für kompliziert genug, um die Staatsanwaltschaft in Groningen zu verständigen. Er hat Geeske in sein Büro kommen lassen und ihr mitgeteilt, angesichts der sensiblen Sachlage wolle er den Fall in die Hände des Staatsanwalts legen. Van de Wal ist noch nicht lange Brigadekommandeur. Er sagt zwar, er sei zufrieden, doch das ist er nicht. Van de Wal will höher hinaus.
»Sollte man das wirklich tun?«, fragt Geeske vorsichtig. »Sollte man den Toten nicht einfach den Deutschen übergeben? Ein Deutscher, gefunden in Deutschland, ein Anruf und fertig.«
»Und wie verkauft man das dann, Opper?«, fragt van de Wal. »Was soll dann im Bericht stehen?«
»Wir halten uns einfach an die Tatsachen«, sagt Geeske. »Wir finden einen toten Deutschen auf deutschem Gebiet, wir bergen ihn, weil die Flut kommt, wir rufen die Bundespolizei See in Cuxhaven an, die schicken ein Schiff, wir übergeben den Toten, und das war’s.«
»Der Tote lag auf niederländischem Gebiet«, erklärt der Kommandeur. »Auf unserer Seite.«
»So kann man’s auch sehen«, erwidert Geeske, »aber dann kriegt man weitere Probleme als kostenlose Zugabe.«
Van de Wal, ein rechthaberischer Mann in den Vierzigern, hochgewachsen, Bürstenschnitt, Brille mit schlankem Goldgestell, schaut Geeske verärgert an. »Das sind dann wohl deine Menschlichen Möglichkeiten«, sagt er etwas lauter. »Du bist nicht von hier, dir fehlt die Verbindung zu diesem Gebiet.« Er geht zum Fenster, von dem aus das Watt nicht zu sehen ist, weil Gebäude davor stehen, der Brigadeposten ist ein Stück vom Meer entfernt. Trotzdem zeigt er aus dem Fenster, während er weiterhin Geeske anschaut.
»Ich stamme aus einer Familie von Dollartfischern«, erklärt er, den Finger in Richtung Fenster ausgestreckt. »Ich bin in Termunten unterhalb des Deichs aufgewachsen. Als Kind war ich hier überall und hab mit Kreiern Reusen gelegt. Dieses Land gehört uns.«
Geeskes Blick ist dem Finger des Brigadekommandeurs gefolgt, sie sieht Hausdächer, dahinter Kräne, den Schornstein eines Küstenmotorschiffs.
»Zusammenarbeit, gern, Opper«, sagt er, »aber irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Dieser Tote hat auf niederländischem Gebiet gelegen, es ist unsere Aufgabe, Ermittlungen anzustellen. Vielleicht ist er ja dort ermordet worden, kannst du das ausschließen?«
Geeske sagt nichts.
»Kannst du das ausschließen?«, drängt van de Wal.
»Nein«, räumt Geeske ein.
»Ich rufe Groningen an.«
Und er schickt sie mit einer Geste aus seinem Büro.
Im Flur begegnet Geeske Anne-Baukje von der Kriminalabteilung, die am Wasserspender gekühltes Wasser zapft. Der Automat blubbert verführerisch, Geeske nimmt selbst auch einen Becher.
»Hast du kurz Zeit?«, fragt Geeske. Sie deutet mit dem Kopf auf die Tür des Kommandeurs. »Henk will Groningen anrufen, das wird eine unendliche Geschichte. Könntest du nicht kurz mit mir ins Krankenhaus, solange die Sache noch in der Schwebe ist?«
»Was hast du vor?«
»Dass du dir mal diesen Wattwanderer ansiehst, bevor man mir den Fall wegnimmt.«
»Du meinst, es ist ein Wattwanderer.«
» Ganz sicher.«
»Muss das nicht die Polizei übernehmen?« Anne-Baukje, Bauerntochter aus dem Norden der Provinz Friesland, hellblaue Augen, kurzes blondes Haar, zerknüllt den Plastikbecher und wirft ihn in den Mülleimer.
»Das könnte auch sein«, sagt Geeske. »Aber jetzt treffe ich dich gerade, und ich fände es wirklich wichtig, dass wir mal ins Krankenhaus gehen, wir beide. Du kennst doch den dortigen Pathologen, wie heißt der noch … Ich bin ihm nie begegnet, bisher bestand keine Veranlassung.«
»Derk Wortelboer«, antwortet Anne-Baukje. »Unser Shakespeare.« Sie lacht. »Gehen wir.«
7
Peter Lattewitz macht in der Polizeidienststelle einen desorientierten Eindruck. Er fragt, ob er sich umziehen darf. Seine Sachen sind nass, er riecht stark nach Ebbe.
»Ich habe trockene Sachen bei mir«, sagt er und zeigt auf seinen Rucksack, den Jürgen auf einem Tisch abgestellt hat.
»Nehmen Sie sie bitte hier heraus«, sagt Jürgen, »dann begleitet Sie mein Kollege und nimmt Ihre nassen Sachen an. Sie können sich in einer Zelle umziehen.«
»In einer Zelle?«
»Da hat man noch am meisten Privatsphäre«, erklärt Jürgen. »Das ist der einzige Grund. Wieso?«
»Kann ich nicht kurz auf die Toilette?«
»In der Zelle gibt’s eine Toilette.«
Peter steht auf und folgt mit schleppendem Gang dem anderen Beamten. Die Wattdurchquerung hat ihm offensichtlich das Äußerste abverlangt.
Bald darauf sitzt er in Jogginghose, T-Shirt und Flipflops am Vernehmungstisch, ihm gegenüber Jürgen und Hans. Er hat Kaffee bekommen. Er stützt sich mit den Unterarmen auf den Tisch