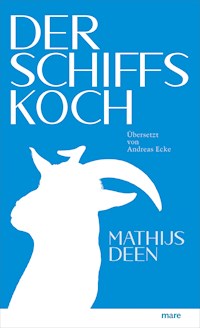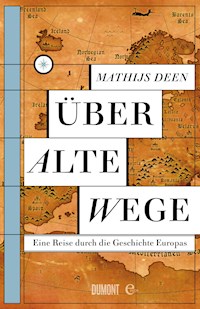Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Liewe Cupido
- Sprache: Deutsch
Bei einem Spaziergang an der Küste Northumberlands stoßen niederländische Urlauber auf die Überreste einer Leiche. Eine alte Schwimmweste deutet auf eine Verbindung zu einem 21 Jahre zuvor geschehenen Unglück hin. Damals sank der Seeschlepper Pollux nördlich der Düneninsel Rottumerplaat. In einer komplizierten Mission der Seenotretter von Ameland und Norderney konnten alle Besatzungsmitglieder gerettet werden – bis auf den Kapitän. Handelt es sich bei dem geborgenen Skelett um den Vermissten? Kommissar Liewe Cupido, genannt »der Holländer«, will den Fall abgeben, ist er doch gerade mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigt: dem mysteriösen Verschwinden seines Vaters auf See. Doch als sein ermittelnder Kollege Xander Rimbach auf Norderney vergiftet wird, muss Cupido erneut seinen friesischen Spürsinn unter Beweis stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mathijs Deen
DER RETTER
Roman
Aus dem Niederländischenvon Andreas Ecke
Originaltitel: De Redder
Copyright © Mathijs Deen, 2024
Das Zitat auf S. 98 aus Charles Baudelaire, Die Blumen des Bösen, ist der Übersetzung von Carlo Schmid, Insel 1976, entnommen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Warren Keelan
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-833-5
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-707-9
www.mare.de
Die Wahrheit wirkt nie wahr.
Georges Simenon
Wenn man sich gegenseitig nicht mehr hat, hat man niemanden mehr.
Henk van de Wal, ehemaliger Brigadekommandeur der Marechaussee Delfzijl
INHALT
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
KAPITEL 69
KAPITEL 70
NACHBEMERKUNG
PROLOG
Als in der Nacht vom 3. auf den 4. März 1995 plötzlich Sturm aufkam, Böen von fast hundert Stundenkilometern durch die Straßen Norderneys fegten, auf dem Hafengelände Türen schlugen und die Stage und Wanten der Boote sangen, wanderten Michael Waagmanns Gedanken, wie immer, wenn er bei Sturm in seiner Koje auf Notrufe wartete, zu jener windstillen Nacht des Jahres 1974, als er Technischer Wachoffizier auf der MS Antwerpen war. Sie waren mit einer Ladung Holz aus Rumänien im Marmarameer unterwegs, um durch die Dardanellen ins Mittelmeer und dann nach Hamburg zu fahren, und er und der Dritte Offizier Jannes Boll hielten auf der Brücke nach den Leuchtfeuern Ausschau, und es war so merkwürdig still unter den Sternen. Kurz vor Mitternacht kam der Kapitän auf die Brücke und sagte, dass man den Zweiten Offizier nicht für die Hundewache wecken sollte, weil er ihm die heikle Einfahrt in die Dardanellen nicht zutraute und er das Steuern lieber selbst übernahm. Michael und Jannes blieben zuerst noch untätig auf der Brücke, aber nach einer halben Stunde ließen sie den Kapitän allein und gingen in ihre Unterkünfte. Michael war kaum eingeschlafen, als ihn ein heftiger Ruck aus der Koje schleuderte.
Alles, was dann geschah – wie er vorbei an umgefallenen, Türen blockierenden Stühlen zum nächsten Niedergang rannte, wie das Dröhnen des Motors das Schiff vibrieren ließ, wie erschrockene Matrosen schon die Boote klarmachten, wie der Kapitän unter dem Kartentisch lag, wie der verstörte Zweite Offizier auf die Brücke kam, nach vorn zeigte und nichts anderes sagte als: »Kiek doch bloß … kiek doch bloß …«, weil im Schein des Topplichts der zerknautschte Bug an dem Felsen zu sehen war, gegen den der stampfende Motor das Schiff drückte –, all das konnte er sich ins Gedächtnis rufen, als wäre es gestern gewesen. Er hatte nicht vergessen, dass der Kapitän zu verwirrt gewesen war, um irgendetwas zu unternehmen, dass er selbst den Maschinentelegrafen auf Halt stellte, woraufhin der Motor verstummte, was nur heißen konnte, dass der Zweite Technische Schiffsoffizier noch handlungsfähig war, und dass er zum Maschinenraum hinunterrannte und zusammen mit seinem Kollegen die Pumpen in den Laderäumen einschaltete. Nur Raum eins machte Wasser, die übrigen Räume waren trocken, die Schotten folglich dicht, und die Antwerpen würde schwimmfähig bleiben.
Und doch waren es nicht die Gefahren und die Aufregung der Havarie, zu denen während des Wartens bei Sturm seine Gedanken abdrifteten; es war die Stunde der spiegelglatten See vor dem Aufprall, die Stille, als das Schiff über das Marmarameer fuhr und er und Jannes zu den fernen Lichtern ringsum blickten und er dachte: Wie seltsam friedlich es jetzt ist. Die Stunde, in der noch nichts geschehen war.
Der alte Seenotkreuzer Otto Schülke, der bald außer Dienst gestellt werden sollte, zerrte an den Festmacherleinen und neigte sich leicht zur Seite. Michael lag auf dem Rücken und achtete auf die Durchsagen des Seefunkdienstes. Er zwang sich, an die anderen Retter zu denken, die mit ihm an Bord waren und wie er in ihren Kojen auf den Sturm horchten. Navigator Atte Germer, der unruhige, gewissenhafte, gläubige Insulaner; Rettungsmann Tade Bojenga, der übermütige jüngere Sohn des Matrosen Bojenga aus Büsum; der schweigsame Maschinist Heiko Büsing, ebenso zuverlässig wie der ihm anvertraute Mercedes-Benz-Achtzylinder. Michael war der Vormann und für sie verantwortlich. Bei allem, was passieren konnte, musste er ihre Eigenheiten berücksichtigen, ihre Stärken und Schwächen.
Der erste Notruf ging um zwanzig nach eins ein. Eine Jacht mit drei Personen an Bord war bei der Einfahrt in die Osterems nördlich von Borkum auf die Brauerplate aufgelaufen. Der Mann am Funkgerät klang unerfahren und panisch. Ein Besatzungsmitglied hatte sich den Arm verletzt – gebrochen oder ausgerenkt, auf jeden Fall hatte der Mann starke Schmerzen. Michael hörte, dass Atte aufstand. Atte, immer der Erste, ungeduldig wie ein Hund, der darauf wartet, ausgeführt zu werden.
»Warte, Atte«, sagte Michael. »Das ist für Borkum.«
Und tatsächlich kam sofort die Antwort der Alfried Krupp, des Seenotkreuzers von Borkum. Das Gespräch wurde schnell auf einem anderen Kanal fortgesetzt, und es war wieder ruhig. Wasser klatschte gegen das Boot, eine Bö zog die Leinen stramm.
Michael hörte Atte in seine Koje zurückkehren, und seine Gedanken schweiften wieder ab. Erst vor drei Monaten war die Alfried Krupp nach einem Einsatz nördlich von Ameland kurz vor der Westerems von einer hohen seitlichen Grundsee erfasst worden und durchgekentert, wobei der Maschinist aus dem oberen, offenen Steuerstand gerissen wurde; später, während bereits ein Hubschrauber vergebliche Bergungsversuche unternahm, wurde auch noch der Vormann durch hohe Wellen von dem manövrierunfähigen Schiff gespült. Die Otto Schülke war ausgelaufen und konnte zusammen mit einem niederländischen Seenotkreuzer die Alfried Krupp nach Eemshaven schleppen. Michael wusste, dass Atte und Tade wie er selbst in der neuerlichen Funkstille an die beiden verunglückten Rettungsmänner dachten. Und dass die reparierte Alfried Krupp trotz dieser Tragödie selbstverständlich wieder auslief, in die Nacht, zu den Strömungen und Grundseen der Ems-Mündungsarme. Es war Niedrigwasser, das Watt südlich von Borkum war trockengefallen, die Retter mussten erst einmal westlich um Borkum herum auf die Nordsee hinausfahren, um zur Osterems zu kommen. Der Mann mit dem verletzten Arm auf der Jacht würde noch lange Schmerzen haben, bis die Alfried Krupp längsseits gehen konnte.
Angst empfand Michael nicht mehr, nur Ärger. Über die unerfahrene Besatzung der Jacht, die bei diesem Wetter mitten in der Nacht unbedingt versuchen musste, in die Osterems einzufahren, statt auf See bis Sonnenaufgang den Sturm abzuwettern. Was hatten sie überhaupt so früh im Jahr da draußen zu suchen? Er stellte sich die Borkumer Kollegen vor, die noch längst nicht über den Tod ihrer Kameraden hinweggekommen waren und jetzt für diese Stümper ihr Leben riskieren mussten.
Dann kam der zweite Notruf. Es war fünf nach halb zwei. Der deutsche Seeschlepper Pollux hatte nach dem Brechen einer Trosse nördlich von Ameland das von ihm geschleppte Schwimmdock verloren. Die niederländische Küstenwache antwortete und fragte nach der Position. Drei Mann waren auf dem Dock und fünfzehn an Bord des Schleppers. Die Pollux versuchte, eine neue Leinenverbindung herzustellen, aber man machte sich Sorgen um die drei auf dem Dock.
Michael richtete sich auf und horchte. Das Rettungsboot Johannes Frederik von Ameland schaltete sich ein und meldete, dass es im Begriff sei auszulaufen. Dieser Notruf betraf die Otto Schülke nicht, weil sich alles zu weit westlich abspielte. Außerdem war der Schlepper selbst unbeschädigt, und die drei Mann auf dem Dock schwebten auch nicht unmittelbar in Gefahr. Das Schwimmdock würde im schlimmsten Fall bald auf Grund laufen, das kenterte bestimmt nicht. Ameland würde allein damit fertigwerden.
Doch als die Pollux und die Johannes Frederik auf einen anderen Kanal umschalteten, sagte Michael zu Heiko, Atte und Tade, sie sollten weiter Kanal 16 abhören, während er die Kommunikation zwischen dem Schlepper und den Niederländern verfolgen wollte. Der Kapitän der Pollux klang ruhig; wie ein Flugkapitän, der die Passagiere vor der Landung über das Wetter am Zielort informiert.
Der Leuchtturm von Schiermonnikoog mischte sich ins Gespräch und gab eine deutlich andere Position des Schleppers durch. Das Schiff lag nördlich der Rottumerplaat gerade noch innerhalb des Fahrwassers.
Der Kapitän der Pollux, ganz von dem Versuch in Anspruch genommen, eine neue Schlepptrosse an das Schwimmdock zu übergeben, beendete vorläufig das Gespräch. Michael horchte in die Stille. Nach einer Viertelstunde streckte er gerade die Hand nach dem Funkgerät aus, um auf den allgemeinen Notkanal zurückzuschalten, als das Gespräch wiederaufgenommen wurde. Es war die Stimme des Kapitäns, nun nicht mehr so ruhig. »Mayday, Mayday!«, rief er. »Wir sind mit dem Dock kollidiert und machen Wasser. Mayday, Mayday!« Bevor die Johannes Frederik reagieren konnte, antwortete Michael. »Hier die Otto Schülke, Norderney. Wie ist Ihre Position?«
»Mayday, Mayday«, wiederholte der Kapitän. »Das Achterschiff macht Wasser.«
Der Leuchtturm von Schiermonnikoog schaltete sich ein. »Die von uns ermittelte Position ist 53° 43' Nord, 6° 26' Ost.«
»Wir kommen«, meldete die Johannes Frederik.
»Otto Schülke ist auch auf dem Weg«, sagte Michael.
Und so kam es, dass Michael Waagmann mit dem Seenotkreuzer von Norderney in jener Märznacht des Jahres 1995 kurz vor zwei zu einem Rettungseinsatz auslief. Schon unmittelbar außerhalb des Hafenbeckens, noch im Schutz der Insel, war das Wasser kabbelig, aber die Männer in ihren roten Anzügen wussten, dass der stärkste Seegang sie nördlich des Westkopfs am Übergang vom Norderneyer Seegatt in Dovetief und Schluchter erwartete, wo sich Nordsee und Wattenmeer begegnen. Sie schnallten sich an und machten sich auf alles gefasst. Die sechsundzwanzig Jahre alte Otto Schülke sollte zwar ersetzt werden, aber sie war mehr als gewissenhaft instand gehalten worden und lief mit voller Kraft den schwarzen Wellenbergen im Seegatt entgegen.
1
Am Ostersonntag 2016 haben die Zwillinge Thieu und Xavier Derckx einen aufregenden Vormittag. Sie verbringen mit ihren Eltern die Ferien in Low Newton-by-the-Sea, einem kleinen Küstenort in Northumberland, in dem der National Trust das Lookout Cottage vermietet, eine ehemalige Küstenwachstation. Das Cottage, hoch und einsam auf einer Landzunge gelegen, ist von einer Mauer umgeben, die für Thieu und Xavier etwas zu hoch ist. Ihr Vater Sjeng hat deshalb vom Strand ein paar Steine und ein angeschwemmtes Brett hinaufgeschleppt und dort, wo die Mauer am weitesten vorspringt, ein wackeliges Podest errichtet, damit die Zwillinge nach ein wenig Kletterei über den Mauerrand in Richtung Meer blicken können wie Ritter auf dem Wehrgang einer Burg. Beim ersten Versuch kracht das Podest zusammen, weil einer der Steine, von Sjeng zu nachlässig abgelegt, ins Rollen kommt. Die Brüder sind beide mit einer kleinen Schramme davongekommen, aber doch sehr erschrocken. Die verbesserte Konstruktion, von Sjeng unter Aufsicht von Mutter Marie-Louise errichtet, ist stabiler, und seitdem halten Thieu und Xavier regelmäßig Schulter an Schulter Ausschau über die Nordsee, auf die man von der Landzunge aus in drei Himmelsrichtungen blicken kann. Im Süden zeichnet sich am Horizont die Ruine von Dunstanburgh Castle ab, im Norden der Leuchtturm der Farne-Inseln, im Osten ist die Leere der offenen See. Vom höchsten Punkt der Landzunge fällt Grasland allmählich bis zum Flutsaum ab. Manchmal äst dort ein Reh, oder ein Wanderer kommt vorbei, doch meistens ist niemand zu sehen. Die Brüder erspähen zwar hin und wieder ein paar Wikingerschiffe, aber die sind jedes Mal verschwunden, sobald Sjeng oder Marie-Louise dazukommen.
Nun ist Ostermorgen, und über das ummauerte Cottage-Grundstück verteilt liegen die Eier, die Marie-Louise am Vorabend gefärbt und versteckt hat. Es hat in der Nacht zwar nicht geregnet, aber ein Sturm hat das hohe Gras flach geweht, und so sind viele der Eier verdeckt. Sjeng und Marie-Louise müssen bei der Suche manchmal deutlich nachhelfen, aber nach einem viertelstündigen Hin und Her sind alle gefunden, sodass am Frühstückstisch das Eiertitschen beginnen kann. Thieu und Xavier schlagen mit der Spitze des Eis in ihrer kleinen Hand auf das Ei des Bruders und auf die ihrer Eltern, bis nur Thieus Ei noch heil ist und er deshalb gewonnen hat. Marie-Louise tröstet Xavier, der betreten sein schwer angeschlagenes Ei anstarrt. Sie verspricht, dass sie nach dem Frühstück alle zusammen zum Meer hinuntergehen, um Fische zu fangen, und dass er und Thieu anschließend beim Ship Inn heißen Kakao mit Sahne bekommen.
»Ich glaube, es ist Ebbe«, sagt sie, »deshalb gibt es jetzt viele Felstümpel mit Fischen drin. Wir nehmen die Kescher mit.«
»Lass uns gleich losgehen«, sagt Sjeng. »Aufräumen können wir später.«
Der Wind schiebt die Familie mit solcher Kraft vor sich her, dass Marie-Louise die Jungen an die Hand nehmen muss, damit sie beim Abstieg zum Meer nicht umgeblasen werden. Sjeng stiefelt fröhlich voraus. Die Landzunge ist von glatten, aber vielfach geborstenen Felsbrocken gesäumt, deren Spalten und Hohlräume dank des Gezeitenwechsels mit Sedimenten gefüllt sind.
Es ist der Tag nach Vollmond, und das Meer hat sich weit zurückgezogen. Weil der steife ablandige Wind das Wasser noch weiter von der Küste fortgeweht hat, kann man etliche Stellen, die normalerweise auch bei Niedrigwasser überspült sind, trockenen Fußes erreichen. Marie-Louise hilft Thieu und Xavier von den kniehohen Felsen auf den trocken gewehten Meeresboden, dann rennen sie in ihren roten Gummistiefeln hinter Sjeng her, die Kescher vor sich in der Luft. Hier und da ragen parallel zur Küstenlinie niedrige, lang gestreckte Felsadern aus dem Sand, deren Spalten zu Tümpeln mit zurückgebliebenem Meerwasser geworden sind. Glasklare Miniaturwasserwelten, bevölkert von hellgrünem Tang, dunkelroten Seeanemonen, unterschiedlich gefärbten Schalentieren und schmutzig weißen Seepocken mit langsam das Wasser filternden Fäden. Als die Jungen sich nähern, schnellen kleine Fische davon. Einsiedlerkrebse wuseln unbekümmert herum.
Sjengs Aufmerksamkeit schweift bald von der erfolglosen Kescherei zu einem kleinen Einschnitt in der Landzunge ab, wo der Boden bei normalem Niedrigwasser überspült ist. Er betrachtet die Stelle eine Weile von den Tümpeln aus, entschließt sich dann aber, mit den Jungen hinzugehen.
»Seht mal, Jungs, eine Grotte«, ruft er.
Tatsächlich kann man den Einschnitt mit etwas gutem Willen als kleine Grotte ohne Decke betrachten, groß genug für einige wenige Menschen. Vor dem Eingang stehen zwei mehr als mannshohe, glatt geschliffene dunkelgraue Felsen wie schweigende Schildwachen, die den Zugang zu dem Raum dahinter verengen, aber nicht völlig versperren. Wenn bei Flut die Wellen aus einer bestimmten Richtung anrollen, kann das Wasser an dieser Stelle hoch aufspritzen, als wäre dort ein Geysir verborgen – ein Schauspiel, das Sjeng von Weitem schon mehr als einmal fasziniert beobachtet hat. Und da er nun einmal hier ist und das Meer weit weg, kann er der Versuchung nicht widerstehen. »Kommt, Jungs«, ruft er, und als Thieu und Xavier sehen, wohin er geht, lassen sie die Kescher fallen und rennen hinter ihrem Vater her. Marie-Louise, die sich noch über die Felstümpel gebeugt hat, richtet sich auf und ruft: »Was habt ihr vor?« Doch Sjeng und die Jungen, die schon zwischen den beiden steinernen Wächtern verschwinden, hören sie nicht mehr. Sie hebt die Kescher auf und folgt ihnen. Als sie näher kommt, hört sie ihre hallenden Stimmen.
»Okay, Jungs, hier, nehmt das!«, ruft Sjeng. »Und jetzt ziehen!«
Sie blickt an den beiden Felsen hinauf, die ihr die Sicht auf das Dahinterliegende weitgehend versperren. »Das gefällt mir nicht, Jungs«, sagt sie. »Was treibt ihr da?«
»Wir haben einen Schatz gefunden«, antwortet Sjeng. »Eine Schwimmweste, aber sie hängt ein bisschen fest … Ziehen, Jungs … eins … zwei …«
Marie-Louise macht einen Schritt nach vorn, schaut zwischen den beiden Wächtern hindurch und sieht, wie ihr Mann und die Kinder zusammen an etwas zerren, das aus dem Boden herausragt. »Jetzt tut sich was«, sagt Sjeng. »Noch ein letztes Mal … eins … zwei …«
Diesmal kommt die Schwimmweste tatsächlich frei, und Sjeng, Thieu und Xavier fallen rückwärts auf den Boden. Die Äste, in denen sich die Weste verheddert hat, geben nach, und ein runder Gegenstand von der Größe eines kleinen Fußballs schnellt hoch, rollt über Thieu hinweg, zwischen den Felsen hindurch und bleibt vor Marie-Louises Füßen liegen. Sie springt zurück, lässt die Kescher fallen und starrt das Ding an.
Sjeng und die Jungen haben sich aufgerappelt und kommen schnell ins Freie. Thieu und Xavier blicken von ihrer Mutter zu dem Ball, der mit der Schwimmweste im Boden gesteckt hat.
»Was ist das?«, fragt Sjeng.
Es ist ein Schädel, von einem Menschen. Die Augenhöhlen sind auf Marie-Louises Gummistiefel gerichtet, das geborstene und ein wenig eingedellte Schädeldach liegt zu den Zwillingen hin. Sjeng, die Schwimmweste in den Händen, starrt den Totenkopf dümmlich an.
»Ist das ein Ei?«, fragt Xavier.
»Auch kaputt, wie deins«, sagt Thieu.
»Ey!«, sagt Xavier beleidigt.
»Was … hast du jetzt wieder gemacht«, stammelt Marie-Louise, während sie um den Schädel herumgeht und ihre Jungen an den Schultern wegzieht. »Du immer mit deinen Ideen!«
»Ich dachte …«, sagt Sjeng, »eine Schwimmweste … das ist doch toll … toll für die Jungs.«
»Ja, toll, Sjeng, supertoll!«
Sjeng zuckt mit den Schultern, betrachtet die von Seepocken bewachsene Schwimmweste, auf der verschwommen noch das Wort »Pollux« zu erkennen ist. Er will sie hinter die Felsen zurückwerfen, überlegt es sich anders und bleibt ratlos stehen. »Was jetzt?«, fragt er schließlich.
»Kommt«, sagt Marie-Louise und schiebt die Jungen vor sich her, weg von dem Schädel. »Wir gehen Kakao trinken. Nehmt eure Kescher. Wer als Erster da ist …«
Und während die Jungen in Richtung Ship Inn losrennen, dreht sie sich noch einmal zu Sjeng um und sagt: »Und das hier bringst du in Ordnung, Mister.«
2
AUTOPSIEBERICHT
Northumbria Police
Gerichtsmediziner: Henderson MD
Newcastle, 30. März 2016
Name: unbekannt
Geburtsdatum: unbekannt
Alter: 50–60 (geschätzt)
Geschlecht: männlich
Körpergröße: 192 cm (geschätzt)
Todeszeitpunkt: 2000 oder früher (geschätzt)
Datum der Autopsie: 29. März 2016
Befund:
Ertrinken, möglicherweise nach physischem Trauma
– Craniumfraktur
– Costaefrakturen
– Projektilrest in rechter Clavicula
– Durchtrennung der rechten Tibia
Erläuterung:
Sonntag, den 27. März 2016, wurden bei Springniedrigwasser an der Küste unmittelbar nördlich von Low Newton-by-the-Sea die Überreste eines Mannes entdeckt. Es handelte sich um ein unvollständiges Skelett, halb von Schlick und Sand bedeckt. Die rechte Hälfte des Skeletts sowie der Schädel und die Wirbelsäule waren dank der abdeckenden Sedimentschicht gut erhalten. Der rechte Fuß fehlte. Die Rippen auf der linken Seite waren verwittert und teilweise gebrochen, die Knochen des linken Arms einschließlich der Hand sowie das linke Bein einschließlich des Fußes fehlten ebenfalls. Die linke Scapula (Schulterblatt) und das Becken waren, soweit nicht von Sediment bedeckt, verwittert, zerfallen oder teilweise zerfressen. Das Schädeltrauma (möglicherweise durch Einklemmen) und das Trauma am rechten Schienbein (Schnitt durch heftigen Schlag mit einem scharfen Gegenstand) können sowohl zu Lebzeiten als auch nach dem Ertrinken durch Ereignisse auf See verursacht worden sein. Der Körper war bis zum Anspülen zumindest teilweise durch eine Rettungsweste an der Oberfläche gehalten worden, die beim Skelett vorgefunden wurde.
Die Projektilreste im rechten Schlüsselbein, vermutlich von einer Schusswaffe kleineren Kalibers, deuten möglicherweise auf eine Verletzung hin, die beim Schwimmen behindert haben kann. Für sich genommen war diese Verletzung auf keinen Fall tödlich. Der Unterkiefer fehlt, aber der Oberkiefer enthält noch einige Molare, ausreichend für den Versuch einer Identifizierung durch DNA-Abgleich.
3
Weil seine linke Schulter ein wenig niedriger ist als die rechte, scheint Cees Wagevier, Kommandeur des District Noord der Koninklijke Marechaussee, etwas schief zu gehen. Er ist klein, aber kräftig, und er füllt seine Funktion mit solcher Würde aus, als wäre er dafür geboren. Seine tadellose Uniform sitzt wie angegossen, ja wie maßgeschneidert für seine etwas ungewöhnliche Gestalt. Das Barett, der Schnurrbart, die Schulterklappen, die leuchtend blauen Revers, alles passt perfekt zusammen. Er hat sich von der Brigade in Havelte nach Delfzijl fahren lassen, um sich mit der stellvertretenden Postenkommandeurin Geeske Dobbenga zum Mittagessen zu treffen, ein ziemlich ungewöhnliches Ansinnen.
»Sagten Sie Mittagessen?«, hatte Geeske am Telefon gefragt, als hätte sie ihn nicht richtig verstanden.
»Natürlich, Postenkommandeur«, hatte Wagevier geantwortet. »Sie kennen doch bestimmt ein Restaurant in Delfzijl, wo wir einigermaßen gut essen können, oder? Gibt es da nicht eins, das auf Pfählen im Watt steht? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder ist das nichts?«
»Ich habe da noch nie gegessen«, antwortete Geeske.
Im vergangenen Herbst stand sie kurz davor, im Rang eines Opperwachtmeester in Ruhestand zu gehen, als ihr direkter Vorgesetzter, Brigadekommandeur Henk van de Wal, in einem Wutanfall ein nagelneues Patrouillenboot in voller Fahrt auf die Bayreuth zusteuerte, ein Einsatzschiff der Bundespolizei See, und das Festrumpfschlauchboot der Marechaussee dabei beschädigte. Wagevier hatte van de Wal für einige Zeit beurlaubt und Geeske gebeten, ihn bis auf Weiteres zu vertreten.
Sie hatte nichts dagegen, aber Schreibtischarbeit ist eigentlich nichts für sie, und der Besuch des Distriktkommandeurs lässt sie hoffen, dass eine dauerhafte Lösung gefunden wurde und sie nun doch bald unbesorgt in Pension gehen kann. Mit van de Wal wurden einige Gespräche geführt, an denen sie aber nicht beteiligt war. Er hat sich auch nie im Brigadeposten blicken lassen.
Dass Wagevier nach Delfzijl kommt, »um eine Kleinigkeit zu essen und etwas zu besprechen«, hat Geeske so gedeutet, dass er ihren kommenden Abschied auf besondere Weise würdigen möchte – eine Abweichung vom Protokoll, aber es ist ja das letzte Mal, dass sie dienstlich miteinander sprechen. Es gibt kein nächstes Mal, es kann nicht schaden.
Doch jetzt, als sie zusammen die Treppe des Seedeichs hinaufsteigen, spürt sie, dass es um etwas anderes gehen muss. Wagevier hat zwar ein paar freundliche Worte über ihre Laufbahn gesagt, die darauf schließen lassen, dass er sich vorbereitet hat, aber er hat nicht gefragt, was sie für die Zeit nach dem Ende ihres Arbeitslebens vorhat. Im Gegenteil. Während der knappen Viertelstunde, in der sie durch die Geschäftsstraßen in Richtung Eemshotel gegangen sind, hat er über die neue Arbeitsweise der Brigade Waddengebied gesprochen, die ersten Erfahrungen mit den schnellen Festrumpfschlauchbooten, über die jüngsten Einsätze von Kollegen in Griechenland, über Flüchtlinge, europäische Außengrenzen, Schwerpunkte, strategische Entscheidungen, Ärger mit Den Haag. Und als sie auf der Deichkrone angekommen sind und auf das Eemshotel blicken, das auf Pfählen über dem Watt thront, und Wagevier stehen bleibt, weiß sie, dass nun das Entscheidende kommt.
»Ich wende mich mit einer großen Bitte an Sie, Opper«, sagt er. »Wir haben hier gute Arbeit geleistet, aber wir werden die Brigade auflösen. Hier wird nur ein Posten übrig bleiben.«
Er schiebt das Kinn vor, sein Blick gleitet über das Watt.
»Auflösen«, sagt Geeske.
»Auflösen. Van de Wal kommt dafür zurück, nicht als Kommandeur, sondern als eine Art Manager, der den Übergang organisieren soll. Keine große Sache, aber jemand muss es machen.«
»Und derjenige soll van de Wal sein.«
»Richtig. Sagen wir, er bekommt die Chance, sich zu rehabilitieren.«
Geeske atmet tief ein und hält einen Moment die Luft an. Es entgeht Wagevier nicht.
»Gut möglich, dass nicht alle ihn gern wiedersehen«, sagt er. »Er hat kein Taktgefühl, ich weiß. Aber er ist ein Macher, ohne allzu viel Empathie-Ballast. Und es wird ihm helfen, bei sich selbst das eine oder andere in Ordnung zu bringen. Für van de Wal ist Ordnung sehr wichtig.«
Geeske schaut auf und sieht eine Möwe auf sie zuschweben. Kurz bevor der Vogel über sie hinwegfliegt, landet Kot auf dem Asphalt. Der letzte Klacks trifft Wageviers linke Schulter. Er scheint es nicht zu merken.
»Es wird natürlich für Unruhe sorgen«, fährt er fort, »und deshalb muss jemand diskret alles im Auge behalten.« Wagevier nickt und wendet sich Geeske zu. »Deshalb möchte ich Sie bitten, noch einige Zeit zu bleiben, wo Sie sind, um van de Wals Maßnahmen aus der Nähe zu beobachten und mich auf dem Laufenden zu halten. Sie haben das Vertrauen der Truppe, Sie besitzen Taktgefühl, die Betroffenen können sich an Sie wenden.«
»Eine Möwe hat auf Ihre Uniform …«, sagt Geeske. Sie deutet mit dem Kopf auf seine Schulter.
»Ich weiß«, sagt Wagevier, »aber ich wollte erst meine Ausführungen beenden.«
»Kommen Sie«, sagt Geeske, »dann besorge ich ein Tuch.«
Wagevier nickt. Sie gehen über die Brücke zum Hotel, das ein Stück vor dem Deich auf seinen Pfählen im auflaufenden Wasser steht.
»Die Möwen werden nicht die Einzigen sein, die ihrem Unmut Luft machen«, murmelt Geeske.
Am Eingang des Hotels bleibt Wagevier stehen. Geeske geht hinein; als sie wiederkommt, hat sie ein nasses Spültuch in der Hand und fängt an, Wageviers Uniform zu säubern.
»Ich danke Ihnen«, sagt er.
»Lassen Sie ruhig das ›Sie‹«, sagt Geeske, während sie einen der Sterne blank zu reiben versucht.
»Danke.«
»Hast du noch andere Aufgaben für mich im Sinn, oder soll ich nur hinter van de Wal aufräumen?«
Wagevier neigt den Kopf ein wenig zur Seite, aber Geeske ist mit dem Ergebnis ihrer Bemühungen schon zufrieden. Sie schlägt das Tuch aus.
»Du erhältst die Beförderung zum Adjudant-onderofficier und wirst zugleich Postenkommandeur Delfzijl-Eemshaven, nicht mehr nur stellvertretender Postenkommandeur. Die entscheidende kleine Beförderung vor deiner Pensionierung.«
Geeske faltet das Tuch zusammen. »Gehen wir rein«, sagt sie.
Als sie kurz darauf am Fenster sitzen, Sonnenlicht auf dem Tisch, das Essen schon bestellt, fragt Geeske: »Soll ich denn nur im Büro sitzen und van de Wal beobachten?«
»Nein, nein, ab und zu mal reinschauen, die Leute ansprechen, dich erkundigen, ganz sicher nicht am Schreibtisch sitzen und nichts tun. Das würde ein ganz falsches Signal senden.«
»Was soll ich denn den ganzen Tag machen?«
»Gibt es nichts von früher, was liegen geblieben ist? Wofür du bisher nie Zeit hattest?«
Geeske zuckt mit den Schultern. »Mich selbst vielleicht?«
Der Kellner stellt zwei Teller mit Suppe auf den Tisch. Eine sämige grauweiße Suppe, in der ein paar Stängel frittierte Petersilie treiben.
Wagevier breitet seine Serviette auf dem Schoß aus, wartet, bis Geeske ihren Löffel in der Hand hat, nimmt dann seinen und lässt ihn einen Moment über dem Teller schweben.
»Wir haben eine Anfrage von der Wasserschutzpolizei bekommen. Ursprünglich aus England«, sagt er, während er den Löffel langsam in die Suppe sinken lässt. Die sämige Flüssigkeit schließt sich erst nach kurzem Zögern darüber. »Ein Ertrunkener, an der Küste von Northumberland gefunden. Man weiß nicht, wer es ist, aber man nimmt an, dass er ein Besatzungsmitglied eines Schiffs mit dem Namen Pollux war. Der stand auf seiner Rettungsweste.«
»Es gibt bestimmt etliche Schiffe mit Namen Pollux«, meint Geeske. Sie kostet vorsichtig von ihrer Suppe.
»Im Augenblick allein zwanzig«, antwortet Wagevier. Er isst einen Löffel Suppe und zuckt fast unmerklich zusammen. »Das heißt, zwanzig mit eingeschaltetem Transponder. Vor allem Jachten, aber auch ein norwegischer Trawler, ein Tanker unter panamaischer Flagge, ein Schlepper in Finnland, auch einer im Hafen von Amsterdam, sogar einer in Malaysia. Vor allem Schlepper.«
»Ihr seid also nicht die Einzigen, die diese Anfrage bekommen haben«, sagt Geeske.
»Nein, auch die Deutschen.«
»Wie ist deine Suppe?«
»Och, ja …«, sagt der Distriktkommandeur. Er deutet mit dem Kopf nach draußen. »Schöne Aussicht.«
Geeske rührt mit dem Löffel langsam in ihrem Teller. Die Petersilie folgt dem Löffel. »Wenn er in Nordengland angespült wurde, ist er meiner Ansicht nach eher irgendwo vor der englischen Küste verunglückt, oder weiter nördlich. Wer hier vor der Küste über Bord geht, treibt nach Dänemark, oder natürlich mit dem Ebbstrom nach Texel.«
»Allerdings wurde auch mal eine Frau auf Juist angespült, die an der englischen Küste über Bord gegangen war«, sagt Wagevier.
Geeske nickt und isst weiter.
»Es geht übrigens nicht um heutige Schiffe mit Namen Pollux«, erklärt Wagevier. »Von dem Toten sind nur Knochen übrig. Ein halbes Skelett in einer Rettungsweste. Muss vor längerer Zeit passiert sein. Wurde auch schon vor einem knappen halben Jahr gefunden.«
»Nichts Dringendes also«, sagt Geeske. »Pollux … Da war doch mal was mit einer Pollux, aber was?« Sie fischt die Petersilie aus der Suppe und legt sie auf den Tellerrand.
»Ein Schlepper mit diesem Namen ist mal irgendwo nördlich von Schier oder Rottum gesunken«, sagt Wagevier.
»Jetzt, wo du’s sagst … Daher kommt mir der Name bekannt vor«, sagt Geeske. »Da hatte ich gerade erst hier angefangen. Irgendwann in den Neunzigern?«
»1995.« Wagevier lächelt. »Du warst ein halbes Jahr hier. Hab mal einen kurzen Blick in deine Akte geworfen.«
»Klar«, sagt Geeske.
»Kannst du dich an dieses Schiff erinnern?«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich habe nur in den Nachrichten davon gehört. Es war ein großer deutscher Seeschlepper, der das Fahrzeug, das er schleppte, verlor und dann damit kollidierte und leckschlug. Soweit ich weiß, hat das Seenotrettungsboot von Ameland die Besatzung aufgenommen.« Plötzlich hellt Geeskes Miene sich auf. »Ach, jetzt fällt’s mir wieder ein. Die Sache war etwas verwirrend. So war es: Es waren zwei Rettungsboote beteiligt, das von Ameland und ein deutscher Seenotkreuzer. Sind dabei nicht zwei Retter ums Leben gekommen? Oder war das wieder etwas anderes?«
»Na also!«, sagt Wagevier. »Genug offene Fragen. Du brauchst nicht still zu sitzen.«
»Aber ist das überhaupt ein Fall für uns? Die Anfrage kam doch von der Wasserschutzpolizei?«
Wagevier zuckt mit den Schultern. »Die leidet doch unter chronischem Zeit- und Personalmangel. Außerdem geht es um eine Person, die möglicherweise irgendwo im Grenzgebiet als vermisst gemeldet wurde. Aus meiner Sicht könnte deshalb die Marechaussee das übernehmen. Sonst wird sich ohnehin niemand darum kümmern, oder? Du könntest wenigstens ein paar Nachforschungen anstellen, um auszuschließen, dass es sich um einen Niederländer handelt. Dann haben wir etwas, was wir den Engländern melden können. Ich werde beim Staatsanwalt Nordsee anfragen, ob eine Akte vorliegt. Wenn ja, lasse ich sie dir zukommen. Wenn du möchtest.«
Sie essen eine Weile schweigend. Dann schweift Geeskes Blick über Wageviers Uniform und bleibt an der linken Schulter hängen. Zwischen den Sternen auf der Schulterklappe ist doch eine Spur Möwenkot zurückgeblieben. Er hat die gleiche Farbe wie die Suppe. Sie legt den Löffel hin und schiebt den Teller ein kleines Stück weg.
»In Ordnung«, sagt sie, »ich bleibe im Dienst, bis die Reorganisation abgeschlossen ist. Aber ich habe eine Bitte.«
Wagevier tupft Lippen und Schnurrbart mit der Serviette ab, faltet sie zusammen und legt sie neben den Teller.
»Ich höre«, sagt er, den Blick noch auf die Serviette gerichtet.
»Ich hätte gern die Erlaubnis, in Zivil zu arbeiten.«
Der Distriktkommandeur schaut auf, antwortet aber nicht.
»Wenn es nötig ist, ziehe ich die Uniform natürlich an«, erklärt Geeske. »Aber wenn ich Ertrunkenen nachspüren soll oder zivile Angestellte beruhigen, möchte ich Frau Dobbenga sein, Cees. Darauf habe ich mich schon lange gefreut, und darauf möchte ich nicht gern verzichten.«
»Aber wenn du dich an Henk van de Wal wenden willst …«
»Dann komme ich in Galauniform«, sagt Geeske. »Aber falls ich nach Ameland fahren muss, möchte ich das in Zivil machen.«
Wagevier nickt. »Ist in Ordnung«, sagt er. »Nur nicht zu auffällig.«
Geeske schüttelt den Kopf und lacht. »Nein, nicht zu auffällig, darauf kannst du dich verlassen.«
4
Es ist der erste Sommer von Yildiz Deniz bei der Inselpolizei Norderney. Sie ist sechsundzwanzig, kommt aus Berlin, lacht gern und hat glänzende, immer etwas verwundert blickende Augen. Sie kennt Norderney noch nicht gut, sodass Polizeiobermeister Christian Just, mit dem sie im Streifenwagen eine Morgenrunde durchs Städtchen fährt, ihr nach Herzenslust erklären kann, was sie hier so alles erwartet. Christian ist Anfang vierzig, schon über zehn Jahre Inselpolizist, mit beginnender Glatze unter der Mütze und kleinen dunklen Augen, die auffällig nah beieinanderstehen, weshalb sein Blick ein wenig an ein kleines, Insekten jagendes Tier erinnert. Während er auf die Strandpromenade einbiegt, zählt er auf, worauf er achtet, wenn er am Strand entlangfährt.
»Heute Nacht hat es gestürmt«, sagt er, »dann kann alles Mögliche angespült werden. Meistens Treibholz, aber manchmal auch andere Sachen, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Schiff was verloren hat. Deshalb fahren wir jeden Morgen kurz den Deich entlang, nur um zu sehen, was da unten liegt. Es sind auch schon Päckchen mit Drogen angespült worden. Wahrscheinlich über Bord geworfen, als ein Schiff kontrolliert wurde.«
»Warst du selbst dabei?«, fragt Yildiz.
»Jaja«, sagt er eilig. Doch nach kurzem Schweigen korrigiert er sich: »Oder nein, eigentlich nicht, nicht direkt … Aber dafür bei anderen Sachen.«
Yildiz fragt nicht nach den anderen Sachen. Sie wird abgelenkt durch ein dreirädriges Krankenfahrzeug, das ein paar Hundert Meter vor ihnen vom Ort her den steilen Anstieg zum Deich hinaufgefahren ist und gerade auf der Deichkrone in Sicht kommt. Christian scheint es nicht zu bemerken. Er deutet mit dem Kopf in Richtung Meer, wo die auslaufende Fähre auf den Wellen schaukelt.
»Die Fähre«, sagt er. »Sie dreht hier, und wenn’s ein bisschen stürmt, rollt sie.«
»Ist das erlaubt?«, fragt Yildiz. »Mit so einer Karre über den Deich?«
Christian schaut nach vorn, fährt etwas langsamer und erklärt: »Das ist Atte Germer mit seinem DUO, dem kann man nichts verbieten. Der fährt seine tägliche Runde, so wie wir.«
Das Krankenfahrzeug fährt auf der Seeseite des Deichs zur Strandpromenade hinunter und beschleunigt. Blauer Rauch kommt aus dem Auspuff. Christian fährt ebenfalls etwas schneller, um mitzuhalten.
»Seit es dieses Denkmal für die Retter gibt, fährt er täglich über den Deich. Er war früher selbst einer. Hat ziemlich vielen das Leben gerettet. Deshalb lassen ihn alle in Ruhe. Er tut keiner Fliege was.«
»Gerettet?«
»Aus Seenot.«
Yildiz beobachtet, wie sich das Wägelchen, ohne abzubremsen, von hinten einem Paar nähert. Die beiden können gerade noch rechtzeitig ausweichen, ihr nicht angeleinter Hund bellt dem weitersausenden Gefährt nach.
»Und das lasst ihr ihm durchgehen?« Yildiz schüttelt den Kopf. Sie öffnet das Seitenfenster und fragt im Vorbeifahren die Spaziergänger: »Alles in Ordnung?«
»Manche Leute glauben, hier gäbe es keine Regeln, weil es eine Insel ist«, sagt die Frau wütend.
»Sie müssen Ihren Hund anleinen«, sagt Christian.
»Zeus! Hierher!«, brüllt der Mann dem kleinen Terrier nach, der auf dem Deich zwischen ein paar Strandkörben verschwunden ist.
Christian beschleunigt wieder.
Vor ihnen hat Atte Germer angehalten. Er hat das Kärrchen mitten auf der Strandpromenade stehen lassen und ist ausgestiegen.
»Da ist das Denkmal«, sagt Christian und zeigt. Oben auf dem Deich steht eine leicht gewölbte, niedrige Wand aus glattem schwarzem Marmor oder Granit. Von diesem Mäuerchen aus, das offenbar die Bordwand eines Rettungsbootes darstellen soll, streckt eine Gestalt mit einem Südwester auf dem Kopf den Arm nach unten aus. Wonach genau, kann man vom Auto aus nicht sehen.
»Vor zwei Jahren eingeweiht«, sagt Christian. »Nicht von den Seenotrettern, die waren nämlich aus irgendwelchen Gründen entschieden gegen dieses Denkmal. Sie wollen nicht als Helden gesehen werden, auch wenn alle auf der Insel finden, dass sie welche sind. Aber man brüstet sich nicht damit, dass man Seenotretter ist.«
»Trotzdem fährt dieser alte Seenotretter Tag für Tag zu dem Denkmal.«
»Ja«, antwortet Christian. Er beobachtet Germer, der beim Denkmal angekommen ist und die Hände vor die Augen legt, als würde er tief nachdenken. Er ist über sechzig, hat langes, schütteres graues Haar, trägt eine Arbeitsweste mit großen Taschen, Wollhandschuhe und eine Schlabberhose, und er hat sich einen Beutel umgehängt, der vor seinem Bauch baumelt, weshalb er ein wenig an einen Sämann auf einem Gemälde erinnert.
»Als er noch ein Kind war, haben die Leute gesagt, er hätte zu viel Wind im Kopf. Aber schon sein Vater war Retter, und sein Großvater. Und als Nummer zwei auf dem Seenotkreuzer war er nicht schlecht.«
»Hat ihn nie mal jemand gefragt, warum er das jeden Tag macht?«
»Gefragt?« Christian schüttelt ein wenig unwirsch den Kopf. »Nein, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich würde ihn nicht einfach so ansprechen. Er macht weiter keine Probleme. Wie gesagt, sein Vater und Großvater …«
»Schon komisch, dass er das macht und niemand mit ihm spricht«, unterbricht ihn Yildiz.
»Dass dieses Denkmal aufgestellt wurde, dafür hat Jann van Hiddensee gesorgt, ein Unternehmer, dem das Kurhotel Hochsee hier hinterm Deich gehört. Nachdem die Seenotretter seine Tochter mit ihrem Surfbrett aus dem Seegatt gefischt hatten, wollte er um jeden Preis ein Denkmal. Oben auf dem Deich. Es gab ziemlich viel Streit deswegen, die meisten Norderneyer und besonders die Retter hielten das für Blödsinn, aber dieser Hotelier hat so einige Lokalpolitiker in der Tasche. Deshalb hat er seinen Willen durchgesetzt. Es gab sogar einen ziemlich langen Artikel darüber im Ostfriesland Magazin, auch mit einem Porträt von Jann.« Christian betrachtet das Denkmal. »Ich find’s ja eigentlich schön … aber das bleibt unter uns. Sollen wir kurz hingehen?«
»Ich würde gern einen Moment warten«, antwortet Yildiz, »und sehen, was er macht.«
Sie beobachten, wie Germer ein paar frische Zweige aus dem Beutel holt. Er wählt einen davon aus, bückt sich und scheint ihn beim Denkmal abzulegen. Dann nimmt er einen weiteren Zweig und verschwindet damit hinter dem Deich.
Yildiz steigt aus und geht zur Deichkrone hinauf. Von dort sieht sie Germer durch die Bismarckstraße gehen, wo er hier und da einen Zweig ablegt. Die Straße endet an einem Platz mit einem düsteren Obelisken.
Yildiz dreht sich zum Denkmal um und sieht, dass der Boden vor der Wand eine stark gewellte Fläche ist, aus der Stirn, Augen, Nase, Mund und Hand eines Mannes herausragen, alles aus schwarzem Marmor. Unruhiges Wasser mit einem Ertrinkenden darin.
»Wow«, sagt sie. »Schön.«
»Der Retter, der die Hand nach dem Ertrinkenden ausstreckt«, sagt Christian.
»Schön, dass die Hände sich noch nicht berühren. Wie auf diesem Gemälde, du weißt schon.«
In der Hand des Retters steckt ein Zweig. Wie ein Zeichen des Friedens, oder der Hoffnung. Yildiz greift danach, sticht sich aber. »Au«, sagt sie. Ein Tropfen Blut quillt aus der Kuppe ihres Zeigefingers. Sie steckt den Finger in den Mund.
»Heckenrosen«, sagt Christian. »Die haben Dornen. Manchmal nimmt er auch Sanddorn. Die Fahrradverleiher beklagen sich ab und an wegen der Reifenpannen, immer in der Bismarckstraße, aber sonst macht Germer eigentlich keinen Ärger.«
5
OSTFRIESLAND MAGAZIN
Von Hiddensee zu Hochsee
Jann van Hiddensee und das Denkmal für die Retter
Von Pauline Islander
Norddeich – »Nein, nein, Sie kommen nicht auf die Insel. Sie leben auf Borkum, ich auf Norderney, wir sprechen uns auf neutralem Boden!« Am Telefon klang Jann van Hiddensee so, wie ihn wohl alle Stammgäste des Kurhotels Hochsee kennen: als den lebhaften Mann mit Willie-Nelson-Haartracht und Norderney-Wappen-Bandana, immer einen Scherz oder einen flotten Spruch auf den Lippen. Als wir uns endlich in der Teestube von Hotel Simone in Norddeich gegenübersitzen, erzählt er, bevor ich auch nur ein Wort sagen kann, die Geschichte von der Möwe von Norderney, die jeden Morgen nach Eemshaven fliegt, um an einem Fischstand Hering und Fritten zu stibitzen. »Und abends auf dem Heimflug kneift sie am Anfang immer das linke Auge zu. Wissen Sie, warum?« Er schaut mich über seine Teetasse hinweg durchdringend an. »Um Borkum nicht sehen zu müssen!« Und danach dieses dröhnende Lachen, Krähenfüße an den Augen, rot geäderte Wangen.
Jann van Hiddensee wird nie eine Gelegenheit versäumen, zu betonen, dass Norderney, seine Insel, der schönste Ort auf Erden sei.
Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis von Norderney, dass diese wandelnde Werbekampagne für die Insel als Friedrich Holzmann, Sohn von Jann und Uta Holzmann, in Bitterfeld zur Welt gekommen ist, wo beide Eltern beim Elektrochemischen Kombinat arbeiteten. Jann van Hiddensee stammt weder von Norderney noch von Hiddensee, sondern ist im Bezirk Halle in der DDR aufgewachsen.
Als 1968 eine Gasexplosion, bei der viele Menschen ums Leben kamen, mehrere Produktionsanlagen zerstörte, bekamen Janns Eltern und andere Arbeiter, die diese Katastrophe überlebt hatten, von der Partei eine Woche Urlaub auf Hiddensee spendiert, und er sah mit achtzehn zum ersten Mal das Meer. Noch im selben Jahr fuhr er mit einem befreundeten Lastwagenfahrer von Leipzig nach Stralsund, versteckte sich in der Ladung des Lasters und kam so mit der Fähre ungesehen nach Hiddensee, fand an der Steilküste am Nordende der Insel das Kajak wieder, das er während des Aufenthalts mit seinen Eltern dort versteckt hatte, und paddelte in einer nebligen Nacht, von den Grenztruppen unentdeckt, auf die lebensgefährliche Ostsee hinaus. Die Besatzung eines dänischen Feuerschiffs nahm ihn an Bord, ein Versorgungsschiff setzte ihn kurz danach auf Møn ab, von wo er in die BRD weiterreiste. So kam er in den Westen. »Ich spreche nicht gern darüber«, sagt er. »Es war fürchterlich und ist mit viel Glück gut gegangen. Für mich ist das endgültig Vergangenheit.« Der Mann, der sonst so gern lacht, ist ernst geworden. »Ich dachte, wir wollten über das Denkmal für die Retter sprechen«, sagt er. »Und jetzt fangen Sie von dieser alten Geschichte an. Dafür bin ich nicht gekommen.«
»Hängt denn das eine nicht mit dem anderen zusammen?«, frage ich. »Sie sind doch auch aus Seenot gerettet worden.«
»Überhaupt nicht! Es ist ein Denkmal für die Helden der Küste, die Männer und Frauen, die für andere ihr Leben riskieren, als wäre das ganz selbstverständlich. Nicht nur für meine Tochter, sondern für alle, die auf See in Schwierigkeiten geraten.«
Es war ein Sommertag mit sonnigem, nur etwas böigem Wetter, als Janns Tochter Uta Holzmann auf einem Surfbrett vom Weststrand Norderneys wegtrieb. Die Strandaufsicht war durch eine Auseinandersetzung zwischen Urlaubern abgelenkt. Jann merkte selbst erst, dass etwas schiefging, als er sich wieder in Richtung Meer umdrehte und sah, dass Uta weit vom Strand weggetrieben war, zu weit auch für die damals noch nicht mit Jetski ausgerüsteten Rettungsschwimmer. Der Ebbstrom zog ihr Surfbrett weiter und weiter auf das Seegatt zu. Uta lag mit dem Bauch auf dem Brett und paddelte verzweifelt mit den Händen, aber es war ein ungleicher Kampf. Als das Brett im Fahrwasser zu schaukeln begann, glitt sie ab. Sie konnte sich festhalten, versuchte, sich wieder hinaufzuschieben, doch vergeblich. So nahm der Ebbstrom sie mit: eine verängstigte junge Frau, Oberkörper auf dem Brett, Beine im Wasser. Sie schrie, aber niemand hörte sie. Nach wenigen Augenblicken war sie in den Wellen des Seegatts vom Strand aus nicht mehr zu sehen.
Die Strandaufsicht setzte einen Notruf ab, der Rudergänger der Fähre, der sie sah, tat das Gleiche, und der Norderneyer Seenotkreuzer Otto Schülke lief aus. Zehn Minuten später zog Vormann Michael Waagmann sie an Bord des Tochterbootes, und man kehrte mit ihr in den sicheren Hafen zurück. Jann van Hiddensee stand auf dem Kai, als sie an Land kam. So hatten die Norderneyer ihn noch nie gesehen: ohne Bandana, ohne Brille, mit zitternden Händen, die langen Haare wirr. Er schloss seine Tochter in die Arme und brachte kein Wort heraus.
»Mein Leben war an dem Tag eine Stunde lang zu Eis erstarrt«, sagt er heute. »Nichts war noch von Bedeutung, nur Uta. Die Seenotretter haben nicht nur ihr, sondern auch mir das Leben gerettet.« Er umschließt seine Teetasse mit den Händen und fährt fort: »Das Leben kann so schnell vorbei sein, deshalb sage ich immer: Solange man lebendig ist, muss man positiv sein.« Er schaut mich an und fügt mit leiser Stimme hinzu: »Auch wenn man über Norderney schreibt, oder über die Retter, oder über das Denkmal, positiv, verstehen Sie? Po-si-tiv.«
Ob es seine positive Lebenseinstellung war oder das Vertrauen in seine Fähigkeit, Gegner zu überzeugen: Nachdem er sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, ein Denkmal für die Retter errichten zu lassen – auf dem Deich am Nordstrand, genau vor seinem Kurhotel Hochsee –, ließ er sich durch nichts und niemanden davon abbringen. Der Bürgermeister war dagegen, die Mehrheit im Stadtrat war dagegen, und, was am schwersten wog, auch und gerade die Retter selbst waren entschieden dagegen.
»Denkmäler sind etwas für die Toten«, erklärte Michael Waagmann in der Norderneyer Badezeitung. »Wir sind für die Lebenden da.« Damit war die Sache für ihn erledigt. Solange er der Vormann des Seenotkreuzers war, hatte sein Wort auf der Insel Gewicht.
So begann für Jann van Hiddensee ein langer Kampf um die Verwirklichung seines Traums in einem ungünstigen politischen Umfeld. Er nahm Kontakt mit Bildhauern in ganz Europa auf und entdeckte schließlich in den Niederlanden, genauer gesagt in Zeeland, die Künstlerin Adrianna Rau, die sich in den Niederlanden und Belgien mit ihren glatten Skulpturen meist drahtiger, schmerzgeplagter Männer einen bescheidenen Ruf erworben hatte. Jann wartete die Zustimmung der Norderneyer Politik nicht ab, sondern erteilte ihr den Auftrag, das Denkmal zu entwerfen: ein Retter, der einem Ertrinkenden die Hand hinstreckt.
Er bezahlte sie aus eigener Tasche.
»Es war ein Risiko«, sagt Jann van Hiddensee, »aber hätte ich die Insulaner nicht umgestimmt, dann hätte ich es eben in der Lobby meines Hotels aufgestellt. Gott sei Dank ist es mir gelungen, sie davon zu überzeugen, dass es auf den Deich gehört, wo alle es sehen können.«
Es ist bis heute nicht ganz klar, wie Jann van Hiddensee das gelungen ist. Eine wichtige Rolle spielte sicher, dass Michael Waagmann nicht lange nach Utas Rettung Norderney verließ. Jann van Hiddensee kandidierte für den Stadtrat und wurde gewählt, auch ein neuer Bürgermeister wurde gewählt, der Seenotkreuzer bekam eine neue Besatzung, und Jann schaffte es, einen Gegner nach dem anderen für sein Vorhaben zu gewinnen.
»Ich bin kein großer Fan von Demokratie«, bekennt er, »aber manchmal gibt es keinen anderen Weg.«
»Wie haben Sie die Gegner umgestimmt?«
Sein Mund lächelt, aber die Augen lächeln nicht mit. »Man gibt, man nimmt«, sagt er.
Es ist viel geschehen, seit Jann van Hiddensee als Friedrich Holzmann zum ersten Mal nach Norderney kam, um sich als Saisonaushilfe in den Spülküchen mehrerer Hotels durchzuschlagen. Er wollte sich von seiner Vergangenheit befreien und stellte sich überall als Jann van Hiddensee vor. Bald war von seinem ostdeutschen Akzent nichts mehr zu hören, zumindest bei den Touristen ging er als echter Insulaner durch. Er war fleißig und deshalb eine gefragte Arbeitskraft im Hotelgewerbe, ein immer gut gelaunter Tausendsassa, der keine Gelegenheit ausließ, seinen Arbeitgebern Arbeit abzunehmen. War eine Reinigungskraft krank, putzte er Zimmer, hatte ein Hotelgast Probleme, half er.
Die Trinkgelder, die bald reichlich flossen, legte er zur Seite. Und als er erfolgreich um die einzige Tochter des Eigentümers des Kurhotels Hochsee warb, die rebellische Stella, war der Vater, bereits älter und herzkrank, voll und ganz einverstanden. Der Hotelier lebte noch ein Jahr. Er erlitt auf der Treppe des Hotels einen Herzinfarkt, purzelte vor den Augen gerade eingetroffener Gäste in die Lobby hinunter, richtete sich halb auf, rief »Da!« und verstarb. So wurde Friedrich Holzmann, der mittellose DDR-Flüchtling, als Jann van Hiddensee Miteigentümer des Hotels. Stella und er verwandelten die etwas langweilige Hotelbar in eine Art Piratennest, was auch dank des Kontrasts zum sonst so feinen Hotel großen Anklang fand. Jann van Hiddensee ließ sich die Haare wachsen, lernte, ein Bandana zu binden, spielte erfolgreich den gut gelaunten Piraten und legte sich eine Brille zu, die er verkehrt herum aufsetzte. Nach einem Jahr bekamen Stella und er eine Tochter, die sie nach seiner Mutter Uta nannten.
Und nun hat Jann van Hiddensee gegen alle Widerstände Norderney seinen Stempel aufgedrückt und auf dem Deich sein Denkmal für die Retter aufstellen lassen. In seiner Ansprache bei der Einweihung, der mehr Feriengäste und Journalisten als Einwohner Norderneys beiwohnten, sagte er, das Denkmal ehre die Helden der Küste, indem es jenen heiligen Moment einfange, in dem Retter und Ertrinkender sich die Hand reichen und eine Verbindung zwischen zwei Sterblichen entstehe, die leben wollen. »Es ist ein Denkmal für die Lebenden, nicht für die Toten«, erklärte er.
Ich frage ihn, ob er damit auf die Äußerung Waagmanns zehn Jahre zuvor angespielt habe. Doch er schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagt er.
»Auf jeden Fall hat der Retter des Denkmals große Ähnlichkeit mit Waagmann«, sage ich. »Hat er Modell gestanden?«
Jann gießt mir und sich selbst ein letztes Mal Tee ein. »Ich kann nur sagen, dass ich Michael Waagmann und seiner Besatzung dankbar sein werde, solange ich lebe. Ich bin froh, dass ich ein Denkmal für solche Helden errichten konnte, Männer und Frauen, die immer wieder ihr Leben riskieren.«
»Sie hatten das Gefühl, dass Sie sich revanchieren mussten?«
Jann räuspert sich, will etwas sagen, tut es dann doch nicht.
»Waagmann ist nicht zur Einweihung gekommen«, sage ich.
Jann schüttelt den Kopf. »Man kann das gar nicht wettmachen«, sagt er. »Wenn ich an diese Männer denke, an Waagmann, dann habe ich das Gefühl, dass ich ihm etwas schulde … oder, nein … das ist es nicht.« Er schluckt, fasst sich wieder. »Ich bin ihm verpflichtet«, sagt er. »Immer noch. Das ist es. Immer noch. Für immer.«
6
Freitag
Jetzt, wo sie endlich einmal nicht in Uniform zum Brigadeposten muss, fällt es Geeske gar nicht so leicht zu entscheiden, was sie anziehen soll. Es ist eine Woche her, dass Wagevier vor versammelter Mannschaft die anstehende Auflösung der Brigade verkündet hat. Auch van de Wal war anwesend, unauffällig und etwas abseits, während Wagevier sprach. Er stand am Fenster des kleinen Saals, vermied den Blickkontakt mit den zahlreichen Männern und Frauen, deren Vorgesetzter er im Vorjahr noch gewesen war. Wagevier erwähnte seine Suspendierung nicht, sondern bemerkte lediglich anerkennend, dass van de Wal ein paar Monate in Griechenland europäische Kollegen bei der Aufnahme von Flüchtlingen unterstützt habe. Van de Wal sah so aus, als hätte er irgendwo im Urlaub in der Sonne gelegen, ohne sich erholt zu haben. Als er selbst das Wort ergriff, fiel vor allem auf, dass er leiser sprach als früher. Er fasste sich kurz, schaute aus dem Fenster, während er sprach, suchte gar nicht erst nach beruhigenden Worten. Das Sonnenlicht spiegelte sich in seinen kleinen Brillengläsern.
Als er wieder schwieg, wartete Wagevier einen Moment ab, bevor er selbst weitersprach, als hätte van de Wal seiner Ansicht nach ruhig noch etwas mehr sagen können. Doch es kam nichts mehr. Wagevier dankte ihm und erteilte Geeske das Wort. Sie war es, die zur Beruhigung der Kollegen, vor allem der zivilen Angestellten, beitrug. »Ich bleibe hier in Delfzijl, bis alles geregelt ist«, sagte sie. »Henk wird sehr viel anderes zu tun haben, deshalb habe ich weiterhin formal das Kommando, und ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Lasst mich bitte wissen, wenn es etwas gibt, was euch stört oder unklar ist. Bekommt keinen Schreck, wenn ich hin und wieder in Zivilklamotten erscheine. Ich bin ja eigentlich inzwischen mehr oder weniger im Ruhestand und versuche, mich schon mal daran zu gewöhnen, seht es so.«
Aber was sind angemessene Zivilklamotten? Geeske ist früh aufgestanden, hat einen kleinen Rollkoffer aufs Bett gelegt und starrt in ihren Kleiderschrank. Nach ein paar Fehlstarts entscheidet sie sich für einen strohgelben Kaschmirpullover und eine dunkle Hose; ordentlich angezogen, aber mit ein bisschen Farbe wie von einem milden Herbst.
»Dich lass ich hier«, sagt sie zu der Uniform, die an einem Bügel neben dem Spiegel in der Morgensonne hängt.
Kurz darauf ist sie auf dem Weg zum Brigadeposten, um mit Anne-Baukje von der Kriminalabteilung zu sprechen. Nicht zu lange, denn sie muss um 11:30 Uhr in Holwerd die Fähre nach Ameland erwischen. Es ist Freitag, und sie hat fürs Wochenende ein Ferienhäuschen am Rand von Hollum gemietet, dem Nachbardorf von Ballum, wo Douwe Boomsma wohnt. Boomsma war 1995 Kapitän der Johannes Frederik, des Seenotrettungsbootes, das die meisten Besatzungsmitglieder der Pollux gerettet hat. Geeske ist Douwe einmal begegnet, im Hafen von Ameland. Ein großer, gesprächiger Mann mit einem Troyer, wenn sie sich recht erinnert.
Sie hat sich nicht angekündigt, sondern wird einfach bei ihm klingeln. So gesehen fährt sie auf gut Glück nach Ameland, aber selbst wenn er nicht auf der Insel sein sollte, ist der Ausflug für sie keine verlorene Zeit. Sie kennt von Ameland nur den Hafen hinter dem Fähranleger, wo sie regelmäßig mit dem Patrouillenschiff RV 180 gelegen hat. Den kleinen Hafen in der Ballumerbocht, in dem das Rettungsboot liegt, hat sie immer nur auf Seekarten gesehen. Es ist nicht viel mehr als ein Kai auf dem Deichvorland, eine ausgebaggerte Fahrrinne entlang einer Mole, ein paar Anleger, eine Station der Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij auf einer kleinen Warft.
Als sie die Dienststelle betritt, bedauert sie sofort, diesen gelben Pullover gewählt zu haben. Nicht zu auffällig, hatte Wagevier im Eemshotel gesagt. Jetzt fühlt sie sich zwischen all den dunklen Uniformen deplatziert. Sie behält ihre Jacke an, sucht Anne-Baukje und findet sie am Kaffeeautomaten, wo sie mit Wachtmeester Rob Bonte spricht. Beide verstummen für einen Moment, als sie bei ihnen stehen bleibt.
»Ich hab dich nicht erkannt«, sagt Rob.
Erst als sie mit Anne-Baukje in ihr Büro gegangen ist und die Tür geschlossen hat, zieht Geeske die Jacke aus. »Wie läuft’s hier?«, fragt sie.
»Unruhe«, antwortet Anne-Baukje, »aber kein Aufstand.« Sie betrachtet Geeskes Pullover und Hose. »Hübsch«, sagt sie.
»Muss mich erst dran gewöhnen«, sagt Geeske.
Anne-Baukje nickt. »Wir auch.«
»Zu dem Bericht der englischen Kollegen. Hast du ihn gesehen?«
»Hab ihn ausgedruckt«, sagt Anne-Baukje. »Ich hol ihn mal.« Sie verlässt das Büro und kehrt kurz darauf mit einem Schnellhefter zurück. »Ich fühlte mich wieder wie in der Ausbildung«, sagt sie, als sie ihn auf dem Schreibtisch aufschlägt. »Ein halbes männliches Skelett an der Küste gefunden, unter dem Sand, eingedrückter Schädel, Rettungsweste mit dem Namen Pollux, Projektilreste in der Schulter, Unterschenkel gebrochen. Erstellen Sie eine Analyse.« Sie blättert einen Moment. »Sie haben keine Fotos mitgeschickt. Ziemlich knapper Bericht.«
»Zu meiner Ausbildung gehörte so was nicht. Ich dachte, ich frage Anne-Baukje.«
»Die Gurte waren nach all den Jahren noch fest«, sagt Anne-Baukje, während sie den Bericht noch einmal überfliegt. »Jedenfalls einer. Der Schrittgurt ist gerissen. Solide Weste.«
»Was ist dein Eindruck?«
Anne-Baukje zuckt mit den Schultern. »Ein Ertrunkener, der angespült und unter Sand begraben wurde. Er trug eine Rettungsweste, ist also vermutlich bei einer Havarie im Wasser gelandet. Man weiß nicht, wie lange das zurückliegt, vielleicht fünfzehn Jahre, es können aber auch dreißig sein. Diese Sorte Rettungswesten wird schon seit zwanzig Jahren nicht mehr hergestellt. Was war das für eine Marke? Pollux? Ist das überhaupt eine Marke?«
»Ich vermute, das ist der Name des Schiffs, auf dem er war.«
»Wenn jemand mit einem gebrochenen Bein und einer Kugel in der Schulter über Bord geht, ist es auf der Pollux anscheinend nicht gerade gemütlich zugegangen.«
»Zuerst müssen wir mal herausfinden, um wen es sich handelt«, sagt Geeske. »Sollen wir die Fotos anfordern?«
»Ich glaube, von den Angaben zum Zahnstatus haben wir mehr. Die haben sie mitgeschickt.«
Geeske schaut auf die Wanduhr. »Ich muss nach Holwerd«, sagt sie. »Diese Pollux könnte ein Seeschlepper gewesen sein, der 1995 nördlich von Rottumerplaat gesunken ist. Es war ein deutsches Schiff, deshalb ist es wahrscheinlich kein Fall für uns. Aber wenn ich sowieso auf Ameland bin, gehe ich mal bei Douwe Boomsma vorbei, der damals Kapitän des Rettungsbootes war und diese Rettung geleitet hat.«
Anne-Baukje schaut Geeske lächelnd an. »Die Sache macht dir Spaß«, sagt sie.
»Weißt du, was das Schöne daran ist?«, fragt Geeske, während sie in ihre Jacke schlüpft. »Dass ich nichts muss, dass nichts davon abhängt, dass ich einfach so, ohne dass mir jemand über die Schulter guckt, auf eine Insel fahren und da ganz in Ruhe ein paar Fragen klären kann. Und mit diesem Boomsma kann man sich nett unterhalten. Den Eindruck hatte ich jedenfalls, als ich ihm mal beim Fähranleger begegnet bin.«
»Gibt es eine Frau Boomsma?«
»Auch diese Frage werde ich ganz in Ruhe klären.«