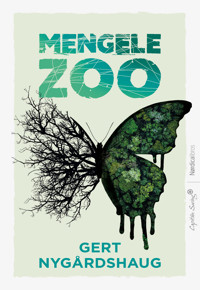Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein weiterer Fall für den norwegischen Hobbydetektiv Fredric Drum, den seine Liebe zum Wein dieses Mal nach Frankreich verschlagen hat: Eigentlich wollte der Osloer Feinschmecker und Weinconnaisseur ja nur die edlen Tropfen in Saint-Émilion nahe Bordeaux genießen. Doch ehe er so richtig in die Genusswelt abtauchen kann, erfährt er von den sieben Menschen, die aus dem bekannten Winzerdorf innerhalb von zwei Monaten jeweils nachts verschwanden. Als dann auch noch ein Mordanschlag auf ihn verübt wird, ist er schon wieder mitten drin in den Ermittlungen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gert Nygårdshaug
Der Honigkrug
Aus dem Norwegischen von Andrea Dobrowolski
Saga
Der Honigkrug
Übersezt von
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1985, 2021 Gert Nygårdshaug und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726791860
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1.
Fredric Drum fällt und kriecht, vergreift sich aber dann doch an einer Flasche Château Cheval Blanc 1961
Da stimmte etwas ganz und gar nicht. Das Unterholz wurde immer dichter, er watete bis zu den Knien im Farnkraut. Der Pfad, er musste den Pfad wiederfinden.
Plötzlich erblickte er etwas Gelbes, das links von ihm an einem Ast hing und hin und her baumelte. Ein Stofffetzen? Neugierig bahnte Fredric sich einen Weg durch das Gebüsch auf dieses auffallende gelbe Ding zu.
Da verschwand der Boden unter seinen Füßen.
Er fiel einfach durch das Farnkraut hindurch, hinab in ein Loch, und spürte einen gewaltigen Druck gegen die Brust. Er saß völlig fest in einem tunnelförmigen Spalt, unter ihm war nur Leere. Er musste da in der Öffnung zu einem unterirdischen Raum hängen, einer Höhle, einem Abgrund. Sein Kopf ragte gerade noch über den Boden, einige Farnwedel kitzelten ihn im Gesicht, und er nieste.
Durch das Niesen rutschte er noch ein Stück tiefer. Es gelang ihm, einen Arm über den Kopf zu zerren, er versuchte, sich an etwas festzuhalten, fand aber nichts. Er riss einige Farnbüschel mit den Wurzeln aus, wand sich, aber jede Bewegung führte nur dazu, dass er immer tiefer versank, Millimeter für Millimeter.
Eine Zeit lang hing er ganz bewegungslos. Er hörte sein Herz schneller und schneller schlagen, spürte, wie der Druck gegen die Brust immer stärker wurde. Sein Mund war trocken. Er leckte einige Schweißtropfen auf. Es fehlte nicht mehr viel zu einer Panikattacke. Er öffnete den Mund, um zu rufen, aber es kam nur ein Keuchen und Stöhnen dabei heraus.
Hier im Wald zu rufen würde sowieso nichts nützen, denn er hatte auf der Wanderung keine Menschenseele gesehen. Niemand würde ihn hören.
Er zappelte etwas mit den Beinen, aber da war nur leerer Raum, der ihn von unten anzusaugen schien, gnadenlos abwärts. Wie tief war dieses Loch, wie weit war es bis zum Grund? Es konnte sehr, sehr tief sein.
Millimeter für Millimeter. Mit jedem Atemzug glitt er ein Stück tiefer nach unten. Wenn er den Atem anhielt und den Brustkorb anspannte, passierte nichts, aber er konnte ihn nicht lange anhalten. Jetzt ist alles aus, Fredric Drum, du fällst in einen bodenlosen Schacht in Südfrankreich, in der Gironde, weit von zu Hause entfernt, und stürzt dich zu Tode! Niemand wird dich finden, dachte er, du wirst für immer verschwinden. Im wahrsten Sinne des Wortes vom Erdboden verschluckt. Er presste sein Kinn gegen den moosbewachsenen, rutschigen Fels und versuchte verzweifelt, sich hochzustemmen. Dann schloss er die Augen und hielt den Atem an.
Die Trommelfelle pochten, es fühlte sich so an, als ob das Blut durch seinen Kopf schäumte, und er hörte einen Wirrwarr von Stimmen. Französisch und Norwegisch, Norwegisch und Französisch, durcheinander. Er hörte die Stimme seines Freundes Tob, Torbjørn Tinderdal, der sagte: »Geräucherte Auerhahnbrust mit feingehackter Leber in Cognacsauce. Eine Flasche Château Talbot, Fredric, was hältst du davon?« Er hörte seine Freundin Maya Manuella sagen: »Der Médoc, Fredric, der Médoc ist die allerbeste Weinregion. Denk doch mal an die Städtchen Margaux, Paulliac und St. Estèphe. Alle auf der Médoc-Halbinsel.« Er hörte ein Dutzend Weinhändler und Château-Besitzer, die im Chor riefen:
»Petite dégustation, ausgezeichneter Wein, der beste von St. Emilion, Grand Cru, Grand Cru Classé, Premier Grand Cru Classé, probieren Sie meinen, probieren Sie diesen Jahrgang!«
Millimeter für Millimeter. Jetzt schrammte sein Kinn über einen rauen Stein, und er versuchte zu atmen, ohne den Brustkorb zu bewegen. Er verrenkte den Kopf nach hinten, sah die Farnwedel, die in der leichten Brise vibrierten, sah einen Baumstamm, dessen Rinde sich in großen Fetzen ablöste. Er sah Äste und Blätter, rote, grüne und gelbe. Salzige Schweißtropfen liefen ihm in die Augen, und das brannte. Wenn er doch nur einen Halt für seine Füße finden könnte, wenn das Loch unter ihm doch bloß nur einen Meter tief wäre!
War das die Art, wie er sterben sollte? Sollte Fredric Drum, der von vielen »der Pilger« genannt wurde, sein Leben so beenden? Vom Erdboden verschluckt, endgültig und für immer verschwunden. Viele würden suchen, aber niemand würde finden.
Sein Hemd wurde ihm vom Leib gekratzt, die Reste hatten sich in seine Schultern und seinen Hals eingeschnitten. Der glatte, etwas unregelmäßige Kalkstein ritzte ihn an mehreren Stellen in die Brust und den Rücken. Er riss ihm die Haut auf, während er gnadenlos immer tiefer versank. Bald würde er durchgerutscht sein, bald würde er in das bodenlose Dunkel fallen und auf scharfen Steinen zerschmettert werden. Sein ganzer Unterkörper vom Bauch abwärts hing jetzt frei. Verzweifelt suchte er nach einem Halt für seine Füße, aber er fand nur Luft. Seine beiden Arme waren in einer unmöglichen Stellung verkeilt, er konnte sie nicht bewegen, nur die Position des Kopfes ließ sich noch verändern, und er schlug seinen Oberkiefer in den Fels. Konnte er sich vielleicht festbeißen? Seine Zähne schrappten mit einem hässlichen Geräusch über den Stein, das Zahnfleisch blutete, er hatte keine Kraft mehr.
Hatte das Rutschen aufgehört? Glitt er nicht mehr weiter nach unten? Einige Sekunden oder Minuten lang hatte er die Augen geschlossen, und er spürte, dass er ganz ruhig hing. Er atmete vorsichtig. Er lauschte. In der Ferne hörte er einen Hund bellen. Ein Zweig knackte nicht weit entfernt mit einem scharfen Geräusch. Ein Zweig knackte! Kam da jemand? War jemand in der Nähe? Ein heiserer Ruf presste sich über Fredrics Lippen, und als seine Lungen sich entleert hatten, fiel er.
Das weiße Meereslicht der Médoc-Region weit im Nordwesten von St. Emilion blendete Fredric Drum, als er auf dem mittelalterlichen Marktplatz von St. Emilion saß. Das schöne, kleine Dörfchen auf der Anhöhe nördlich des Flusses Dordogne war das Mekka der Weinkenner. St. Emilion. Der bloße Name hatte alle Zutaten eines guten Weins in sich: weiche Vokale, die durch den Mund rollten und darin wuchsen. Ein langer Nachgeschmack, Nachklang.
Seit vier Tagen war er jetzt hier. Er wollte guten Wein für das kleine Restaurant kaufen, das sie zu Hause in Norwegen besaßen: die »Kasserolle«. »Die KASSEROLLE, exklusives Restaurant mit intimer Atmosphäre. Nur sechs Tische. Gourmet-Menü. Nur telefonische Vorbestellung.« So hatte es in der Eröffnungsannonce gestanden. Diese sechs Tische waren fast jeden Abend besetzt. Es lief gut, richtig gut.
St. Emilion. Es war ihm gelungen, mit mehreren Weinhändlern Bekanntschaft zu schließen, kleinen propriétaires und stolzen maîtres de chai, den Wächtern über die Reifung und die Lagerung des Weins. Heute saß er mitten unter ihnen, an den Tischchen rund um die große Eiche mitten auf dem Marktplatz. Das Herbstlicht aus Nordwest war stark, aber wohltuend.
Diskussionen über die Tische hinweg. Arme, die fuchtelten, gestikulierten. Laute Stimmen. Ernsthafte Gespräche. Es wurde nicht über Wein diskutiert. Und auch nicht über Fußball. Nicht über Politik. Eine tiefe Tragödie hatte das schöne Weinstädtchen St. Emilion in ihren Bann geschlagen.
Ein unfassbares Mysterium.
Im Laufe von August und September waren sieben Menschen spurlos verschwunden. Sieben Menschen im Alter zwischen neun und dreiundsechzig Jahren. Alle stammten aus St. Emilion oder der umliegenden Region.
Der Turm der mittelalterlichen Kirche warf einen langen und düsteren Schatten über den Marktplatz.
Er rang mit etwas Dunklem. Es war so dunkel um ihn. Und hart. War es nicht hell in St. Emilion? Der Marktplatz, der weiße Marktplatz. Saß er nicht eigentlich gerade dort? Träumte er jetzt? Dann musste er aber wirklich zusehen, dass er aufwachte! Der Marktplatz von St. Emilion; all die Tischchen, Weinkenner, Château-Besitzer und er. In einem Gespräch über Wein? Nein, nicht über Wein, über etwas anderes, etwas Trauriges. Halt, hier stimmte etwas nicht, es war so dunkel hier, so hart, steinig, schmerzhaft! Er hatte Schmerzen, in der Brust, der Hüfte, im Gesicht. Jemand hatte gesagt, dass es einen Pfad durch den Wald hinter dem Château Frigeac zum Château Cheval Blanc gebe; eine Abkürzung, einen sehr guten Pfad. Er hatte eine Verabredung mit dem maître de chai im Château Cheval Blanc. Eine Weinprobe. Du träumst, Fredric, es ist doch hell auf dem Marktplatz von St. Emilion!
Jetzt war er ganz wach und dachte wieder klar. Er war gefallen. In ein Loch in der Erde gefallen. Er war nicht tot. Wahrscheinlich verkrüppelt, aber nicht tot. Er war bewusstlos gewesen. Jetzt lag er da und starrte zu einem Lichtspalt hoch, der weit über ihm lag. Wie weit? Der Sturz musste zu schweren Verletzungen geführt haben. Wagte er es, diesen nachzuspüren?
Er wagte es. Volle Beweglichkeit aller Glieder. Nicht schlecht. Kein Knochenbruch? Kein Knochenbruch. Innere Verletzungen? Er räusperte sich und spuckte, schmeckte aber kein Blut. Trotzdem hatte er starke Schmerzen in Hüfte, Brust und Kopf.
Er lag auf einem Haufen von Ästen und verwelktem Laub. Wie ein richtiger Heuhaufen. Durch den war auch sein Sturz gedämpft worden. Um ihn herum tropfte es: Plopp, plopp.
Mühsam setzte er sich auf, und erstaunlicherweise nahmen seine Kopfschmerzen ab. Die Hüfte war schlimmer dran, sie war wund und steif. Aber er konnte hocherfreut feststellen, dass er lebte und auch nicht verkrüppelt war. Aber er war tief, tief ins Dunkel gefallen.
Irgendetwas passte hier nicht zusammen, er verstand es nicht, aber es schwirrte ihm im Kopf herum: Waren die anderen sieben Menschen in den letzten Monaten auch auf diese Weise verschwunden? Waren sie einfach wie er in Erdspalten gefallen? Das konnte nicht sein, sie waren alle aus dieser Gegend und kannten sich mit all diesen merkwürdigen unterirdischen Grotten aus. Denn St. Emilion war noch für etwas anderes als seinen Wein berühmt: Unzählige sogenannte monolithische Grotten durchzogen kreuz und quer das Gelände, fast jedes Château hatte seine eigene Grotte, wo der Wein gelagert wurde.
Verschwunden. Sieben Menschen. Und jetzt auch noch ein Norweger.
Er stand auf und stieß sich den Kopf an einem Vorsprung. Funken sprühten vor seinen Augen, aber er konnte sich aufrecht halten. Finster, es war fast stockfinster um ihn herum. Das Licht von dem kleinen Spalt über ihm konnte nicht bis zum Grund, auf dem er sich befand, durchdringen. Sieben, acht Meter mussten es bis dort oben sein. Er tastete sich an den Wänden entlang. Gab es einen Weg nach draußen, nach oben? Es war kein Lichtschimmer von irgendwo anders als von dem kleinen Spalt zu sehen.
Er stolperte über Zweige und rutschte auf nassen Steinen aus. Er trat gegen etwas, das hohl klang und davonrollte. Hohl? Ein hohler Stein? Ein hässlicher Verdacht beschlich Fredric, und er bekam eine Gänsehaut. Er ging auf die Knie und tastete herum. Da, da war das, was er weggetreten hatte. Einige Sekunden hielt er es in der Hand, bis er es fallen ließ, als ob er sich daran verbrannt hätte.
Es war ein Schädel, ein Menschenkopf. Er war also nicht der Erste. Ein lang gezogenes, schmerzerfülltes Heulen brach aus Fredric Drums Brust hervor.
»Nein, fahr in den Médoc. Nach Margaux oder St. Julien. Da gibt es vielleicht auch besseren Wein«, beharrte Maya Manuella in ihrem mit starkem Akzent gesprochenen Norwegisch.
»Es hat keinen Zweck, mit mir darüber zu reden«, antwortete Fredric. »Ich habe mich für St. Emilion entschieden. Das liegt nicht nur an dem Wein. Dort soll es so schön sein. Ein mittelalterliches Dorf. Nächstes Mal bist du ja an der Reihe, Maya, und dann kannst du ja in den Médoc fahren. Dann hast du mal eine Abwechslung von all deinen Madeira-Reisen.«
Maya Manuella Gardilleiro stammte von Madeira, aus einem kleinen Walfängerdorf, das Canical hieß. Dort wohnten ihre Mutter und ihr Bruder, erzählte sie. Der Vater lebte in Norwegen, aber sie hatte keinen Kontakt zu ihm. Fredric und Tob fragten sie nie nach dem Grund. Offensichtlich gab es feindliche Lager in der Familie. Maya war schon seit vielen Jahren in Norwegen und sprach recht gut Norwegisch.
Sie hatten ausgelost, wer die erste Weinreise machen würde, und Fredric hatte gewonnen. Einmal im Jahr wollten sie in die Weinregionen fahren, um Wein für ihr kleines Restaurant zu probieren und zu kaufen. Natürlich über das staatliche Weinmonopol. Sie waren sich einig, dass zu gutem Essen auch guter Wein gehörte. Ganz besonders guter Wein.
»Ich finde das dumm, das wirst du bereuen«, sagte Maya und trank einen kleinen Schluck Wein. Alle drei, Tob, Maya und Fredric, saßen an ihrem privaten Tischchen in der »Kasserolle«. Sie hatten die schöne Angewohnheit, eine halbe Flasche guten Wein zu teilen, wenn alle Gäste gegangen waren.
»Fredric entscheidet selbst«, beendete Tob die Diskussion und putzte die runden Gläser seiner Apothekerbrille. »Und warum auch nicht St. Emilion? Einer meiner Lieblingsweine kommt von dort, Château Pavie.«
Er hätte auf Maya Manuella hören sollen. Er hätte den Médoc wählen sollen. Aber wer hätte ahnen können, dass so etwas passieren würde.
Fredric Drum lehnte sich gegen einen feuchten Stein und blinzelte zur Decke und dem Spalt weit da oben. Dann murmelte er etwas vor sich hin und zog einen Gegenstand aus der Tasche; einen Gegenstand, den er überall mit sich trug, egal, wo auf der Welt er war. Es war ein Kristall. Geformt wie ein fünfzackiger Stern, so groß wie ein Fünfkronenstück, aber viel dicker, vielleicht einen Zentimeter. Eine Spezialanfertigung des Hadeland-Glaswerks nach einer Idee, die er vor einigen Jahren gehabt hatte, nachdem er ein Buch über die mystischen Eigenschaften und die Bedeutungsgeschichte der Kristalle gelesen hatte. Abergläubisch war Fredric Drum durchaus nicht, aber es war eine Tatsache, dass dieser fünfzackige Kristallstern mit ihm kommunizieren konnte. Irgendwie. Er musste nur die Farben deuten, die durch die fünf Prismen der Zacken gebrochen wurden.
Er hielt den Kristallstern hoch über seinen Kopf. Er leuchtete in schwachem Gelb; eine unbedeutende Farbe.
Jetzt unternahm Fredric eine Reihe merkwürdige Manöver: Indem er in der Grotte herumkroch, hielt er immer wieder den Kristallstern dicht vor sein rechtes Auge, während er das linke schloss. Er murmelte vor sich hin, sprach mit sich selbst:
»Gelb – fast weiß, ein bisschen blau? Nein, vielleicht hier – wieder gelb – gelb – verdammt! Hier, hier ein bisschen rot? Leicht rötlich – ja tatsächlich, leicht rötlich – näher an dieser Wand – vorsichtig mit dem Kopf – kräftiger rot – ja, genau, genau – rot, richtiges Rot! Da, ruhig, ruhig jetzt.«
Er lag jetzt unten am Boden der Grotte an die Wand gedrückt, tastete mit den Händen die unregelmäßige Kalksteinwand ab, drückte und klopfte mit den Knöcheln. Und plötzlich löste sich ein größerer Stein und fiel aus der Wand. Ein kleiner Erdrutsch aus Steinchen und Sand löste sich.
»Voilà!«, rief er aus, nieste und rieb sich den Sandstaub aus den Augen.
Ein schwerer, muffiger Geruch drang aus dem Loch in der Wand. Denn ein Loch war daraus geworden, ein richtiges Loch, und es führte weiter nach innen. Fredric steckte den Kristallstern in seine Tasche und kroch in das Loch. Es war eng, unangenehm eng, aber er schlängelte sich vorwärts, Meter für Meter. Nach einiger Zeit weitete sich der Tunnel, und er konnte ein gutes Stück krabbeln. Aber dann wurde er wieder schmaler und schließlich sehr eng. Fredric verschnaufte einen Augenblick.
Wo führte das hin? Hinab ins Innere der Erde? Folgte er einem uralten Lavatunnel? Konnte er sich Erlebnisse wie Ludvig Holbergs Untergrundreisender Niels Klim erhoffen?
Er kroch weiter und hatte das Gefühl, dass der Tunnel immer schmaler wurde. An manchen Stellen war es so eng, dass es ihm nur mit Mühe gelang, sich hindurchzupressen. Mehrmals war er auf der Kippe zu einem schweren Klaustrophobieanfall. Es war warm, er schwitzte und fühlte sich ziemlich erschöpft. Weiter, weiter! Er zwang sich dazu, an angenehme Dinge zu denken; an die »Kasserolle«, das beste und kleinste Restaurant Oslos, mit einer Speisekarte, die in Nordeuropa ihresgleichen suchte. Bald würde er dort wieder mit seinen beiden Freunden und Mitbesitzern, Tob und Maya Manuella, zusammensitzen, er würde von seiner Weinreise nach St. Emilion berichten, sie würden an einem guten Wein nippen und mit der Gästezahl des Abends zufrieden sein! Sie würden das Menü des nächsten Abends planen: vielleicht dünne, knusprig gebratene Rentiernierenscheiben, mariniert in Cognac, serviert mit Mandelkartoffelbrei, abgeschmeckt mit etwas Dijon-Senf?
Denk nach, Fredric, denk nach!
Der Tunnel fing an, sich dramatisch nach vorne zu neigen, an manchen Stellen fast senkrecht. Fredric glitt mit dem Kopf voran weiter, und es wurde ihm klar, dass es unmöglich sein würde, sich wieder zurückzubewegen. Wenn sich der Tunnel nur bald ein bisschen weiten würde! Wenn er sich bloß nicht noch mehr verengte. Er krallte sich vorwärts, Stück für Stück.
Denk, denk an etwas ganz anderes! Kriech, Fredric, kriech!
Wie weit war er schon gekrochen? Hundert Meter, fünfhundert, einen ganzen Kilometer? Welche Tageszeit war jetzt, wie lange war er schon unterwegs? Würde dieser Albtraum nicht bald enden? Seine Kräfte würden nicht mehr lange reichen.
Er stieß gegen einen Stein – zum hundertsten Mal? – und blieb still liegen. Es war so eng, eng, enger, am engsten. Keine Luft mehr. Jetzt erstickst du, Fredric!
Er hakte sich mit den Händen vor seinem Kopf ein, stieß sich mit den Füßen ab, zog sich einige Meter vorwärts. Müsste es nicht bald mal wieder aufwärtsgehen?
Rote Punkte tanzten vor ihm in der Dunkelheit, direkt vor seinen Augen, ein Schwarm roter Insekten in seinem Kopf, sie tanzten, flimmerten, stachen. Er lag ganz still und spürte, wie tausend Tonnen Fels sich in seinen Rücken pressten.
Die farbenfrohen Gebäude um den Marktplatz herum. Charcuterie, Boucherie, Boulangerie. Und heute waren so viele auf dem Platz versammelt, an den Tischchen unter der Eiche, vin de maison, kleine Becher. Und alle redeten und diskutierten. Drei Tage war der siebzehnjährige Jean-Marie Lascombe jetzt schon verschwunden. Jean-Marie, Lehrling im Château Beauséjour Bécot. Er hatte Ampelographie, Rebsortenkunde, studiert. Er wohnte bei seinen Eltern in St. Emilion. Aber vor drei Tagen war er abends nicht wie üblich gegen acht nach Hause gekommen. Keiner seiner Freunde hatte ihn gesehen. Der maître de chai vom Château Beauséjour Bécot berichtete, dass er wie üblich das Schloss gegen halb acht verlassen habe. Er war der Letzte, der ihn gesehen hatte.
War Jean-Marie Lascombe der Siebte in der Serie der Verschwundenen?
Fredric lauschte und betrachtete die ernsten Gesichter um sich herum. Es wurde ihm klar, dass sich in dem friedlichen kleinen Weinstädtchen eine Tragödie abspielte. Trotzdem hatte er hier eine Arbeit zu verrichten: Er wollte Wein probieren und einkaufen. Mitten in all der Trauer und der ernsten Stimmung gelang es ihm, einige Verabredungen zu treffen. Heute wollte er zum Château Cheval Blanc. Neben dem Château Ausone das schönste Schloss in der Region St. Emilion. Diese beiden waren eine Klasse für sich. Er freute sich auf den Termin beim maître de chai im Château Cheval Blanc.
Wie kam er am schnellsten da hin? Diese Frage hatte er am Vormittag an allen Tischchen gestellt, und er hatte viele Antworten bekommen. Alle sagten, es ginge ein Pfad durch den Wald, hinter dem Château Figeac, ein richtig schöner Pfad. Später am Nachmittag hatte er ihn gefunden. Aber mitten im Wald hatte sich der Pfad geteilt in zwei gleich aussehende Pfade. Auf einem Pfeil stand: »Château Cheval Blanc«. Natürlich hatte er die Abzweigung gewählt, auf die der Pfeil zeigte. Aber nach einiger Zeit war dieser Pfad ins Leere gegangen. Da war nur noch Farnkraut, jede Menge Farnkraut. Er wäre beinahe umgekehrt, aber dann hatte er den gelben Stofffetzen gesehen, der an einem Ast hing. Es sah so aus, als sei dieser dort mit Absicht hingehängt worden.
Weiteratmen, Fredric, weiteratmen!
Der Schweiß lief ihm in Strömen herunter, er war einen Moment eingeschlafen, es war ja so warm! Vorwärts, konnte er weiter vorwärtskommen? Er drückte, rückte einen Dezimeter vor, konnte sich mit dem Fuß abstoßen. Einen halben Meter, einen Meter, aber immer abwärts. Bald würde er wohl in einen See aus kochender Lava stürzen. Gib auf, Fredric, du kannst genauso gut aufgeben!
Niemals. Fredric Drum gab nicht auf. Hatte er sich nicht schon früher in schwierigen Situationen befunden? Und sie überstanden? Doch, doch, schon wahr. Drum hatte in seinem kurzen Leben schon so manches durchgemacht. Aufgeben? Nie. Er spuckte aus und hustete Staub.
An seinen Fingerspitzen war die Haut abgeschabt, sie taten weh und bluteten nach all der Kratzerei an dem rauen Kalkstein. Sein ganzer Körper schmerzte, aber er zog sich weiter vorwärts. Dezimeter wurden zu Metern. Und plötzlich spürte er die Ahnung eines Luftzugs in seinem Gesicht. Es war Bewegung in der Luft! Und sie war jetzt auch kühler, oder? Diese Entdeckung verlieh ihm neue Kräfte, und er kam mehrere Meter voran.
Es wurde immer kühler. Der Tunnel war auch etwas breiter geworden; er konnte jetzt auf den Knien kriechen. Er war voller Eifer, tastete nicht mehr mit den Händen vor sich her, und plötzlich knallte er gegen etwas. Funken sprühten in seinem Kopf, aber als er sich wieder gesammelt hatte, konnte er fühlen, wogegen er da gestoßen war: ein stählernes Gitter! Der Tunnel vor ihm war mit einem Stahlgitter abgesperrt. Er tastete die Umgebung des Gitters ab und bekam etwas Weiches, Wolliges an die Hände. Spinnweben.
Diese Entdeckung machte ihn ganz verrückt vor Freude. Mit seinen letzten Kräften boxte er gegen das Gitter, und: platsch! Es verschwand mit einem klirrenden Geräusch, das sich so anhörte, als ob es sich durch endlose Hallen fortpflanzte.
Fredric begriff sofort, dass der Tunnel, in dem er sich befand, in eine Wand einer größeren Grotte mündete. Aber was war das klirrende Geräusch gewesen, als das Gitter hinuntergefallen war?
Er hatte einen starken Verdacht.
Mit Mühe und Not gelang es ihm, sich umzudrehen. Er ließ vorsichtig die Beine voran über die Kante gleiten. Dann folgte er mit dem Oberkörper. Bald stand er auf etwas Welligem, Glattem. Sicherheitshalber setzte er sich hin und betastete die Oberfläche mit den Händen. Da bestand kein Zweifel, er saß jetzt oben auf einem Stapel Weinflaschen. Er war in einem ziemlich großen Weinkeller gelandet; in einer Grotte, die zu einem Château gehörte. Mit anderen Worten: Er war gerettet.
Er kletterte von dem Stapel Weinflaschen hinab – es war ein enormer Stapel, Schicht über Schicht in beträchtlicher Breite – und stand schließlich auf einem Zementboden. Er schwankte und musste sich setzen. Er legte sich auf den Rücken. Fredric Drum lag auf dem Rücken und atmete frei, ohne Druck auf seinen Körper, und er atmete gute, kühle Luft.
Er lachte. Laut und wild. Sein Gelächter rollte unheimlich durch die gewaltigen Grotten.
Also war er nach wie vor in St. Emilion und nicht auf dem Weg ins Erdinnere.
Er blieb so liegen und ruhte sich aus, spürte, dass sein Herz allmählich wieder normal schlug. Wie lange hatte das gedauert? Wie viele Stunden, Tage hatte er sich da drinnen durch den Berg gekämpft? Er hatte keine Ahnung. Eine Uhr hatte Fredric Drum – der »Pilger« – nie bei sich.
Sein Körper schmerzte, er war wie eine einzige große Wunde. Die Kleider nur noch Lumpen. Sein Magen knurrte, er spürte plötzlich, dass er unglaublichen Hunger hatte. Es musste eine Ewigkeit her sein, dass er in dem kleinen, gemütlichen Restaurant »Le bon Vigneron« am Place Bouqueyre in St. Emilion Confit de canard gegessen hatte, Ente auf Bordeaux-Art.
Fredric stand auf, tastete sich an den Wänden entlang und taumelte zwischen den Stapeln mit Weinflaschen hindurch. Gab es irgendwo einen Lichtschalter? Er hatte die Dunkelheit satt.
Nach einiger Zeit fand er etwas, das offensichtlich das Tor zur Freiheit sein musste. Eine massive Stahltür, verriegelt und mit vielen Schlössern gesichert. Er vermutete stark, dass es inzwischen Nacht war. Es hatte also keinen Sinn, zu klopfen und zu rufen.
Neben der Tür fand er tatsächlich einen Lichtschalter. Jäh ging eine Menge Glühbirnen um ihn herum an, überall in den Hallen, über jedem Flaschenstapel. Das plötzliche grelle Licht blendete ihn, er blinzelte, und es dauerte eine Weile, bis er richtig sehen konnte.
Auf einem Schild, das vor der Tür von der Decke hing, einem schön gestalteten Schild, konnte er lesen: »Grand Cave de Château Cheval Blanc«. Er war also schließlich doch zum Château Cheval Blanc gekommen. Er hätte gerne gewusst, wie viele Weinkäufer wohl schon auf dem gleichen Weg wie er gekommen waren.
Fredric Drum, der Weinliebhaber, ganz allein in einem der berühmtesten Weinkeller der Welt. Das konnte ja eigentlich gar nicht wahr sein. »Grand Cave de Château Cheval Blanc«!
Jetzt hätten Tob und Maya Manuella ihn sehen müssen! Tob, der mit immer gleichem Enthusiasmus zwischen den wohlduftenden Töpfen in der Küche hin und her rannte; ein gefühlvolles Umrühren hier, ein bisschen Abschmecken dort. Und Maya mit ihren tausend Ideen und exotischen Kombinationen. Sie waren ein Team; in großen, weißen Schürzen und immer sauberen, weißen Hemden wechselten sie sich ab beim Servieren, Kochen und den Weinempfehlungen. Zusammengeschweißte Freunde: Tob, Maya und Fredric. Und in stilleren Momenten konnten sie sich an dem kleinen, privaten Tisch hinter den Weinregalen niederlassen, während sie die Gäste über eine ausgeklügelte, diskrete Anordnung von Spiegeln im Auge behielten.
Ja, jetzt hätten sie ihn wirklich sehen müssen!
Fredric hinkte steif in der riesigen Grotte herum. Stapel über Stapel. Staub, dicke Staubschichten auf einigen, dünnere auf anderen. Über jedem Stapel eine Jahreszahl. 1978: mäßig dicke Staubschicht. 1976: großer Stapel, aber ein miserables Weinjahr. 1975: sehr gutes Jahr, der Stapel nicht allzu groß. So ging es immer weiter, Jahr für Jahr, alle Wände entlang und in den Nischen.
Fredric blieb bei einem kleinen Stapel stehen, der nur aus ein paar hundert Flaschen bestand: 1961. Das Jahr der Jahre, kein Rotwein in unserem Jahrhundert konnte sich wohl mit der Qualität aus diesem Jahr messen. Ein Glücksjahr für die Winzer.
Sollte er?
Ja, selbstverständlich sollte er! Wenn jemand auf dieser Erde gerade jetzt einen guten Wein verdient hatte, dann musste das Fredric Drum sein. Andächtig nahm er eine Flasche vom Stapel und rieb den Staub ab. An der Tür hatte er ein Regal mit Weingläsern bemerkt, pour dégustation, und einen Korkenzieher.
Er öffnete die Flasche. Dann nahm er ein Glas und suchte sich einen abgeschirmten Platz ganz hinten im Keller, hinter einem Weinstapel. Da waren einige Bretter und Pappkartons, auf denen er sitzen konnte.
Welch ein Bouquet! Tausend Düfte, unmöglich, einen einzigen zu benennen. Voll und mild, es wuchs im Mund. Kein Hauch von Tannin, Gerbsäure. Und der Geschmack hielt nach jedem Schluck mehrere Minuten an. Er nistete sich in den Nebenhöhlen und in den kleinen Hohlräumen hinter den Augen ein. So sollte es sein.
Fredric trank. Große Schlucke, kleine Schlucke. Château Cheval Blanc 1961. Seine blutigen Finger versuchten, das Glas ruhig zu halten.
Er hatte die Flasche ungefähr zur Hälfte leergetrunken, und alles war nur noch Wohlgefühl, als ein schrecklicher Gedanke durch seinen Kopf fuhr: Und wenn sein Unfall arrangiert gewesen war?
Der Pfad durch den Wald. Der Pfad teilte sich. Ein Schild zeigte: In dieser Richtung zum Château Cheval Blanc. Was nicht stimmte. Jemand konnte das Schild umgedreht haben. Jemand konnte das gelbe Stück Stoff aufgehängt haben, um ihn zu dem Loch zu locken. Ganz zufällig war er ja nicht durch den Farn gegangen. War er nicht einer ganz schwachen Andeutung eines Weges durch das Unterholz gefolgt? Als ob da schon vor ihm jemand gegangen wäre. Schon eine Person hätte genügt, um die Illusion eines Pfads durch den Farn zu erzeugen. Direkt auf den Stofffetzen zu. Direkt über das Loch.
Jetzt lässt du deine Fantasie aber mit dir durchgehen, Fredric, lass das. Du hast dich zwar im Laufe deiner zweiunddreißig Lebensjahre in die unglaublichsten Geschichten verwickelt, nicht umsonst hast du dir den Spitznamen »Pilger« zugezogen, aber das ist wohl doch ein bisschen zu heftig. Das ist die reinste Paranoia. Er versuchte, diesen Gedanken, der so sinnlos in seinem Kopf aufgetaucht war, zu ersticken.
Trotzdem. Je tiefer er in der Flasche kam, desto hässlicher wurde der Verdacht. Er wurde regelrecht finster.
Auf dem Marktplatz am Vormittag: Viele hatten gehört, dass er zum Château Cheval Blanc wollte. Viele hatten ihm von dem Pfad erzählt. Einige von denen, die dort saßen, kannte er mit Namen, bei anderen erinnerte er sich noch nicht einmal an das Gesicht.
Unsinn. Reiner Unsinn.
Da war genug Zeit gewesen, das Schild umzudrehen und den Fetzen aufzuhängen. Aber er hatte doch keine offene Rechnung mit irgendeinem Franzosen. Er war noch nicht einmal jemals vorher im Land gewesen; dies war seine erste Reise hierher. Daher war es doch absurd anzunehmen, dass ihm jemand nach dem Leben trachtete.
Er erreichte den Grund der Flasche, ohne dass er diese Zwangsvorstellung loswurde. Sie wurde allmählich undeutlich und schwirrte ihm im Kopf herum, aber sie war noch da. Als er aufstand, um eine neue Flasche zu holen – kein 1961er dieses Mal, nein, so viel Respekt vor gutem Wein hatte er, daher wählte er einen 1978er –, torkelte er. Er fühlte sich ziemlich betrunken, aber in guter Stimmung. Er war ja am Leben!
Er hatte noch nicht viel von der 1978er Flasche getrunken, als ihm das Geräusch wieder einfiel, das er direkt vor seinem Sturz gehört hatte. Das laute Geräusch eines brechenden Zweigs, woraufhin er gerufen hatte. Es konnte der Wind gewesen sein, der einen Ast losgerissen hatte. Es war aber nicht windig. Konnte ein Ast gewesen sein, der von selbst gefallen war. Konnte sein. Aber es konnte auch …
»Drum-drum-drum«, lallte er vor sich hin, »drummedidrum-drum-drum. Weiter du Drum, so dumm! Fredric, der Gehäutete, der Aufgeschrammte, der Geschundene. Hör auf das Hornorchester, auf die Trommeln, nur auf die Trommeln: Rented a tent a tent a tent, rented a tent, rented a tent a tent, sagen die Trommeln. Die Trommeln, ha-ha!«
Er rollte sich auf die Seite und lag mit dem Ohr an einem flachgedrückten Pappkarton. Er war jetzt besoffen, schwer besoffen. Bald darauf schlief er ein.
Er erwachte jäh. Ein Tor, das aufgestoßen wurde, dröhnte laut. Das Geräusch übertrug sich auf die Weinstapel, die ein dürres Klirren von sich gaben. Es vergingen etliche Minuten, bis er vollkommen begriff, wo er sich befand und wie er hier gelandet war. Die Erkenntnis war nicht angenehm, und sein Körper fühlte sich wie eine gestampfte Beerenhülse an. Sein Kopf? Der Kopf war da, unangenehm deutlich.
Raus. Er musste hier raus. Unbemerkt.
Er richtete sich mühsam auf, schlich um einen Weinstapel herum und schaute hervor. Er sah niemanden. Der Weg war frei, das Tor offen. Er brach hervor, lief hinkend, humpelnd aus dem Tor, einen Schotterweg hoch, sprang zur Seite und hockte sich hinter einige Büsche. Dann verschaffte er sich einen Überblick über die Situation.
Das eigentliche Château, Cheval Blanc, lag etwa zweihundert Meter entfernt. Ein paar zusammengedrängte Häuschen links von ihm. Rechts: ein Wald. Derselbe Wald? Drüben beim Schloss fing ein Hund an, furchtbar zu bellen. Verdammte Château-Köter!
Er riskierte den Wald. Er ging langsam, jeder Schritt war eine Qual. Wenn jemand ihn auf diesem exklusiven Weingut in seinem Zustand erblickte, zerlumpt und blutig, würde sofort die Polizei gerufen werden, da war er sich vollkommen sicher. Dann würde er für den Diebstahl von teurem Wein angeklagt werden. Sehr teurem Wein.
Er ging am Waldrand entlang. Ein kleines Schild tauchte auf und ein Pfad: St. Emilion. Der Pfad, das war also der Pfad. Schaudernd dachte er daran zurück, wie er sich hier tief unter der Erde vorwärts gequält hatte, stundenlang, voller Leiden und Schmerz. Aber er hatte es geschafft. Trotz allem hatte er es geschafft.
Dem Pfad konnte man leicht folgen. Er war einige hundert Meter gegangen, als er die Stelle plötzlich wiedererkannte. Er war zu der Verzweigung der Pfade gekommen. Und ein Schild mit einem Pfeil zeigte: Hier entlang zum Château Cheval Blanc.
Von dort war er gekommen.
Gestern Nachmittag hatte der Pfeil auf den anderen Pfad gezeigt. Auf den, der ins Leere führte. Den, der zum Loch führte.
Fredric Drum fror.
2.
Er tanzt Street-Dance, studiert die Weinkarte der Diskothek und schließt eine Bekanntschaft
Wie zum Teufel sollte er sich rasieren! Fredric mühte sich mit dem Rasiermesser ab, versuchte, leicht über die aufgeschürfte Haut, die Risse und Wunden zu fahren. Missmutig starrte er sich selbst im Spiegel an: Zweiunddreißig, nicht ohne Falten. Jetzt war das sonnengebräunte Gesicht durch hellrote, entzündete Bereiche ohne Haut verunstaltet. Blaue Augen, die kindlich aufrichtig wirkten, die aber auch Funken sprühen und schlitzig und hart wie bei einem Huskie werden konnten, wenn ihn etwas aufs Blut reizte. Aber hinter all diesen Zügen lauerten Humor und Gelächter. Sein Lachen war Fredrics einzige Waffe, mit der er aber viele Duelle gewonnen hatte.
Seinen Spitznamen – »Pilger« – hatte er sich nach der unglückseligen Geschichte mit der berühmten Schauspielerin Mia Munch zugezogen. Grün hinter den Ohren und unerfahren im Liebesleben, war er leicht zu erobern gewesen. Sie hatten sich bei irgendeiner Party getroffen, und als er ehrlich und ohne Hintergedanken von seinem ruhelosen und erlebnisreichen Leben erzählt hatte, erklärte sie laut und deutlich: »Ich habe meinen Pilger gefunden.« Sofort danach druckte ein größeres Boulevardblatt Bilder und die Überschrift: »MIA MUNCHS NEUER FREUND: DER PILGER«. Mit einem einfältigen, aber aufrichtigen Lächeln stand er da, den Arm um sie gelegt, und entblößte sich vor ganz Norwegen. Drei Monate später sprang Mia Munch in die Arme eines anderen Mannes. Aber der Name »Pilger« blieb an ihm kleben.
Das war jetzt fast drei Jahre her. Damals hatte es die »Kasserolle« noch nicht gegeben. Aber die Erinnerung brannte immer noch in Fredric Drums Seele. Denn Frauen gegenüber war er schüchtern, aber nicht abweisend. Insgeheim nährte er einen Traum von einer zarten und feinen Romanze.
Der Weg zurück nach St. Emilion war nicht leicht gewesen, sein Körper hatte bei jedem Schritt wehgetan. Und die Blicke der Leute, denen er begegnet war: Einfacher und unmissverständlicher Abscheu lag in diesen Blicken. Ein Krawallmacher, der eine Prügelei hinter sich hatte, erweckte keine Sympathie. Der Empfangschef im Hôtel de Plaisance, in dem er wohnte, war eine Ausnahme, wahrscheinlich, weil er Fredric schon vorher gesehen hatte und weil das Hôtel de Plaisance ein Fünfsternehotel war. Dort wohnten keine Krawallmacher.
»Accident?«, hatte er mit weit aufgerissenen Augen gefragt.
»Oui«, hatte Fredric geantwortet, »un grand accident.« Und er hatte sich beeilt, auf sein Zimmer zu kommen.
Erledigt. Das war erledigt.
Er hatte mehrere Stunden geschlafen. Hatte geduscht, seine Wunden versorgt und neue Kleider angezogen. Es war Dienstag, der 2. Oktober, Viertel nach fünf. Was er noch nicht wissen konnte: Der Tag sollte in die Lokalgeschichte eingehen. Es war la date de vintage. Die Trauben waren reif. Die Lese konnte beginnen. Dieser Termin wurde von Spezialisten fast auf die Stunde genau bestimmt. Zwei Tage zu früh wäre eine Katastrophe. Zwei Tage zu spät genauso.
Er wollte jetzt abschalten, sich gründlich entspannen.
Er war mit seiner Rasur zufrieden und setzte sich an den Schreibtisch. Jetzt wollte er Wein und Weinkeller eine Zeit lang vergessen. Jetzt wollte er ein paar schöne Stunden mit seinem Hobby verbringen. Es gab keine bessere Erholung als ein gutes Hobby. Und das hatte Fredric Drum.
Er hatte eine militärische Ausbildung als Dechiffrierungsexperte gemacht. Schon seit seiner Kindheit war er von Geheimschriften, Codes und Bilderrätseln fasziniert gewesen. Und als er zum Militärdienst einberufen wurde, bekam er die Chance, sich in diesem Fach ausbilden zu lassen. Aber das Knacken von Militärcodes war für Fredric Drum auf die Dauer nicht zufriedenstellend. Es wurde zu eindimensional, ohne Spannung. Er nahm sich andere Herausforderungen vor. Nach einigen Jahren Sprachstudium an der Universität spürte er, dass er ein Fundament für eine bestimmte Fähigkeit gelegt hatte: Er wollte es sich zur Aufgabe machen, bisher ungedeutete Ursprachen zu entschlüsseln.
Zuerst machte er sich über die Bildersprache der Mayas her. Hier war es den Forschern bisher nur gelungen, die Zahlen von eins bis zehn zu erraten. Mit champollionischem Eifer und Fleiß reiste er ein ganzes Jahr durch Mittelamerika, studierte Inschriften und verglich sie. Diego de Landas »Relación de las cosas de Yucatán«,