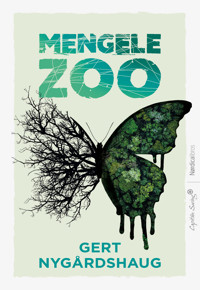Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gert Nygårdshaugs preisgekrönter Öko-Thriller, der immer noch aktuell ist: Mino wächst im lateinamerikanischen Regenwald auf. Doch nicht nur der Wald ist vom Kapitalismus bedroht, sondern auch die indigene Bevölkerung. Als Minos Familie von den Hintermännern großer Ölkonzerne getötet wird, flieht er, und seine lange Reise beginnt. Aber seine Rachegedanken werden immer stärker, und schließlich wird Mino der Anführer einer gefürchteten Terrororganisation, die für den Naturschutz bereit ist, über Leichen zu gehen...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gert Nygårdshaug
Mengele Zoo
Übersezt von
Saga
Mengele Zoo
Übersezt von
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1989, 2021 Gert Nygårdshaug und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726741193
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Wenn ich an die seltsamen Tage tief in den Regenwäldern Venezuelas und Brasiliens zurückdenke, denke ich auch an den Canaima-Indianer Thomas, der mit bescheidener Zurückhaltung jeden Abend am Lagerfeuer die unglaublichsten Geschichten erzählte, nachdem er seine Piroge an Land gezogen hatte. Geschichten über die Selva, den großen Urwald, der nun langsam stirbt.
Ich erinnere mich an viele Gespräche bei einem Glas Rum in der Stalingrad-Bar in der armen Küstenstadt Cumana. Hier wurde immer noch darüber spekuliert, was aus dem legendären englischen Kapitän Percy Fawcett geworden ist, der auf der Suche nach alten Kulturen vor über fünfzig Jahren spurlos im Dschungel südlich des Rio Xingu verschwand – Fawcett, der über hundert indigenen Indianerstämmen, von denen heute nur noch knapp zehn existieren, einen Namen gab.
Die Gewalt gegen den Regenwald und seine Bewohner ist unbeschreiblich und in der wirklichen Welt sogar noch grausamer, als es je ein Roman vermitteln könnte. Niemand kann sich die daraus entstehenden Konsequenzen vorstellen.
In diesem Buch vermische ich bewusst portugiesische, spanische und indigene Begriffe, um die Aufmerksamkeit des Lesers nicht auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Gegend des Kontinents zu lenken, wo große Teile der Handlung spielen. Die Namen der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten sind authentisch.
Straumen, 22.11.1988
Gert Nygårdshaug
1
Weiß wie das Innere der Kokosnuss
Der Magnolienhügel auf der südöstlichen Seite des Dorfes leuchtete goldgrün in der tief stehenden Abendsonne, und eine feuchte, kaum merkliche Brise trug das leicht bittere Aroma von Kampfer mit sich. Jacaranda-Bäume standen in voller Blüte und glichen porzellanblauen Leuchttürmen, die von den Geiern und Kolibris bis zu den Tukanen mit ihren neugierigen Schnäbeln sämtliche Vögel anlockten.
Ein Schwarm Statiras – Zitronenfalter – stob nach einem kräftigen Nachmittagsschauer aus der Deckung und flatterte zum Dorf hinüber, vom starken Duft des Blumen- und Gemüsemarktes angelockt. Wie Dampf stieg die Hitze aus dem Regenwald.
„Hau ab, Kleiner, sonst ruf ich die Obojo- und Kajimi-Geister, damit sie nachts unter deine Decke kriechen und dich mit ihren Pfeilen vergiften!“ Ein dünner, alter Kokosverkäufer schlug mit seinem zerlumpten Hut nach einem barfüßigen, halbnackten Jungen, der mit frechem Lachen davonflitzte.
Mino Aquiles Portoguesa war sechs Jahre alt und hatte schon fast keine Milchzähne mehr. Er versteckte sich einer riesigen Platane, hatte jedoch eigentlich kein bisschen Angst vor dem Kokoshändler. Der alte Eusebio mit seinem Handkarren machte überhaupt keinem der Kinder Angst, obwohl er grantig und verbissen seine Ware verteidigte, sobald die Jungen diesem Wagen zu nahe kamen. Sie wussten, dass Eusebio im Grunde seines Herzens ein guter Mann war. Mehr als einmal hatte er ihnen schon eine ganze Kokosnuss geschenkt. Und das konnte man nicht von vielen Verkäufern behaupten.
„Minolito! Schau mal, was wir gefunden haben!“, rief Lucás, ein Freund des Jungen.
Mino sprang hinter der Platane hervor und lief zu einem Stapel alter Gemüsekisten, die in einer Ecke des Marktes standen. Lucás, Pèpe und Armando stocherten mit Ästen in einer Kiste braun vergammelter Kohlblätter herum. Mino sah hinein.
„Sapito“, rief er. „Eine kleine weiße Kröte! Sie versteckt sich unter den Kohlblättern. Lass sie in Ruhe, Armando!“
Armando, der mit zehn Jahren schon fast erwachsen war, warf den Stock beiseite. Dafür zog er eine Schnur aus seiner Hosentasche und knüpfte sie gekonnt zu einer Schlinge.
„Wir hängen sie auf und erschrecken die Kokoshändler damit, bis sie wegrennen. Die ist giftig, sag ich euch! Mein Großvater ist einmal fast gestorben, als er so ein Vieh angefasst hat.“ Armando senkte die Schlinge langsam über den Kopf des Tieres und zog sie dann mit einem Ruck stramm.
Lucás, Pèpe und Mino wichen erschrocken zurück. Die Kröte baumelte und zappelte mit den Hinterbeinen, und ihre glasigen Augen bekamen einen matten Schimmer. Armando zitterte vor Freude und lachte wild, während er das Tier weit von sich streckte. Plötzlich machte die Kröte eine jähe Bewegung und klatschte gegen Armandos nackten Unterschenkel. Der Junge heulte auf und ließ die Kröte fallen, die unter die Gemüsekiste floh.
Auf Armandos Bein bildete sich ein roter Fleck, als hätte er sich an einem Mujare-Busch verbrannt. Lucás, Pèpe und Mino starrten mit aufgerissenen Augen auf den Fleck und warteten darauf, dass er zu dampfen anfing, bevor er sich über Armandos Bein bis zur Leiste und weiter hinauf über Bauch und Brust ausbreitete. Bald würde Armando brutzeln und brodeln wie ein hellrotes Spanferkel überm Feuer – und dann wäre er tot.
Alle wussten, dass die weißen Sapos gefährlich waren.
Doch der Fleck wurde nicht größer und Armando nicht blasser. Bald hatten seine Wangen die gewohnte Farbe zurück, und seine Augen wirkten so trotzig wie vorher.
„Mist“, sagte er und trat gegen den Kistenstapel, unter dem die Kröte sich verkrochen hatte. „Mist. Ich lauf zur Pumpe und wasch das ab. Dann such ich mir ein paar fette Kokosschalen und bring sie heim zu Mama Esmeralda.“ Wie ein Wirbelwind sauste er zwischen den Gemüsehändlern hindurch und verschwand hinter der Platane. Pèpe lief ihm nach.
„Heute Nacht stirbt er“, sagte Lucás und griff nach Minos Arm. Die beiden Sechsjährigen sahen einander ernst an und nickten.
Vorsichtig näherte sich Mino dem Waldrand. Seine nackten Füße sanken tief in den rotbraunen, matschigen Boden ein, auf dem Pater Macondo vergeblich versucht hatte Taro anzubauen. Die welken Büsche hingen verloren über dem nährstoffarmen Morast, den man kaum als Erde bezeichnen konnte. Der Regenwald umgab das Dorf und legte einen Gürtel aus stinkendem Moor zwischen sich und den schmalen Streifen urbares Land. Pater Macondo aber pflanzte und pflanzte und gab nicht auf.
Mino blieb stehen und hob einen Zweig auf, der von einem der Baumriesen gefallen war und die Form eines Ypsilons hatte. Er eignete sich perfekt. Der Junge nahm ein Moskitonetz aus der Tasche, das zu einem Beutel vernäht war und aussah wie eine lange Wurst mit offenen Enden. Das zog er geschickt über die beiden Spitzen des Zweiges und hatte im Nu einen erstklassigen Schmetterlingskescher. Hier, dicht am Dschungelrand, konnte man die schönsten Mariposas fangen.
Sein Vater hatte ihm gesagt, dass er heute zwei große blaue Morphos brauche.
Mino dachte an die Kröte, an der sich Armando verbrannt hatte, und daran, dass sein Freund inzwischen sicher an hohem Fieber litt. Da es im braunen Morast viele dieser Kröten gab, achtete er auf jeden seiner Schritte.
Ein großer, orangefarbener Argante flog vorbei und ließ sich auf einem verwelkten Tarostrauch nieder. Mino kannte die Namen der meisten Falter im Regenwald, hatte ihm sein Vater doch alles aus dem großen Schmetterlingsbuch beigebracht. Vorsichtig pirschte er sich an die Pflanze heran und senkte den Kescher mit einem Ruck über das Insekt. Mit seinen geübten Fingern drückte er es über der Brust zusammen. Gerade so fest, dass er es nicht zerquetschte, sondern nur betäubte. Er zog eine kleine Blechdose aus der Hosentasche und sperrte den Schmetterling zusammen mit einem in Äther getränkten Wattebausch darin ein, der ihn allmählich tötete.
Jedes Mal wenn Mino mit dem Kescher loszog, fühlte er sich wie ein Jäger – dann war er ein großer Jäger. Keiner seiner Freunde durfte mitkommen, wenn er für den Vater Schmetterlinge fing, denn in seiner Tasche steckte eine tödliche Waffe: die Blechdose mit dem giftigen Gas. Wenn sie auf die Jagd gingen, hatten sein Vater und er ein geheimes Ritual. „Minolito“, sagte der Vater dann und schob ein schwieriges Wort hinterher: „Ethylacetat“. Mino musste es wiederholen, dann nickten sie einander zu. Der Vater schlich ins Badezimmer und stahl einen winzigen Wattebausch aus der obersten Kommodenschublade der Mutter. Wieder nickten sie einander zu, und Mino folgte ihm in den Schuppen. Verborgen hinter einem Brett unter dem Dach – so weit oben, dass der Vater sich auf eine Kiste stellen musste – stand die Flasche mit den „Todestropfen“. Der Wattebausch wurde mit nur wenig Flüssigkeit beträufelt und sofort in der Dose verschlossen. Seine todbringende Wirkung hielt über viele Stunden an.
Inzwischen hatte Mino die ersten Bäume erreicht und sah sich wachsam um. Wenn er Morphos finden wollte, musste er in den Dschungel hineingehen, denn die schönen metallblauen Schmetterlinge gab es nur dort. Sie waren schwer zu fangen und flogen oft zu hoch für Minos Kescher. Ab und zu ließen sie sich jedoch auf dem Boden der Waldlichtungen nieder, wo er sich an sie anschleichen konnte.
Der Junge wusste, dass jetzt die richtige Zeit für die Jagd auf die Morphos war – später Nachmittag, in einer Stunde würde es dunkel. Genau dann geschah es oft, dass die Schmetterlinge aus den Baumkronen wie glänzende, blaue Flocken herabschwebten. Und für einen blauen Morpho bekam der Vater den zehnfachen Preis eines Statiro oder eines Argante.
Der Urwald war still und klamm. Von den vermoderten Blättern unter seinen Füßen stieg Dampf auf. Winzige Frösche und grellgrüne Leguane flohen erschrocken. Mino liebte den Dschungel. Er spürte keine Angst, obwohl es dämmerte und die riesigen Bäume etwas Bedrückendes an sich hatten. Er ging immer nur so tief hinein, dass er die Rufe und den Lärm des Dorfes noch hören konnte.
Er war ein kleiner Jäger. Nein, er war ein großer Jäger, wie die Obojo- und Kajimi-Indianer vor fünfzig Jahren. Sie hatten damals Giftpfeile benutzt, hatte Armando erzählt, und erselbst hatte nun giftiges Gas in der Tasche. Wäre die Blechdose groß genug, hätte er sicher auch Cerrillos, Nabelschweine, und Armadillos, Gürteltiere, fangen können. Die lebten jedoch viel tiefer im Dschungel.
Mino erwischte einen Morpho, dann einen zweiten und kurz bevor es dunkel wurde sogar einen dritten. Er war größer als Minos Hand und fand auch mit gefalteten Flügeln kaum Platz in der Dose. Sein Vater würde ihn bestimmt auch einen großen Jäger nennen.
Er hüpfte und rannte durch den Morast und vergaß dabei die weißen Kröten. Im Zickzack lief er durch Señor Gomeras Tomatenfeld und sprang über Señora Serratas üppige Maniokpflanzen. Bald erreichte er die Platane, wo er das Bündel mit den Kokosschalen versteckt hatte, die er am Nachmittag neben den Wagen der Händler aufgelesen hatte. Dann sah er Mama Esmeralda, die schluchzend auf den Markt gelaufen kam und ein schwarzes Tuch schwenkte.
Da wusste er: Armando war bereits tot.
Bevor Pater Macondo den Spaten hob und etwas rostbraune Erde über Armandos tief im Boden ruhenden Sarg rieseln ließ, sagte er:
„Die kleinen Herzen, die plötzlich aufhören zu schlagen, schlagen weiter vor Gott. Und das Blut, das durch ihre Adern fließt, sprudelt wie ein klarer Bergbach vor lauter Glück. Armando ist jetzt im Himmel. Dort gibt es keine Tränen und keine Lumpen. Kein Hunger nagt wie gierige Ozelots an den Bäuchen kleiner Kinder. Von dort oben lacht Armando zu uns herab, zu uns armseligen Geschöpfen, die wir unfruchtbare Erde bebauen. Aber auch unsere Zeit wird kommen.“
Mino umklammerte die Hand seines Vaters und dachte an Pater Macondos verwelkte Taropflanzen. So tief wie Armando jetzt in der Erde lag, würden sicher weder Ameisen noch Käfer an ihn herankommen. Dann dachte er an die weiße Kröte, und ein Schauer lief ihm über den Rücken.
„Papa“, flüsterte er, „sind die Kröten giftiger als das Ethylacetat?“
„Psst“, Sebastian Portoguesa legte Mino sacht die Hand auf den Mund.
Erneut streute der Pater Erde, und Armandos Großmutter, die alle Mama Esmeralda nannten, schluchzte. Wo seine Eltern waren, wusste niemand im Dorf.
Als die Beerdigung fast vorüber war, sah Mino einen Schwarm scharlachroter Ibisse zum großen Fluss hinüberfliegen. Der Arzt hatte gesagt, das Gift der Kröte sei nicht wirklich gefährlich gewesen, Armandos Herz sei vor Angst stehen geblieben. Der Junge habe sich so gefürchtet, dass es aufgehört habe zu schlagen und das Blut nicht mehr durch den Körper geflossen sei.
„Papa, warum haben Schmetterlinge kein Blut, haben sie etwa kein Herz?“ Mino hielt noch immer die Hand seines Vaters, als sie im Schatten der Zimtbäume verschwanden. Sie säumten den Friedhof und die kleine weiße Kirche mit den zwei Türmen und verströmten einen frischen Duft.
Das Haus, in dem Mino wohnte, war nicht sehr groß. Es lag am Dorfausgang an einem kleinen Bach, in dem das Wasser meist stand und nur zur Regenzeit über die Ufer trat. Dann erreichte es fast die Tür von Señora Serrata, der Nachbarin. Minos Großvater hatte das Haus, dessen Dach aus rostigen Wellblechplatten bestand, aus Lehm, Stroh und Baumstämmen erbaut. Es war eines der schönsten im Dorf, weil Sebastian Portoguesa mindestens zweimal im Jahr Kalk und Farbe in Señor Riveras Venda holte. Dann band Minos Mutter kleine und große Pinsel aus Tarapo-Federn zusammen, und die ganze Familie strich und kalkte das Haus, während sie improvisierte Texte zu Bolívars Balladen sangen. Tèofilo, Minos jüngster Bruder, der für diese Arbeit noch zu klein war, wurde währenddessen an einem Kleiderständer festgebunden, damit er nicht umfiel oder aus den Kalkeimern trank. Minos Mutter Amanthea, seine Zwillingsschwester Ana Maria und sein vierjähriger Bruder Sefrino arbeiteten mit Feuereifer, nur sang die Mutter nicht. Seit über einem Jahr war kein Laut mehr über ihre Lippen gekommen.
Sebastian Portoguesa lebte vom Präparieren und Verkauf von Schmetterlingen. In der Provinzhauptstadt, die zwanzig Minuten flussabwärts lag, hatte er einen Kontakt, der jede Woche eine Lieferung mit dem Regionalbus entgegennahm. In kleinen Plastikschachteln, die Sebastian im Laden von Señor Rivera bekam und die früher einmal mit Süßigkeiten gefüllt gewesen waren, fixierte er die schönsten Schmetterlinge: vollkommene Geschöpfe, die in den unglaublichsten Farben und Mustern strahlten. Er nannte sie Engel des Dschungels und wurde gut für sie bezahlt. Weil Ana Maria und Mino zusätzlich die Kokosschalen neben den Marktständen aufsammelten, schafften sie es, den Hunger fernzuhalten, auch wenn selten Fleisch oder Fisch in Amanthea Portoguesas Töpfen kochte. Die Familie besaß jedoch ein Schwein, sieben Hühner und zwei zahme Hokkos, Dschungelhühner, die sich Tag für Tag mit Maniokschalen und Reistöpfen fett fraßen.
Stundenlang konnte Mino neben dem Vater sitzen und die präparierten Schmetterlinge betrachten. Es wurde ihm nie langweilig, die Handgriffe des Vaters zu beobachten, mit denen er die Falter über das Spannbrett zog, ohne die zarten Flügel mit den Fingern zu berühren. Er benutzte Nadeln, Pinzetten und durchsichtiges Papier, das er über die Schmetterlingsflügel legte. Die Flügel selbst durchstach er nie, bevor er jedoch mit der Präparation begann, bohrte er eine lange, dünne Nadel durch die Brust des Insekts – den Thorax, wie er es nannte. Dann wurde das Tier auf dem Spannbrett befestigt und die Flügel vorsichtig in die richtige Position geschoben. Sobald alles perfekt war, legte er die Fühler in ein schönes, symmetrisches V. Mino wusste, dass dies der kritischste Augenblick der Präparation war. Zerbrach ein Fühler, war der gesamte Schmetterling wertlos. In solchen Momenten konnte der Vater vor Wut explodieren, und Mino hielt jedes Mal den Atem an, wenn die Fühler an der Reihe waren. Hatte der Vater ein besonders seltenes Exemplar vor sich, wagte Mino nicht einmal, ihm zuzusehen. Dann verzog er sich lieber hinter den Schuppen und wartete auf das Donnerwetter. Blieb es aus, ging er schnell wieder hinein und lachte den Vater an, der selbst über das ganze Gesicht strahlte und das Spannbrett ins Licht hielt: Ein Pseudolycaena marsyas! Ein Morpho montezuma! Oder gar ein Parides perrhebes! Mino kannte all ihre lateinischen Namen, es waren spannende, geheimnisvolle Wörter.
Mindestens eine Woche musste der Schmetterling trocknen, bevor er in eine Plastikschachtel mit Korkboden platziert wurde. Über den Korkboden legte der Vater ein Stück weißes Papier, auf das die Mutter mit ihrer eleganten Handschrift Name und Gattung des Exemplars geschrieben hatte. Sie hatte die schönste Schrift in der Familie.
Mino und sein Vater waren sich einig: Etwas Vollkommeneres als einen Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln, gefangen in ewiger Unbeweglichkeit, hatten sie noch nie gesehen.
Der Vater hatte Mino und Ana Maria das Lesen beigebracht. Es hätte längst ein Lehrer ins Dorf kommen sollen, hatten die Behörden versprochen, doch bisher war das nicht geschehen. Mino konnte laut und fließend aus dem großen Schmetterlingsbuch vorlesen. Am Abend aber, vor dem Einschlafen, setzte der Vater sich manchmal auf die Bettkante und erzählte vom Leben der Falter: von ihrer Entwicklung vom Ei zur Larve zur Puppe und schließlich zum ausgewachsenen Insekt. Das letzte Stadium war in der Regel das kürzeste und dauerte selten länger als zwei Monate; dafür konnte der Falter in dieser kurzen Zeit allerhand erleben.
Die Mutter stand in der Tür und hörte mit traurigem Lächeln zu. Kein Wort kam über ihre Lippen.
Niemand im Dorf verstand, wie Sebastian Portoguesa auf die Idee mit den Schmetterlingen gekommen war und woher er wusste, wie man sie präparierte. Aber alle fanden, er habe sich einen vernünftigen und respektablen Broterwerb gesucht. Armut und Arbeitslosigkeit klebten an den meisten von ihnen wie zähes Harz: Es war unmöglich sie loszuwerden. Und keiner von Minos Spielgefährten hänselte ihn, wenn er seine täglichen Ausflüge mit dem Kescher unternahm. Er war ein einsamer, aber respektierter Jäger.
„Warum fällen wir die Bäume nicht, die uns im Licht stehen? Warum töten wir die Schmeißfliegen nicht mit Feuer und Paraffin? Haben wir hier im Dorf denn kein Rückgrat? Sind wir denn nicht mehr wert als der Kohl, der in den Stiegen vergammelt? Seht euch Señor Tico an. Er hat eine scharfe Machete an seine Krücken montiert, die er jedes Mal gegen Caburas Hals richtet, wenn der sich auf den Markt traut! Ist Señor Tico als Krüppel der einzige mutige Mann hier im Dorf? Ihr habt gehört, was Pater Macondo gesagt hat: Die Gutsbesitzer oben in der Savannekaufen Maschinen, die größer sind als unsere Kirche und schneller arbeiten als Tausende caboclos. Die haben uns das Land genommen, und nun nehmen sie uns die Arbeit. Wir sind nur noch stinkender, gammliger Kohl. Wir sind Ungeziefer, das sich verkriecht, wenn man ihm auf den Schwanz tritt!“
Der Kokoshändler, der neben Eusebios Handkarren seinen Stand hatte, stand auf ein paar Gemüsekisten und fuchtelte wild mit den Armen. Sein Redeschwall, der sich über den Markt ergoss, kurz bevor alle zusammenpackten, um Siesta zu machen, erntete großen Beifall. Der alte Eusebio wedelte mit seinem Hut, und sein zahnloser Mund lachte in der Sonne. Er zog eine Flasche Aguardiente hervor, trank einen großen Schluck und reichte sie dem Redner.
„Mehr, Gonzo, mehr! Es lebe Tico mit der Machetenkrücke!“
„Armseliges Gewürm!“ Señor Gonzo musste vom starken Zuckerrohrschnaps husten, fuhr aber fort: „Hat uns die Regierung nicht Arbeit, Essen und Schulen versprochen? Und was haben wir? Nichts! Unsere Häuser sinken immer tiefer in den Schlamm, der Putz bröckelt von den Wänden, und die Balken verrotten! Unsere Äcker sind ausgelaugt, und in unseren frisch gepflanzten Bäumen sitzt der Schimmel. Ihre Rinde ist grün und sie tragen keine Früchte mehr. Sobald du einen neuen fruchtbaren Flecken Erde findest, sind die Gutsbesitzer mit ihren feinen Papieren und besiegelten Dokumenten zur Stelle, und die Armeros setzen dir die Gewehrmündungen zwischen die Augen und führen dich in Ketten zu den Rattenlöchern in die Hauptstadt! Was wurde denn aus Señor Gypez? Oder Señor Vasques und seinem Sohn? Nachdem man sie gezwungen hatte, Caburas Pisse zu trinken, hat man sie auf einen Lastwagen verfrachtet und fortgeschafft! So ist es immer, und wir stecken unsere Köpfe in den Schlamm, der mit jeder Regenzeit tiefer wird.“
Mino kletterte auf die Friedhofsmauer unter den Zimtbäumen, um das Spektakel auf dem Markt besser sehen zu können. Lucás machte es ihm nach, nachdem er seine Schildkröte sicher zwischen zwei Steine in die Mauer gesetzt hatte.
„Señor Gonzo ist schon wieder wütend. Er steht auf einer Stiege und fuchtelt mit den Armen“, flüsterte Mino.
„Señor Gonzo ist nicht wütend. Ich weiß es, ich hab gestern noch eine schöne, große Nuss von ihm bekommen“, widersprach Lucás bestimmt und kniff die Augen zusammen, um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen.
„Auf uns ist er ja auch nicht wütend, sondern auf Cabura, das Schwein.“
„Auf Cabura sind ja alle wütend.“
„Komm!“, rief Mino und sprang von der Mauer. „Wir schleichen uns bis vor seine Stiege. Vielleicht kriegen wir eine Nuss, wenn wir Beifall klatschen.“
Aber Lucás blieb auf der Mauer sitzen. Er hatte Angst, ihm könnte jemand in der dichten Menschenmenge auf den Zeh treten, der nach einem Biss von Señora Serratas Katze angeschwollen war.
Mino schlängelte sich durch die grölenden und wild gestikulierenden Gemüse- und Kokoshändler und stand bald neben Señor Gonzos Podest. Er klatschte eifrig in die Hände und hoffte, dass ihn der Redner bemerkte. Der aber ließ seinen Blick über die Menschenmenge schweifen, weit über Minos Kopf hinweg, berauscht von seinen Worten, dem eigenen Mut und davon, dass er Schluck für Schluck aus der Flasche des zahnlosen Eusebio nahm. Die Rede wurde immer dramatischer.
„Was machen wir mit Schweinen, die ihre Jungen fressen, na? Ganz genau, wir holen das größte und beste Küchenmesser und rammen es ihnen in den fleischigen Hals, bis ihr verpestetes Blut über den Boden schäumt. Und dann hängen wir den Kadaver über einen Ameisenhaufen im Dschungel. Oder etwa nicht, hm? Das nächste Mal, wenn ich an Caburas Schlangennest von einem Büro vorbeikomme, rotze ich ihm direkt vor die grünen, verseuchten Armeestiefel. Ich werde seinen Karabiner wegstoßen, ihm jedes seiner giftig gelben Nasenhaare ausreißen und ihm klarmachen, dass wir seine Americano-Lakaien nicht brauchen, um das Land zu schützen, das unsere Eltern dem Dschungel abgerungen haben!“
Plötzlich applaudierte niemand mehr. Jubel und Geschrei verstummten, und eine Unheil verkündende Stille legte sich über den Marktplatz. Verwirrt sah der Redner sich um, und sein Blick blieb an einem Punkt links neben der Platane haften. An dieser Stelle wich die Menschenmenge zurück, und drei Männer in gelb-burgunderroten Uniformen samt Bandolieren und geschulterten Karabinern marschierten geradewegs auf Señor Gonzo zu, dessen Gesicht eine graubleiche Farbe annahm. Er machte hilflose Kaubewegungen, und seine Augen begannen sich mit Tränen zu füllen.
Mino umklammerte das Bein des erstbesten Gemüsehändlers, als er begriff, wer dort anrückte. Es war Sargento Felipe Cabura persönlich in Begleitung zweier seiner Soldaten. Los armeros.
Señor Gonzo stand völlig regungslos auf der Stiege und hatte eine Haltung angenommen, die der Schwerkraft und anderen Naturgesetzen zu trotzen schien: Seine Arme und ein Fuß waren auf dem Weg nach unten, aber er stand so ungeschickt, dass ein sicherer Abstieg unmöglich war. So verharrte er einen Augenblick, den jeder im Nachhinein als eine Ewigkeit empfand.
Felipe Cabura trat die unterste Stiege mit einer solchen Wucht fort, dass Señor Gonzo rücklings in Eusebios Handkarren fiel und zwischen den glatten, grünen Kokosnüssen liegen blieb. Das Weiß seiner Augen war zum gnädigen blauen Himmel hinauf gerichtet. Felipe Cabura ging zum Handkarren hinüber, nahm den schweren Karabiner, den er bei sich trug, und stieß mit aller Kraft zu. Der Kolben traf eine Nuss. Sie zerbarst und ein Sprühregen grauglänzender Kokosmilch ergoss sich über die umstehenden Zuschauer.
„Frische Kokosnuss“, sagte er und setzte den Karabiner erneut zu einem gewaltigen Stoß an.
Diesmal traf es eine Nuss links neben Señor Gonzos Kopf; Kokosmilch spritze heraus.
„Noch eine frische Nuss!“
Der dritte Stoß von Felipe Caburas Karabiner landete mit ungeheurer Wucht mitten auf Señor Gonzos Nase; rote Tropfen regneten auf die Gemüsehändler nieder.
„Vergammelte Nuss“, sagte Cabura, wandte sich um und marschierte mit seinen Soldaten auf demselben Weg wieder ab, den sie gekommen waren. Señor Gonzos magere Beine ragten in den letzten Todeskrämpfen aus dem Handkarren.
Mino ließ das Bein des Gemüsehändlers los und rannte so schnell er konnte davon. Er stolperte, fiel, stand wieder auf und rannte weiter bis er den Arbeitstisch seines Vaters im Schatten des Bananenbaums erreicht hatte. An ein paar Leinen daneben hängte die Mutter gerade Wäsche auf.
„Cabura, das Schwein, hat Señor Gonzos Kopf geknackt wie eine Kokosnuss“, stammelte der Junge atemlos.
Sebastian Portoguesa sah seinen Sohn geistesabwesend an. Er legte das Spannbrett mit einem halb fertig präparierten Anartia zur Seite und nahm Mino auf den Schoß.
„Minolito“, sagte er.
Als er den Stakkato-Bericht seines Sohnes angehört hatte, stand er auf und ging zum Markt hinüber. Es dauerte zwei Stunden, bis er zurückkam. Dann saß er lange da und stocherte in einem Teller dampfender, mit Chili und grünem Pfeffer gewürzter Mungobohnen und Maniok herum, den Ana Maria vor ihn hingestellt hatte. Seine Frau Amanthea, die ihm vier hübsche und gesunde Kinder geboren hatte, stand in der Tür und starrte verstört auf den festgetretenen Erdboden.
„Wo ist Minolito?“, fragte er mit gebrochener Stimme.
„Spielt hinter dem Schuppen mit Tèofilo und Sefrino“, antwortete Ana Maria.
„Heute Abend erzähl ich euch das Märchen vom Obojo-Häuptling und Mariposa Mimosa“, sagte der Vater.
„Jenseits des großen Flusses, hinter den fernen Hügeln, tief in der Selva, dem großen Urwald, lebte einst der mächtige Obojo-Häuptling Tarquentarque. Er hatte sieben Frauen und vierunddreißig Söhne, aber nicht eine einzige Tochter. Deshalb saß er jeden Abend am Feuer, bemitleidete sich und trank riesige Schalen mit vergorenem Kassave, die ihm seine Frauen und die unzähligen Söhne in einem fort reichten. Am Ende war sein Bauch so prall und schwer, dass er bis zum Boden hing. Wie einen Sack zog ihn der Häuptling hinter sich her, wenn er zum Fluss hinunterging und sich auf eine Mangrovenwurzel setzte. Dort konnte er nächtelang sitzen und sich bedauern, während sein Bauch unter die Wasseroberfläche tauchte und große Piranhaschwärme anlockte, die gierig versuchten, Löcher in den verführerisch dicken Wanst zu nagen. Die Haut seines Bauches aber war so zäh und fest, dass die pfeilspitzen Zähne der Piranhas sie nicht durchdringen konnten. So saß Tarquentarque Abend für Abend, Nacht für Nacht da und trauerte, weil er keine Tochter hatte.“
Mino blinzelte. Die Stimme des Vaters war ruhig und gleichmäßig, und die vertrauten Abendgeräusche aus dem Dschungel hundert Meter hinter dem Haus legten sich wie eine Schlaf bringende, wohlige Decke über die drei Kinder, die sich in dem breiten Familienbett aneinanderschmiegten. Tèofilo hatte seine eigene Kiste in einer Ecke und schlief schon.
Mino schloss die Augen und sah das grässliche Antlitz von Sargento Felipe Cabura vor sich, als dieser mit dem Gewehrkolben in Eusebios Handkarren stieß. Kokosmilch und Blut. Bald aber verschwand das Bild, und die lebendige Schilderung des Vaters, von den Sorgen des Dschungelhäuptlings und Mariposa Mimosas flirrender Schönheit, die den Häuptling in ihren Bann zog, brannte sich in die Vorstellungswelt des Sechsjährigen ein und vertrieb die schlimmen Erlebnisse des Tages.
Als Sebastian Portoguesa seine Geschichte beendet hatte und das Moskitonetz über dem Bett befestigte, sah er, dass sein Sohn ins Land der Träume entrückt war, ohne dass die quälenden und schmerzhaften Bilder ihn begleitet hatten und ihm böse Fieberträume bescheren konnten.
Er drehte sich zu seiner Frau um, die in der Tür stand. Sie hatte den Haarknoten in ihrem Nacken gelöst, und das blauschwarze Haar fiel ihr über die Schultern und rahmte das weiche, fein geschnittene Gesicht zu einem Bild bodenloser Sorge und erstarrter Begierde. Sie formte die Lippen zu einem lautlosen Wort, als ihr Mann sie an sich zog und ihr zärtlich über den Rücken strich. Seit über einem Jahr ging das nun so.
Mino war fast neun, als er das Geräusch zum ersten Mal hörte. Er folgte gerade einem schönen Feronia zu einer Lichtung im Dschungel. Der hellrosa Schmetterling mit den schwarzen Flecken setzte sich gerne weit oben an die Baumstämme, zu hoch für den Kescher. So musste Mino ein paar Zweige nach ihm werfen, um den Falter aufzuschrecken, sodass er weiterflog und sich vielleicht weiter unten am Stamm niederließ.
Plötzlich hielt Mino inne. Was war das für ein merkwürdiger Ton? Ein tiefes, bedrohliches Brummen, das mal lauter, mal leiser wurde und sich mit den aufgeregten Schreien der Silberreiher mischte, die über ihm durch die Baumkronen flatterten. Das war kein Tier. Es hörte sich an wie eine Maschine oben am Magnolienhügel. Er blieb stehen und lauschte. Ja, das musste eine Maschine sein, aber was hatte eine Maschine hier zu suchen und wie war sie hierhergekommen? Er vergaß den Schmetterling und lief, so schnell er konnte, zurück zur Friedhofsmauer, wo Lucás und Pèpe die Kaiserameisen ärgerten, die stets irgendeiner unerklärlichen Arbeit zwischen den Mauersteinen nachgingen.
Die Freunde saßen auf der Mauer und ließen die Beine baumeln.
„Hört ihr das?“, rief Mino.
„Ja, glaubst du wir sind taub?“
Alle drei standen auf der Mauer und schauten zu den grünen Baumwipfeln hinüber, zu dem Hügel, der den Namen eigentlich nicht verdient hatte und nur eine kleine Anhöhe in der endlosen Waldlandschaft war, auf der Magnolien und Kampferbäume wuchsen. An den wenigen Tagen im Jahr, wenn der Ostwind blies, versammelten sich die Alten im Dorf, die an Bronchitis und Schleimhusten litten, samt ihren Stühlen vor der Kirchenmauer. Dort saßen sie dann mit offenen Mündern und atmeten den heilsamen Duft der Kampferbäume ein, den der Wind herantrug.
Zu sehen war nichts, aber das Brummen schwoll an und ab, rhythmisch und monoton.
„Vielleicht ist ein Flugzeug abgestürzt. Und jetzt liegt es ratternd da und versucht wieder zu starten?“, vermutete Pèpe.
Señora Serrata trat zu ihnen, den Rock voller Tarowurzeln, und blieb erstaunt stehen. Nach ihr kam der Großvater des lahmen Drusilla. Schließlich stand eine ganze Schar Kinder und Erwachsener an der Kirchenmauer und wunderte sich über das merkwürdige Geräusch, das so unvermittelt aufgetaucht war und die tausend anderen Klänge verdrängt hatte, die allen vertraut waren, auch wenn sie sie nicht täglich hörten.
„Das ist sicher Don Edmundo mit irgendeiner Höllenmaschine, die uns zu Tode erschrecken soll!“, piepste ein alter Mann. Don Edmundo lebte in unmittelbarer Nähe des Dorfes und besaß einen beachtlichen Landstrich, der sich von der fruchtbaren Savanne bis hinunter zum Fluss und ein unabsehbares Stück in den Dschungel hinein Richtung Dorf erstreckte. Einmal hatte Don Edmundo behauptet, ihm gehöre auch das Land, auf dem das Dorf selbst errichtet war. Daraufhin hatte es einen riesigen Aufstand gegeben. Sicheln und Macheten waren gewetzt und eine Protestdelegation war in die Provinzhauptstadt geschickt worden. Ein Heer von Kindern und alten Weibern hatten Schweine, Hühner und Maniok als Proviant mitgenommen und sich in Don Edmundos privatem und sehr luxuriösem Pationiedergelassen, wo sie nächtelang Lärm schlugen, bis der einflussreiche Landbesitzer seine unbedachten Worte zurücknahm. Er sah sich gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, das ihm Pater Macondo vorgelegt hatte und in dem festgehalten war, dass er keinerlei Ansprüche auf den Grund und Boden des Dorfes erhob.
Es gab viele und ausschweifende Vermutungen über die Herkunft des rätselhaften Geräuschs. Als aber der Nachmittagsbus auf den Markt fuhr und vor Señor Riveras Laden hielt, nachdem er sich zwanzig Meilen über den kurvigen und matschigen Weg von der Provinzhauptstadt ins Dorf gekämpft hatte, wusste Elvira Mucco, die Tochter von Señor Mucco, der die schönsten Geranien züchtete, Folgendes zu berichten:
Genau dort, wo der Weg sich hinter dem großen Stein am Schlammteich vorbeischlängelte, wo Don Edmundo vergeblich versucht hatte, Señor Rivera und Pater Macondo daran zu hindern, einen Sergata-Baum zu pflanzen, stünden ein paar monströse Maschinen, die Abgase und Dampf in die Luft stießen. Ein Großteil des umliegenden Dschungels sei bereits abgeholzt worden, und es wimmele von Amerikanern mit weißen Plastikhelmen, die grölten und mit Messbändern, Ferngläsern und seltsamen Gerätschaften herumhantierten. Als wäre das nicht genug, hämmere ein fürchterlicher Apparat eine Eisenstange immer tiefer in die Erde. All das hatte Elvira Mucco mit eigenen Augen gesehen, als der Bus fast eine halbe Stunde warten musste, weil ein riesiger Baum vom Weg gehievt worden war. Das Sprechen bereitete ihr Mühe, denn sie war in der Provinzhauptstadt gewesen, um sich alle schmerzenden Zähne aus dem Oberkiefer ziehen zu lassen. Außerdem seien beide Söhne Don Edmundos dort gewesen, gemeinsam mit der Primera Lazzo, erzählte sie weiter. Lächerlich hätten sie ausgesehen, mit Schlamm im Gesicht und ihren weißen Helmen.
Inzwischen hatte sich eine Traube von Menschen um den Bus versammelt, die Elvira Muccos Erzählung lauschten. Pater Macondo drehte die Finger hinter seinem Rücken und wirkte sehr ernst, während Señor Rivera gegen eine Blechbüchse trat und einen Hund aufscheuchte, der im Schatten vor der Treppe der Venda lag. Louis Hencator, der eher besonnene Ersatzbusfahrer, spuckte aus.
„Öl“, sagte Señor Rivera.
„Öl“, erwiderte Pater Macondo.
„Öl“, flüsterten alle, die den Bus umringten.
„Öl“, sagte Mino und stieß Lucás in die Seite.
Das Brummen vom Magnolienhügel hörte nicht auf. Ab und zu hielten die Leute inne und horchten, schauten hinüber und schüttelten die Köpfe.
Eines Tages war plötzlich ein glänzender Stahlturm zu sehen, der aus den Bäumen herausragte und in der Sonne blinkte. Fast alle Dorfbewohner – außer Sargento Felipe Cabura und seinen Armeros – hatten sich an der Friedhofsmauer versammelt. Mino half Pèpe, ein sicheres Versteck für seine beiden Schildkröten zu finden, damit niemand auf sie trat. Die Männer unterhielten sich leise, und Mino sah, wie der Vater mit Señor Hencator und Señor Mucco lebhaft gestikulierte.
„Der Wald gehört dem Dorf!“, sagte Pater Macondo auf einmal laut. „Sie haben haufenweise Bäume gefällt, ohne uns zu fragen.“
„Gerade dort hätten wir ein schönes Tarofeld anlegen können“, sagte ein Gemüsehändler mit Fistelstimme.
„Ja, genau da gibt es auch guten Nährboden für Serenga“, stimmte ihm ein anderer zu.
„Vielleicht bitten wir sie einfach, uns etwas von dem Öl zu abzugeben, das wir dann an die Tankstelle in der Stadt verkaufen können?“, schlug der alte Olli Occus vor.
„Das Öl gehört uns, das ganze Öl!“, behauptete Señor Rivera.
„Nicht so laut“, warnte Pater Macondo und hob beschwichtigend die Hände. „Es gibt vielleicht etwas, was wir tun können. Viele hier im Dorf haben zurzeit keine Arbeit, weil Don Edmundo große Sä- und Erntemaschinen gekauft hat. Vielleicht können wir mit dem Chef der Americanos reden, damit alle, die wollen, dort Arbeit bekommen. Wir könnten sie als Ausgleich für die gefällten Bäume um eine Schule bitten. Auf lange Sicht könnte das Öl, das sie dort oben fördern, unser Dorf vielleicht sogar reicher machen.“
Nach Pater Macondos Worten entstand ein wildes und hitziges Gemurmel. Ziemlich rasch wurde eine Delegation bestimmt, die mit el jèfe americano sprechen sollte. Mit Pater Macondo an der Spitze zogen fünf der Männer los.
Mino und Pèpe hatten all das von der Friedhofsmauer aus beobachtet. Als Mino sich umdrehte, um herunterzuklettern, sah er, wie sich einer von Caburas Männern aus dem Schatten eines Zimtbaumes löste und davonschlich.
Ein prächtiger Morpho peleides flatterte aus einer Baumkrone herab und setzte sich auf einen morschen Stamm gleich neben Mino, der dort mit seinem Kescher stand und Ausschau hielt. Es war fast unmöglich, den Schmetterling mit zusammengefalteten Flügeln zu erkennen. Das Farbmuster auf der Rückseite seiner Flügel fügte sich nahezu perfekt in die umliegende Vegetation ein. Doch Mino hatte ihn entdeckt, noch bevor er gelandet war. Wie eine blau schimmernde Flocke war er herabgeschwebt. Der Junge schlich sich vorsichtig an und schlug mit einer geschickten Bewegung den Kescher über das Insekt. Bald darauf lag es reglos in der Blechdose.
Mino blinzelte und sah zwischen Blätterdach, Baumstämmen und Lianen hindurch. Über dem Dschungel lag ein sonderbares Licht, friedlich und zugleich dramatisch. Es roch intensiv – nach Blumen, vermodertem Laub und Zweigen, nach Erde und Pilzen. Er konnte nur still dastehen, mucksmäuschenstill, und nichts anderes tun als staunen und lauschen: den Hunderten von Vögeln in den Kronen über ihm, dem Summen der Abertausend verschiedenen Insekten, dem Rascheln der unzähligen Echsen, Ameisen in allen Größen beim Herumwuseln im Waldboden, den Käfern, Larven und Spinnen. Nicht ein Baum glich dem anderen, es gab hundert, ja tausend unterschiedliche Arten. Wenn er in der Erde scharrte, kam immer eine neue Farbe zum Vorschein, begleitet von einem neuen, ganz eigenen Geruch.
So viele seltsame Geschöpfe, dachte Mino. So viele schöne Schmetterlinge muss es auf der Welt geben! Ob sie alle in den Büchern seines Vaters standen? Vielleicht gab es viele, die noch niemand entdeckt hatte? Vielleicht würde er eines Tages mit einem besonders schönen Schmetterling nach Hause kommen, der in keinem der Bücher verzeichnet war? Und er wäre sein Entdecker. Was würde sein Vater wohl sagen? Er würde damit eine Menge Geld verdienen! Geld genug, um ein Zimmer anzubauen, sodass Mino und seine Geschwister ihre eigenen Betten bekamen.
Mino träumte. Er sah unbekannte Falter durch die Baumkronen fliegen. Barfuß schlich der Neunjährige immer weiter in den Dschungel hinein.
Sebastian Portoguesa blickte seinen Sohn zärtlich an, als dieser eifrig die Dose mit dem Tagesfang öffnete. Zwei zauberhafte Morphos und viele schöne Heliconidae. Amanthea kam mit einem Teller dampfender Carvera zum Tisch und stellte ihn vor Mino ab. Wortlos strich sie ihm übers Haar und lächelte, als er sich hungrig über das duftende Gericht hermachte.
Stolz betrachtete Señor Portoguesa seinen Sohn beim Essen. Dann wanderte sein Blick hinüber zu seiner Frau.
Fast vier Jahre war es her, seit Amanthea Portoguesa ihren letzten zusammenhängenden Satz gesagt hatte. Im vergangenen Jahr hatte sie zwar ein paar einsilbige Wörter über die Lippen gebracht, mehr jedoch nicht. Sebastian Portoguesa hatte mit seiner Frau zweimal die lange und teure Reise in die Provinzhauptstadt unternommen, um den Medico psicologo aufzusuchen. Nach dem letzten Mal hatte er eine deutliche Besserung bemerkt: Ihre Augen hatten wieder Glanz bekommen, und sie sprach ein paar Worte. In einigen Monaten würde er genug Geld für eine weitere Reise gespart haben. Er wollte, dass seine Frau wieder gesund wurde, nach jenem grausamen und erniedrigenden Ereignis an einem späten Nachmittag vor vier Jahren, das aus Amanthea Portuguesa eine wandelnde Tote mit leerem Blick gemacht hatte.
Sie war mit zwei anderen Frauen, der alte Esmeralda und Señora Freitas, die Straße entlanggegangen, nachdem sie die von den Bäumen gefallenen Anonas eingesammelt hatten. Amanthea hatte einen prächtigen Anona-Baum ein Stück tiefer im Dschungel entdeckt und hatte dort die Früchte aufgelesen. Als sie genug davon gesammelt hatte, eilte sie den anderen nach, die schon auf dem Rückweg ins Dorf waren. Genau in diesem Augenblick kam ein Jeep mit vier Armeros auf der Fahrt in die Provinzhauptstadt an ihr vorbei.
Vor dem Altar in der Kirche, das Kreuz in der rechten Hand an die Brust gedrückt, konnten Señora Freitas und die alte Esmeralda auf Pater Macondos inständige und gebieterische Aufforderung hin Folgendes berichten:
Sie hätten sich nach dem herannahenden Jeep umgedreht. Neben Señora Portoguesa, die mit dem Rock voller Anonas am äußersten Wegrand stand, habe er plötzlich angehalten. Alle vier Armeros seien aus dem Wagen gesprungen und hätten Amanthea umringt, die den Rocksaum hatte fallen lassen, sodass sämtliche Früchte auf den matschigen Weg gerollt waren. Die Männer hätten sie dann zum Jeep gezerrt und festgehalten. Sie hätten ihr alle Kleider ausgezogen und Amanthea auf die Motorhaube geworfen. Während drei sie festgehalten hatten, habe der vierte mit ihr gemacht, was er wollte. So hätten sie sich abgewechselt, bis alle genug hatten. Zuerst habe Señora Portoguesa noch geschrien, doch irgendwann sei sie still gewesen. Als der Jeep weiterfuhr, habe sie nackt am Wegrand gelegen, blutend und stumm. Mit großer Mühe hätten die beiden Frauen die geschändete und schwer verletzte Amanthea zurück ins Dorf und zu ihrem Haus geschleppt.
Das hatte Señora Freitas vor vier Jahren in der Kirche berichtet.
Sebastian Portoguesa seufzte, verscheuchte ein paar aufdringliche Pium-Fliegen und fuhr mit der Präparation der Schmetterlinge fort. Mino hatte inzwischen aufgegessen und bekam den Auftrag, zum Gemüsemarkt zu laufen und die Kokosschalen aufzusammeln, die die Händler beim Einpacken ihrer Stände und Karren zurückließen. Sein Bruder Sefrino, der mittlerweile sechs Jahre alt war, hatte die Beeren eines Turkuesa-Busches gegessen und lag deshalb mit Fieber und Übelkeit im Bett. Minos Zwillingsschwester half der Mutter beim Abwasch, während das jüngste Familienmitglied, der vierjährige Tèofilo, Ameisen zählte und sie mit dem Zeigefinger zerdrückte, sobald sie aus einem Spalt neben der Türschwelle krabbelten.
Auf dem Magnolienhügel dröhnten die Maschinen.
„Dann kam der wunderschöne Mariposa Mimosa geflogen, mit Goldstreifen auf den Flügeln und großen, blauen Fühlern. Er setzte sich auf den Bauch des unglücklichen Tarquentarque und kitzelte ihn mit den Flügeln. Der Obojo-Häuptling versuchte ihn zu verscheuchen, aber Mariposa Mimosa kam immer wieder zurück und schien sich auf der riesigen Wampe, die an der Wasseroberfläche trieb, äußerst wohl zu fühlen.
,Warum hast du einen so dicken Bauch, mächtiger Häuptling?‘, fragte Mariposa Mimosa mit zarter Stimme. ‚Weil ich so viel Kassave trinke‘, brummte der Häuptling. ‚Und warum trinkst du so viel Kassave, mächtiger Häuptling?‘, summte Mariposa Mimosa. ‚Weil ich traurig bin‘, antwortete der Häuptling und musste kichern, weil der Schmetterling ihn kitzelte. ‚Aber warum bist du denn traurig, mächtiger Häuptling?‘, wunderte sich der goldgestreifte Schmetterling. ‚Weil ich vierunddreißig Söhne habe, aber nicht eine einzige Tochter‘, jammerte der Häuptling und wiegte seine Wampe hin und her. ‚Ich wünsche mir eine Tochter, die genauso schön ist wie du, Schmetterling, aber die werde ich wohl nicht bekommen.‘ ‚Nun, wenn du meinem Rat folgst, sollst du sie haben, mächtiger Häuptling.‘ Da horchte der unglückliche Häuptling neugierig auf.“
Mino lag im Bett und lauschte mit halbem Ohr dem Märchen, das er schon kannte und das sein Vater nun Sefrino erzählte. Er hing seinen eigenen Gedanken nach und ließ sich von der Geschichte kaum stören. Er wusste nicht genau, was es mit dem Öl auf sich hatte, das die Americanos aus der Erde holen wollten. Warum kamen sie nicht einfach und fragten die Dorfbewohner und Pater Macondo um Erlaubnis, bevor sie die Bäume fällten, die dem Dorf gehörten? Pater Macondo war mit ein paar Männern zu ihnen gegangen und hatte mit el jèfe gesprochen, aber sie waren enttäuscht zurückgekehrt. Viele der sonst eher stillen Männer hatten gebrüllt und über die Americanos und Armeros geschimpft. Das war gefährlich, soviel wusste Mino. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie das Schwein Cabura, vor drei Jahren den Kopf des Kokoshändlers geknackt hatte wie eine Nuss. Señor Gonzo hatte damals seine Stimme erhoben. Cabura hatte inzwischen immer mindestens zehn Armeros um sich, in der letzten Woche waren sechs neue hinzugekommen. Sie fuhren mit ihren Jeeps herum, grölten und johlten, jagten die Hühner und zogen widerwärtige Grimassen, um die Kleinsten zu erschrecken, die sich weinend hinter den Röcken ihrer Mütter versteckten.
Mino mochte das Dröhnen vom Magnolienhügel nicht, es tat ihm weh. Als sein Vater zum Ende der Geschichte vom Obojo-Häuptling Tarquentarque kam, vergaß er aber die trüben Gedanken und hörte aufmerksam zu. So sollte es sein.
Im Jahr darauf kam es im Dorf und seiner Umgebung zu großen Veränderungen. Und zwar mehr als in den vergangenen fünf Jahren zusammen, behauptete Señor Rivera aus der Venda. Doch nichts wendete sich zum Guten.
Delegation um Delegation wurde vom Dorf zum Ölfeld geschickt. Hauptsächlich um ihre Besitzansprüche auf dieses Gebiet zu untermauern, aber auch um dem arbeitstauglichen Teil der Dorfbevölkerung eine Beschäftigung im neuen Unternehmen zu sichern. Alles vergebens. Genau drei Männern wurde Arbeit angeboten, die sie jedoch aus Solidarität mit den siebenundzwanzig anderen ablehnten. El jèfe, der Amerikaner, der den komischen Namen D. T. Star trug und den Pater Macondo bald darauf Detestar, Abscheulich, taufte, kam den Männern kaum entgegen. Er behauptete, der Wald, ja, das gesamte Gebiet gehöre Don Edmundo, und konnte dies mit einem druckfrischen Dokument auch belegen, das Siegel und Stempel trug und vom Präsidenten persönlich unterzeichnet war. Ein anderes, ebenso imponierendes Dokument bestätigte, dass seine Gesellschaft, seine Company, das Recht zur Ölförderung in der gesamten Provinz erworben habe. Als Pater Macondo seine Dokumente vorlegte, unter anderem das von Don Edmundo, lachte D. T. Star nur laut, riss sie in Fetzen und warf sie der Dorfdelegation vor die Füße. Was die Arbeit und die Wiedergutmachung für den Wald anging, konnte die Dorfbevölkerung wenig ausrichten. Es wurdenArbeiter mit Spezialkenntnissen gebraucht, denn der Großteil der Arbeit wurde mit komplizierten Maschinen erledigt. Für nutzlose Analphabeten hatte D. T. Star keine Verwendung. Und der Wald? Eine Wiedergutmachung? Gehörte der Wald denn nicht Don Edmundo? Die Company hatte doch für den Wald bezahlt. Don Edmundo hatte eine ordentliche Summe dafür erhalten.
Barfuß und niedergeschlagen kehrte die Delegation ins Dorf zurück. Später in der Kirche hielt Pater Macondo eine donnernde Rede in einem Ton, den man noch nie zuvor im Dorf gehört hatte.
Auf dem Markt bei den Gemüsehändlern herrschten ebenfalls düstere Zeiten. Vier von ihnen, unter anderem Eusebio mit dem Handkarren, hatten ihr Geschäft aufgeben müssen. Es waren jene, die Sergata-Früchte und Wildbete verkauften. Ihre ertragreichsten Sammelgebiete waren von den Bulldozern der Company niedergewalzt worden. Die Bänke unter der mächtigen Platane auf dem Dorfplatz, wo die Arbeitslosen saßen, wurden immer voller. Pium-Fliegen klatschen und unreifes Kokos kauen war vielen zur täglichen Hauptbeschäftigung geworden. Ab und zu machten sie ihrer Aggression Luft, indem sie Caburas Männern, die immer öfter mit ihren Karabinern durchs Dorf patrouillierten, kräftig hinterherspuckten.
„Erschießt mich doch!“, rief Señor Tico eines Tages und richtete seine Krücken gegen einen der Armeros. „Erschießt mich, erschießt einen Krüppel. Dann habt ihr wenigstens was, woran sich eure Erbsenhirne aufgeilen können!“
Daraufhin erhob der Armero sein Gewehr, entsicherte es und schoss Tico achtzehn Löcher in den Leib. Mindestens zehn der Schüsse waren tödlich.
Die Kinder, die Kokosschalen auf dem Markt sammelten, hatten es auch nicht leicht. Immer seltener kamen Mino und Sefrino mit vollen Armen nach Hause. Das führte dazu, dass einige der Kinder in den Dschungel geschickt wurden, um dort nach Wildbete, Sergata und Fallobst zu suchen, was nicht ungefährlich war. Señor Muccos jüngste Tochter, Teobalda, verschwand eines Tages von der Seite der anderen Kinder. Vier Tage lang rief und suchte man vergebens nach ihr. Sie kehrte nie mehr zurück. Und Minos bester Freund Pèpe fiel von einem morschen Anona-Baum und brach sich das Bein, sodass er den Rest seines Lebens auf Krücken angewiesen war.
Immer öfter geschah es, dass D. T. Star im Dorf zu tun hatte, in Sargento Caburas Büro. Niemand wusste, was sie dort besprachen, aber die Ergebnisse dieser Besuche wurden für die Dorfbewohner sichtbar, als eine leere Flasche aus Caburas Fenster auf die Straße flog. Das Etikett auf den Flaschen war immer das gleiche: „Old Kentucky Bourbon. Five Years Old“.
An einem Tag, als Mino im Dschungel an Stellen, die nur er kannte, auf der Jagd nach den seltensten Schmetterlingen unterwegs war, kam ihm ein Gedanke, der so groß und unheimlich war, dass er sich auf einen riesigen, aus der Krone eines Metador-Baums gebrochenen Ast setzen musste.
Der Gedanke war folgender: Das Schwein Cabura und D. T. Star waren befreundet und kannten einander sicher schon lange. Wahrscheinlich war es Cabura, der D. T. Star erzählt hatte, dass es in der Erde neben dem Dorf Öl gab. Cabura war also schuld an dem Unglück, das über das Dorf hereinzubrechen drohte. Außerdem war er der Anführer der Armeros, die die Dorfbevölkerung in Angst und Schrecken versetzten. Cabura war ein Mörder und würde das Dorf dem Erdboden gleichmachen. Deshalb musste er sterben.
In diesem Moment, auf einem Ast tief im Dschungel, während eine Kolonne Sauba-Ameisen ihren Marsch über seinen linken Fuß antrat, während er dem Schnüffeln eines Nabelschweins in den Büschen lauschte und sich ein Serpico-Falter rätselhafterweise neben die Blechdose mit Ethylacetat setzte, die vor ihm auf dem Boden lag, fasste der zehnjährige Mino Aquiles Portoguesa einen schwerwiegenden Entschluss: Er würde Sargento Felipe Cabura umbringen.
Als er den Gedanken zu Ende gedacht hatte und sein Entschluss feststand, blinzelte er hinauf zum Lichterspiel in den Baumkronen, hob vorsichtig den Kescher und fing den seltenen Serpico mit elegantem Schwung.
*
Tief unter der Erde, an einem Ort unterhalb der Rue du Bac in Paris, wahrscheinlich genau unter dem auffallend schmalen und recht miserablen Hotel Fleury, saßen zwei Männer in einem seltsam eingerichteten Raum. Er war nur ihnen und drei weiteren Personen bekannt und auf keinem Plan verzeichnet. Der Eingang und der Weg dorthin waren so ausgeklügelt konstruiert worden, dass man sie nicht finden konnte. Der Raum war internationales Territorium. Bei einem der fünf Personen, die von seiner Existenz wussten, handelte es sich um Frankreichs Verteidigungsminister, der jedoch nur selten vor Ort war.
Die Herren Urquart und Gascoigne saßen einander in bequemen Sesseln gegenüber. Sie trennte eine Art Glastisch voneinander, auf dem quadratische und runde Felder in Rot, Grün und Blau markiert und mit Buchstaben und Zahlen versehen waren. In der Mitte stand ein randvoller Aschenbecher, daneben lagen unzählige Papiere.
Der Raum war ziemlich groß, und an den Wänden waren Fernschreiber, Monitore und die neueste Datentechnik montiert. Die angenehme Beleuchtung erinnerte an gedämpftes Tageslicht.
Urquart, der ältere der beiden, war fast sechzig. Aus seinem dunklen, ernsten und fein geschnittenen Gesicht blickten klare Augen durch eine große Hornbrille. Das dünne Haar hatte er mit fettiger Pomade nach hinten gestrichen. Zu einem eleganten dunklen Anzug trug er ein hell gestreiftes Hemd und eine neutrale Krawatte.
Gascoigne dagegen war legerer gekleidet: Er trug helle Hosen und einen dazu passenden Acrylpullover. Außerdem war er jünger als Urquart, höchstens fünfzig, etwas behäbig, mit rot geflecktem Gesicht und von recht gutmütiger Erscheinung.
Auf der Straße hätten Urquart und Gascoigne nicht aus der Menge herausgestochen.
Gascoigne drückte seine Zigarette aus und berührte mit dem Zeigefinger ein grünes Feld auf der Glasplatte. Neben ihnen an der Wand leuchtete ein Monitor auf.
„Der Zug Athen-Istanbul“, sagte er und nickte.
„Wer schnappt sie sich?“ Urquart entfernte ein Staubkorn von seinem rechten Brillenglas.
„Ein Grieche in Zivil namens Nikis. Er bringt sie direkt zum Flughafen nach Komotini. Dort wartet der Spezialjet.“
„Was denken Sie, wie lange braucht sie im Lusthaus?“ Gascoigne machte eine abschätzende Handbewegung. „Zwei Stunden bis zwei Tage, schwer zu sagen. Merde. Ich hoffe, sie ist ein braves Vögelchen und singt.“
Ein Telex traf ein, Urquart riss es ab und las laut vor. „Bestätigt“, sagte er, als er am Ende angelangt war. „Bald sitzt die Schmeißfliege in der Falle, und die Welt kann aufatmen.“
Das Gespräch zwischen Urquart und Gascoigne, auf internationalem Territorium, tief unter der Rue du Bac in Paris, ereignete sich genau viertausenddreihundertachtzig Tage, nachdem der zehnjährige Mino Aquiles Portoguesa beschlossen hatte, das Schwein Cabura zu töten.
*
Pèpe hinkte auf seinen viel zu großen Krücken neben Mino her. „Wollen wir heute die Schildkrötenpanzer anmalen?“
Mino schüttelte den Kopf. Er hatte seinen besten Freund gebeten, ihn zum Teich neben Señora Serratas Haus zu begleiten. Hinter dem dichten Schilf hatte Mino einen kleinen Platz nur für sich. Hier war die Erde hart getreten und er konnte in Ruhe auf ein paar zu einer Mauer gestapelten Steinen sitzen und die Frösche beobachten, die auf den breiten Victoria-Blättern quakten. Im Teich lebten die sonderbarsten Kreaturen und führten ihre eigene komplizierte Existenz.
Mino brauchte Hilfe, um Cabura zu töten. Er wollte Pèpe in seinen Plan einweihen.
„Wir bringen Cabura um“, sagte er plötzlich, nachdem sie sich gesetzt hatten. „Echt?“ Pèpes Augen begannen zu leuchten. „Ja, das spielen wir, Minolito. Wir spielen, dass wir alle Armeros kaltmachen. Der da ist das Schwein Cabura. Er sieht ihm ähnlich, oder?“ Pèpe zeigte lachend auf einen Frosch.
„Quatsch“, winkte Mino ab. „In Wirklichkeit. Du und ich werden Cabura umbringen. Richtig umbringen, so dass er aufhört zu atmen.“ Er erzählte seinem Freund von dem Plan, den er im Wald gefasst hatte. Pèpe wurde blass und schlug mit einem Stock ins Wasser. Dann beäugte er seinen Fuß, der so umständlich gebrochen war, dass er nie wieder richtig zusammenwachsen würde.
„Cabura und seine Armeros sind gefährlich, das schaffen wir nie“, flüsterte er.
„Doch.“ Mino legte den Kopf in den Nacken „Ist gar nicht schwer. Einen Serpico-Schmetterling zu fangen ist schwieriger, das kannst du mir glauben. Aber du darfst es niemandem erzählen. Absolut niemandem. Oder redest du im Schlaf?“
Energisch schüttelte Pèpe den Kopf. Mino erklärte ihm daraufhin genau, wie sie Cabura umbringen und das Dorf vor der Zerstörung durch Don Edmundo und D. T. Star retten würden.
Señor Gomeras Tomatenfeld war das beste im ganzen Dorf. Niemand besaß so üppige Tomatensträucher wie er. Die vier penibel angelegten Reihen mit je zehn Sträuchern bescherten ihm täglich zwei volle Körbe für den Markt. Sein Geheimnis waren die Miamorates, ein Nachtschattengewächs. Er hatte entdeckt, dass er doppelt so viele Tomaten erntete, wenn diese Pflanze in ihrer Nähe wuchs. Sie war zwar unglaublich giftig, aber niemand würde auf die Idee kommen, sie zu essen, das spielte also keine Rolle.
Nun war es so, dass einer von Sargento Caburas Armeros, ein kurz geschorener Stiernacken namens Pitrolfo, einen Schäferhund besaß, ein mageres, aggressives Tier, das die meiste Zeit hinter der Caserna in einen Zwinger gesperrt war. Dann und wann holte Pitrolfo ihn heraus, band ihn an eine lange Liane und ging ein Stück mit ihm spazieren. Manchmal ließ er ihn auch frei herumlaufen, worauf alle Kinder im Dorf in die Häuser geholt und die Türen verriegelt wurden.
Als er den Hund wieder einmal von der Leine ließ, sprang das Tier, ohne zu zögern, auf Señor Gomeras Tomatenfeld, schnüffelte darauf herum und bepinkelte einige der Pflanzen. Und dann geschah das, was Señor Gomera zum Verhängnis werden sollte: Auf einmal begann der Hund, reihenweise die kleinen weißen Miamorates-Blüten zu fressen. Nachdem er noch vier, fünf weitere Tomatenpflanzen angepinkelt hatte legte er sich hin und begann fürchterlich zu jaulen. Pitrolfo ließ seinen Karabiner fallen und blies in eine Pfeife, um den Hund zurückzurufen. Dieser aber blieb jaulend zwischen den Tomatensträuchern liegen. Er rollte sich auf den Rücken und streckte die Beine in die Luft. Sein Gejaule ließ nach. Pitrolfo gab das Pfeifen auf und ging zu seinem Hund hinüber. Im Moment, als er den Acker erreichte, krampfte sich das Tier im Todeskampf zusammen, winselte heiser und blieb schließlich reglos liegen. Er war tot. Verreckt an Señor Gomeras Miamorates.
Pitrolfo sprangen fast die Augen aus dem Kopf, als er den leblosen Hund vor sich liegen sah. Dann entdeckte er eine halb zerkaute Miamorates im Maul des Tieres. Er sah sich wie ein Wahnsinniger um, fluchte wild und feuerte siebzehn Schuss aus seiner Maschinenpistole auf den nächsten Tomatenstrauch ab.
Die meisten Dorfbewohner hatten sich wegen des Hundes in ihren Häusern verschanzt. Als sie aber die Schüsse hörten, wussten sie, dass etwas passiert war. Die Gemüsehändler packten ihre Stände zusammen und versteckten sich hinter den leeren Kisten oder zogen sich in die dunkelsten Schatten zurück. Das Dorf wirkte plötzlich wie ausgestorben.
Mino und Pèpe, die Cabura schon seit dem frühen Morgen nachspionierten, saßen hoch oben in einem Baum hinter seinem Büro. Von hier aus konnten sie beobachten, wie vierzehn Armeros, angeführt von Sargento Cabura und mit ihren Gewehren im Anschlag, zum Tomatenfeld stürmten, um Pitrolfo beizustehen, was auch immer seine siebzehn Schüsse zu bedeuten hatten.
Im Dorf herrschte helle Aufregung. Als Felipe Cabura und seine Männer herausgefunden hatten, was vorgefallen war, begann Pitrolfo wild zu gestikulieren. Der Hundekadaver wurde zur Caserna geschleift und in den Zwinger gelegt, wo er nach einer Weile riesige Fliegenschwärme anlockte. Die Armeros verteilten sich und gingen mit ungeheurer Entschlossenheit zu jedem Haus im Dorf und traten gegen die Tür.
„Wem gehört dieses verseuchte Tomatenfeld?“, brüllten sie.
„Der Besitzer des Teufelszeugs soll rauskommen! Sofort!“
Die Dorfbevölkerung hüllte sich in Schweigen und begegnete den Armeros überall mit verhaltenem Kopfschütteln.
Señora Gomera wohnte in einem Häuschen mitten im Dorf. Sie und ihr Mann teilten es sich mit der Familie Perez, die eine kleine Wäschereibetrieb. Als sie das Gebrüll und die Tritte gegen ihre Haustür vernahm, drückte sie die acht Monate alte Maria fest an ihre Brust und öffnete vorsichtig die Tür. Zwei Armeros fragten barsch, ob hier der Eigentümer des Tomatenfeldes wohne.
Señora Gomera nickte, sie konnte niemanden belügen. Jetzt, wo die Armeros das Haus des Tomatenbesitzers ausfindig gemacht hatten, versammelte sich der ganze Trupp davor, mit Sargento Cabura an der Spitze. Es entstand ein riesiger Tumult, und die kleine Maria schrie herzzerreißend, als ihre Mutter auf die Straße gezerrt wurde.
Augenblicklich wusste das gesamte Dorf, dass die Gomeras der Grund für die Wut der Armeros waren, doch kaum jemand wusste, warum. Die Gemüsehändler kamen aus ihren Verstecken hervor, die Haustüren wurden wieder geöffnet, und die Leute liefen auf die Straße. Um Señora Gomera und die tobenden Armeros bildete sich ein stummer Ring.
Ein kleiner, drahtiger Mann trat hervor und ging geradewegs auf Sargento Cabura zu. Es war Señor Gomera selbst, der höflich fragte, was der Aufstand zu bedeuten habe. Wenn sie ihn sprechen wollten, könnten sie doch zu seinem Marktstand kommen, statt seine Familie derart zu erschrecken.
„Olé!“, brüllte Cabura. „Olé! Pitrolfo! Hier haben wir den Giftmischer, diesen elenden Wurm, der Giftpflanzen neben frischen roten Tomaten wachsen lässt! Der heilige Giovanni weiß, dass er das Zeug mit Absicht pflanzt, um es uns eines schönen Tages in die Suppe zu mischen! Pitrolfo! Was machen wir jetzt mit dem Hurensohn, der deinen prächtigen Cäsar vergiftet hat?“
Pitrolfo grinste kalt und wedelte mit dem Gewehr vor Señor Gomeras Gesicht herum. Dieser duckte sich zwar, die scharfe Kante des Visiers riss ihm jedoch ein Ohrläppchen auf, und Blut tropfte auf sein sauberes weißes Hemd.
„Was wir mit ihm machen? Ha! Das werd ich euch sagen: Er soll zwei volle Hände seiner Giftpflanzen fressen. Und wenn er sie nicht schluckt, schneiden wir ihm die Eier und den Schwanz ab!“
Durch die Menge ging ein Raunen, die Frauen begannen zu schluchzen. Pater Macondo bahnte sich gemeinsam mit dem alten Doktor Pedro Pinelli einen Weg durch den Menschenauflauf.
„Hören Sie“, bat er und hielt beide Hände flehend vor Sargento Cabura. „Der Doktor hier sagt, dass eine solche Menge tödlich sein kann. Seien Sie doch vernünftig, Sargento Cabura. Soll etwa ein Mensch sterben, weil ein Hund zufällig von den Giftpflanzen auf einem Acker frisst und daran krepiert? Kein gerechter Gott würde Pitrolfos Rache gutheißen.“
Cabura lachte abschätzig und schob den Pater und den Doktor in die Menge zurück. Dann befahl er einem der Armeros, eine ordentliche Menge Miamorates zu holen. Señor Gomera wurden die Hände auf den Rücken gebunden, und man setzte ihn auf eine Kiste vor sein Haus. Sieben Armeros bewachten ihn, alle mit entsicherten Waffen, die sie auf seinen Kopf richteten. Schluchzend lief Señora Gomera mit der kleinen Maria ins Haus.
Das Raunen der Menge um diese seltsame Szene nahm bedrohliche Züge an. Immer dichter wurde der Ring um die Armeros und den armen Señor Gomera. Ein paar von Caburas Männern wurden sichtlich nervös und richteten die Mündungen ihrer Gewehre auf die Umstehenden.
Als einer der Armeros mit den Händen voll Giftpflanzen vom Acker zurückkehrte, trat Pater Macondo erneut vor und bat um Gnade. „In Gottes Namen, hören Sie auf, Sargento Cabura!“ Wieder wurde er höhnisch mit Gewehren und schroffen Händen zurückgedrängt.
Señor Gomera saß mit zusammengekniffenen Lippen auf der Kiste und starrte trotzig zu Boden. Sein Gesicht aber war blass geworden. Als Pitrolfo eine Handvoll Miamorates-Blätter zu einer Kugel gepresst hatte und unter Gomeras Kinn hielt, öffnete dieser unversehens den Mund und schnappte sie sich, bevor Pitrolfo ihn dazu zwingen konnte.
Es wurde totenstill. Sogar die Armeros hörten auf, an ihren Bandelieren und Gewehren zu hantieren. Alle Augen waren auf Gomera gerichtet. Seine Wangen blähten sich auf. Wäre es keine Tragödie gewesen, hätte es fast komisch ausgesehen.
„Kau!“, schrie Pitrolfo plötzlich.
Und Señor Gomera begann langsam zu kauen. Er kaute und kaute. Bald blähte sich die rechte Wange auf, bald die linke. Die ganze Zeit über starrte er hasserfüllt auf Pitrolfo.
„Schluck!“, brüllte dieser.
Señor Gomera hörte auf zu kauen und blickte seinem Henker lange in die Augen. Dann schluckte er.
Ein Seufzen ging durch die Menge.
Der Unglückliche kippte nach hinten von der Kiste und zappelte auf dem trockenen Lehmboden wie ein Insekt, das nicht mehr fliegen kann. Seine Zuckungen wurden heftiger und heftiger. Dann wurde er langsam ruhig und blieb schließlich still liegen. Um seinen Mund hatte sich grüner Schaum gebildet.
Pater Macondo und Doktor Pinelli stürmten nach vorne und knieten sich neben Gomera. Die Armeros zogen sich zurück, und Pitrolfo murmelte, dass eine Handvoll sicher reichte.
Señor Gomera wurde ins Haus getragen.
Hoch oben, in einem Baum mit gutem Ausblick auf das Geschehen, sagte Mino zu Pèpe: „Verstehst du jetzt, warum wir das Schwein Cabura umbringen müssen?“
Ein Wunder geschah: Señor Gomera überlebte. Der alte Doktor konnte sein Leben retten, indem er ihm einen Plastikschlauch in den Magen schob und die unverdauten Miamorates absaugte. Gomera wurde jedoch halb blind und fast taub, und er erkannte die Menschen im Dorf nicht mehr wieder. Sogar seine eigene Frau und die kleine Maria waren ihm völlig fremd geworden. Ständig ging er umher und zog den Hut vor seinen engsten Verwandten und Freunden, wobei er sich mit dem vollen Namen seines Vaters vorstellte. Er wusste nicht mehr, dass er Tomaten besaß, und obwohl ihn seine Frau geduldig zu seinem Marktstand brachte, weigerte er sich, unter wildfremden Menschen Tomaten zu verkaufen, die ihm nicht gehörten.