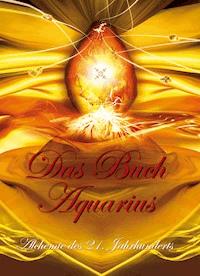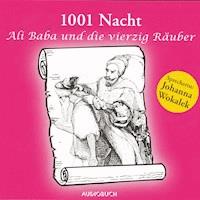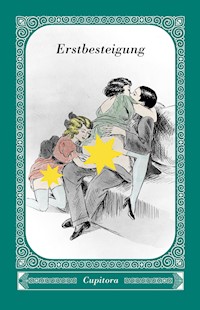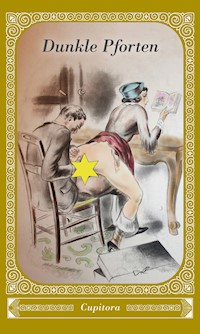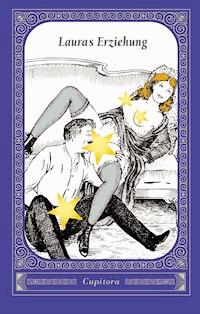Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kult (Schätze der Unterhaltungsliteratur)
- Sprache: Deutsch
SÂR DUBNOTAL Nr. 4 enthält zwei Geschichten: Der Hypnotiseur Sâr Dubnotal versucht mithilfe eines Mediums, seinen verschwundenen Diener aufzuspüren. Doch bald muss er erkennen, dass er in dem Russen Tserpchikoff einen äußerst gefährlichen Gegenspieler hat. Die Astralspur Der Verbrecher Tserpchikoff bleibt verschwunden. Erst nach Kontakt mit einem Astralfreund kann Sâr Dubnotal die verlorene Spur wieder aufnehmen. Sie führt nach Tunis in Nordafrika. Dort geschieht ein weiteres Verbrechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bücher dieser Reihe
Der Hypnotiseur
Sar Dubnotal 04
Kult Romane
Buch 21
Gerd Frank
Inhalt
Der Hypnotiseur
Tserpchikoff, der blutige Hypnotiseur
Die Anrufung
Der Anschlag auf den Express-213
Eine dunkle Affäre
Entscheidung in letzter Sekunde
Die Rettung
Ein Wunder, das keines war
Verwicklungen
Der falsche Magier
Die Astralspur
Der Schutzgeist
Der verhexte Passagierdampfer
Sâr Dubnotals Macht zeigt sich immer deutlicher
Die irdischen Ermittler des großen Psychagogen treten in Aktion
Spurlos verschwunden
Der Angriff
Anmerkungen
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Hans-Peter Kögler
Logo und Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten.
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-….
1020v1
Der Hypnotiseur
Tserpchikoff, der blutige Hypnotiseur
Es war an einem der letzten Augusttage des Jahres 1889, als Sâr Dubnotal, der große Psychagoge, dabei war, seinen umfangreichen Posteingang durchzusehen. Er saß in seinem prächtigen Bungalow, den er in dem bretonischen Badeort Trez-Hir errichten hatte lassen. Der einem Hindu-Chalet stark ähnelnde Bau diente ihm einerseits als Erholungsort und andererseits als Ausgangspunkt seiner gefahrvollen Missionen, die ihn oft genug an die entlegensten Stellen des Erdballs führten. Denn Sâr Dubnotal war wegen seines brillanten Wissens, seiner hervorragenden Fähigkeiten als Wissenschaftler und zahlreicher kriminalistischer Erfolge geradezu weltberühmt.
Einer seiner exotischen Diener (die meisten von ihnen hatte er in Indien eingestellt) stellte ihm in diesem Augenblick ein großes silbernes Tablett auf den Tisch, das von Telegrammen, Briefen und Zeitungen förmlich übersät war.
Der Meister saß in einem Schaukelstuhl in der Ecke eines riesigen – in orientalischem Stil eingerichteten – Raumes, der ihm gleichzeitig als Chemielabor, Schreibzimmer und Büro diente. Der geflieste Boden mit attraktiven Mosaiken, die wertvollen Seidentapeten an den Wänden und die bogenförmigen Fenster verliehen dem Raum eine geheimnisvolle exotische Atmosphäre. Sâr Dubnotal überflog in gewohnter Manier seine Korrespondenz, die er mit allen möglichen Ländern aus aller Welt führte und die in zwanzig verschiedenen Sprachen abgefasst war.
Zunächst widmete er sich den Telegrammen, die er von seinen Mitarbeitern erhalten hatte, die er auf eigene Kosten in den meisten Großstädten Europas und Asiens unterhielt. Selbstverständlich schöpfte der große Meister alle natürlichen Mittel der Informationsbeschaffung auch persönlich aus, er wusste bestens Bescheid über all die wichtigen Dinge, die sich auf der Welt ereigneten. Seine wunderbare Fähigkeit, mithilfe wissenschaftlicher Methoden, außergewöhnlichem Scharfsinn und einer begnadeten Intuition, die ihm ermöglichte, sich in die abwegigsten und seltsamsten Gedankengänge fremder Individuen hineinzuversetzen, bewirkte, selbst die verborgensten Spuren aufzudecken oder die dunkelsten Rätsel der menschlichen Seele zu lösen.
Aufgrund seiner reichhaltigen Erfahrungen mit der astralen und transzendentalen Welt und dank der Hilfe seiner Medien war er in der Lage, seine Nachforschungen und Ermittlungen auch in jenen Bereichen durchzuführen, die dem Normal-Sterblichen für gewöhnlich verschlossen blieben. Sâr Dubnotal war übrigens nicht der Mann, der seine außergewöhnliche Macht, die er nach eigenem Bekunden nur Gott verdankte, für dunkle Zwecke oder Absichten einsetzte, auch wollte er seine Kontakte mit dem Jenseits nicht überstrapazieren.
Als der Psychagoge mit der Durchsicht der erhaltenen Telegramme fertig war, übergab er die geöffneten Schriftstücke einem jungen Mann, der respektvoll und den Meister bewundernd neben ihm stand.
Dieser bemerkenswerte, gut aussehende junge Mann war schlank und dennoch kräftig gebaut; er hatte eine hohe Stirn, die auf große Intelligenz schließen ließ, und sehr ausdrucksstarke Augen. Die Gesichtszüge waren energisch, ernst und rechtschaffen; er war kein anderer als Rudolf, der Lieblingsschüler des Meisters.
Auch Rudolf sah nun die Telegramme durch, notierte sich interessante Informationen, bewahrte diejenigen Dokumente auf, die er für wichtig genug befand, und warf den Rest in ein Weidenkörbchen, das sich hinter ihm befand. Wenn die Sichtung beendet war, vergaß er übrigens in keinem Fall, die nicht mehr benötigten Papiere sofort zu verbrennen.
„Alles klar“, murmelte Sâr Dubnotal, nachdem er das letzte Telegramm geöffnet und rasch überflogen hatte. „War nichts Besonderes unter der heutigen Post, nicht einmal Nachricht von Naïni, die ich eigentlich erwartet hatte. Schließlich trug ich ihm ja extra auf, gleich nach seiner Ankunft in Marseille an mich zu drahten.“
„Sicher kommt die Nachricht bald, Meister“, meinte Rudolf zuversichtlich. „Es ist noch nichts aus der Zeit.“
„Vielleicht hast du recht“, entgegnete Sâr Dubnotal, doch wie es aussah, war er beunruhigt. Irgendetwas lastete schwer auf seiner Seele. Naïni war eine derjenigen Personen, denen er uneingeschränkt vertraute und auf den er sich hundertprozentig verlassen konnte. Wenn der sich nicht meldete, musste ihn etwas daran gehindert haben ...
Der herkulisch gebaute Diener stammte aus der Ganges-Region in Indien und hatte in seiner Jugend im Dienste eines despotischen und grausamen Radschas gestanden, der ihn des Öfteren wirklich abscheulich behandelt hatte. Naïni war Sâr Dubnotal gegenüber außerordentlich dankbar, ergeben und willfährig, da dieser ihn von seinem bisherigen Herrn kurzerhand freigekauft hatte. Er zeichnete sich durch absoluten Gehorsam, Pünktlichkeit und geradezu militärische Disziplin aus, weshalb sein neuer Herr sich in jeder Beziehung auf ihn verlassen konnte.
„Der Auftrag, den ich Naïni erteilt hatte, war sehr heikel“, fuhr der große Psychagoge fort. „Es ist noch keineswegs sicher, dass er ihn überhaupt ausführen konnte.“
„Aber die Gräfin von Tréguilly hat sich doch ausdrücklich damit einverstanden erklärt, seine Begleitung, um nicht zu sagen, die Bewachung durch ihn, zu akzeptieren!“, meinte Rudolf.
„Diese hochmütige, armselige Kreatur?“, fragte Sâr Dubnotal verächtlich. „Erinnerst du dich nicht mehr an ihre Scheinheiligkeit und Heuchelei, insbesondere im Zusammenhang mit den teuflischen Verbrechen an ihrem Schwiegervater, Graf Hector, und ihrem Mann, Graf Jean, um sich deren Vermögens zu bemächtigen? Dabei hätte ihr auf legalem Weg nur ein Bruchteil davon zugestanden.“
„Glauben Sie wirklich, Meister“, hielt Rudolf dagegen, „dass diese junge und hübsche Frau, die Mutter zweier entzückender Töchter und Trägerin des noblen Namens derer von Tréguilly, aus purer Habgier diese abscheulichen Taten begangen hat?“
Der große Psychagoge zuckte kaum merklich die Schultern. „Zumindest hat Habgier mit eine maßgebliche Rolle gespielt“, sagte er dann. „Es ist nicht schwer, dies zu erkennen, wenn man die Ereignisse betrachtet, die zu dem Spuk auf dem Landsitz von Crec’h-ar-Vran geführt hatten. Du warst ja damals dabei, als ich die Angelegenheit untersuchte, und hast mir assistiert bei der Aufdeckung der Hintergründe. Unsere Beweisführung war letzten Endes erdrückend und unwiderlegbar. Ich war daraufhin in der Lage, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um dem jungen Grafen Albert de Tréguilly zu seinen ursprünglichen Ansprüchen zu verhelfen, vor allem, was sein materielles Erbe anbelangte. Sicher hast du auch bemerkt, dass diese elende Verbrecherin bereit war, unter Bewachung für einige Zeit außer Landes zu gehen, um so einem Strafprozess vor der hiesigen Justiz zu entgehen und an einem Ort, der nur mir allein bekannt sein sollte, ihre schrecklichen Taten zu sühnen. Aber wie wir wissen, war da noch etwas anderes. Azilis de Tréguilly hatte kurz vor der Tat die Bekanntschaft eines angeblichen russischen Bojaren1 gemacht, nämlich des Prinzen Tserpchikoff, und wollte vor allem auch wegen ihm Witwe werden, um frei für ihn zu sein.“
„Vielleicht war es ja sogar dieser rätselhafte Mensch, der sie zu diesen Verbrechen getrieben hat?“, fragte Rudolf leise.
„Das könnte durchaus sein, ich hatte auch schon diesen Gedanken“, meinte Sâr Dubnotal hierauf und ein wildes Feuer glomm in seinen dunklen Augen. „Jetzt, da die Gräfin nicht mehr mit ihm zusammen ist, kann ich ja darangehen, dieser Frage auf den Grund zu gehen.“
„Wer ist dieser Tserpchikoff? Ist er tatsächlich ein russischer Bojarenprinz? Was war seine eigentliche Absicht, als er die Beziehung zu Azilis suchte, bis er schließlich sogar zu ihrem Liebhaber wurde? Hat er sie wirklich geliebt oder sich nur für das gräfliche Vermögen interessiert? Kurz gesagt: Hatten wir es in diesem Fall mit einem Verbrechen aus Leidenschaft zu tun oder aber mit einer Tat, die lediglich aus niederen, heimtückischen Beweggründen verübt worden ist? Hat sich der Prinz der schönen Azilis nur bedient oder haben die beiden aus den gleichen minderwertigen Motiven gehandelt? Diese Fragen müssen beantwortet werden, lieber Rudolf! Aber bis wir hierauf Antworten gefunden haben, wird noch einige Zeit vergehen.
Doch noch einmal: Die Tatsache, dass ich von Naïni bislang kein Telegramm erhalten habe, beunruhigt mich. Ich muss daher davon ausgehen, dass die beiden das Schiff in Marseille noch nicht bestiegen haben. Aber: Solange die beiden Frankreich nicht verlassen haben, besteht die Gefahr, dass dieser Tserpchikoff alles daransetzen wird, seine Gefährtin wiederzugewinnen. Bestimmt lauert er irgendwo im Verborgenen wie ein Raubtier, das seine Fänge in den Hals seiner Beute schlagen will.“
„Da haben Sie recht, Meister“, murmelte Rudolf, nachdem er das Gehörte verarbeitet hatte. „Naïnis Schweigen ist auch für mich unerklärlich und ich befürchte nun auch, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte.“
„Genau“, brummte der große Psychagoge, erhob sich aus seinem Sessel und durchmaß den Raum mit großen Schritten.
„Haben unsere Agenten den Aufenthaltsort des russischen Prinzen bislang noch nicht in Erfahrung bringen können?“, fragte Rudolf nach einer Weile. „Sie waren ihm doch gewiss auf der Spur und haben versucht, zu verhindern, dass er mit Azilis noch einmal Kontakt aufnehmen konnte.“
„So ist es“, entgegnete der Meister. „Genau dies waren meine Anordnungen an unsere drei Freunde. Ich erwarte jeden Moment ihre Rückkehr und damit ihren Bericht.“
Der große Psychagoge hatte kaum zu Ende gesprochen, als durch einen geradezu unglaublichen Zufall kräftig an die Tür geklopft wurde. Otto, Frank und Fréjus, die drei erwähnten Agenten, standen draußen. Sie waren gekommen, um dem Meister von ihrem Ermittlungsstand Bericht zu erstatten.
„Nun, meine Freunde“, sagte Sâr Dubnotal lebhaft, „habt ihr herausgebracht, wo Tserpchikoff sich derzeit befindet?“
„Ja, Meister“, antwortete Fréjus, ein gescheiter und lebhafter kleiner Franzose. „Es war gar nicht schwer, diese Information über die Concierge der Gräfin zu erhalten. Während seines Aufenthalts in Paris bewohnte Prinz Tserpchikoff ein möbliertes Appartement am Boulevard Voltaire.“
„Nun gut. Und jetzt – ist er noch dort?“
„Das ist genau das Problem. Als wir uns am Boulevard Voltaire einfanden, um ein Wörtchen mit dem Herrn zu reden, rein privat, versteht sich, da war der Vogel ausgeflogen.“
„Und seine Concierge?“
„War nicht imstande, auch nur das Geringste zu sagen, Meister.“
„Konnte sie nichts oder wollte sie nichts sagen?“
„Oh, den guten Willen hatte sie schon“, flocht Frank hier schnell ein. Er war ein athletisch gebauter Engländer, der in jungen Jahren als Detektiv bei Scotland Yard gearbeitet hatte. „Sie hätte uns gerne geholfen, wenn sie nur gekonnt hätte! Denn so wie es aussieht, hat sich der gute Mann heimlich aus dem Staub gemacht, ohne sie vorher zu entlohnen.“
„Ja“, sagte nun Otto, der Deutsche. „Genauso ist es. Die gute Frau hat sich von dem weltmännischen Auftreten Tserpchikoffs blenden lassen. Heute verwünscht sie den Tag, an dem sie ihn kennengelernt hat. Er hat sich als ganz gemeiner Gauner entpuppt.“
„So ist es euch also nicht gelungen, seine Fährte ausfindig zu machen?“, forschte Sâr Dubnotal, halb ängstlich, halb ironisch.
Die drei Männer senkten die Köpfe, denn sie waren mit leeren Händen nach Trez-Hir zurückgekehrt. All ihre Bemühungen, den derzeitigen Aufenthaltsort des sogenannten Bojarenprinzen zu ermitteln, waren erfolglos geblieben; Tserpchikoff war spurlos verschwunden. Hatte er Paris verlassen? Dies war wahrscheinlich, doch die drei Agenten wagten nicht, an anderen Orten nach ihm zu forschen – denn ihr Auftrag hatte sich lediglich auf das Stadtgebiet von Paris bezogen. Deshalb hatten sie es vorgezogen, nun nach Trez-Hir zurückzukehren, um zum einen Bericht zu erstatten und zum anderen, neue Order einzuholen, wie sie sich fürderhin verhalten sollten.
„Es sind nun genau drei Tage, dass Naïni und die Gräfin an Bord hätten gehen müssen“, murmelte der Meister. „Heute ist Donnerstag – am Montagabend schon hätten sie nämlich in Marseille sein müssen. Ein Telegramm hätte schon längst hier eintreffen müssen, ausgenommen, dass ein Unfall das Abschicken verhindert hat.“ Der Psychagoge wandte sich erneut an die drei Agenten und fragte: „Wann hat Tserpchikoff den Boulevard Voltaire verlassen?“
„Exakt vor drei Tagen“, antwortete Fréjus. „Am vergangenen Montag! Wie es aussieht, hat der Prinz an jenem Tag gegen etwa sechs Uhr nachmittags Besuch von einer fremden Person erhalten. Kurz darauf muss er sein Arrangement getroffen haben: Er packte seine Siebensachen zusammen und verschwand vor den Augen der Concierge auf Nimmerwiedersehen.“
Rudolf kam nicht umhin, eine verächtliche Geste zu machen. „Warum hat sie ihn ungehindert gehen lassen?“
„Oh, sie war sich seiner absolut sicher“, antwortete Frank. „Und ganz sicher war Tserpchikoff clever genug, sie mit irgendwelchen Bemerkungen abzulenken. Tricks genug hatte er auf Lager! Er schickte den Mann der Concierge irgendwohin und unterhielt sich in der Zwischenzeit eifrigst mit der Frau, währenddessen transportierten der eben angekommene Besucher sowie ein Dienstbote die persönliche Habe außer Haus.“
„Und die Concierge hat das nicht durchschaut?“ Sâr Dubnotal konnte es kaum glauben. „Hat sie sich nicht gewundert, wenn da Leute mit Paketen das Haus verließen?“
„Ja und nein, Meister! Nein, weil Tserpchikoff es ganz ausgezeichnet verstanden hat, all ihre Aufmerksamkeit auf das Gespräch zu lenken. Er berichtete von einem seiner Bevollmächtigten in Russland, der dabei gewesen sei, eine Aufstellung über die Einnahmen aus den Besitztümern zu erstellen, was seine Anwesenheit erfordere, und bat sie, deshalb umgehend seine Rechnung vorzubereiten. Dann hat einer der beiden Helfer irgendeine Kiste auf der Treppe fallen gelassen, weshalb die Concierge – neugierig geworden wegen des Lärms – nachschauen wollte, was da vorging. “
„Hinderte sie Tserpchikoff daran?“
„Das hat die gute Frau nicht gesagt“, entgegnete Otto. „Fakt ist, dass sie, kaum dass sie vor ihre Tür getreten war, mit einem Mal ohnmächtig wurde und zu Boden stürzte. Als sie nach einer Weile wieder zu sich kam, war zu ihrem grenzenlosen Erstaunen der Mieter Tserpchikoff verschwunden.“
„In diesem Augenblick erwachte ihr Misstrauen“, wandte Fréjus hier ein. „Niemals zuvor hatte sie eine Ohnmacht erlitten und sie argwöhnte sogleich, dass Tserpchikoff irgendetwas damit zu tun gehabt haben musste. Nun erinnerte sie sich plötzlich daran, dass der Russe sie während der Unterhaltung sehr merkwürdig, vor allem aber mit stechenden Blicken angesehen hatte. Die Augen des Prinzen sollen in dämonischem Feuer geglüht haben – hat sie gesagt. Und dieses dämonische Feuer hat sie schließlich nicht mehr ausgehalten.“
„Diese Information ist ja hochinteressant“, sagte der große Psychagoge nun zu Rudolf. „Dieses Detail eröffnet einen ganz neuen Horizont, den ich bislang überhaupt nicht in Betracht gezogen habe! Fahre fort, Fréjus!“
Der Franzose, den die Bemerkung des Meisters gefreut hatte, nickte mit dem Kopf. „Als ihr Mann zurückkehrte, erzählte ihm seine Frau von dem Vorfall, den sie als eine Art Zauber oder Hexerei darstellte. Dadurch sei es Tserpchikoff gelungen, sich unbemerkt aus dem Staub zu machen. Der Mann der Concierge dachte wohl zunächst, dass seine Frau nicht ganz richtig im Kopf sei, und begab sich zunächst in das Appartement seines Mieters, dem er die Sachen übergeben wollte, die er für ihn hatte besorgen müssen. Als er das Nest leer fand, war ihm klar, dass seine Frau die Wahrheit gesprochen hatte. Die hinterlassene Unordnung in den Räumen sprach eine zu deutliche Sprache.“
„Ist der guten Frau im visuellen oder auditiven Bereich seither noch einmal irgendetwas Seltsames passiert?“, fragte Sâr Dubnotal neugierig.
„Ja, Meister“, antwortete Otto hier. „Und sie ist voll und ganz davon überzeugt, dass man sie irgendeinem faulen Zauber ausgesetzt hat, genauso, wie Freund Fréjus es ausgedrückt hat. Sie sieht noch immer die dämonischen Augen vor sich und hat offenbar jeglichen Appetit und Durst verloren.“
Der große Psychagoge unterbrach die Wanderungen in seinem Zimmer. „Sie hat nur zum Teil recht“, murmelte er nach einer Weile. „Sie wurde nicht behext, sondern hypnotisiert.“
„Hypnotisiert?“, stammelten die Agenten wie aus einem Mund.
„So ist es“, entgegnete der Psychagoge ernst. „Hypnotisiert lediglich aufgrund seines starren Blickes! Dieser Mensch muss über eine ungewöhnliche Hypnosekraft verfügen und das macht ihn zu einem gefährlichen Gegner für uns.“
„Da müssen wir dann wohl davon ausgehen, dass er eventuell mit Naïni genauso verfahren hat?“, warf Rudolf hier ein.
„Ich fürchte ja“, antwortete Sâr Dubnotal kaltblütig. „Tserpchikoffs überstürzte Abreise erfolgte ja kurz nach dem Weggang der Gräfin und Naïnis. Ganz bestimmt hat ihm der unerwartete Besucher die Nachricht übermittelt, dass Azilis festgenommen worden sei, weshalb er sofort etwas dagegen unternehmen musste. Er konnte seine Komplizin doch nicht hilflos zurücklassen! Unter diesen Umständen ist es für mich nicht länger verwunderlich, dass Naïni sich noch nicht gemeldet hat! Der Hindu konnte sich ganz einfach nicht melden, weil ihm etwas zugestoßen sein muss ... Seine physische Stärke hätte ihm womöglich gegenüber einem Hypnotiseur nichts genützt.“
„Es sei denn, dass er magnetischen Wellen gegenüber resistent gewesen ist“, meinte Rudolf.
„Genau“, sagte der Meister bedächtig. „Und deine Bemerkung beruhigt mich wieder ein bisschen, mein Freund, denn Naïni ist wohl auch nicht leicht zu hypnotisieren, wie ich bei verschiedenen Gelegenheiten bereits bemerkt habe. Aber wie Frank schon gesagt hat: Tserpchikoff hat ja über viele Tricks verfügt. Und der Hindu ist ihm wohl, trotz seiner Vorsicht und Klugheit, irgendwie auf den Leim gegangen.“
Sâr Dubnotal entließ seine Agenten und bat sie, ihm eines seiner Medien, nämlich die Italienerin Annunciata Gianetti, zu schicken. Zu seinem Schüler Rudolf sagte er: „Du weißt, mein Freund, wie lange ich zögere, von den sogenannten übernatürlichen Kräften Gebrauch zu machen, um bestimmte Informationen zu erhalten. Diesmal aber muss ich es tun, denn alle anderen herkömmlichen Methoden haben versagt. Was ist mit Azilis und Naïni geschehen? Ich muss es wissen! Und bevor ich nach Marseille reise, um das vor Ort in Erfahrung zu bringen, nutze ich diese Zeit besser hier bei mir.“
„Was wollen Sie tun, Meister?“, fragte der Schüler neugierig.
Sâr Dubnotal überlegte ein Weilchen, dann antwortete er mit tiefem Ernst: „Ich werde mit meinem Freund Ranijesti Kontakt aufnehmen – und zwar aus der Ferne, Rudolf. Ich hoffe, dass es mir mit seiner Hilfe gelingen wird, Licht in das Dunkel zu bringen.“
Die Anrufung
In diesem Moment wurde an die Tür des Zimmers geklopft.
„Herein!“, rief der Psychagoge.
Die Tür öffnete sich und eine junge Frau betrat den Raum. Sie war klein, mager, nervös und nach der italienischen Mode gekleidet: Sie trug einen bunten Rock und ein Mieder, das teilweise unter einem vorn verknoteten, langen Kaschmirschal verborgen war.
Ihr durch üppige schwarze Zöpfe geschmückter Kopf, der infolge der malerischen Frisur der Neapolitanerinnen besonders geschützt war, ließ nur einen dreieckigen Spalt der Stirn frei. Der Blick ihrer dunklen Augen war für gewöhnlich stark getrübt, wie nach innen gerichtet. Es war offensichtlich, dass sie häufig bedrückenden Gedanken anhing und deshalb nicht immer ansprechbar war. In solchen Augenblicken schaute sie die Leute in ihrer Umgebung zwar an, nahm sie aber nicht konkret wahr und zeigte folglich auch keinerlei Interesse an ihnen.
Der Meister ließ ihr nicht Zeit, sich zu setzen. „Rudolf“, sagte er, „nimm deine Tasche und folge mir mit Annunciata in das Grüne Zimmer.“
Das Grüne Zimmer wurde wegen der dort vorherrschenden grünen Farben der Möbel und Wände so genannt. Die dicken Vorhänge, welche die Fenster verhüllten, bewirkten, dass dieser Raum entschieden dunkler wirkte als der vorherige. Die Einrichtung war zweckmäßig; sie bestand aus einigen Sesseln, einem großen Sofa, einem runden Tisch und einem einfachen Tischchen mit Schreibtisch.
Sâr Dubnotal nahm in einem Lehnstuhl Platz, sein Medium legte sich aufs Sofa. „Bitte, schließe die Tür und ziehe die Vorhänge vor“, verlangte der Meister dann von Rudolf.
Der junge Mann gehorchte und der ohnehin bereits relativ düstere Raum war urplötzlich in tiefes Dunkel gehüllt. Dennoch waren die beiden Psychagogen noch in der Lage, allgemeine Konturen der Gegenstände auszumachen. Die Gianetti jedoch schien von grünem Nebel umwallt zu werden; ansonsten waren der runde Tisch und das Medium kaum zu erkennen.
„Schalte die elektrische Lampe ein, Rudolf“, ordnete der Meister an. Nach einem Griff in die Ledertasche, die er bei sich trug, holte der Schüler eine Taschenlampe hervor, die mit einem besonderen Reflektor ausgestattet war, knipste sie an und projizierte einen Strahl hellen gelben Lichts in das grünliche Halbdunkel. Dann leuchtete er den ganzen Raum aus, richtete den Strahl in alle vier Ecken und ließ ihn schließlich auf dem bleichen Gesicht des italienischen Mediums ruhen.
Es sah so aus, als ob Annunciata schliefe: Sie lag vollkommen unbeweglich da, die Augenlider waren geschlossen. Sâr Dubnotal betrachtete sie aufmerksam und murmelte dann zufrieden: „Das Medium befindet sich im richtigen Zustand, Rudolf. Ich bin zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden.“ Er warf einen gebieterischen Blick auf die Italienerin und sagte mit lauter Stimme zu ihr: „Annunciata, bist du bereit, mit der Person in Kontakt zu treten, die ich dir jetzt gleich benennen werde?“
„Ja, Meister“, antwortete das Medium mit monotoner, matter Stimme.
„Gut, so lasst uns anfangen!“
Ohne zu zögern, nahmen Sâr Dubnotal und Rudolf an der Garderobe zwei lange, grüne Morgenmäntel an sich und zogen diese an. Auch Annunciata verfuhr nach ihrem Beispiel, dann reichte ihr Rudolf ein kleines Stäbchen, das er ihr in die rechte Hand drückte.
Anschließend schaltete der Schüler die Taschenlampe wieder aus und Sâr Dubnotal sagte: „Annunciata, ich möchte nun gerne in Kontakt mit dem Yogi Ranijesti treten.“
Diesen Yogi kannte der Meister noch aus seiner Jugend, als beide gemeinsam Psychagogik studiert hatten. Er war überaus begabt, verfügte über ein exzellentes Wissen und lebte sehr bescheiden und zurückgezogen von der Welt, nachdem er sich mehrfach einem harten Überlebenstraining, ohne Reis und Wasser in einem Kellerloch in Benares, ausgesetzt hatte. Es ist bekannt, dass erfahrene Yogis in der Lage sind, oftmals längere Zeit, sogar monatelang, ihre elementaren Lebensfunktionen außer Kraft zu setzen ... So auch Ranijesti, der vor allem auf diese Weise gewissermaßen im Voraus den Zustand der Glückseligkeit erkunden wollte, der dem Menschen im Nirwana zuteilwird.
Ranijesti hatte Sâr Dubnotal ermutigt, sich jederzeit an ihn wenden zu können, falls dieser irgendwann einmal ein psychagogisches Problem haben sollte, das er selbst nicht lösen könne. Der große Psychagoge hatte schon des Öfteren von diesem Versprechen Gebrauch gemacht und festgestellt, dass Ranijesti Wort hielt und er, der Meister, sich hundertprozentig darauf verlassen konnte, dass ihm der Yogi entweder als wertvoller Ratgeber oder aber als heimlicher Beschützer Beistand leistete.
Annunciata Gianetti näherte sich dem runden Tischchen und klopfte dreimal mit dem Ende ihres Stäbchens auf das Holz, was in dem stillen Raum deutlich zu vernehmen war. Darauf ließ sie sich in voller Länge auf das Sofa gleiten, wo sie bewegungslos liegen blieb.
Eine Zeit lang geschah gar nichts. Niemand reagierte auf die Einladung des Mediums, das mittlerweile träge, nahezu bewusstlos dalag. Dann aber bildete sich ein leichter Nebel dicht neben Annunciatas lang gestrecktem Körper, der sich zu einer Art Wolke verdichtete. Diese schwebte schließlich langsam durch den Raum und verharrte dann zwischen Tisch und Zimmerdecke. Von der Mitte der Wolke her zeigte sich zunächst ein blasses, verschwommenes Gesicht; der Dunst verschwand allmählich und machte einer Aura Platz. Es zeigte sich ein stattlicher, alter Mann, der in vornehme orientalische Tracht gekleidet war. Er trug einen Hinduturban, und das edle Gesicht strahlte Ekstase und Genius zugleich aus.
„Ranijesti“, murmelte der Psychagoge, dessen Augen wie gebannt an der erstaunlichen Erscheinung hingen.
Und Rudolf stammelte respektvoll: „Er lächelt Sie an, Meister!“
„Ja, weil er mich auch erkannt hat“, sagte Sâr Dubnotal. Die beiden Männer sahen zu, wie sich die Erscheinung immer mehr vergrößerte. Es war tatsächlich die genaue Projektion des weisen Yogi aus Benares, sein astrales Double, das da vor ihnen stand: geduldig, ruhig und sympathisch, offenbar nur darauf wartend, dass jemand das Wort an ihn richtete.
„Annunciata“, gebot Sâr Dubnotal schließlich, „frage meinen Freund Ranijesti, ob er damit einverstanden ist, mit mir direkt zu sprechen.“
Das Medium bewegte sich geringfügig. Die Italienerin streckte ihren Arm in die Richtung des Tisches und klopfte dann mit ihrem Stäbchen erneut mehrmals auf das Holz.
Dann geschah etwas Außergewöhnliches. Das Double des ehrwürdigen Hindus, der silhouettenhafte alte Mann, sprach mit matter, aber deutlicher Stimme. „Fangen Sie ruhig damit an, Sâr Dubnotal! Ich bin hier, um Ihre Fragen zu beantworten.“
Bei diesen Worten stieß Annunciata einen lauten Schrei aus, glitt vom Sofa auf den Boden des Zimmers und verharrte dort bewegungslos, während Rudolf fühlen mochte, wie sein Herz wie wild in seiner Brust zu schlagen begann. Obwohl er derartige Anrufungen schon des Öfteren miterlebt hatte, so fühlte er in diesem Fall eine besondere Beklemmung, ja sogar so etwas wie Furcht.
Der Meister hingegen zeigte sich wieder einmal unbeeindruckt; seine stoische Ruhe war offenbar durch nichts in der Welt zu erschüttern. Frei nach Augustus in Pierre Corneille’s Cinna mochte er sich sagen: „Ich bin in jeder Lage Herr meiner selbst.“
Er bohrte seinen Blick in Ranijestis Augen und sagte dann betont ruhig: „Möge Gottes Segen immer und überall bei Ihnen sein, auch im Nirwana! Es tut mir leid, wenn ich Sie mit meinen irdischen Problemen belästige. Aber im Moment weiß ich mir wirklich nicht anders zu helfen. Kennen Sie meinen Hindudiener Naïni?“