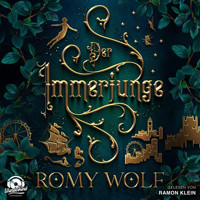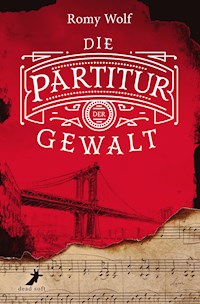Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Peter hat keine Ahnung, warum das fremde Mädchen ihn töten will. So, wie er nicht weiß, woher er kommt, warum er ein Händchen dafür hat, offen stehende Fenster zu finden, oder dass sein Nachname Pan lautet. Topsannah will niemanden töten. Doch Nimmerland liegt im Sterben, seit der alte Immerjunge nach London verbannt wurde. Ein neuer Immerjunge muss her, und dafür muss Peter Pan sterben. Während Topsannah verzweifelt versucht, Peter aufzuspüren, machen in Nimmerland fürchterliche Dämonen Jagd auf die letzten Kinder, die noch vor Ort sind. Topsannah läuft die Zeit davon. Auf der Flucht vor ihr erinnert sich Peter an sein altes Leben. Doch je mehr Erinnerungen zurückkehren, desto klarer wird ihm, dass er selbst es war, der Nimmerland einst in den Abgrund riss – und dass Topsannah mehr als einen Grund hat, ihn zu töten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Immerjunge
ROMY WOLF
Copyright © 2022 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Nina Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Übersetzungen: Marilisa
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-944-9
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Übersetzungen
Drachenpost
For Socrates
who has the best dinosaur facts
Prolog
Irgendwie hatten sie doch immer gewusst, dass Peter Pan sterben musste. Zumindest war es das, was Tinkerbell später behaupten würde.
Zu diesem Zeitpunkt aber schien der Gedanke undenkbar. Schließlich war nicht alles an ihm schlecht gewesen. Die meiste Zeit hatte er wirklich gut auf Nimmerland achtgegeben. Aber auch das war lange her, jedenfalls für einen Jungen wie Peter.
Nicht dass irgendetwas davon jetzt noch eine Rolle spielte. Es gab weitaus dringendere Dinge zu besprechen und zu erledigen. Hermia, die Königin der Meerjungfrauen, hatte sich in ihrer Nachricht an Topsannah zwar in Geheimnisse gehüllt und nicht viel preisgegeben, nur dass es dringend sei, aber man musste kein Hellseher sein, um zu ahnen, warum sie Topsannah sprechen wollte. Nimmerland lag in Schutt und Asche.
Topsannah kletterte über einen umgefallenen Baumstamm und blieb einen Moment stehen. Von der kleinen Anhöhe aus konnte sie einen Großteil der Insel überblicken. Obwohl sie wusste, was sie erwartete, traf sie der Anblick jedes Mal aufs Neue. Die kahlen und verdorrten Bäume des Waldes. Die Lagune der Meerjungfrauen, um die sich langsam ein schwarzer Ölteppich zuzog, von dem keiner wusste, wo genau er eigentlich herkam. Die einst stolze Jolly Roger, die neben dem Totenschädelfelsen auf Grund gelaufen war und deren zerrissene Segel wie Gespenster im Wind flatterten. Über der Insel hingen dunkle Sturmwolken, schon seit Wochen – oder waren es Monate? Jahre? In den Nächten brachen regelmäßig Unwetter über der Insel herein, zogen wie ein ohrenbetäubendes Grollen über das Land, und wenn Topsannah am nächsten Morgen aus ihrem Lager kroch, dann schien immer irgendwo ein Stück von Nimmerland verschwunden zu sein, zerfallen, abgebrochen, weggespült. Doch nicht nur Unwetter suchten die Nächte heim. Mit der Dunkelheit krochen Kreaturen aus den Spalten, schattenhafte Wesen mit weißen, spitzen Zähnen und langen Klauen, die all jenen auflauerten, die sich weit genug vom Lagerfeuer weg wagten. Drei Männer und zwei Frauen hatten sie bisher aus Topsannahs Stamm erwischt, und auch die Feen, Meerjungfrauen und die letzten der Piraten hatten Opfer zu beklagen.
In der Ferne rollte Donner heran, obwohl es helllichter Tag war. Der Wind strich durch die kahlen Äste und ließ die Bäume knarzen. Wie Grabmäler stachen sie aus der Erde heraus, Hunderte von verdorrten Kreuzen. Peter hatte von dem Brauch der anderen Welt erzählt, die Gräber von Verstorbenen mit einem Stück Holz zu markieren. Topsannah fand das albern. Holz verging, wurde marode und verfaulte. Nein, nein, hatte Peter gesagt, und sie hatte ihm angesehen, wie sehr er es liebte, unwissende Zuhörer zu haben. Das Holz kommt als Erstes, und dann setzt man einen Stein drauf. Wenn man bedachte, dass die Berge und Felsen von Nimmerland langsam zerfielen und in gewaltigen Stücken auf die Erde krachten, schien das nicht unbedingt eine langfristigere Lösung zu sein.
Hermia und Tinkerbell warteten schon auf Topsannah, als diese endlich die kleine Lagune erreichte. Sie lag ein wenig entfernt und war durch die überhängenden Felsen vom Land aus kaum einsehbar. Die in den Stein gehauenen Stufen lagen so gut versteckt, dass sie zufällig kaum zu finden waren. Am Horizont zog sich der schwarze Streifen des Ölteppichs entlang, doch noch war das Wasser in der Lagune klar und leuchtete türkis.
Hermia lag halb am Strand, halb im Wasser. Die türkisblauen Wellen umspülten ihren schlanken, hellen Körper sanft. Sie trug eine Krone aus Muscheln und Seetang, und in ihrem dunkelbraunen Haar hingen kleine Krebse und ein Seeigel. Sie unterhielt sich mit Tinkerbell, die auf einem niedrigen Felsen Platz genommen hatte. Obwohl Topsannah noch einige Meter entfernt war, hörte sie das entrüstete Glöckchenklingeln der Fee laut und deutlich. Es erstaunte Topsannah immer wieder, dass ein so zierliches Wesen wie Tinkerbell mehr Schimpfwörter kannte als die gesamte Besatzung der Jolly Roger.
Als Topsannah die letzte Stufe nahm, bemerkten die Fee und die Meerjungfrau sie schließlich. Hermia setzte sich ein wenig auf und strich sich einmal mit der Hand durch die üppigen Haare. Ihre tief sitzenden Augen hatten dieselbe Farbe wie der Ozean, schimmerten in Hunderten Schattierungen aus Blau und Grün.
Tinkerbell sprang auf und schlug mit den Flügeln, bis sie auf Augenhöhe mit Hermia schwebte. Seit Peter Pans Vertreibung trug sie kaum noch Kleider, sondern war auf schmale Hosen und Stiefel umgestiegen. Topsannah kam näher, verbeugte sich knapp – immerhin hatte sie es bei Hermia mit königlichem Blut zu tun – und setzte sich dann zu der Meerjungfrau an den Strand. Tinkerbell schwebte zurück auf den Felsen. Sie musterte Topsannah skeptisch.
Für einen Moment schwiegen sie bloß, tauschten bedeutungsschwangere Blicke aus und warteten darauf, dass jemand das Wort ergriff. Am Ende war es Hermia, die sprach.
»Topsannah«, sagte sie. »Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass deine Nemenakane unter der Situation sehr zu leiden hat.«
Topsannah verzog den Mund und hoffte, es würde als Antwort reichen. Wo nichts wuchs, da weideten auch keine Tiere, und wo keine Tiere weideten, da gab es auch nichts zu jagen. Selbst die Beeren an den Büschen schmeckten bitter. Die Vorräte neigten sich dem Ende zu. Die Kinder standen mit hungrig blickenden Augen vor den Zelten und wurden von ihren Eltern vertröstet, wenn sie nach Essen fragten. Es gab viele Gefahren in Nimmerland, viele Möglichkeiten zu sterben. Hunger hatte bisher nicht dazugehört.
Hermia setzte ein verständnisvolles Lächeln auf und nickte.
»Es steht außer Frage, dass etwas getan werden muss.«
»Nein, wirklich?«, fragte Topsannah. »Es läuft doch gerade alles so gut.«
Hermias Lächeln gefror. Sie war eine schöne Frau, schön und tückisch wie die See. Erneut fuhr sie sich mit der Hand durch die Haare und zog aus einer Strähne einen kleinen violetten Oktopus hervor. Sie betrachtete ihn kurz, setzte ihn dann ins flache Wasser und beobachtete, wie das Tier von den Wellen in die See gezogen wurde. War es Gutherzigkeit? Würde der Oktopus nicht schlussendlich doch in den Ölteppich geraten? Oder in die Fänge eines größeren Räubers? Bei Hermia wäre er in Sicherheit gewesen. Aber um so etwas hatte sie sich noch nie geschert.
Glöckchen ertönten. Tinkerbell hatte sich wieder zu ihrer vollen Größe aufgerichtet und die Hände in die Hüften gestemmt. Sie flatterte aufgeregt mit den Flügeln, und ein ebenso aufgeregtes Glöckchenklingeln erklang.
Genug mit dem Unsinn. Wir haben Wichtigeres zu besprechen, sagte das Klingeln.
»Natürlich.« Da war es wieder, das Lächeln, von dem man nie ganz wusste, wie ernst es gemeint war. Die Königin der Meerjungfrauen richtete ihre Aufmerksamkeit auf Topsannah. »Wir haben eine Aufgabe für dich.«
Topsannah schürzte die Lippen und zog eine Augenbraue nach oben. Letzteres war eine Fähigkeit, die sie von ihrem Vater geerbt und die sich schon oft als nützlich erwiesen hatte. Topsannah benutzte sie häufig.
»Du weißt, wann der ganze Schlamassel angefangen hat.«
Topsannah nickte. »Klar.« Sie wusste das. Jeder wusste es. Sie konnten es drehen und wenden, wie sie wollten, aber alles hatte mit Peter Pans Verbannung aus Nimmerland angefangen. Am Anfang waren es nur ein paar verwelkte Blumen und ein sterbender Baum gewesen, und sie hatten sich nicht viel dabei gedacht. Doch je mehr Zeit verstrich, desto rapider verfiel Nimmerland.
»Wir mussten ihn verbannen.«
»Ich weiß.«
»Aber das hat nicht gereicht.«
Topsannah runzelte die Stirn. Sie war sich nicht sicher, ob sie verstand, worauf Hermia hinauswollte. Sie schwieg in dem Wissen, dass die Meerjungfrau sie sicher gleich einweihen würde. Hermia hörte sich selbst fast so gern reden wie Peter Pan. Topsannah musste nicht lange warten.
»Nimmerland vergeht. Die Stürme, der verdorrte Boden, die verseuchte See, die Kreaturen, die uns jagen und töten …«
»Ich weiß, wie es um die Insel steht«, unterbrach Topsannah sie.
Hermia verengte die Augen, bis nur noch zwei Striche zu sehen waren. Königinnen unterbrach man nicht. Doch sie war nicht Topsannahs Königin.
»Tinkerbell glaubt, dass der Verfall mit Peter zu tun hat. Dass er noch immer eine Verbindung zu Nimmerland hat, und dass die Insel deshalb langsam untergeht, weil er sich nicht an uns erinnert.«
»Wir hatten uns darauf geeinigt, dass er es nicht wissen soll.«
Und er darf es nicht erfahren, warf Tinkerbell ein.
Topsannah blickte von einer zur anderen und wieder zurück. »Wollt ihr ihn etwa zurückholen?« Der Gedanke war naheliegend, auch wenn er ihr nicht gefiel. Sie wollte Peter Pan nicht wieder hierhaben, und schon gar nicht wollte sie etwas mit ihm zu tun haben, oder ihn sehen, oder nur hören, wenn Leute von ihm sprachen. Nicht nach dem, was er getan hatte. Manche Dinge konnte man nicht mehr wiedergutmachen oder vergessen.
Doch Tinkerbells Einschätzung ergab Sinn. Vielleicht konnte Nimmerland nicht existieren, wenn Peter Pan zu lange wegblieb. Das hatten sie nicht bedacht.
Das Klingeln von hellen Glöckchen ertönte, dann begriff Topsannah, dass Tinkerbell lachte. Es war kein schönes Geräusch, sondern klang schrill und verstimmt. Du dummes Ding, kicherte die Fee. Wir werden Peter Pan töten.
»Töten?«, echote Topsannah. Ihr Magen fühlte sich flau an. Halb erwartete sie, dass Hermia und Tinkerbell gleich in schallendes Gelächter ausbrechen würden. Doch die Meerjungfrau blieb ernst, und selbst Tinkerbell lachte jetzt nicht mehr.
»Um genau zu sein, du wirst ihn töten«, sagte Hermia. »Tinkerbell ist zu klein, und ich komme aus offensichtlichen Gründen nicht infrage.« Sie deutete auf ihren Fischschwanz. »Seine Verbannung war die Entscheidung von uns dreien, also müssen wir drei auch dafür sorgen, dass Nimmerland überlebt.« In ihrer Stimme schwang ein gütiger, bedauernder Unterton mit, den Topsannah ihr keine Sekunde abnahm. Hermia scherte sich nicht um Verantwortung oder Mitgefühl, wenn nicht auch etwas für sie dabei heraussprang. Leider änderte das in diesem Moment nichts daran, dass ihre und Tinkerbells Vermutung, was Peter Pans Abwesenheit betraf, Sinn ergab.
»Nimmerland braucht einen Immerjungen«, wandte sie ein.
»Und Nimmerland wird einen bekommen. Lass das ganz meine Sorge sein.« Hermia lächelte und Topsannah ertrug den Anblick nicht. Niemand sollte so grässlich-schön aussehen, wenn er lachte. »Deine Aufgabe ist es, Peter Pan zu töten«, fuhr Hermia fort. Sie legte den Kopf schief. »Du hast doch kein Problem damit, oder?«
Oder, Tiger Lily? Du wirst doch kein Problem damit haben? Die Fee kicherte hämisch.
Sie starrte Tinkerbell düster an, doch die zeigte sich unbeeindruckt. Ob sie ein Problem damit hatte, einen Menschen zu töten? Natürlich hatte sie das. Sie wäre über sich selbst erschrocken, wenn ihr der Gedanke keine Bauchschmerzen bereitet hätte. Ganz gleich, was Peter Pan ihr, ihrem Volk und der Insel angetan hatte. Doch wenn es die einzige Möglichkeit war, alle und alles zu retten, was sie liebte, würde sie den Immerjungen umbringen. Sie schüttelte den Kopf.
Hermia nickte zufrieden. »Wir wussten, wir können uns auf dich verlassen.«
»Wo kann ich ihn finden?«
»Soweit wir wissen, ist er noch immer in London. Bis dahin können wir dich schicken. Danach bist du auf dich selbst gestellt.«
Wie auf ein stummes Kommando verschwand Tinkerbell hinter dem Felsen und tauchte mit einem kleinen Beutel, der fast doppelt so groß war wie sie, wieder auf. Ihre Flügel flatterten hektisch vor Anstrengung. Sie hievte den Beutel zu Topsannah, das Gesicht hochrot von diesem Kraftakt, und Topsannah streckte die Hand aus. Tinkerbell ließ den Beutel hineinfallen und sank nach Luft schnappend zurück auf den Felsen.
Topsannah wog das merkwürdige Geschenk in der Hand. »Murmeln?«
»Nicht irgendwelche Murmeln. Peter Pan hatte sie bei sich, als er das erste Mal aus der Menschenwelt nach Nimmerland kam.« Das Wort Entführung hing unausgesprochen zwischen ihnen. »Sie werden dich zu ihm führen wie ein Kompass.«
Mehr sagte sie nicht dazu, und Topsannah widerstand dem Drang zu fragen. Sie bezweifelte, dass sie eine klare Antwort bekommen hätte. Nachdenklich strich sie die Ärmel ihres grob gewebten Hemdes glatt und atmete einmal tief durch. »Seid ihr sicher, dass ihr solange ohne mich auskommt? So wie die Lage sich entwickelt, wird es eher schlimmer werden als besser. Wer passt auf mein Volk auf?«
Pfui. Du kannst hier nichts tun, erklang das vertraute Glöckchenklingeln.
Tinkerbell flatterte von dem Felsen auf und ließ sich auf Hermias Schulter nieder. Sie gaben ein seltsames Paar ab, aber eins, das merkwürdig gut zusammenpasste. Die Meerjungfrau und die kleine Fee. Irgendwo erzählte man sich Geschichten darüber. Und dann war da noch sie selbst, Topsannah, Anführerin ihres Volkes. Niemand verneigte sich vor ihr. Das mussten sie nicht.
Der Gedanke, die Frauen, Männer und Kinder zurückzulassen, behagte ihr überhaupt nicht. Aber wenn Peter Pan selbst noch von der Menschenwelt aus Nimmerland ins Verderben schickte, dann gab es nur eins, was getan werden konnte, und es lag an ihr, es zu tun. Sie war eine Kriegerin, eine gewandte Jägerin, sie war zielsicher mit Pfeil und Bogen und geschickt mit dem Dolch. Sie wollte niemanden töten, nicht einmal Peter. Aber sie würde es tun. Das waren die Regeln, wenn so viele Leben davon abhingen.
Sie hörte Tinkerbell wieder lachen, und diesmal schienen die Glöckchen noch schriller, noch aufgeregter zu läuten.
Peter Pan muss sterben. Peter Pan wird sterben.
Kapitel1
Peters besonderes Talent war es, offene Fenster zu finden. Zu jeder Tageszeit, an jedem Ort, wann immer er wollte.
Erstaunlich fand er, dass die Menschen immer wieder vergaßen, Fenster zu verriegeln, doch beklagen würde er sich ganz bestimmt nicht. Die Nachlässigkeit bedeutete weniger Nächte im Freien für ihn.
Die äußeren Vororte von London am letzten Zipfel der U-Bahn unterschieden sich deutlich von den noblen Vierteln in der Innenstadt, waren weniger aufpoliert und wirkten eher wie Kleinstädte, denen man irgendwann den Stempel London aufgedrückt hatte, was nicht selten der Wahrheit entsprach. Entlang der Hauptstraßen drängten sich Supermärkte, Bäckereien, Wettbüros, Banken, kleine SPAR-Märkte und Schnellimbisse, die Essen aus allen Winkeln der Welt verkauften. Davon gingen kleinere und schmalere Straßen ab, an denen aufgereiht wie Perlen an einer Schnur Häuser standen. Ein Fenstererker mit zugezogenen Vorhängen dahinter, ein Windfang, der Vorgarten nicht selten betoniert, um als Parkplatz zu dienen. Hier ging Peter auf Jagd.
In den vergangenen Monaten – oder waren es Jahre? – hatte Peter gelernt, dass es wichtig war, beschäftigt auszusehen, während man in Wahrheit rumlungerte und die Gegend auskundschaftete. Er trug all seine Besitztümer – zwei frische Pullover, eine Hose und etwas Unterwäsche zum Wechseln und ein paar Murmeln, die er einem Erstklässler geklaut hatte – in einem blauen Rucksack, auf dem Kinder ihren Namen gekritzelt hatten. Der Rucksack gehörte streng genommen ebenfalls nicht ihm, aber er konnte wirklich nichts dafür, wenn andere nicht auf ihre Sachen aufpassten.
Ein paar Häuser sahen vielversprechend aus. Trotz der grauen Wolken brannte kein Licht, und der Post nach zu urteilen, die sich hinter der Haustür sammelte, war seit ein paar Tagen niemand mehr zu Hause gewesen. Peter konnte keine Schlösser knacken, aber das brauchte er auch nicht. Ihm genügte ein offenes Fenster.
Es hatte schon den ganzen Tag genieselt, doch gegen Abend ließ der Himmel einen Wolkenbruch auf London los, als wollte er persönlich den Wasserstand der Themse korrigieren. Peter hatte die Hände in die Jackentaschen geschoben, die Kapuze hochgezogen und versuchte nicht allzu sehr auszusehen wie jemand, der ziellos seit Stunden durch den Regen gewandert war. Ihm war kalt, die Kleidung klebte wie eine zweite Haut an seinem Körper, und außerdem knurrte sein Magen seit Stunden. Der Wind peitschte den Regen unbarmherzig durch die Straßen. An den Bordsteinen hatten sich Pfützen gebildet und spiegelten die umliegenden Häuser und den Himmel verzerrt wider.
Aus einigen Häusern drang der Duft von frisch zubereitetem Abendessen, und Peters Magen knurrte erneut.
Am Anfang, als Peter nach London gekommen war, hatten sich ihm die Optionen praktisch aufgedrängt, aber die Leute schienen tatsächlich zu lernen, dass man lieber noch mal nachprüfte, ob ein Fenster wirklich verschlossen war, bevor man sein Heim für mehrere Tage verließ. An diesem verregneten, kalten Herbstnachmittag musste Peter lange nach einer Gelegenheit suchen, und während er durchweicht und durchgefroren durch die Straßen streifte, kam ihm zum ersten Mal der furchtbare Gedanke, dass er diesmal vielleicht die Nacht im Freien verbringen musste.
»Keine Sorge«, murmelte er. »Wir werden schon was finden. Wir finden immer was.«
Trotzdem ergab sich die Gelegenheit erst, als er schon beinahe aufgeben wollte. Das Haus stand am Ende einer Sackgasse. Im Vorgarten wucherte das Gras in alle Richtungen. Hinter der Haustür stapelten sich Briefumschläge und Werbeprospekte. Kein Licht brannte.
Peter schaffte es, sich durch jedes Fenster zu zwängen, egal wie schmal und unüberwindbar es wirkte, doch diesmal hatte er tatsächlich etwas Glück.
Das Haus hatte altmodische Fenster, die sich nach innen öffnen ließen, statt nur wie üblich einen Spalt Luft hineinzulassen, und jemand musste vergessen haben, das obere Schlafzimmerfenster korrekt zu schließen, denn Peters trainiertes Auge bemerkte sofort, dass der rechte Flügel nur angelehnt war.
Peter kannte keine Höhenangst, und es dauerte keine Minute, bis er sich an der Außenmauer entlang nach oben gehangelt hatte. Er stieß das Fenster auf, und es gab wie erwartet nach. Peter hüpfte hinein und schloss das Fenster hinter sich. Dies war vorläufig sein Zuhause, und er dachte nicht daran, es mit anderen zu teilen.
So wie Peter das sah, war er ein Gast in diesem Haus, auch wenn man ihn nicht offiziell eingeladen hatte, und als solches war es sein gutes Recht, sich wie zu Hause zu fühlen. Schließlich benutzte und brauchte das Haus gerade niemand, was eine Schande war.
Als erste Maßnahme schlüpfte Peter unter die Dusche und bediente sich großzügig an den teuer riechenden Shampoos und Duschgels. Wer auch immer hier wohnte, hatte eindeutig Geschmack. Er ließ das heiße Wasser über seinen ausgekühlten Körper laufen, bis seine Haut rot war und man im Badezimmer vor Dampf kaum noch etwas sehen konnte. Dann drehte er den Hahn zu, kämmte sich nachlässig mit einer der Haarbürsten, die auf der kleinen Kommode lagen, und wickelte sich in einen übergroßen, flauschigen Bademantel, der an einem Haken bereithing und praktisch auf ihn wartete. Seine nasse Kleidung warf Peter über die beheizten Handtuchhalter und hoffte, dass sie den Rest übernahmen.
Im Schlafzimmer stand ein großes Doppelbett, flankiert von jeweils einem großen Schrank. In dem einen hingen Kleider und Blusen, in dem anderen Schrank Blazer, Anzüge und Wollpullover mit Zopfmustern.
Die Sachen des Vaters waren Peter zwar etwas zu groß, aber sie würden schon reichen, bis seine eigene Kleidung wieder trocken war. Unzeremoniell wühlte Peter sich durch den Kleiderschrank und schnappte sich schließlich einen grünen Pullover, der ihm zu lang war, und eine Jeans, deren Hosenbeine er zweimal umschlagen musste, um nicht darüber zu stolpern.
Wieder knurrte sein Magen laut und vernehmlich. Es wurde höchste Zeit, dass er was zu essen bekam. Er war halb verhungert. Peter trottete die schmale Treppe nach unten ins Erdgeschoss, vorbei an gerahmten Familienfotos, denen er keine weitere Beachtung schenkte, und fand sich kurz darauf in der Küche wieder. Peters Mundwinkel krümmten sich nach oben.
Die Familie besaß einen großen, mannshohen Kühlschrank, inklusive Eiswürfelmaschine. Blieb nur zu hoffen, dass man den vor der Abreise nicht leer geräumt hatte. Peter hasste es, wenn das der Fall war. Es war so rücksichtslos ehrenamtlichen Haussittern wie ihm gegenüber.
In der Tat stellte sich der Kühlschrank als unhöflich leer heraus, aber im Tiefkühlfach entdeckte Peter ein paar Chicken Wings und Mozzarella Sticks. Er nahm alles heraus, verteilte es auf einem Backblech und schob das in den Ofen. Auf der Arbeitsplatte lag ein angebrochenes Toastbrot, und in einem der Unterschränke trieb Peter ein paar Flaschen Cola auf. In seinem Magen tanzte Vorfreude. Heute Abend würde er es sich gut gehen lassen.
Das Essen im Ofen und die Getränke gesichert, beschloss Peter, sich weiter im Haus umzusehen. Das Elternschlafzimmer hatte er bereits beim Einsteigen begutachtet und entschieden, dass das breite, hohe Doppelbett für die kommenden Nächte sein Schlafplatz sein würde. Neben dem Schlafzimmer und dem Bad befanden sich im ersten Stock nur noch ein etwas kleineres Kinderzimmer in bunten Farben mit zwei Betten, und ein schmales Arbeitszimmer, das mit Aktenordnern und anderem Papierkram vollgestopft war. Peter verzog das Gesicht. Wie langweilig.
Im Wohnzimmer hing ein riesiger Flachbildschirm über einem unechten Kamin, in dem statt Feuerholz ein Blu-Ray-Player und verschiedene Gaming-Konsolen aufgebaut waren. Zwischen Bücherregalen, die die Wände säumten, hingen immer wieder Fotos von lächelnden und sich umarmenden Kindern, und Erwachsene mit teils grauen und weißen Haaren, die wohl Eltern und Großeltern waren.
Unentschlossen stopfte Peter die Hände in die Hosentaschen und betrachtete die Bilder.
Da waren zwei Mädchen, die immer wieder auftauchten und wohl die Bewohner des Kinderzimmers im ersten Stock waren. Eins der Bilder zeigte das ältere Kind mit einem wilden Lockenkopf und einem Baby im Arm, das wohl die Schwester sein musste. Daneben hing ein Porträt der beiden, das ein paar Jahre später entstanden war – der Lockenkopf war geblieben, doch jetzt trug das Mädchen eine Schuluniform, und ihre Schwester, die blonden Haare zu zwei Zöpfen gebunden, lachte durch riesige Zahnlücken heraus neben ihr. In einem anderen Bild saßen die beiden Mädchen vor einem Weihnachtsbaum und packten Geschenke aus, während ein weißhaariger Mann und eine ebenfalls bereits ergraute Frau, vermutlich die Großeltern, den beiden dabei zusahen. Unzählige solcher Fotos hingen an den Wänden. Peter betrachtete sie fasziniert und verstand sie dennoch nicht ganz.
Vielleicht lag es daran, dass er sich an nichts vor der Nacht, in der er allein im Leicester Square aufgewacht war, erinnern konnte. Nicht an seinen echten Namen, nicht an seine Familie, nicht daran, wo er herkam. Vier Jahre waren vergangen, seit ihn eine Polizistin aufgegriffen und in die Ambulanz gebracht hatte, weil er nur zitternd auf einer Bank gesessen hatte, in ein merkwürdiges Kostüm aus Blättern gekleidet, und keine ihrer Fragen beantworten konnte. Eine Woche hatte man ihn in der Psychiatrie behandelt und anschließend in ein Waisenheim geschickt, aus dem Peter nur zweit Tage später abgehauen war, weil Erwachsene ihm ganz sicher nichts zu sagen hatten. Seitdem schlug er sich allein durch.
Die Mädchen sahen glücklich aus, und Peter spürte einen Stich in der Brust, direkt neben seinem Herzen, den er nicht zuordnen konnte. Das Leben war besser ohne Erwachsene, die einem vorschrieben, was man zu tun und zu lassen hatte. Die einzige Person, die Peter etwas zu sagen hatte, war er selbst. Er schnaubte leise, und dann piepte die Uhr am Backofen und riss Peter aus seinen Gedanken.
Was scherten ihn schon die Familien anderer Leute. Sie hatten ja keine Ahnung, was sie verpassten.
Kapitel2
Topsannah war sich nicht sicher, ob sie Peter Pan wirklich töten wollte. Nein, das stimmte so nicht. Eigentlich wollte sie niemanden töten.
Doch noch auf dem Heimweg zum Lager ihrer Familie waren ihr Lotsee und Pahayoko entgegengekommen, ein einziges erlegtes Kaninchen in den Händen.
»Wie sollen wir davon alle satt werden?« Pahayoko hatte schwer geseufzt. Noch vor Kurzem war er der fröhlichste junge Mann gewesen, den man sich vorstellen konnte. Unbeschwert, lauter Flausen im Kopf, aber mit der Seele eines sanften Riesen. Der resignierte Blick stand ihm nicht, und Topsannah wusste in diesem Moment, dass der Immerjunge, der alte Immerjunge, der in der Menschenwelt lebte, sterben musste.
»Macht euch keine Sorgen.« Topsannah lächelte aufmunternd und klopfte Lotsee auf die Schulter. »Ich habe einen Plan.«
Sie hatte ihrer Familie und den anderen Familien, deren Anführerin sie war, Auf Wiedersehen gesagt und sich auf den Weg nach London gemacht, mit der Gewissheit im Herzen, dass ihr keine Wahl blieb. Jemand musste Peter Pan töten, und es führte zu nichts, sich darüber zu beklagen, dass ihr dieses Los zugefallen war.
Tinkerbell und Hermia hatten es irgendwie geschafft, Topsannah Geld zu besorgen und ihr die Murmeln in die Hand zu drücken. »Sie werden dich zu ihm führen.« Dann hatten sie Topsannah nach London geschickt, und hier saß sie nun, mit einem zuckenden Beutel Murmeln in der einen Manteltasche und einem Bündel grober, bunter Scheine in der anderen.
»Davon kannst du dir Dinge kaufen«, hatte Hermia erklärt.
Topsannah hatte sich die bunt bedruckten Scheine angesehen und sich gefragt, wie um alles in der Welt ein Stück Papier so wertvoll sein konnte.
»Was, wenn ich Hunger bekomme?«
»Dann musst du in einen Laden gehen und etwas Essbares gegen das Geld tauschen. Du musst überhaupt alles in der Menschenwelt gegen Geld tauschen. Aber geh achtsam damit um, denn wenn das Geld weg ist, kannst du kein neues bekommen.«
Erst hatte Topsannah gelacht, weil ihr der Gedanke so absurd vorkam. Wie konnte man etwas zu essen gegen ein buntes Stück Papier tauschen? Wo war denn da der Sinn? Und was machte dann der Nächste, der das Papier bekam? Weitertauschen. Man hätte doch direkt alles … der Gedanke verursachte ihr Kopfschmerzen. Die Fahrkarte für die U-Bahn hatte sie trotzdem gekauft, nachdem sie stundenlang an dem Automaten herumprobiert hatte, bis eine nette junge Frau ihr half. Jetzt saß sie in der grauen Linie und wartete darauf, dass die Murmeln sich meldeten, wann es Zeit war auszusteigen.
Die Londoner Welt war bunter, als Topsannah es gedacht hatte. Sie hatte erwartet, in ihrer Kleidung, mit den langen schwarzen Haaren und der gebräunten Haut herauszustechen, aber das Gegenteil war der Fall. Da saßen Menschen in allen Schattierungen in dieser Bahn, in den unterschiedlichsten Trachten und Kleidungsstücken, manche bunt wie die Vögel in Nimmerland, andere unscheinbar. Eine Frau mit dunkler Haut hatten ihre Haare zu Dutzenden kleinen Zöpfen geflochten, eine andere trug das Haar kurz, wie die Verlorenen Jungs in Nimmerland sie getragen hatten. Niemand störte sich an Topsannah. Sieh an, Peter Pan. Es geht also doch.
Sie war so fasziniert von dem Anblick, dass sie das Ziehen und Zerren der Murmeln nicht bemerkte und ihre Station fast verpasst hätte. Erst als sie die kleinen Kugeln ruckartig nach vorn rissen, wachte Topsannah aus ihrem Tagtraum auf und sprang im letzten Augenblick durch die Türen und auf den Bahnsteig.
Hinter ihr rauschte die Bahn davon in den schwarzen Tunnel. Die Vorstellung, dass der Zug einfach weiterfuhr und die Leute zu ganz anderen Orten brachte, die sie nie sehen würde, fühlte sich merkwürdig an. Nimmerland war klein. Topsannah kannte jeden Pfad, jeden Stein und jede Flussbiegung. Sie verstand plötzlich, was Tinkerbell gemeint hatte, wenn sie von ihren Ausflügen mit Peter Pan berichtete. Du kannst dein ganzes Leben in dieser Stadt verbringen und dennoch nur einen kleinen Teil kennen.
Sie schüttelte den Gedanken ab, schließlich war sie hergekommen, um einen Auftrag zu erledigen, und nicht, um Zeit in der Menschenwelt totzuschlagen. Je eher sie es hinter sich brachte, desto besser.
Sie nahm die Rolltreppe, vor der Tinkerbell sie nicht gewarnt hatte, und passierte das Drehkreuz, dann blieb sie unschlüssig stehen. Mehrere Ausgänge führten von hier aus nach oben zurück ans Tageslicht, und alles, was Topsannah besaß, waren ein paar störrische Murmeln, die sich selbst nicht ganz einig zu werden schienen, in welche Richtung es nun gehen sollte.
Kurz entschlossen nahm Topsannah die nächstbeste Treppe und fand sich an einer breiten, viel befahrenen Straße wieder. Es roch anders als alles, was Topsannah aus Nimmerland kannte – es stank bestialisch. Wie konnten Menschen hier freiwillig leben? Instinktiv hob sie den Arm vor Nase und Mund und verzog das Gesicht. Sie vermisste Nimmerland jetzt schon so sehr, dass sie das Gefühl hatte, ihr müsste die Brust zerreißen. Sie wollte nach Hause und verstand nicht, warum Peter Pan immer wieder freiwillig nach London zurückgekehrt war, um Kinder einzusammeln. Wenn die ganze Sache vorbei war, dann würde Topsannah garantiert keinen Fuß mehr in diese Stadt setzen.
Es wurde bereits dunkel, einige der Fenster waren hell erleuchtet, und die grellen Schilder der Läden durchschnitten die Dämmerung auf unnatürliche Weise. Überall blinkte und leuchtete es. Der Himmel war bewölkt, doch Topsannah war sich nicht sicher, ob man hinter all dem künstlichen Licht die Sterne überhaupt hätte sehen können.
Die Murmeln wurden ungeduldig.
»Ist ja gut«, murmelte Topsannah und setzte sich in Bewegung, dirigiert vom Zurren und Zerren der Glaskugeln. Es dauerte nicht lange, bis die Murmeln sie von der großen Straße in schmalere führten und Topsannah das Gefühl hatte, zumindest ein wenig aufatmen zu können. Hier schienen die Lichter hinter den Fenstern warm und einladend, und der Lärm der vorbeibrausenden Autos ließ nach.
Sie ging die dunklen Straßen entlang und versuchte die Eindrücke in sich aufzunehmen, zu begreifen und sich zu orientieren. Sie war die Anführerin ihres Clans, und als solche war es ihre Pflicht, Dinge schnell zu verstehen und sich mit neuen Situationen auseinanderzusetzen, damit sie keine falschen Entscheidungen traf und das Wohlergehen ihres Volkes aufs Spiel setzte. Doch die Menschenwelt war überwältigend, wenngleich nichts davon Topsannah bisher wirklich beeindruckte. Sie schloss die Finger um die Murmeln und ging weiter.
Ein paar Gestalten lungerten auf dem Gehweg herum, gehüllt in dunkle Kleidung, die Hände in den Jackentaschen und die Kapuzen hochgezogen.
»Hey, Süße«, sagte einer von ihnen, als Topsannah die Gruppe unbeeindruckt passierte. Die anderen lachten höhnisch, einer pfiff. Topsannah blieb stehen, drehte sich um und musterte die Truppe von oben bis unten, wägte ab.
Sie waren zu viert, alle weiß und in dem Alter, in dem Arme und Beine schneller wuchsen als der Rest des Körpers und junge Männer nicht so recht wussten, wie sie mit ihnen umgehen sollten. Keiner von ihnen hatte jemals einen Büffel mit Pfeil und Bogen erlegt und anschließend mit einem Dolch und purer Muskelkraft zerlegt.
Topsannah hob das Kinn, nur ein Stückchen, aber die Geste schien genug zu sein, um die Halbstarken zu verunsichern. Sie wichen einen Schritt zurück.
»Hey, Süße, was denn, das war doch nur ein Kompliment …«, sagte einer der jungen Männer. Topsannah trat einen Schritt an sie heran.
»Ich werde nicht gern aufgehalten«, sagte sie und legte den Kopf schief. Zu Hause, in ihrem Clan, brachte man ihr Respekt und Höflichkeit entgegen, und sie spürte, wie sich Wut in ihren Bauch fraß. Sie hatte keine Zeit, sich mit diesem Haufen Peter Pans herumzuschlagen.
»Jetzt stell dich doch nicht so an.« Ein anderer Halbstarker lachte nervös.
Topsannah seufzte und schob den Mantel zurück. Darunter kamen an einem Gürtel zwei Dolche zum Vorschein. Ihre Klingen spiegelten das fahle Licht aus dem Haus hinter ihr wider.
»O Scheiße«, keuchte einer aus der Truppe.
»Ich werde nicht gern aufgehalten«, wiederholte Topsannah.
»Hey, das war doch nur ein Scherz, wir …«, begann einer von ihnen, doch er kam nicht dazu, den Satz zu beenden, weil ein anderer seiner Kumpels ihn am Arm packte und mit sich riss. Die Bande ergriff die Flucht, noch bevor Topsannah überhaupt die Hand an den Griff des Dolches legen konnte.
Sie schnaubte verächtlich und ließ den Mantel wieder nach vorn fallen. Feiglinge. Doch die Zeit, darüber nachzudenken, blieb nicht, denn die Murmeln drängten sie weiter, und Topsannah setzte sich wieder in Bewegung und folgte den verschlungenen Pfaden durch das Wohnviertel.
Vor einem kleinen, unauffälligen Haus schließlich wurden die Murmeln still, fielen leblos in die Manteltasche zurück und Topsannah blieb stehen. Ihr war, als hätte ihr jemand mit der Faust in den Magen geschlagen, und in ihrer Kehle kratzte es, als müsste sie sich gleich übergeben. Sie war hier. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Nimmerland braucht dich. Nimmerland hängt von dir ab. Wenn du das verbockst, stirbt deine Heimat. Sie dachte an die Insel, an ihr Volk, ihre Schwester, ihre Mutter und ihren Vater, der nun schon seit einiger Zeit tot war. Sie dachte an die Lagune der Meerjungfrauen, das türkisblaue Wasser und den weißen Strand, an den Felsen, auf dem Peter Pan beinahe ertrunken wäre, weil er nicht schwimmen konnte. An die Meerjungfrauen, die vergnügt im Wasser planschten, und die Feen, die in den Baumwipfeln lebten und mit ihrem Lachen den Wald zum Klingen brachten. An den Wald, so wie er gewesen war, bevor das Unheil über Nimmerland gekommen war. So konnte es wieder werden. So musste es wieder werden.
Sie durfte kein Mitleid mit Peter Pan haben. Er hat dich nie gemocht, ermahnte sie sich. Nicht mal deinen Namen wollte er sich merken.
Sie nickte, wie um sich selbst Mut zuzusprechen. Als Erstes musste sie einen Weg finden, ungesehen in das Haus zu gelangen, damit sie ihn überraschen konnte. Sich versichern, dass ihr sonst niemand in den Weg geraten konnte, dass er allein war. Und dann würde sie Peter Pan töten.
Peter mochte Horrorfilme nicht, aber das hielt ihn nicht davon ab, sie sich anzusehen, wenn er welche entdeckte. In erster Linie, weil er sich ganz bestimmt von niemandem vorschreiben ließ, ob er alt genug für bestimmte Filme war, und wenn auf irgendetwas ein Sticker mit der Freigabe ab 18 klebte, war das für ihn Grund genug, sich den Film anzusehen. Was nicht unbedingt bedeutete, dass er den Anblick von abgesägten Körperteilen besonders mochte.
Er hatte das Licht nicht angeschaltet und es sich unter einer kuscheligen Decke auf dem weißen Sofa gemütlich gemacht. Die Mozzarella Sticks und der Rest der Chicken Wings lagen auf einem Teller neben ihm, und ihre Krümel zierten zusammen mit einem Cola-Fleck das ehemals makellose Sofa.
Auf dem Flachbildschirm flackerte eine Lampe in einem verlassenen Flur, der Boden knarzte, während sich eine Schattengestalt mit einem Säbel in der Hand von Zimmer zu Zimmer schlich. Peter hatte die Decke bis zur Nasenspitze hochgezogen und versicherte sich mehrmals, dass er garantiert keine Angst hatte.
Der Killer auf dem Bildschirm schob eine Tür auf, und es quietschte durchdringend über die Lautsprecher. Unwillkürlich hielt Peter die Luft an. Die Szene wechselte. Eine junge Frau saß zusammengekauert unter einem Tisch und hatte die Hände über den Mund geschlagen, um nicht zu laut zu atmen. Ihre Augen waren vor Angst weit aufgerissen.
Über Peter polterte es.
Um ein Haar wäre er vor Schreck von der Couch aufgesprungen. Sein Herz hämmerte laut in seiner Brust, und er meinte das Blut in den Ohren rauschen zu hören. Dabei hatte er doch gar keine Angst, ganz bestimmt nicht.
Hier ist niemand, Peter. Er presste die Lippen zusammen und versuchte sich zu entsinnen, ob er irgendwo einen Fressnapf oder Katzenspielzeug gesehen hatte. Wahrscheinlich war bloß etwas umgefallen.
Er kuschelte sich tiefer in sein Nest aus Decke und Couchkissen, doch die Unruhe wollte nicht weichen. Er meinte ein Knarzen zu hören, dann noch eins. Das konnte doch nicht sein. Oder? Ach, verflucht.
Vielleicht war die Blu-Ray-Wahl für heute Abend doch nicht ganz optimal gewesen. Er konnte sich den Film immer noch morgen ansehen. Vielleicht bei Tageslicht. Peter tastete nach der Fernbedienung, aber irgendwie war sie in der letzten Stunde anscheinend abhandengekommen. So ein Mist. Brummend schälte er sich aus den Wolldecken, tapste zum Kamin und schaltete den Player aus.
Er drehte sich ganz um, und da stand ein Mädchen auf der Treppe.
Noch während er einen entsetzten Schritt nach hinten machte, schwang sich der Eindringling elegant über das Geländer und setzte federleicht auf dem Boden auf. Gelassen zog sie etwas aus dem Ärmel, das im Halbdunkel bläulich schimmerte. Erst im zweiten Moment begriff Peter, dass es ein Dolch war. Er stolperte noch einen Schritt rückwärts, bis er mit dem Rücken den Kaminsims berührte.
»Wer …«, brachte er hervor. »Was willst du?«
Das Mädchen war ungefähr in seinem Alter – welches Alter das auch immer sein mochte. Ihre Haut hatte die Farbe von Kupfer, und ihr dichtes schwarzes Haar hing in einem langen Zopf über ihre Schulter. Sie trug ein Oberteil und eine Hose aus weichem, rauem Leder und dazu Stiefel und einen Mantel, der ihr ein wenig zu groß war. Nicht der sonderbarste Aufzug, der Peter in London je begegnet war. Doch das Mädchen umklammerte entschlossen den Dolch in der Hand und starrte ihn an, als sei er die Quelle allen Übels.
»Durchs Fenster?«, fragte sie spöttisch. »Wirklich?«
Ihre Stimme klang merkwürdig vertraut, auf die Art, wie man nach dem Aufwachen manchmal glaubte, noch den Nachhall eines Traumes zu spüren.
»Wer bist du?« Er hörte das Beben in seiner Stimme. Was tat sie hier? War sie wegen ihm hier, oder hatte sie gehofft, die verreisten Urlauber ausrauben zu können?
Der Körper des Mädchens blieb angespannt wie eine Raubkatze kurz vor dem Sprung. In der Hand blitzte der Dolch auf. Sie hantierte wie beiläufig damit.
»Wer ich bin?« Sie verzog den Mund zu einem Lächeln, das Peter einen Schauer den Rücken herabschickte. »Ich bin der Tiger, der dich umbringen wird, Peter.«
Er konnte den erstickten Laut, der seiner Kehle entwich, nicht unterdrücken. Dann verstand er, dass sie seinen Namen benutzt hatte. Sie kannte ihn. Und zwischen all der Angst flackerte ein wenig Hoffnung auf. »Kannst … kannst du mir sagen, wer ich bin? Woher weißt du, wie ich heiße?«
»Was bedeutet schon ein Name, nicht wahr?« Die Bitterkeit in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Er kannte das Mädchen. Er kannte es, so wie er den Klang von Glöckchen kannte und das Ticken des Weckers. Aber die Erinnerung entzog sich ihm, so wie eine Seifenblase, die zerplatzte, sobald man sie berührte.
»Wie dem auch sei, du sollst wissen, dass es mir keine Freude bereitet, dich zu töten. Ich wünschte wirklich, es hätte anders kommen können, Peter. Aber uns bleibt kein anderer Weg.« Leiser fügte sie hinzu: »Ich hatte dich mal richtig gern. Wir waren Freunde, du und ich. Wir alle hatten dich gern.«
In ihren Augen schimmerte es, und sie wandte kurz den Blick ab. Peter wusste, er würde sterben, wenn er nichts tat. Er hörte es in ihren Worten, in dem resignierten Tonfall, der keinen Raum für Zweifel ließ. Er wollte wissen, wer sie war, woher sie wusste, dass sein Name Peter lautete, aber wenn der Preis für die Antwort sein Leben war, dann war er nicht bereit zu bezahlen. Innerlich zählte er bis drei. Dann warf er sich nach vorn und knallte gegen die Einbrecherin.
Sie hatte mit dem Angriff nicht gerechnet und fiel auf den Boden, Peter über ihr. Doch der Überraschungsvorteil verpuffte, bevor Peter irgendetwas anderes tun konnte, um zu fliehen. Noch immer hielt das Mädchen den Dolch in der Hand, und es hob den Arm, um zuzustoßen. Peter wollte ihn ihr aus der Hand reißen, doch seine Bewegungen waren zu langsam und zu zögerlich, der Griff des Mädchens zu stark. Sie ließ den Arm nach unten schnellen, zog ihn dann wieder nach oben. Peter begriff nicht sofort, dass sie ihn an der Schulter verletzt hatte. Dann schrie er auf.
»Feigling!«, brüllte das Mädchen. Es holte ein weiteres Mal aus, ließ die Klinge im Zwielicht aufblitzen. Aber diesmal war Peter schneller. Bevor sie zustechen konnte, griff er die Cola-Flasche vom Couchtisch und schleuderte sie dem Mädchen gegen den Kopf. Es stöhnte auf und lockerte unwillkürlich den Griff. Peter entriss ihr den Dolch, warf ihn zur Seite und sprang auf die Füße. Weg, er musste hier weg. Er rannte zur Haustür und rüttelte daran, doch sie war verschlossen. Das Mädchen war inzwischen wieder auf den Beinen und hatte den Gesichtsausdruck eines verletzten Raubtieres. Er zweifelte nicht daran, dass sie ihn mit bloßen Händen erwürgen konnte, wenn sie wollte. Und vermutlich wollte sie.
»Peter«, fauchte seine Angreiferin.
»Warum willst du mich umbringen? Was hab ich dir getan?« Er drückte sich von der Haustür an der Wand entlang. Ein weißer Blitz aus Schmerz flammte in ihm auf. Er fuhr herum und sah, dass an der Wand Blut klebte, drehte sich aber blitzschnell wieder nach vorn. Er durfte das Mädchen nicht aus den Augen lassen. Wenn er nur das Fenster erreichen konnte …
Ihr Blick folgte ihm. Sie rückte den Dolch in ihrer Hand zurecht und wischte sich einmal mit dem Arm über den Mund. Zögerte sie etwa?
»Das spielt keine Rolle«, erwiderte sie.
»Och, ich finde schon, dass das eine Rolle spielt.« Er tastete hinter sich, hoffte irgendetwas zu finden, was ihm weiterhelfen konnte. Den Knopf für eine Geheimtür, zum Beispiel. Doch alles, was er fand, war ein kleiner Blumentopf auf der Fensterbank.
Peter packte ihn und knallte ihn dem Mädchen mit aller Kraft entgegen.
Diesmal überraschte er sie nicht. Die Einbrecherin warf sich zur Seite, um dem Geschoss auszuweichen. Im selben Moment öffnete Peter das Fenster, stieß es auf und sprang nach draußen in den Vorgarten.
Er wartete nicht, ob das Mädchen ihm folgte, sondern hüpfte über das kleine Mäuerchen, das den Garten vom Bürgersteig trennte, und rannte so schnell wie er konnte. Nur Sekunden später erklangen hinter ihm Schritte. Seine Angreiferin folgte ihm, und Peter mobilisierte alle Kräfte, um einen Zahn zuzulegen.
Schon nach kurzer Zeit war er völlig außer Atem. Seine Lunge brannte, genau wie seine verletzte Schulter. Doch jedes Mal, wenn er daran dachte, langsamer zu werden, hörte er die Schritte des Mädchens und lief weiter durch das verschlungene Netz aus Nebenstraßen, in dem er sich so gut auskannte. Doch immer wenn er glaubte, seine Verfolgerin abgeschüttelt zu haben, tauchte sie wieder auf. Schließlich traf er auf die Hauptstraße.
Kurz zögerte er, ohne eine genaue Ahnung, wohin er laufen sollte. Er entschied sich für rechts, rannte weiter, überquerte eine Straße, ohne auf die Autos zu achten, hörte Reifen quietschen und Menschen fluchen. Er rannte weiter, sah nicht wohin, immer weiter und weiter, wagte nicht, über die Schulter zu sehen und abzuschätzen, wie dicht das Mädchen ihm auf den Fersen war.
Auf dem Gehweg tat sich eine Treppe nach unten auf, darüber das Zeichen der U-Bahn. Peter hetzte die Stufen nach unten und fand sich in einem gefliesten Raum wieder, in dem schummriges Licht von der Decke flackerte. Rechts und links von ihm taten sich Barrieren auf, der Zugang zur U-Bahn war versperrt. Er konnte die Schilder darüber nicht entziffern, er hatte keine Ahnung, wohin die Züge fuhren. Um diese Uhrzeit war selbst in London die U-Bahn fast menschenleer. Niemand, der sich darum kümmerte, was ein schlaksiger Junge mit Blut an der Schulter so spät am Abend hier zu suchen hatte. Peter lief auf die Barriere zu, warf nun doch einen Blick über die Schulter, erspähte das Mädchen, das die Treppe herunterkam und nach ihm Ausschau hielt. Als sie ihn entdeckte, schrie sie triumphierend auf.
Peter hatte keine Zeit zu verlieren. Er stützte sich rechts und links an den Ticket-Lesegeräten ab und setzte über das Drehkreuz hinweg, hastete die Rolltreppe nach unten. Peter nahm zwei, drei Stufen auf einmal, sprang dem Boden entgegen. Ein langer Tunnel folgte. Er rannte, obwohl seine Lunge heftig protestierte und seine Schulter pochte und schwarze Punkte vor seinen Augen zu tanzen begannen. Er konnte spüren, wie er langsamer wurde, und biss die Zähne zusammen. Er wich den wenigen Leuten aus, die ihm entgegenkamen, überholte die, die in seiner Richtung unterwegs waren. Hinter sich hörte er hastige Schritte. Das Mädchen holte auf.
Schließlich erreichte er eine zweite Treppe. Peter stolperte mehr, als dass er lief. Da stand eine U-Bahn, bereit zur Abfahrt. Der Mann am Lautsprecher verkündete, dass man zurücktreten solle. Peter sprang die restlichen Stufen nach unten. Ein Schritt, zwei Schritte, die Türen schlossen sich, er war drin. Er fiel gegen einen leeren Sitz, sah seine Verfolgerin mit den Fäusten gegen die Türen trommeln, dann fuhr der Zug los.
Kapitel3
Keuchend zog Peter sich an der Sitzlehne hoch. Er fühlte sich merkwürdig leicht im Kopf. Seine Brust schien zu eng, um frei zu atmen, als gäbe es nicht mehr genug Luft auf der Welt. Er sank zurück in den Sitz und biss die Zähne zusammen. Seine Schulter schmerzte höllisch, aber er war zu erschöpft, um dem Pochen weitere Beachtung zu schenken.
Träge ließ er den Blick durch den Wagen schweifen. Zum Glück war er zu der späten Stunde praktisch leer. Nur etwas weiter hinten saßen zwei Mädchen und sprachen leise miteinander, bevor eines der beiden Peter entdeckte. Sie schien die ältere der beiden zu sein und musterte ihn eingehend. Ihr schwarzes, lockiges Haar trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ihre Haut war ein sattes, dunkles Braun. Sie flüsterte dem anderen Mädchen etwas zu, das anschließend ebenfalls einen Blick in Peters Richtung riskierte. Ihre Haut war blass wie Porzellan, ihr Haar hatte sie unter einer Kapuze versteckt.
Peter fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und bemühte sich, zu Atem zu kommen und einen klaren Gedanken zu fassen. Am besten stieg er an einer der nächsten Stationen aus, bevor die Mädchen begannen, Fragen zu stellen oder am Ende jemand verständigten. Er musste nur irgendwie zurück auf die Beine kommen. Ein schales Lachen entglitt seiner Kehle, weil ihm der Gedanke so absurd erschien. Die Mädchen sahen auf und Peter streckte ihnen die Zunge raus. Er fühlte sich schwerelos. Die Welt verschwamm. Dunkelheit und Licht wechselten sich miteinander ab, die U-Bahn schaukelte wie ein Schiff bei starkem Seegang. Er musste an eine Kapitänskajüte denken und fragte sich, ob U-Bahnen Steuermänner hatten.
»Hey!« Jemand schüttelte ihn an der Schulter. Er schreckte hoch und hob abwehrend die Hände vor das Gesicht. Doch es war nicht seine Verfolgerin, die vor ihm stand, sondern das Mädchen mit den schwarzen Locken, das ihn beobachtet hatte. Peter blinzelte ihr entgegen.
Sie hatte Sommersprossen im Gesicht. Das war das Erste, was ihm auffiel. Kleine dunkelbraune Punkte, die sich über ihre Nase und auf den Wangen verteilten. Er lachte, und wusste nicht warum.
»Du blutest«, stellte das Mädchen fest. Erst jetzt sah er, dass das blasse Mädchen mit den roten Haaren hinter ihr stand und ihn aus großen wässrig-blauen Augen betrachtete.
»Ich weiß«, sagte er.
»Du brauchst einen Arzt.«
Er musste an die Ärzte denken, die ihn für verrückt erklärt hatten, und schüttelte heftig den Kopf. Ihm wurde schwindelig. »Nein, keinen Arzt.« Sein Kinn sank auf seine Brust, um ihn wurde es schwarz. Er riss sich zusammen und verkündete: »Es geht schon wieder.«
Der Ausdruck in den Augen der beiden Mädchen verriet, dass sie ihm kein Wort glaubten.
Das ältere Mädchen mit den Sommersprossen setzte sich neben ihn und legte ihre Hand behutsam an seine Wange. Er zuckte zusammen.
»Wer war das?«, fragte das Mädchen und deutete mit dem Kinn zu seiner Schulter. Als er nicht antwortete, sagte sie: »Ich heiße Olivia. Das ist Geraldine.« Sie nickte zu dem blassen Mädchen hinter ihr. »Wie heißt du?«
Er musste einen Moment nachdenken. »Peter.«
»Wer war das?«, fragte Olivia noch einmal. Er blickte in ihre dunklen Augen und schien darin zu versinken. Sie erinnerten ihn an das Meer bei Nacht. »Hey.« Sie schüttelte ihn wieder an der Schulter. »Nicht einschlafen, Peter.«
»Ich schlafe nicht«, brummte er.
Olivia wandte sich um und sagte etwas zu ihrer Freundin, doch sie war plötzlich zu weit weg, um es zu verstehen. Peter versuchte sich in dem Sitz weiter aufzurichten, doch seine Beine rutschten ihm weg. Auf einmal war ihm übel. Dann war Olivias Stimme wieder ganz dicht bei ihm.
»Komm schon. Wir helfen dir.«
Das Schaukeln hatte aufgehört. Olivia zog ihn auf die Füße und er stolperte hinter ihr her auf den Bahnsteig. Die U-Bahn rauschte davon.
»Ich kann dich nicht tragen«, sagte sie. »Kannst du noch gehen?«
Er nickte, so heftig, dass er das Gefühl hatte, sein Kopf würde gleich abfallen. Olivia zog ihn mit sich, auf der anderen Seite wurde er von Geraldine flankiert. Der Boden unter seinen Füßen bewegte sich. Peter blinzelte erneut und setzte sorgsam einen Fuß vor den anderen. Es ging eine Rolltreppe rauf, dann standen sie vor der Barriere.
»Oje«, nuschelte Peter. »Ich hab kein Ticket.«
»Keine Sorge.«
Sie steuerten auf die Barriere zu und Peter war zu schwindelig, um irgendwelche weiteren Einwände zu haben. Kurz vor den Drehkreuzen bugsierte Olivia ihn ein Stück zur Seite, zu einer Gittertür, vor der ein Mann in blauer Uniform postiert war. Noch während Peter sich fragte, was zum Geier Olivia wohl vorhatte, sprach das Mädchen den Mitarbeiter an.
»Hey, Davey.«
Der Mann nickte ihr freundlich zu und zog die Augenbrauen hoch, als sein Blick auf Peter fiel. Schlagartig wurde Peter heiß. Wenn der Mann ihn nun packte und zum Arzt schleifte, dann … Er wollte sich losreißen, aber Olivia war erstaunlich kräftig. Auch Geraldine konnte für ein so zierliches Geschöpf überraschend fest zupacken. Olivia deutete zu Peter, der Mühe hatte, überhaupt auf den Beinen zu bleiben.
»Ich hab da was in der U-Bahn aufgegabelt. Lässt du uns durch?«
»Er sieht nicht gut aus.«
»Ich weiß, aber er will keinen Arzt.« Sie bedachte Davey mit einem langen Blick. Peter wusste nicht, worüber genau sie mit ihm kommunizierte, aber der Mann schien zu verstehen. Er schloss die Tür auf und öffnete sie. »Sieh zu, dass du die Wunde versorgt kriegst«, sagte er.
»Werd ich.«
Olivia zerrte Peter weiter. An seinem anderen Arm klebte Geraldine. Sie war kleiner als er, wirkte aber weiterhin fest entschlossen, ihn ebenfalls zu stützen. »Werd jetzt bloß nicht ohnmächtig«, sagte sie.
Später konnte er sich nicht mehr daran erinnern, wie er den Rest des Weges zurückgelegt hatte, wie er die Stufen hoch zur Straße erklommen und noch ein paar Straßen weitergelaufen war. Aber auf einmal stand er in einem kargen, kalten Raum. Die Fenster waren eingeschlagen und die fehlenden Scheiben mit Pappe verkleidet. Auf dem Boden lag Schutt.