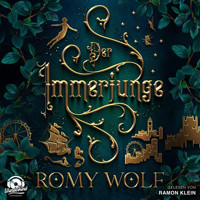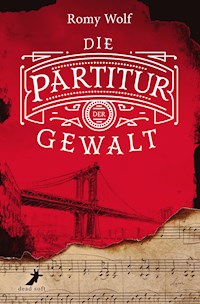Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ach je Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Queer*Welten
- Sprache: Deutsch
Queer*Welten ist ein halbjährlich erscheinendes queerfeministisches Science-Fiction- und Fantasy-Magazin, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kurzgeschichten, Gedichte, Illustrationen und Essaybeiträge zu veröffentlichen, die marginalisierte Erfahrungen und die Geschichten Marginalisierter in einem phantastischen Rahmen sichtbar machen. Außerdem beinhaltet es einen Queertalsbericht mit Rezensionen, Lesetipps, Veranstaltungshinweisen und mehr. In dieser Ausgabe: Stadt der Sündigen von Romy Wolf (Kurzgeschichte) Das letzte Marzipanbrot von Rebecca Westkott (Kurzgeschichte) Rechter Haken von Jol Rosenberg (Kurzgeschichte) Historisch korrekte Drachenreiter von Alex Prum (Essay) Queertalsbericht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
https://queerwelten.de
Ach je Verlag
Berlin - AT&Tlantis - Tschuri
https://ach.je
Impressum
Herausgeberinnen:
Judith Vogt, Lena Richter, Kathrin Dodenhoeft
1. Auflage
©2020 Ach je Verlag
ein Imprint des Amrun Verlag Traunstein
Layout: Kathrin Dodenhoeft
Covergestaltung Rilana Blumenstiel
Queer*Welten Logo: Milan Dangol
https://milandangol.de
Ebook Herstellung im Verlag
ISBN 978-3-947720-79-8 (Heft)
ISBN 978-3-95869-480-4 (E-Book)
Inhaltsverzeichnis
Über unsere*n Cover-Künstler*in: Tanks Transfeld
Impressum
Vorwort
Stadt der Sündigen
Über Romy Wolf
Das letzte Marzipanbrot
Über Rebecca Westkott
Rechter Haken
Über Jol Rosenberg
Historisch korrekte Drachenreiter
Über Alex Prum
Queer*Welten – Der Queertalsbericht 02/2021
Orientierungsmarken
Inhaltsverzeichnis
Cover
Vorwort
Liebe Leser*innen,
wir begrüßen euch zu einer weiteren Ausgabe Queer*Welten, die wir mit einleitenden Worten zum Thema Pandemie beginnen könnten. Doch eigentlich ist dazu schon alles gesagt. Wir hoffen einfach, dass ihr alle noch trotz ignoranter bis böswilliger Politik, Impfdebakel und endlosem Nicht-so-richtig-Lockdown durchhaltet und euch unsere fünfte Ausgabe die Zeit etwas versüßen kann.
Auch der 8. März fand dieses Jahr unter Pandemie-Umständen statt, und er brachte einige Diskussionen mit sich: Nennt man ihn jetzt Frauentag oder feministischen Kampftag? Ziemlich unschöne transfeindliche Diskurse entwickelten sich im Internet, cis Frauen forderten, der 8. März sollte nur ihnen gehören und wollten ihn nicht mit anderen teilen. Für uns ist das Grund genug, an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir bei Queer*Welten intersektional denken wollen. Die Forderung nach intersektionalem und solidarischem Denken wird zu oft als eine Art Bedrohung oder übertriebene Anspruchshaltung gesehen, während sie in Wirklichkeit die größte Chance ist, die sich uns bietet. Denn letztendlich sind die verschiedenen Kämpfe, die wir ausfechten, einfach nur unterschiedliche Facetten des Kampfes gegen die patriarchale, cis-heteronormative, binär gedachte, neoliberale, rassistische, ableistische Gesellschaft, in der wir alle leben. Es ist immer dieselbe Illusion von „normal“ und „objektiv“, erdacht und durchgesetzt seit Hunderten von Jahren, um immer dieselben Leute an der Spitze zu halten, um immer denselben Status Quo zu zementieren und alles zu zerschlagen, was ihn infrage stellt. Auch wenn wir nicht alle Kämpfe kennen und verstehen, die andere Personen ausfechten, können wir verstehen und anerkennen, dass diese Kämpfe auch unsere Kämpfe sind – wie es auch Teresa Teske in ihrer Geschichte aus Ausgabe 4 so wunderbar gezeigt hat.
Uns nach anderen, die ähnliche Kämpfe führen, umzuschauen, kann uns helfen, zu erkennen, dass wir nicht allein sind. Wenn Menschen, die schwanger werden können, um ihr Recht auf die Autonomie über den eigenen Körper kämpfen, sollten sie die Kämpfe von trans Personen, die über ihren eigenen Körper bestimmen möchten, oder die Kämpfe von be_hinderten Menschen, die nicht aus Kostengründen in Heime eingewiesen werden sollen, nicht als Ablenkung von ihrer eigenen Agenda sehen, sondern vielmehr als potenzielle Verbündete auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben für alle. Wenn wir erkennen und begreifen, wer alles ebenfalls unter dem Status Quo und der sogenannten „Mehrheitsgesellschaft“ leidet, dann begreifen wir auch, dass wir viel mehr sind, als wir vielleicht dachten. Und dann, wenn wir an dieser Stelle mal kurz träumen dürfen, ist die Revolution vielleicht ein Stückchen näher, als wir denken.
Deshalb freut es uns sehr, dass wir in Ausgabe 5 mit „Das letzte Marzipanbrot“ auch eine Geschichte dabeihaben, in der es um chronische Krankheiten und intersektionale Diskriminierung durch Behörden geht. Und wir wünschen uns noch viel mehr Texte, die alle Facetten der Kämpfe aufgreifen, die jeden Tag von Menschen geführt werden, damit wir alle einander besser verstehen und zusammen mehr erreichen können.
Aber erstmal wünschen wir euch viel Vergnügen mit Ausgabe 5.
Eure Queer*Welten-Redaktion
Stadt der Sündigen
von Romy Wolf
Inhaltshinweise
Tod, Suizid, Abhängigkeit, Alkohol, Krebs (Erwähnung)
„Ich muss etwas regeln“, sagte Salome.
Iason, der bis eben den Boden gefegt hatte, verharrte in der Bewegung und musterte Salome kurz. Er war ein junger Bursche, gerade alt genug, um am Tag des Jüngsten Gerichts nicht mehr als Kind durchgegangen zu sein. Damals hatte er sich in einem unklugen Moment die Haare knallblau gefärbt, was seine helle Haut betonte, und musste nun für den Rest der Ewigkeit – buchstäblich – mit seiner Frisur leben.
„Dafür brauchst du Selbstgebrannten?“, fragte er und hob eine Augenbraue.
Salome schnaubte und drückte die Flasche näher an ihren Körper. Sie musste mit einer Person reden, die sie kannte, die sie verstand, und Leah war am einfachsten mit Alkohol zu bestechen. Sie war schon lange nicht mehr gut auf Salome zu sprechen, aber Salome vertraute ihr mehr als allen anderen. Woraus der Schnaps genau gebrannt war, stand weder auf der Flasche noch interessierte es Salome wirklich. Sie hatte in all der Zeit gelernt, dass es besser war, manche Dinge nicht zu wissen. Zudem konnte man es sich auf dem Schwarzmarkt nicht leisten, wählerisch zu sein. „Benimm dich oder du kannst dir einen neuen Job suchen. Viel Glück damit.“
Der Junge verzog den Mund, verkniff sich aber einen weiteren Kommentar und machte sich wieder ans Fegen.
Die Räume mit dicht aneinander gedrängten Träumenden mied Salome, wenn sie nicht gerade gebraucht wurde. Ihr Geschäft war in einem mehrstöckigen viktorianischen Reihenhaus aus roten Backsteinziegeln untergebracht, in dem nur wenige Räume noch unversehrte Fensterscheiben besaßen. Die Energie des Generators reichte gerade so, um im Winter die Zimmer und Salomes eigenes Quartier in der Kellerwohnung zu beheizen. Nicht zuletzt deshalb lagen die Kunden in Stockbetten, in übereinander angebrachten Hängematten und auf dicht aneinander gedrängten Matratzen.
Durch eine Hintertür schlüpfte Salome in einen Innenhof, der von Efeu und wild wucherndem Unkraut zugewachsen war und zumindest tagsüber für ein bisschen Grün sorgte. Am Anfang hatte sie den Traum gehegt, hier einen kleinen Garten anzulegen, doch alle Versuche waren kläglich gescheitert. Nichts, was Pflege und Liebe brauchte, überlebte ihre Nähe lange. Jetzt kaufte oder tauschte sie Gemüse, wenn jemand was zu tauschen oder zu verkaufen hatte. Im Bokim-Viertel war es ein paar Leuten tatsächlich gelungen, Reisfelder anzulegen, und Tomaten zu züchten. Salome hatte es nicht einmal vor der Apokalypse geschafft, einen Kaktus am Leben zu erhalten.
Sie steckte die Flasche in die Innentasche ihrer übergroßen, geflickten Jacke, und zog das Gartentor hinter sich zu. Leah lebte ein paar Straßenzüge östlich, in der Nähe der Stadtmauer, wo die Straßen nur schmale Gassen waren und sich die vielstöckigen Häuser in gefährlichen Schieflagen Etage um Etage auftürmten. Es erinnere sie an die Besuche bei ihren Großeltern in Guangzhou, hatte Leah geantwortet, als Salome sie einmal gefragt hatte, warum sie hier lebte und nicht in einem anderen, sichereren Viertel. In Wahrheit, vermutete Salome, hatte sich Leah dieses Quartier ausgesucht, weil es viele Winkel und verschlungene Wege gab, auf denen man ungesehen verschwinden konnte, wenn man wollte. Leah sprach nicht oft darüber, aber Salome ahnte, dass sie dem Widerstand bei der Flucht half und die Mitglieder zeitweise versteckte. Sie hatte nie einen Hehl daraus gemacht, was sie vom Regime der Engel über die Stadt hielt. Das war einer der Gründe, warum es zwischen ihnen so schwierig geworden war.
Am Anfang hatte es sich wie ein Sieg angefühlt. Natürlich, sie hatten es nicht in den Himmel geschafft, aber die Engel hatten den Menschen eine Stadt geschenkt, in der sie in Sicherheit vor den Dämonen und Monstern lebten, die nun über die verwüstete Erde herrschten. Irgendwann aber hatten sie begriffen, dass die Stadt nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Gefängnis war.
Vielleicht hätten sie draußen, in den ausgedörrten Landstrichen, bessere Überlebenschancen gehabt als in dieser Wüste aus Stein, in der jedes Pflänzchen wie ein Akt aufsässiger Bockigkeit wirkte.
Kurz nach der Ankunft der Menschen in der neu errichteten Stadt hatten die Engel sich ihnen wohlgesonnen gezeigt, sie mit Nahrung versorgt, versucht, zu helfen und die Gebäude instand zu halten. Doch irgendwann hatten sie begriffen, dass Menschen niemals zufriedenzustellen waren, dass die Dankbarkeit, überlebt zu haben, nicht von Dauer sein würde. Aus Enttäuschung wurde Wut, dann Abscheu – auf beiden Seiten. Mittlerweile verteilten die Engel nur noch selten Güter, ohne dass es einen bestimmten Anlass oder Grund dafür gegeben hätte. Sie waren Engel. Salome hatte gelernt, dass jeder Versuch, sie zu verstehen, verschwendete Zeit war.
Verrostete Autowracks säumten die Straßen. Autos, die nie auch nur einen Meter gefahren waren, weil die Engel die Autos nicht funktionstüchtig erschaffen hatten, so wie vieles in der Stadt nur Fassade ohne funktionierendes Innenleben war. Einige Wagen waren in winzige Unterkünfte umfunktioniert worden. Praktisch jedes Gefährt bestand nur noch aus Karosserie. Alles, was sich irgendwie anderweitig verwerten ließ, war schon vor langer Zeit geplündert worden. Zwischen den Gebäuden verlief ein ganzes Netz aus improvisierten Stromkabeln, Antennen und Leitungen. Hinter einigen Fenstern flackerte Licht. Tod den Engeln! hatte jemand in eiligen Buchstaben auf eine Hauswand gepinselt.
Auf der Straße lungerten ein paar Kerle herum, die Salome höflich grüßten und Platz machten, um sie vorbeizulassen. Niemand legte sich mit einer Person an, die Erinnerungen und Gedanken manipulieren konnte.
Die meisten Leute nahmen an, dass Salomes Fähigkeit eine Beigabe der Apokalypse war, doch das stimmte nicht. Ihre Gabe hatte schon zu ihr gehört, als sie noch jeden Morgen ins Büro gefahren war, um Rechnungen zu prüfen und Budgets freizugeben.