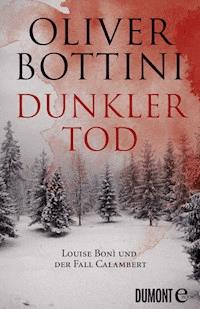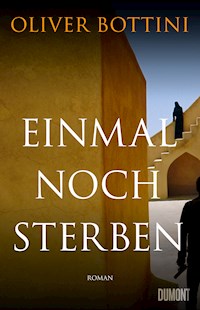9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hochspannend, dramatisch, brisant Rottweil, eine idyllische Stadt in Schwaben: Sasa Jordan steht vor dem Hof der Familie Bachmeier und wartet. Sie sehen ihn von drinnen. Aber er wartet ab. Er hat Zeit. Zeit ist alles, was er braucht, bis sie zermürbt sind – bis sie ihm freiwillig geben, was er will. Thomas Cavar war Deutscher. Gerade hatte er sein Abitur bestanden, die Zukunft wirkte vielversprechend. Doch dann kam der Krieg, der alles änderte. War nicht Kroatien seine richtige Heimat? Musste er nicht kämpfen für die Unabhängigkeit? Thomas Cavar kämpfte – und fiel. Jetzt, fünfzehn Jahre später, tauchen plötzlich Fragen zu seinem Tod auf: Yvonne Ahrens, Journalistin in Zagreb, stößt auf Hinweise zu kroatischen Kriegsverbrechen und auf einen Soldaten, der daran beteiligt gewesen sein soll. Richard Ehringer, Ex-Politiker, bittet seinen Neffen bei der Polizei in Berlin, mehr über Cavars Kriegseinsatz herauszufinden. Und Sasa Jordan, kroatischer Geheimdienstler, forscht in Rottweil nach. Dort, wo alles begann. Irgendjemand muss etwas über Cavar wissen – zum Beispiel, ob er noch lebt. Eine kaltblütige Hetzjagd beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Rottweil, eine idyllische Stadt in Schwaben: Sasa Jordan steht vor dem Hof der Familie Bachmeier und wartet. Sie sehen ihn von drinnen. Aber er wartet ab. Er hat Zeit. Zeit ist alles, was er braucht, bis sie zermürbt sind – bis sie ihm freiwillig geben, was er will. Thomas Cavar war Deutscher. Gerade hatte er sein Abitur bestanden, die Zukunft wirkte vielversprechend. Doch dann kam der Krieg, der alles änderte. War nicht Kroatien seine richtige Heimat? Musste er nicht kämpfen für die Unabhängigkeit? Thomas Cavar kämpfte – und fiel. Jetzt, fünfzehn Jahre später, tauchen plötzlich Fragen zu seinem Tod auf: Yvonne Ahrens, Journalistin in Zagreb, stößt auf Hinweise zu kroatischen Kriegsverbrechen und auf einen Soldaten, der daran beteiligt gewesen sein soll. Richard Ehringer, Ex-Politiker, bittet seinen Neffen bei der Polizei in Berlin, mehr über Cavars Kriegseinsatz herauszufinden. Und Sasa Jordan, kroatischer Geheimdienstler, forscht in Rottweil nach. Dort, wo alles begann. Irgendjemand muss etwas über Cavar wissen – zum Beispiel, ob er noch lebt. Eine kaltblütige Hetzjagd beginnt …
Oliver Bottini wurde 1965 geboren. Für seine Romane erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem viermal den Deutschen Krimi Preis, den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner ›Krimifuchs‹ und zuletzt den Stuttgarter Krimipreis für ›Ein paar Tage Licht‹ (DuMont 2014). Bei DuMont erschienen außerdem ›Der kalte Traum‹ (2012) sowie die Kriminalromane um die Freiburger Kommissarin Louise Bonì. Oliver Bottini lebt in Berlin.
OLIVER BOTTINI
DERKALTE TRAUM
ROMAN
Ein ausführliches Glossar und eine Karte des ehemaligen Jugoslawien finden Sie am Ende des Buches. eBook 2012 © 2012 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlag: Zero, München
Für Željko Peratović
und alle anderen unabhängigen Journalisten Kroatiens
Im Andenken an
Josip Reihl-Kir,
ehemaliger Polizeichef von Osijek (Kroatien),
am 1. Juli 1991 von einem kroatischen Polizeireservisten ermordet,
und
Milan Levar,
Zeuge der Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag,
Die wahren Schuldigen sind jene,
die aus Interesse, oder weil es ihr Naturell ist,
den Krieg ständig für unvermeidbar erklären,
und indem sie dafür sorgen,
dass er tatsächlich unausweichlich wird,
zugleich behaupten, es stünde nicht in ihrer Macht,
ihn zu verhindern.
Baron d’Estournelles de Constant, 1914,
I
FREUNDE
1
SAMSTAG, 9. OKTOBER 2010
NAHE ROTTWEIL/BADEN-WÜRTTEMBERG
So stellte Saša Jordan sich das Leben vor, irgendwann einmal, wenn alles vorbei war: ein sanftmütiges Tal wie dieses, umgeben von rotgoldenen Wäldern, unter einem stillen Himmel, den weder die Lebenden noch die Toten zu fürchten brauchten. In all den Jahren hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eines Tages auch in der Heimat solche Orte geben würde.
Orte, die vergessen hatten.
Aber noch war es nicht so weit.
Fast lautlos trat er aus dem Wald und stieg die Böschung zur Schotterstraße hinunter. Der Bauernhof lag jetzt in Sichtweite, Scheune und Stall, dazwischen das Wohnhaus mit rotem Schindeldach, das in der Vormittagssonne zu glühen schien. Über den Vorplatz wirbelte ein grasgrüner Punkt, das kleine Mädchen, flog hin und her wie ein Schmetterling. Ein dunklerer Punkt folgte träge, der alte Hund, trottete nach rechts, nach links, sank aufs Hinterteil.
Ein fernes Kläffen, ein Mädchenlachen, dann war es wieder still.
Jordan hatte den Namen des Mädchens vergessen, an den des Hundes erinnerte er sich, er hatte ihn in den letzten Tagen oft genug gehört – Methusalem. Als hätte Markus Bachmeier vor zwanzig Jahren geahnt, dass der Welpe in seinen Händen ein biblisches Alter erreichen würde.
1990, dachte er, ein Hund wird geboren, ein Staat entsteht. Zwanzig Jahre später kreuzten sich beider Schicksale.
Auf dem Hügelkamm jenseits des Hofes fuhr ein glitzerndes Auto, über das abgeerntete Feld neben der Schotterstraße flogen Raben. Eine Hand in der Hosentasche, das Sakko über der Schulter, folgte Jordan der Straße in Richtung Bauernhof, und der Frieden des Tales erfüllte ihn mit Ruhe.
Im Schatten eines Baumes blieb er stehen, etwa fünfzig Meter von dem Hof entfernt. Der kräftige Duft der trockenen Rinde, der Duft von Harz, ein leises Rascheln über ihm, Blätter zitterten im Wind. Er ließ das Sakko fallen, lehnte sich an den Stamm. Wartete.
Eine Stunde verging.
Das Mädchen und der Hund waren im Haus verschwunden, eine Frau im blauen Kittel hatte den Vorplatz überquert und den Stall betreten. Bachmeiers Frau oder die Angestellte, auch deren Namen hatte er vergessen.
Auf dem Rückweg zum Haus warf die Frau einen Blick in seine Richtung, kurz darauf glitt hinter einem Fenster ein Vorhang zur Seite.
Sie hatten ihn bemerkt.
Um zwölf erklang in der Ferne Glockenläuten. Minutenlang schwebten die dunklen Töne über dem Tal, zärtlicher und melodischer als das aufgeregte Gebimmel der Kirche von Briševo, das ihn und seinen Bruder viele Jahre lang zum Mittagessen nach Hause gerufen hatte. Spätestens beim letzten Schlag hatten sie am Tisch gesessen. Wer nicht da ist, wenn die Glocke schweigt, kriegt nichts, hatte der Vater oft gedroht, und die Mutter hatte gelacht und erwidert: Gib Gott, dass du nicht eines Tages taub wirst.
Als Briševo brannte, war der Hund Methusalem zwei Jahre alt gewesen.
Eine weitere Stunde verging.
Ein rundlicher Mann erschien in der Haustür, auch er sah herüber. Dann wandte er sich in Richtung Stall, das rechte Bein beim Gehen nachziehend.
Markus Bachmeier.
Vielleicht beim Mägges drüben, hatte ein Bauer aus der Nachbarschaft ein paar Tage zuvor gesagt, der hat ein kaputtes Bein und kann Hilfe gebrauchen, wenn die Hilfe billig ist.
Jordan zündete sich eine Zigarette an. Der Rauch vertrieb den Duft der Rinde und des Harzes.
Bachmeier trat aus dem Dunkel des Stalles und kehrte zum Haus zurück.
Das gedämpfte Schnattern von Gänsen, aus dem Haus ein Klirren, als würde ein Tisch gedeckt, die Kirchenglocken schwiegen.
Briševo.
Die Eltern waren in den Flammen umgekommen, der Bruder spurlos verschwunden. Er selbst war nach Omarska gebracht worden.
Zweimal noch verließen Bachmeier und die Frau das Haus und blickten auf den Mann im weißen Hemd, der kaum fünfzig Meter von ihrem Hof entfernt an einem Baum lehnte. Taten so, als hätten sie im Stall, im Garten Dinge zu erledigen.
Der Mittag verstrich.
Und Saša Jordan wartete und dachte an Briševo.
Am frühen Nachmittag kam Bachmeier, Methusalem begleitete ihn. Mit langsamen Schritten näherten sie sich, als zögerten beide, der Mann und sein Hund.
Reglos sah Jordan ihnen entgegen.
»Grüß Gott«, rief Bachmeier von weitem, die Stimme hell und jungenhaft. Ein paar Meter vor Jordan blieb er stehen. Die Augen unter den buschigen blonden Brauen waren unruhig, das Lächeln zitterte.
Jordan wandte den Blick ab.
Auf dem Vorplatz des Hofes standen die Frau und das Mädchen und beobachteten sie. Plötzlich waren die Namen wieder da, Theresa und Nina, die Angestellte hieß Rose.
Als hätte die Frau gespürt, dass er an sie dachte, griff sie nach dem Arm des Mädchens und zog es an sich. Die Mutter vermutlich, Theresa, nicht die Angestellte.
»Möchten Sie zu uns?«, fragte Bachmeier. Wie um sich den Anschein von Gelassenheit zu geben, schob er die Hände in die Taschen der Arbeitshose.
Jordan musterte ihn. Fast drei Jahrzehnte Arbeit auf dem Hof hatten die kindlichen Züge nicht aus seinem Gesicht vertrieben. Auch jetzt noch, mit siebenunddreißig, hatte er das Gesicht eines in sich gekehrten Jungen, der zeit seines Lebens zu dick, zu gutmütig, zu mutlos gewesen war.
»Oder haben Sie sich verlaufen?«
Jordan zog eine Zigarette aus der Schachtel und entzündete sie. Lehnte an dem Baum, rauchte, wartete auf den richtigen Moment.
Die Beine des Hundes zitterten jetzt.
Zwanzig Jahre, für einen Golden Retriever ein undenkbares Alter. Aber er setzte sich nicht. Vage Reste des Jagdhundinstinkts mochten ihn die Unruhe seines Herrn spüren lassen.
Ein loyales Tier.
Es ging immer um Loyalität.
Bachmeier musste gehört haben, dass Jordan sich im Tal nach Arbeit erkundigt hatte und zu ihm geschickt worden war. Hier schlitzten sich Nachbarn nicht gegenseitig die Kehle auf. Sie sprachen miteinander. Da kommt einer, der will bei dir arbeiten. Einer vom Balkan. Schon um die vierzig, aber er sieht aus, als könnte er zupacken.
Bachmeier nickte in Richtung Baum. »Vorsicht, das Harz. Nicht dass Sie sich das Hemd verderben.« In seiner Stimme schwang eine Andeutung von Angst mit. Er spürte, dass es nicht um Arbeit ging.
Mägges, dachte Jordan. Tapferer, dicker, verängstigter Mägges.
Ob er wusste, wozu man Baumharz benutzen konnte? Wenn man es erwärmte und auf kleine Wunden strich, bildete es eine desinfizierende Schutzhaut. Wenn man es erhitzte und in größere Wunden goss, verursachte es starke Schmerzen.
Doch hier, in diesem friedlichen Tal, brauchte man Baumharz nicht für diese Zwecke. Man hatte Medikamente, und es gab niemanden, dem man Schmerzen zufügen wollte.
»Verstehen Sie mich?«, fragte Bachmeier.
Jordan schnippte die Zigarette von sich und sagte sehr langsam: »Thomas Ćavar.«
»Der Tommy lebt nicht mehr«, sagte Bachmeier. »Schon lange nicht mehr.«
Jordan konzentrierte sich auf die kleinen, unruhigen Augen.
»Er ist im September 1995 gestorben, in Bosnien, im Krieg.«
Hinter den Augen tobten tausend Gedanken.
Sekunden verstrichen, ohne dass ein Wort fiel. Der Hund ließ sich nieder, legte den Kopf auf die Vorderläufe. Die Müdigkeit war größer als die Loyalität.
Schließlich räusperte Bachmeier sich. »Tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss. Er war früher oft hier, wir waren Freunde, das stimmt. Aber wie gesagt, er ist im Krieg gefallen.«
»Und Jelena?«
»Jelena kannten Sie auch?«
»Ja«, log Jordan.
»Ist mit ihren Eltern fortgegangen. 1995, kurz nach Dayton.«
»Wohin?« Das Wort wollte wie alle deutschen Wörter nur langsam aus Jordans Mund. Zu lange hatte er kein Deutsch gesprochen. Mit Briševo und den Eltern war auch die Sprache der Vorfahren verbrannt. Hier, in diesem Tal, wurde sie wieder lebendig.
»Nach Serbien, soviel ich weiß. In die Vojva…«
»Vojvodina.«
Bachmeier nickte. Die Angst schien noch nicht gewichen, hielt sich mit Erleichterung das Gleichgewicht. Man konnte doch reden mit dem Mann vom Balkan, der seit drei Stunden vor dem Hof stand, als wollte er ihn belagern. Bloß ein Bekannter von Thomas und Jelena.
Und doch …
Jordan lächelte.
Auf dem Vorplatz stand nur noch die Mutter. Sie war ein paar Meter in ihre Richtung gekommen. Nina, das Mädchen, war nicht zu sehen.
Der Hund zu Bachmeiers Füßen war eingeschlafen.
Die Oktobersonne machte das Tal träge. Das herbstliche Rotgold, der leichte Wind, der Duft nach Rinde … Aber das Tal hatte seine friedliche Anmutung verloren. Briševo und das nahe serbische Lager Omarska im Nordwesten Bosniens. Thomas Ćavar, der Kroate, und Jelena, die Serbin.
1990 und 1995, dachte Jordan. Ein Hund wurde geboren, ein Staat entstand. Ein Mann starb im Krieg, eine Frau kehrte in die Heimat ihrer Eltern zurück.
War es wirklich so gewesen?
Er sagte: »Ist Thomas hier beerdigt worden?«
»Es gibt kein Grab, nur ein serbisches Massengrab, irgendwo in Bosnien.«
»Man hat seine Leiche nicht gefunden?«
»Nein.«
Jordan nickte. Dies war die Geschichte, die er seit Tagen zu Ohren bekam. »Und von Jelena haben Sie nie wieder etwas gehört?«
»Nie wieder.«
»Aber Sie waren befreundet.«
»Wie gesagt, sie ist fortgegangen.«
Jordan hob das Sakko auf und schwang es sich über die Schulter. Mehr würde er an diesem Tag nicht erfahren.
»Wer sind Sie?«, fragte Bachmeier.
»Ein Freund.«
Jordan spürte Bachmeiers Blick im Rücken, während er die Schotterstraße zurückging. Er würde wiederkommen, und Bachmeier schien das zu ahnen. Lange stand er da und sah ihm nach.
Dann hörte Jordan einen leisen Befehl und unregelmäßige Schritte, die sich rascher entfernten, als sie gekommen waren.
Kurz darauf war er wieder im Wald, tauchte ein in die Hülle aus Blättern. In ein paar Tagen würde er in die Heimat zurückkehren, und dann, nahm er sich vor, würde er mit der Suche nach einem solchen Ort beginnen, einem Ort, der irgendwann einmal vergessen und vergessen lassen konnte.
2
DIENSTAG, 12. OKTOBER 2010
BERLIN
Lorenz Adamek starrte in das Dunkel jenseits der Fensterfront. Er wusste, dass er nicht mehr einschlafen würde, mochte er auch noch so müde sein. Lohnt sich nicht, sagte sein Hirn seit einer Viertelstunde.
3.44 Uhr.
Noch einunddreißig Minuten.
Der nächtliche Himmel war von Lichtpunkten gesprenkelt und zog sich über Tiergarten, Charlottenburg, das Westend bis tief nach Brandenburg hinein. Kein Gebäude, kein Turm stand dem Blick aus dem 24. Stock im Weg. Man wohnte jetzt Platte in Karolins Kreisen. Ambitionierte Architekten machten aus genormten Ostschachteln individuelle living spaces, in denen gestresste Westintellektuelle – und in ihrem Gefolge Kripobeamte – hoch über Berlin Inspiration und Ruhe fanden.
Mitten in der Stadt leben, von keinem Stück Beton bedrängt.
Nur Weite. Nur Freiheit.
Vorausgesetzt, man kam abends rechtzeitig nach Hause. Adamek kam jeden Tag um sechs, aber er brauchte die Weite und die Freiheit nicht. Karolin, die ihn in die Platte gequatscht hatte, kam nie vor neun, und wenn sie sich das Verlagsleben vom Leib geduscht hatte, waren die Weite und die Freiheit dunkel.
In seinen Kreisen schüttelte man den Kopf, und er verstand sich selbst nicht recht. Er hatte sich nie für die DDR interessiert. Jetzt wohnte er in ihren Resten.
Karolin bewegte sich mit einem schläfrigen Seufzer, ihre Hand strich über seine Schulter. »Hmm … Musst du schon raus?«
»In einer halben Stunde.«
»Hmm … Du Lieber, du …«
Er nahm ihre Hand, küsste ihre Stirn. »Schlaf weiter.«
»Hmm … Und du?«
»Lohnt sich nicht.«
Eine Stunde später lenkte Adamek den Wagen zu Füßen der Freiheitstürme in die Leipziger Straße. Die Scheinwerfer glitten über finstere Fassaden, in der Kälte erstarrte Frühaufsteher an unbeleuchteten Bushaltestellen. Die Weite und die Freiheit waren Illusion, Berlin war hart und abweisend.
Er mochte das.
Tief unten im Betongedränge folgte er dem Blick aus dem 24. Stock nach Westen. Aus den Lautsprechern drangen Mendelssohn-Bartholdys »Lieder ohne Worte«. Nicht unbedingt die Musik seiner Wahl, aber er wollte nicht ins kulturelle Abseits zurück, dort hatte er lange genug gelebt. Hatte es sich in der schlichten Welt der Hitparaden, Schlagzeilen und Groschenromane allzu bequem gemacht.
Bis Karolin gekommen war. Seitdem hörte er Mendelssohn, übte Annäherung durch Gewohnheit.
Er fuhr die Friedrichstraße zum Bahnhof hoch. Eine Handvoll Menschen hetzte über die Straße, über ihnen fuhr eine S-Bahn ein. Grelle Lichter, buntes Treiben hinter den Scheiben der 24-Stunden-Betriebe. Auf seine abweisende Art kümmerte sich Berlin, um alle, rund um die Uhr.
Adamek besorgte sich einen Kaffee und kehrte zum Wagen zurück.
Wer seinen Verstand nicht fordert, verdummt, hatte Karolin beim ersten Rendezvous gesagt. Diese Prophezeiung und die Bestimmtheit ihres Kreuzzuges gegen das Mittelmaß hatten ihn wachgerüttelt. Er ging mit ihr ins Theater, las die Bücher ihres Verlages, beobachtete interessiert, wie sie das elterliche Erbe in überteuertem Designerinventar anlegte.
Zog mit ihr in die Platte.
Und er lernte den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärerfahrung kennen. Man muss es fühlen, Lorenz! Man muss als Leser lachen, weinen, lieben können!
Darf man sich auch langweilen?
Man durfte.
Er hatte den Potsdamer Platz erreicht, glitt durch die Häuserschluchten. Fühlte sich zehn Sekunden lang primär wie ein New Yorker.
Richard Ehringer wartete schon.
Der Rollstuhl stand im matten Schein einer Straßenlaterne vor dem Pflegeheim. Auf Ehringers Schoß lag ein Rucksack.
Adamek hielt ein paar Meter vor ihm und stieg aus. Als er sich bückte, um Ehringer flüchtig zu umarmen, spürte er ein Stechen in der Lendenwirbelsäule. Immer häufiger klemmte das Becken, er saß zu viel. Karolin empfahl Yoga auf dem Balkon der Freiheit. Er lag lieber auf dem Sofa. Es lag sich gut auf siebentausend Euro.
»Schön, dich zu sehen«, sagte er.
»Danke, gleichfalls. Fahren wir?«
Adamek legte den Rucksack in den Fond. »Wie sieht’s mit dem Wetter aus?«
»Sechs Grad, klar, leichter Westwind.«
»Kein Regen?«
»Dann hätte ich es verschoben, Lorenz.« Ehringer hielt die Arme hoch. Die Geste hatte etwas Kindliches, und Adamek musste schmunzeln. Trägst du mich, Papa?
Erneut bückte er sich, erneut stach die Hüfte. Er lächelte verlegen, als er den leblosen Körper anhob. Onkel und Neffe, aber sie blieben einander fremd.
Sonst hatte Richard Ehringer nichts Kindliches an sich. Wie auch? Fast dreißig Jahre in der Politik, zuletzt Referatsleiter im Auswärtigen Amt unter Hans-Dietrich Genscher, damals noch, in der Bonner Republik. Dann, 1992, das abrupte Ende, seitdem in Pflegeheimen für verdiente Staatsbeamte und andere Eliten. Ein einstmals einflussreicher Mann aus dem inneren Zirkel, auf dessen Schultern ein Höchstmaß an Verantwortung gelastet hatte. Nun wurden die Schultern von halbjährlich wechselnden Zivildienstleistenden zur besseren Durchblutung mit Bienengiftcreme eingerieben.
Vorsichtig setzte Adamek ihn auf den Beifahrersitz. Von Jahr zu Jahr, so kam es ihm vor, wurde der Onkel leichter. Schon 1999, als sie sich wiedergesehen hatten, war er fast zierlich gewesen. Jetzt, mit Mitte sechzig, war er, sah man von den Armmuskeln ab, hager und knochig.
Aber willensstark.
Adamek verstaute den Rollstuhl im Kofferraum.
»Fahren wir über Spandau«, sagte Ehringer, als er neben ihm saß, »nicht über die Autobahn.«
»In Ordnung. Stört dich die Musik?«
»Nein, ich mag Mendelssohn.«
Sie passierten Schloss Charlottenburg, folgten dem Spandauer Damm. In ihrer Richtung hin und wieder ein Bus, ein Pkw, in der Gegenrichtung setzte der Berufsverkehr ein. Linker Hand glitt Adameks Dienststelle vorüber, er sagte nichts. Details interessierten den Onkel nicht.
Auch Ehringer schwieg. Er war kein Mann der vielen Worte. Nicht mehr, so hatte Adamek es verstanden.
Er dachte an den Anruf vor elf Jahren.
Der Bruder deiner Mutter, erinnerst du dich?
Ja. Ich meine, nicht so richtig.
Der Onkel aus Bonn, ein stimmloser Schatten in seinem Gedächtnis. Adamek war zwei, drei Jahre alt gewesen, als Ehringer ein paar Mal zu Besuch gekommen war, Anfang der Siebziger.
Ich ziehe nach Berlin, hatte der Onkel 1999 gesagt. Ich dachte, wir könnten hin und wieder zusammen etwas unternehmen. Essen gehen, spazieren gehen. Aber du musst mich schieben, ich sitze jetzt im Rollstuhl.
Adamek hatte eine Weile gebraucht, bis er verstanden hatte, weshalb Ehringer nicht nach München gezogen war, wo seine Schwester – Adameks Mutter – wohnte. Die Politik ging nach Berlin, und der Onkel brauchte sie zum Überleben. Brauchte die sporadischen Besuche ehemaliger Kollegen, die gelegentlichen Einladungen in die Ministerien. Er war draußen, aber er wollte noch zum Dunstkreis gehören.
»Ist es nicht schön hier?«, fragte Ehringer.
»Ja«, sagte Adamek.
Sie hatten Spandau hinter sich gelassen und fuhren durch den Staatsforst Falkenhagen. Zwei schnurgerade Kilometer auf Kopfsteinpflaster und keine Menschenseele außer ihnen.
»Wie geht es Karolin?«
»Arbeitet zu viel.«
»Ihr solltet heiraten.«
»Wir sprechen manchmal darüber.«
»Und?«
Adamek zuckte die Achseln.
Mit Tempo dreißig schlichen sie durch ein entrücktes Walddorf. Verwunschene Häuser inmitten der Natur, stille Wege, die sich zwischen den Bäumen verloren. Ein Hauch siebziger Jahre mit Sprenkeln westlicher Ökoarchitektur.
Heiraten war gerade nicht so hip.
Außerdem, argumentierte Karolin, hätten sie für Kinder keine Zeit, glaubten nicht an die lebenslange Partnerschaft, seien ihnen die Kirche ein Gräuel und der Staat – zumindest ihr – ein Ärgernis. Wozu also einen Wisch unterschreiben?
Doch das war alles nur Gerede.
Karolin war Perfektionistin und hatte panische Angst vor dem Versagen. Als Ehefrau, als Mutter, sogar als Katzenmama und Köchin, wenn sie denn einmal kochte. Sie war eine Gefangene ihrer Ansprüche an sich selbst. Gehetzt drehte sie sich um die eigene Achse, um es sich und anderen recht zu machen. Manchmal schleuderte sie die Zentrifugalkraft zu Boden. Dann lag sie nachts weinend im Bett und klammerte sich an ihn. Und das rührte Adamek zutiefst.
In solchen Moment spürte er etwas, was kaum sonst jemand an ihr wahrnahm: Wärme, Weichheit, die Sehnsucht nach Nähe.
»Vielleicht in ein, zwei Jahren«, sagte er.
»Wartet nicht zu lang.«
»Ist uns nicht so wichtig, weißt du.«
»Sollte es aber sein.«
Sie kamen an Maisäckern vorbei, folgten einspurigen, von Bäumen gesäumten Straßen mit Rissen im Belag. Noch war es draußen dunkel, doch wenn Adamek einen Blick nach Osten erhaschte, sah er die ersten Silberfäden am Horizont.
»Keine Sorge, heute ist ein guter Tag«, sagte Ehringer.
Als die Morgendämmerung ihr Licht über Brandenburg warf, saßen sie auf einem matschigen Grasstreifen außerhalb von Linum an der Straße, der Onkel im Rollstuhl, der Neffe auf einem Klappstuhl. Ehringer hatte eine Thermoskanne mit schwarzem Tee aus dem Rucksack genommen, zwei Plastiktassen, dazu Plunderteilchen vom Vortag, die sie schweigend aßen.
Um beider Hals hing ein Feldstecher. Sie waren bereit.
Seit elf Jahren kamen sie Mitte Oktober einmal hierher. Essen gehen, spazieren gehen, ja, und einmal im Jahr das Rhinluch am frühen Morgen. Aber das hatte der Onkel aus Bonn bei ihrem ersten Telefonat wohlweislich für sich behalten.
Adamek ließ den Blick über die feuchte graue Landschaft gleiten. Äcker, Grasflächen, Baumreihen und im Nordwesten verborgen die Teiche und Sumpfgebiete, die das Rhinluch so besonders machten.
Gähnend zog er den Mantel enger, versenkte den Hals im Kragen. Manchmal warteten sie Stunden. Die Natur funktionierte nach Dunkelheit und Licht, nach Sonne und Niederschlag, nicht nach den Zeigern einer Uhr.
Heiraten, dachte er.
Dass Karolin sich nicht dazu entschließen konnte, hing wohl letztlich auch mit dem Unterschied zwischen Primär- und Sekundärerfahrung zusammen. Zwei Begriffe, die präzise beschrieben, weshalb sie ihn liebte und weshalb sie sich irgendwann von ihm trennen würde. Er stand als Kripobeamter für die Primärerfahrung, sie als Lektorin für die Sekundärerfahrung. Er sah das Leben in all seinem Schmutz, sie nahm es in all seiner Ästhetik wahr und empfand den Schmutz als aufregend und authentisch. Das reizte ein paar Jahre lang, dann vielleicht nicht mehr. Nur Gegensätze, Gemeinsamkeiten mussten erst geschaffen werden, aus den Gegensätzen. Wie das Wohnen in der Platte.
Eines Tages, dachte er, würde er ihr nicht mehr genügen.
»Ich habe eine Bitte an dich, Lorenz«, sagte der Onkel.
Adamek sah ihn überrascht an.
»Kannst du einen Namen für mich recherchieren?«
»Was meinst du mit ›recherchieren‹?«
»Durch eure Datenbanken schicken.«
Er nickte zögernd.
Ein Bekannter, vor Jahren aus den Augen verloren, sagte Ehringer. Thomas Ćavar, Deutscher mit kroatischen Eltern, 1971 in Rottweil, Baden-Württemberg, geboren. Keine relevanten Treffer durch die Suchmaschinen natürlich, sonst würde er sich nicht an den Neffen wenden.
Adamek nickte erneut. »Sonst irgendwelche Anhaltspunkte?«
»Nein«, sagte Ehringer und wandte sich ab.
Und Adamek konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er log.
Gegen sieben kamen die Kraniche.
Sie griffen nach den Ferngläsern, justierten sie.
»Sechzigtausend sind hier«, sagte Ehringer.
»Hatten wir schon mal so viele?«
»Vor zwei Jahren waren es achtzigtausend.«
Erst kamen ein paar, dann wurden es immer mehr. Zumeist in Dreiecksformationen, hinter- oder nebeneinander zogen die Kraniche über sie hinweg, von den Schlafplätzen in den Teichgebieten zu den nahen, abgeernteten Maisfeldern, schlanke dunkle Leiber mit nach vorn gereckten Hälsen und weiten Schwingen. Ein-, zweihundert Meter über Adamek und Ehringer rauschte es und trompetete aus Tausenden Kehlen. Der Himmel wurde wieder schwarz, während im Osten die Sonne aufging.
Er konnte nicht recht glauben, dass die Kraniche die Nächte auf einem Bein stehend in den flachen Gewässern des Rhinluchs verbrachten, wenn auch nur auf der Durchreise in den Süden. Nicht in Florida oder Afrika oder China, sondern hier, in Brandenburg, vierzig Kilometer vor Berlin.
Er mochte sie. Die Ordnung ihres gemeinsamen Fluges gefiel ihm, die mäandernden Linien, die riesigen Dreiecke, mal breit, mal spitz, die ihm aus der Ferne wie festgefügt erschienen und sich nach und nach als aus einzelnen, bewegten Gliedern bestehend erwiesen.
Die Ordnung löste sich erst auf, wenn die Landung bevorstand, wenigstens wirkte es aus der Distanz so. Über den Maisäckern südlich von ihnen wogte und brandete es, Wellen aus Leibern hoben und senkten sich miteinander, gegeneinander, übereinander.
Nach und nach lichteten sich die Wellen.
Eine halbe Stunde später hatten sich Zehntausende Kraniche auf den Futterplätzen des Rhinluchs verteilt. Der Himmel war wieder blau, fern im Osten ging die Sonne auf.
Adamek setzte den Feldstecher ab. Ihre Blicke begegneten sich. Um Ehringers Mund lag ein Lächeln. »Fahren wir«, sagte er.
Adamek wischte die Tassen trocken, verstaute sie mit der Kanne, den Servietten, den Ferngläsern in Ehringers Rucksack.
Sie sprachen nie über Linum.
Adamek wusste nicht, weshalb sein Onkel Jahr für Jahr zu den Kranichen ins Rhinluch wollte, an einem beinahe beliebigen Morgen Mitte Oktober vor Anbruch der Dämmerung. Ehringer war kein Hobbyornithologe, kein Naturschützer, kein Bauer, kein Windradlobbyist. Und doch rief er Jahr für Jahr irgendwann im Oktober an und schlug einen Tag vor. Morgens um halb sechs fuhren sie nach Brandenburg, saßen bei Thermoskannentee und trockenem Gebäck in der Kälte und warteten.
Beobachteten die Kraniche, wechselten kaum ein paar Worte.
Fuhren nach Berlin zurück.
Jahr für Jahr seit 1999.
Niemals hatte Richard Ehringer an einem solchen Morgen eine Bitte geäußert. Geschweige denn, dachte Adamek, während er ihn zum Auto trug, eine Lüge.
3
DIENSTAG, 12. OKTOBER 2010
ZAGREB/KROATIEN
Irgendwann fand man, was man suchte.
Yvonne Ahrens hatte in New York gesucht, in Buenos Aires, in Tokio. Sie hatte ihren Job gemacht, sich in die Sprachen und Lebensweisen eingelernt und gewusst, dass sie nicht allzu lange bleiben würde.
Die Stille und die Schuld würden sie einholen, egal, wo sie sich befand. Manchmal brauchten sie ein Jahr, manchmal zwei, dann hatten sie die Ozeane und Kontinente überwunden, und Ahrens wusste, dass es Zeit war zu gehen. Sie kehrte nach Deutschland zurück, wo es am schlimmsten war, und wartete auf den nächsten freien, möglichst weit entfernten Auslandsposten.
Südosteuropa, hatte Henning Nohr vor fünf Monaten gesagt.
Ist da nicht Roger?
Kommt zurück, die Familie will nicht mehr.
Mir wäre Afrika lieber, weißt du. Oder Australien. Die Arktis.
Ich brauche dich in Zagreb.
Schick Benny runter. Er spricht Kroatisch.
Hat Probleme mit dem Cholesterin. Exjugoslawien, sagt er, wäre für ihn Selbstmord. Bitte. Du könntest sofort los.
Also war sie Anfang Juni nach Zagreb gegangen – und hatte unvermutet gefunden, was sie all die Jahre gesucht hatte: ein neues Zuhause. Das Gefühl, an einen Ort zu gehören, an dem sie die Stille und die Schuld ertragen konnte.
Sie wusste nicht genau, woran das lag. Vielleicht an der schlichten Beiläufigkeit, mit der man hier das Leben nahm. An der Unaufgeregtheit der Bewohner Zagrebs.
Ein weiterer Grund mochte die Überraschung sein. Zum ersten Mal zog sie als Auslandskorrespondentin in ein Land, von dem sie ein ausschließlich negatives Bild gehabt hatte. Die Kroaten rau und aggressiv, die Sprache hart und fremd, Zagreb ein Konglomerat hässlicher realsozialistischer Betonblöcke, der restliche Balkan kaum anders, geschweige denn besser. Dann hatte sie die Menschen in Zagreb von Anfang an als warmherzig und lebenslustig empfunden, Kroatisch als faszinierend und sinnlich, das Stadtzentrum als bezaubernd.
Selbst im strömenden Nachmittagsregen.
Sie zog die Jacke über den Kopf und trat auf den Gehweg hinaus. Ihre Wohnung lag am Tomislav-Platz in der Unterstadt, vielmehr: am Trg Tomislava in Donji grad. Mochte auch der Putz des Gebäudes bröckeln, so war die Fassade immerhin klassizistisch, und die Fenster ihrer drei Zimmer gingen auf gepflegte Rasenflächen, Blumenbeete und Bäume hinaus. Wenn sie nachts nicht einschlafen konnte, hielt sie vom Bett aus mit dem bronzenen König Tomislav Zwiesprache, der im zehnten Jahrhundert Kernkroatien, Slawonien sowie Teile Bosniens und Dalmatiens zu einem ersten kroatischen Staat vereint hatte. Er war ein guter Zuhörer. Kannte sich aus, wenn es um Einsamkeit ging.
An dem Platz entlang eilte sie nach Norden, passierte den gelben Kunstpavillon, schließlich den Hauptplatz Zagrebs, früher Platz der Republik, seit dem Unabhängigkeitskrieg Trg Bana Jelačića, an dem sich die Routen der blauen Straßenbahnen kreuzten.
Allein dieses Wort, dachte sie, über eine Pfütze springend: trg. Es sah so unsympathisch aus, doch wenn man es dann hörte, mit einem kurzen, dunklen »I« vor dem gerollten »R«, klang es geheimnisvoll und schön.
Die Sprache war ein weiterer Grund, weshalb sie sich in Zagreb wohlfühlte. So schwierig Grammatik und Aussprache waren, das Lernen ging ihr leicht von der Hand. Sechs Fälle? Kannte man doch vom Lateinischen. Dreißig Buchstaben? Die Welt der Dinge war nun mal komplex. Eine ganze Handvoll unterschiedliche Zischlaute? Der Mund freute sich.
Inzwischen war ihr die korrekte Aussprache von Č, Ć, DŽ, Š und Ž in Fleisch und Blut übergegangen. Tschüss Brötchen, im Jeep schmeckt’s Journalisten nicht.
Sie löste eine Fahrkarte, stieg in die Standseilbahn. Feuchte Leiber drängten sich gegen sie, Kinder malten Fingersonnen an die beschlagenen Scheiben. Fünfundfünfzig Sekunden lang lauschte sie den Stimmen und versuchte zu verstehen, dann hatte sie Gornji grad erreicht, die Oberstadt.
Seit vier Monaten nun tauchte sie, während sie regelmäßig über Kroatien schrieb, Tag für Tag tiefer in seine Kultur, Sprache, Politik, Geschichte und Wirtschaft ein, verbrachte Stunden in Bibliotheken, Archiven, in Gesprächen, vor dem Fernseher, dem Radio, knüpfte Kontakte. Ausländische Kollegen mied sie, in den Presse-Club ging sie selten. Eine ungeheure Sehnsucht hatte sie ergriffen, und sie folgte ihr wie in Trance. Sie wollte dieses Land und seine Menschen begreifen und ein Teil davon werden.
Endlich wieder Teil sein von etwas.
Vergiss bitte den Rest nicht, hatte Henning Nohr nach zwei Monaten gemahnt. Sarajevo, Belgrad und so.
Also reiste sie gelegentlich nach Sarajevo, Belgrad und so und kehrte jedes Mal fiebrig vor Freude nach Hause zurück.
Natürlich konnte es nicht ausbleiben, dass sie früher oder später auch die Schattenseiten Kroatiens entdeckte. Kriegsverbrechen während der Operation »Sturm« im August 1995 zum Beispiel.
Irgendwann fand man eben auch, was man nicht suchte.
Irena Lakič zuckte die Achseln. »Und?«
»Das Foto.« Ahrens deutete auf den Zeitungsartikel, den sie auf das Tischchen gelegt hatte.
Das Foto des Kapetan.
Ein junger kroatischer Soldat in Großaufnahme, der einem greisen serbischen Zivilisten die Pistole an die Schläfe presste und mit der anderen Hand dessen Kopf an den Haaren nach hinten zu zerren schien. Die Miene des Kroaten spiegelte blanken Zorn wider, die des Serben panische Angst. Augen und Mund waren aufgerissen. Aus der Nase lief Blut.
Im Hintergrund ausgebrannte Häuser, ein Stück weiter eine halb zerstörte, kleine orthodoxe Kirche, die Mauern schwarz gefärbt von Flammen.
Die Bildunterschrift lautete: 25.8.95, bei Knin: Ein serbischer Schlächter zittert vor der gerechten Strafe durch den jungen Kapetan.
Das Foto war nicht ganz scharf, doch die beiden Männer, die Pistole und die Kirche waren gut zu erkennen.
Der Artikel war in einer Regionalzeitung aus Split erschienen. Darin wurde die rasche Rückeroberung der 1991 von den serbischen Bewohnern für autonom erklärten kroatischen Vojna Krajina gefeiert, der ehemals österreichisch-ungarischen Militärgrenze zwischen Kroatien und Bosnien. Vom »Vaterländischen Krieg« war die Rede, vom »verehrungswürdigen« Präsidenten Franjo Tuđman, der die »serbischen Monster Milošević, Hadžić, Karadžić und Mladić« niederringe, von der »glorreichen Operation ›Sturm‹«, von »kroatischen Helden der Heimat« wie dem jungen Soldaten, den die Kameraden nur »Kapetan« nennen würden.
»Wir wissen, was 1995 in der Krajina passiert ist«, sagte Irena Lakič auf Kroatisch. Sie nahm die Brille ab, wischte mit der Serviette letzte Regentropfen von den modisch großen Gläsern. »In Den Haag sitzen die Verantwortlichen von damals in Untersuchungshaft.«
Ahrens nickte, sie verfolgte den Prozess »Gotovina et al.«. Wenige Wochen zuvor waren die Schlussplädoyers gehalten worden. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, die Anklage verlangte siebenundzwanzig Jahre Haft für General Ante Gotovina, der im August 1995 den kroatischen Angriff in der südlichen Krajina geführt hatte. Im Dezember sollte das Urteil verkündet werden.
Sie saßen im Café »Bonn« am Fenster und tranken Cappuccino. Über die Scheiben schlängelten sich Wasserlinien, dahinter hasteten Schatten vorbei. Deutsche Journalistin sucht Kroatischlehrer, hatte Ahrens vor drei Monaten inseriert. Irena Lakič hatte angerufen und gesagt: Wir sind sogar Kolleginnen. Sie schrieb für die liberale Tageszeitung Jutarnji List, die kritische Wochenzeitschrift Globus, das Magazin Nacional. Und unterrichtete privat, um leben zu können.
»Gotovina interessiert mich im Moment nicht.« Ahrens wechselte ins Englische. »Mich interessiert der Kapetan. Hast du schon mal von ihm gehört?«
»Nein.«
»Kannst du dich bei deinen Kollegen erkundigen?«
»Wozu?«
Ahrens zeigte auf das Foto. »Er hat vielleicht einen Mord begangen.«
»Vielleicht. Das Foto ist kein Beweis.« Irena setzte die Brille auf. Für einen kurzen Moment wirkte sie fast abweisend. Dann rang sie sich ein Lächeln ab.
Ahrens verstand. Es machte nun mal einen Unterschied, ob man selbst kritisch über das eigene Land schrieb oder ob es ein Fremder tat. Das war in den USA, in Argentinien, in Japan nicht anders gewesen. So distanziert man das Eigene betrachtete, so stark identifizierte man sich unwillkürlich damit, wenn es von außen kritisiert wurde.
Sie nahm die Artikelkopie wieder an sich, verstaute sie in der Klarsichthülle. Sie hätte daran denken müssen.
Irena sagte: »Hast du in der Redaktion angerufen?«
»Die Zeitung gibt es seit 1997 nicht mehr.«
»Weißt du, wer den Artikel geschrieben hat?«
Sie schüttelte den Kopf. Kein Name, kein Kürzel.
»Also gut. Ich erkundige mich«, sagte Irena.
»Danke.«
»Mit wem hast du noch darüber gesprochen?«
»Mit einem Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, letzte Woche.«
»Und?«
»Er sagt, niemand weiß, wer der Kapetan ist. Nicht mal die Armee.«
»Glaubst du ihm?«
»Nein.«
Irena lächelte. »Wie heißt er?«
»Ivica Marković.«
»Nie gehört.«
Jenseits der Fenster war es mittlerweile dunkel. Die Regenlinien, die über die Scheiben liefen, verzerrten die Konturen der bunten Lichter.
Ahrens war vor zwei Wochen in einem Zagreber Archiv auf das Foto des Kapetan gestoßen. Keine andere Zeitung hatte es abgedruckt, nur diese. Es hatte ihren Jagdinstinkt geweckt. Kein Name, keine Geschichte. Nur ein Foto, aufgenommen vielleicht Sekunden vor der Exekution des alten Mannes durch den kroatischen Kapetan. Und die schwülstige Litanei des Nationalismus.
Das Verteidigungsministerium hatte sie zehn Tage lang auf eine Reaktion warten lassen. Am vergangenen Freitag war sie von Ivica Marković empfangen worden, einem eher kleinen, zuvorkommenden älteren Herrn im eleganten Anzug. Wir haben recherchiert. Leider lässt sich nicht mehr feststellen, wer die beiden Männer auf dem Foto sind. Bitte entschuldigen Sie. Manche Antworten enthält uns die Vergangenheit vor. Leider. Aber bleiben wir doch in Verbindung, man weiß ja nie. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Land. Auf Wiedersehen.
In Argentinien und Japan hatte sie ähnliche Menschen getroffen und ähnliche Ausflüchte gehört. Die Vergangenheit einer Nation als Staatsgeheimnis. Überall stieß man noch auf die alten Kader, die glaubten, nur Heldenmythen ließen ein Land im Glanz erstrahlen. Dabei funkelte Aufrichtigkeit doch viel heller.
Auf Englisch sagte Irena: »Sprich von jetzt an mit niemandem mehr darüber, okay? Nur noch mit mir.«
Ahrens schüttelte den Kopf. »Ich möchte an der Geschichte dranbleiben.«
»Du hast hier keine einflussreichen Kontakte. Du bist nicht in ein Netzwerk eingebunden. Du hast keine Redaktion, die hinter dir steht und ein bisschen Wirbel macht, falls nötig.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass …«
Irena legte ihr die Hand auf den Arm. »Du verstehst nicht.«
Es gebe, erläuterte sie, in Kroatien verschiedene mehr oder weniger mächtige Interessengruppen. Darunter eine, die das Land unbedingt bis 2013 in die EU bringen wolle, und eine andere, die kroatische Kriegsverbrecher wie Ante Gotovina noch immer als Helden betrachte, darunter die Kriegsveteranen, die viel Einfluss besäßen.
Eine dritte Gruppe vertrete beide Interessen. Und die sehe den EU-Beitritt gefährdet, falls Gotovina und die anderen Kommandeure – sie deutete Anführungszeichen an – »wider jedes internationale Recht« verurteilt würden und die »angeblichen Kriegsverbrechen« Kroatiens in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerieten.
Ahrens brauchte einen Moment, um die Verbindung herzustellen. Ein Foto aus der dunklen Zeit, darauf ein kroatischer Soldat, der kurz davor stand, einen serbischen Zivilisten zu erschießen. Ein Prozess gegen mutmaßliche kroatische Kriegsverbrecher, der vor dem Abschluss stand. Kamen das Foto und seine Geschichte – falls es eine Kriegsverbrechergeschichte war – jetzt an die Öffentlichkeit, könnten sie den Prozess womöglich noch beeinflussen. Vielleicht brauchte die Anklage weitere Zeugen. Weitere Beweise.
Sie schüttelte den Kopf. »Kroatien ist seit Tuđmans Tod eine Demokratie.«
»Nominell ja.« Irena zuckte die Achseln. Sie versuchte es noch einmal. Im Jahr 2000 war Milan Levar, ein Tribunal-Zeuge, durch eine Bombe getötet worden. Noch 2008 waren unbequeme Journalisten – wie Dušan Miljus – verprügelt oder – wie Ivo Pukanić – ermordet worden. Željko Peratović, der schon in den Neunzigern als einer der Ersten über kroatische Kriegsverbrechen geschrieben hatte, war 2007 willkürlich verhaftet worden und erst auf Anordnung des Staatspräsidenten freigekommen.
»Die Ideologen sind auf dem Rückzug«, sagte Irena. »In ein paar Jahren nimmt keiner mehr Notiz von ihnen, sie fechten ihre letzten Kämpfe aus. Aber das macht sie gefährlich. Ich bitte dich nur, das nicht zu vergessen.« Sie zog das Sprachlehrbuch aus der Tasche. »Wollen wir jetzt?«
»Ich …«
»Heute haben wir eine langweilige Lektion, die leider notwendig ist: Die Liebe.«
Ahrens lachte verdrossen.
Seit sie einander kannten, überlegte Irena, wie sie die Liebe in Ahrens’ Leben zurückbringen konnte. Du brauchst Sex, einen Freund, ein bisschen Aufregung! Na ja, wenigstens Liebe.
Sie hatte ihr einen Cousin, einen Kollegen, einen Nachbarn vorgestellt. Keinem von ihnen hätte Ahrens jemals von dem Wintermorgen vor zwölf Jahren erzählen wollen. Von einem kalkweißen Gesichtchen, kleinen blauen Armen, der grauenhaften Stille.
Das war der Maßstab geworden.
Deine Ansprüche sind zu hoch, das ist das Problem!
Es ist kein Problem, Irena, es ist … eine Garantie.
Ja, auf Masturbation. Hör mal, morgen ist ein Freund von mir in der Stadt, ein Geiger … Kommst du?
Natürlich war sie gekommen. Und hatte dem Geiger zur Begrüßung und zum Abschied freundlich die Hand geschüttelt.
Irena hob das Buch und zeigte auf Abbildungen. »Um Sex geht es auch.«
Ahrens lächelte. »Ich habe am Donnerstag einen Termin im Zagreber Büro des Tribunals.«
»Dann«, erwiderte Irena, »muss ich mich wohl schnell nach deinem Kapetan erkundigen.«
4
MITTWOCH, 13. OKTOBER 2010
BERLIN
Was ein kleines Wort anzurichten vermochte. Löste Gedankenlawinen aus, schlug auf die Laune.
Sonst irgendwelche Anhaltspunkte?
Nein.
Lorenz Adamek war noch nicht dazu gekommen, die Bitte seines Onkels zu erfüllen. Am Dienstag war er von Besprechung zu Besprechung geeilt, der Mittwoch sah nicht anders aus. Vormittags Zeugenvernehmungen und ein Gespräch mit einem Staatsanwalt, mittags das Essen mit den Kollegen von der Bowlingmannschaft, anschließend Rapport bei der Kommissariatsleiterin.
Und immer wieder dachte er an die Lüge Richard Ehringers und ärgerte sich.
Erst am Mittwochnachmittag fand er Zeit, POLIKS den Namen in den digitalen Rachen zu werfen und eine E-Mail-Anfrage an die Rottweiler Kollegen zu schicken.
Als er die Direktion 2 um halb sechs verließ, war er nicht viel klüger.
Thomas Ćavar, 1971 in Rottweil geboren, nie an einem anderen Wohnort gemeldet, nie straffällig geworden, nicht verheiratet, keine Kinder. 1989 hatte er den Führerschein gemacht, 1990 war in Rottweil ein Ford Granada auf seinen Namen zugelassen worden, 1991 hatte er sich bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen für Medizin beworben.
Weitere Informationen waren in den Datenbanken, die POLIKS anzapfte, nicht enthalten. Thomas Ćavar hatte vor zwanzig Jahren aufgehört zu existieren.
Was die Anfrage des Onkels noch irritierender machte.
Die Kripo Rottweil – Mit hochachtungsvollem Gruß in die Hauptstadt, Ihre KOK Daniela Schneider – hatte das Rätsel gelöst: Thomas Ćavar war mutmaßlich 1995 in Bosnien ums Leben gekommen.
Mutmaßlich?, hatte Adamek zurückgeschrieben.
Na ja, offiziell sei er nie für tot erklärt worden.
Aber inoffiziell?
Also, man kenne sich in Rottweil. Man höre so einiges. Die Leiche sei wohl in einem serbischen Massengrab verschwunden. Im Übrigen lebten Vater und Bruder des Nachgefragten noch heute im Ort. Falls erwünscht, könne ein Kontakt hergestellt werden.
Hocherfreut, helfen zu können, Ihre Daniela Schneider.
Im kalten Regen eilte Adamek über den Parkplatz, getrieben von unangenehmen Fragen. Warum interessierte sich Richard Ehringer für einen Jungen, der mutmaßlich vor fünfzehn Jahren gestorben war?
Und warum hatte er gelogen?
»Was heißt das, ›mutmaßlich‹ tot?« In der Stimme des Onkels lag Überraschung.
»Dass es nicht bestätigt ist.«
»Wurde seine Leiche denn nie gefunden?«
»Offenbar nicht.«
Aus den Lautsprechern knisterte es, gegen die Windschutzscheibe prasselte der Regen. Vor Adamek tauchte die Nachbarplatte auf, deren oberste Stockwerke in schwarzgrauen Wolken zu verschwinden schienen. Auch der Balkon der Freiheit war nicht zu erkennen. Ein Tag ohne einen einzigen Moment Sonne – der Berliner Winter hatte begonnen.
Genügsame Menschen wie er schlugen den Mantelkragen für sechs Monate hoch und schlüpften in einen warmen Kokon dauerhaft schlechter Laune. In Karolins weniger robusten Kreisen brauchte man spätestens Mitte Februar zwei Wochen Helligkeit und Wärme, sonst hielt man nicht ohne depressive Anfälle durch bis April. Sie scannte bereits das Internet nach Sonderangeboten. Warm & hip lauteten die Kriterien, wobei die Priorität wechseln konnte. Wochenlang würde der Laptop bis morgens um zwei laufen. Am Ende würden sie an einem Ort landen, den Adamek in einem Leben ohne Karolin niemals gesehen hätte.
Capri? Biste jetzt Jetset oder wat, Lorenz?
War ein Sonderangebot.
Der Lorenz is’ jetzt Jetset, jibt’s det.
Der Regen wurde immer stärker. Adamek hielt an einer Ampel, lauschte auf das Geprassel.
Der Onkel brach das Schweigen. »›Mutmaßlich‹ und ›offenbar‹? Ist das alles?«
Und »inoffiziell«, dachte Adamek und fuhr weiter.
»Ich brauche Tatsachen, Lorenz.«
»Warum?«
»Sagte ich das nicht bereits? Ein Bekannter, den ich aus den Augen verloren habe.«
Kein Wunder, wenn er tot war.
Adamek verließ die Leipziger Straße, hielt vor der Garageneinfahrt, wartete. Unter fünfundzwanzig Stockwerken Platte hatte sein Handy keinen Empfang.
Er starrte auf das Tor. Er hasste es, belogen zu werden.
Und wenn er ehrlich war: Er hasste die Platte.
Capri.
Er seufzte grimmig. Gedanken im Berliner Winter. Die Monate zwischen Oktober und April waren für Männer in seinem Alter gefährlich. Eine breite Einfallschneise für die Midlife-Crisis.
»Du würdest mir einen großen Gefallen tun, Lorenz.«
»Wenn was?«
»Wenn du für mich herausfändest, wann und wo er gestorben ist. Definitiv, nicht nur mutmaßlich.«
»Warum, Richard?«
»Weil er für mich einmal wichtig war.«
Nach einer kurzen Pause sprach Ehringer weiter.
Thomas Ćavar hatte ihn im Krankenhaus in Bonn und in der Reha in Baden-Württemberg besucht. Damals, du weißt schon. Hatte ihn einen Frühling und einen Sommer lang durch den Park geschoben. Ihm aus Rottweil von der Mutter selbst gemachte Ćevapčići mitgebracht. Ihm die ersten freundlichen Worte entlockt nach … Du weißt schon.
Adamek nickte.
Er öffnete das Tor mit der Funkfernbedienung, rollte langsam die Einfahrt hinunter. »Ich werde nicht in bosnischen Massengräbern rumwühlen.«
Ehringer lachte. »Einverstanden. Aber vielleicht …«
In diesem Moment brach die Verbindung ab.
Adamek parkte den Wagen und stieg aus. Der Aufzug ein Albtraum für müde Augen, auch hier hatte sich der ambitionierte Architekt ausgetobt. Drei Wände verspiegelt, ein Heer von Adameks, tausendfach leuchtete der halbkahle Schädel im Neonlicht, und die Tränensäcke schienen kurz vor dem Platzen.
Zwei Schritte, und man war um Jahre gealtert.
Er schloss die Augen, vollendete im Geiste den Satz des Onkels: Aber vielleicht in Rottweil?
5
SAMSTAG, 18. AUGUST 1990
ROTTWEIL
Thomas Ćavar zögerte den magischen Moment hinaus, solange es ging. Wieder und wieder umkreiste er den Ford. Seine Fingerspitzen glitten über den roten Lack, über glatte und rauere Stellen, über Rost und Kratzer, Wülste und Dellen.
Der langgezogene Kotflügel, die mächtige Motorhaube … Die Beule im anderen Kotflügel, Resultat einer winterlichen Kollision mit einem Schwarzwaldhirsch … Die Antenne rechts vor der Windschutzscheibe … Der Außenspiegel auf Jelenas Seite … Jelenas Hand …
Auf dem Fensterrahmen ihr bloßer Unterarm in der Sonne, weich und warm. Ihr vertrautes Lächeln, ein bisschen spöttisch und doch voller Zärtlichkeit.
»Ist nur ein Auto, Tommy.«
Er nickte. Sie wusste, was ihm das Auto bedeutete.
Langsam ging er weiter.
Der Griff der hinteren Tür, das kantige Heck, das Deutschland-D, schwarz auf weißem Grund. Das kühle chromfarbene Schloss der Heckklappe, die beiden Aufkleber, ICH BIN »LÖWENSTARK« und STUTTGARTER KICKERS, rau von Feuchtigkeit und Sonne.
Kriege ich ohne Lackschäden nicht mehr weg, hatte der Vorbesitzer gesagt. Stören sie dich?
VfB wär mir lieber.
Kannst du ja drüberkleben.
Thomas bückte sich, fuhr mit den Fingern über die Typbezeichnung: GRANADA 2.0. Das letzte »A« hatte den rechten Fuß verloren und saß in einer kleinen Delle.
Seine Finger glitten weiter.
Die vier übereinandergesetzten, rechteckigen Rückleuchten, das Plastikgehäuse orange, zweimal rot und unten weiß …
Dreihundertvierzehn Stunden Arbeit auf dem Feld, verteilt auf ein Jahr und sieben Tage.
Ein Jahr und sieben Tage Vorfreude.
Monate des Lernens, obwohl er lieber gearbeitet hätte. Die Abiturprüfungen, obwohl er lieber nach einem Auto gesucht hätte.
Jetzt hatte er eines.
Er hatte es Probe gefahren, natürlich, drei-, viermal. Aber er hatte es noch nie als Besitzer gefahren. War noch nie als Besitzer eingestiegen.
Der magische Moment.
Er richtete sich auf.
Begann seine Runde von vorn.
Eine halbe Stunde später fuhren sie auf der Landstraße in Richtung Schwarzwald. Die Fenster waren geöffnet, die Musik laut gedreht, im Radiorekorder eine Kassette mit dem neuen Album von Phil Collins. Jelenas Hand auf seinem Oberschenkel, er hörte sie summen, manchmal klopfte ihr Zeigefinger den Takt auf sein Bein. Draußen lagen die Dörfer und Felder im Sonnenschein.
Das Leben, dachte er, meinte es gut mit ihm. Deutschland war Weltmeister, er hatte Jelena, ein Auto – und das Abitur.
Komm schon, Tommy, nur noch drei Monate!
Drei Monate, Jelena …
Von wem ist Der alte Mann und das Meer?
Wen interessiert das?
Die Leute, die über deine Zukunft bestimmen.
Nur ich bestimme über meine Zukunft.
Die Antwort, Tommy.
Jacques Cousteau.
Am Ende hatte er es geschafft, wenn auch nur mit Müh’ und Not. Aber was zählte das jetzt noch.
Wie es weiterging, wusste er noch nicht. Jelena würde im Herbst in Stuttgart mit dem Studium beginnen, er war sich noch nicht sicher. Schon wieder lernen?
Er wollte Ingenieur sein, nicht Ingenieur werden.
Oder Jurist. Oder Arzt. Kinderarzt.
Das Schulende hatte ihn kalt erwischt. Tage ohne Verpflichtungen, ohne Lehrer, die den Rhythmus, die Aufgaben und die Ziele bestimmten. Denen er sich verweigern oder unterwerfen konnte.
Hinter ihnen hatte sich eine Kolonne gebildet. Jemand hupte, dann überholten einige Autos. Er ließ sich nicht irritieren, fuhr weiterhin langsam und vorsichtig. Er musste den riesigen Granada erst einmal kennenlernen.
Ein Auto mit vier Türen, Tommy?
Klar, wegen der Kinder.
Was für Kinder?
Unsere, wenn wir mal welche haben.
Jelena hatte gelacht. Das wird noch ’ne Weile dauern.
Sie hatten Zeit, dachte er und bog vorsichtig in die Landstraße ein, die zum Bachmeier-Hof führte. Alle Zeit der Welt. So ein Ford Granada, der machte es noch einmal zehn Jahre. Dann wären sie neunundzwanzig, und hinten auf der Rückbank säßen zwei oder drei Kinder und dahinter ein Schäferhund.
»Darf man hier drin rauchen?«, fragte Jelena lächelnd.
»Solange noch keine Kinder mitfahren.«
Sie zündete zwei Zigaretten an, reichte ihm eine. »Ich will erst studieren, Tommy.«
»Ich weiß. Danach.«
»Danach will ich zwei, drei Jahre arbeiten. Mindestens.«
»Ja. Ich meine, danach.«
»Und wenn ich dann weiterarbeiten will? Wenn ich keine Kinder haben will?«
»Ist ja nur so ’ne Idee.«
»Würdest du dann trotzdem noch mit mir zusammen sein wollen?«
Er sah sie an. Jelena, die so ernst und zielstrebig und stark war und vielleicht deshalb immer schon an morgen dachte. Die sich nicht darauf verlassen wollte, dass alles bleiben würde, wie es war. Dass es das Leben gut meinte mit ihnen.
»Wir gehören doch zusammen«, sagte er.
Sie nickte lächelnd. »Mein Sonnenschein und ich.«
Der Wald zu beiden Seiten der Straße wich zurück, vor ihnen öffnete sich das Tal. Am Nachbarhof der Bachmeiers endete der Teerbelag. Erneut verringerte Thomas das Tempo. Schottersteine sprangen gegen den Unterboden. Wie ein Schiff in Wellentäler senkte sich der Granada sanft in die Schlaglöcher. Im Schritttempo schaukelten sie auf den Hof zu.
Jelena drehte die Musik lauter, sang mit. Ihr Deutsch war fast akzentfrei, in ihrem Englisch lag ein ferner slawischer Klang.
Er liebte ihr Deutsch, ihr Englisch, das Slawische an ihr.
Er ließ den linken Arm aus dem Fenster baumeln, hatte die Zigarette jetzt zwischen den Lippen. Der warme Fahrtwind, die Musik, Jelenas Hand auf seinem Schenkel, so konnte das Leben bleiben.
Sie kamen im falschen Moment.
Markus Bachmeier saß an der Scheunenwand im Schatten, vier hellbraune Hundewelpen im Schoß. Er musste sich entscheiden – für einen, gegen die anderen drei.
Er hatte keine Augen für den roten Granada.
»Kleine Spritztour gefällig?«, fragte Thomas und ließ den Motor im Leerlauf brummeln.
»Ich kann jetzt nicht«, murmelte Markus, ohne aufzusehen.
Sie stiegen aus, knieten sich neben ihn. Jelena nahm einen der Welpen hoch, rieb die Wangen an ihm, flüsterte mit tieferer Stimme Koseworte auf Serbokroatisch, die Thomas nicht geläufig waren. Vukovarer Dialekt vielleicht oder alte Wörter aus der serbischen Heimat ihrer Vorfahren. Wie schön sie war, dachte er, wenn sie nicht ernst oder stark war, sondern zärtlich.
Noch schöner als sonst.
Sie legte den Welpen zurück, griff nach dem nächsten, sprach mit ihm, dann war der dritte an der Reihe, als wäre es ein Ritual, mit dem sie den Tieren die Angst vor der Welt nehmen wollte.
Auch ihm nahm sie manchmal die Angst. Blieb skeptisch, was das Morgen betraf, und flößte ihm doch Mut für das Heute ein.
Der vierte Welpe tastete mit der Pfote nach ihrem Mund. »Da, da, da«, flüsterte sie. Sie mochte es selbst noch nicht wissen, aber sie würde eine großartige Mutter sein.
Falls man von Hundewelpen auf Babys schließen konnte.
Endlich hob Markus den Blick. »Nehmt ihr zwei? Jeder einen? Dann bleiben sie sozusagen in der Familie.«
»Die sind zu klein für den Granada«, sagte Thomas.
»Den was?«
»Mein Auto. Unser Auto.«
Ein flüchtiger Blick auf den Wagen, die Sorgenfalten auf Markus’ Stirn blieben. »Ich weiß nicht, welchen ich behalten soll«, jammerte er.
»Den«, sagte Jelena und deutete auf den zweiten Welpen. Er war ein wenig dunkler als die anderen, erklärte sie. Kam sich vielleicht wie ein Außenseiter vor und brauchte ein liebevolles Herrchen.
Liebevoll, dachte Thomas, und ein kleiner Stich der Eifersucht durchzuckte ihn. Er wusste natürlich, dass Markus keine Gefahr darstellte. Zu schüchtern, zu dick, zu jung, erst siebzehn. Aber liebevoll … War liebevoll wichtig für Jelena? Und fand sie ihn liebevoll?
Du bist manchmal ein bisschen rücksichtslos, Tommy …
Rücksichtslos im Überschwang. Das gefiel ihr nicht. Er nahm sich vor, sich zu ändern.
»Wie willst du ihn nennen?«, fragte sie.
»Granada«, sagte Thomas.
»Methusalem«, sagte Markus.
Auch zu Hause interessierte sich niemand für das neue Auto. Im kleinen Wohnzimmer der Ćavars gärte es.
Stumm standen sie da und lauschten dem serbokroatischen Stimmengewirr. Ein Dutzend kroatische Bekannte waren gekommen. Auch Thomas’ Mutter und sein Bruder Milo waren da. In der Mitte des Raumes drehte sich sein Vater um die eigene Achse und schrie: »Sie stehlen uns die Heimat!«
Wenige Tage zuvor war in der Krajina die »Souveränität und Autonomie des serbischen Volkes in Kroatien« erklärt worden. Nun hatten die Serben Straßen- und Schienensperren errichtet und eine kroatische Polizeistation geplündert.
Die »Baumstammrevolution« hatte begonnen.
Über das Karstland der Plitvicer Seen patrouillierten serbische Milizen und kroatische Polizisten. Eine seltsame Vorstellung, dachte Thomas: Die Plitvicer Seen waren Karl-May-Land.
Winnetou, Old Shatterhand und vor allem die beiden Frauen: Nscho-tschi und Ribanna. Er hatte sich in Nscho-tschi verliebt, Milo in Ribanna.
Gestorben waren beide.
Er hatte tagelang geheult. Milo hatte ihn getröstet.
Die Plitvicer Seen, das grausame Land zwischen Kindheit und Jugend.
Sanft legte er den Arm um Jelena. Auf Nscho-tschi waren andere gefolgt. Auf Jelena würde keine mehr folgen.
Sie blieb steif in seinem Arm, und ihr Blick gefiel ihm nicht. Zu ernst, zu besorgt. Immer suchte sie am Horizont nach drohenden Gefahren.
Lächle, Jelena, lächle.
»Komm, wir gehen«, flüsterte er auf Deutsch.
Sie schüttelte den Kopf.
»Was nehmen sie sich als Nächstes?«, schrie sein Vater. »Dalmatien?«
Die Zierteller an den Wänden ließen seine Stimme hallen. Über vierhundert waren es inzwischen, seit zwanzig Jahren sammelte die Mutter. Das Deutschlandzimmer. Teller mit typischen Motiven aus allen Bundesländern, fast allen größeren Städten. Vor einem Jahr war die DDR dazugekommen. Im Frühling hatte die Mutter die Westteller abgehängt und in kleineren Abständen wieder aufgehängt, um Platz zu schaffen. Seitdem schleppten die Gäste der Ćavars Motive aus den neuen Bundesländern an. Die Mutter – das war das Überraschende – freute sich über jeden einzelnen Teller, als wäre er der erste. Spülte und trocknete ihn ab, hängte ihn auf und sagte beim Abendessen feierlich: Wir haben jetzt auch Eisenach.
Unter Hamburg saß auf einem Stuhl am Fenster ein großer Mann um die sechzig, den Thomas noch nie gesehen hatte. Immer wieder fiel der Blick seines Vaters auf diesen Mann, der als Einziger im Raum Anzug und Krawatte trug.
»Ich bin Josip«, sagte der Mann und lächelte.
Thomas nickte. Jetzt erinnerte er sich, sein Vater sprach häufig von ihm. Josip Vrdoljak aus Balingen, der ein Jahr zuvor den baden-württembergischen Ableger einer neuen kroatischen Partei, der HDZ, mitgegründet hatte.
Kroatische Demokratische Gemeinschaft, Kreisverband Stuttgart, hatte sein Vater mit leuchtenden Augen gesagt. Noch am Tag der Gründung war er der Partei beigetreten. Zwanzig Jahre lang jugoslawischer Gastarbeiter in Deutschland, dann, von einem Moment zum anderen, Exilkroate.
Der Moment, in dem er Josip Vrdoljak begegnet war.
Ein Reisender in Sachen Heimat. Schon Ende der achtziger Jahre war Josip von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf gefahren, um die »Kroaten in Deutschland« zu besuchen. Ihm und anderen war es gelungen, die Kluft zu schließen, die seit dem Zweiten Weltkrieg innerhalb der kroatischen Diaspora bestanden hatte: Sie hatten die Söhne und Töchter der faschistischen Ustaše mit denen der Tito-Partisanen vereint.
Ihr seid Kroaten, hatten sie zu ihren Zuhörern in Kanada, in den USA, in Australien, in Skandinavien, in Deutschland gesagt. Und bald habt ihr eine Heimat!
Dann, im April 1990, die ersten freien Wahlen in Kroatien seit dem Zweiten Weltkrieg. Die HDZ hatte gewonnen. Präsident der Teilrepublik war nun ein Mann, von dem Thomas’ Vater ebenfalls häufig sprach – Franjo Tuđman, Mitbegründer der HDZ.
Bald ist es so weit, hatte sein Vater geflüstert.
Doch jetzt schien das Projekt in Gefahr zu sein.
»Wir stehen vor der serbokommunistischen Invasion!«, rief sein Vater. »Wacht auf! Es geht um die Heimat!«
»Meine Heimat ist Rottweil«, sagte Milo auf Deutsch. Blass, ernst, hoch aufgerichtet saß er da, Milo Ćavar, 1968 in Osijek in Ostkroatien geboren, mit zwei Jahren mit der Mutter nach Deutschland geholt. Der große Bruder, der immer gewusst hatte, wohin er gehörte, was er tun und sein wollte – Klassensprecher, Student, Bankangestellter, Ehemann, Vater, Hausbesitzer in Rottweil, Baden-Württemberg, und wenn Kroatien, dann Urlaub auf Krk oder Mljet, alles andere hatte ihn nie interessiert.