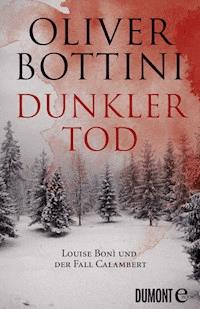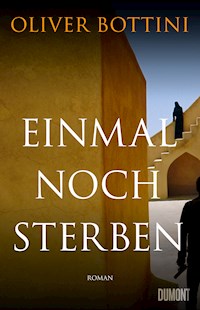9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei preisgekrönte Kriminalromane vom sechsfachen Preisträger des Deutschen Krimipreises Oliver Bottini in einem E-Book – brisant, dramatisch und absolut mitreißend! Ein paar Tage Licht Das Buch zur TV-Serie ALGIERS CONFIDENTIAL! Algerien: Das größte Land Afrikas, gesegnet mit Reichtum, zerrissen im Inneren. Hier wird ein deutscher Rüstungsmanager entführt. Von offizieller Seite heißt es sofort: Al-Qaida hat zugeschlagen! Doch für BKA-Mann Ralf Eley passen zu viele Puzzlesteile nicht zusammen. Heimlich beginnt er zu ermitteln. Als er begreift, dass die algerische wie auch die deutsche Regierung die Wahrheit vertuschen wollen, ist es zu spät. Und Eley begreift: Wenn er die Wahrheit ans Licht bringen will, muss er alles aufs Spiel setzen. Der kalte Traum 1991, eine idyllische Stadt in Schwaben: Thomas Cavar hat gerade sein Abitur bestanden, die Zukunft mit seiner Freundin sieht vielversprechend aus. Doch dann bricht in Jugoslawien der Krieg aus, und plötzlich ist alles anders. Muss er nicht für Kroatien kämpfen? Für seine richtige Heimat? Thomas kämpft – und bezahlt dafür. Jetzt, fünfzehn Jahre später, tauchen Fragen zum Fall Thomas Cavar auf: Eine deutsche Journalistin in Zagreb, ein Kriminalkommissar in Berlin und der kroatische Geheimdienst machen sich auf die Suche und eine mörderische Hetzjagd beginnt … Virtuos verwebt Oliver Bottini politische und gesellschaftliche Themen in mitreißenden Kriminalromanen. Präzise lotet er die Untiefen von Macht und Unterdrückung aus und zeigt mit eindrücklicher Intensität, woran Systeme immer kranken werden – am Mangel an Menschlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 978
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über die Bücher
Zwei preisgekrönte Kriminalromane vom sechsfachen Preisträger des Deutschen Krimipreises Oliver Bottini in einem E-Book – brisant, dramatisch und absolut mitreißend!
Ein paar Tage Licht
Das Buch zur TV-Serie ALGIERS CONFIDENTIAL!
Algerien: Das größte Land Afrikas, gesegnet mit Reichtum, zerrissen im Inneren. Hier wird ein deutscher Rüstungsmanager entführt. Von offizieller Seite heißt es sofort: Al-Qaida hat zugeschlagen! Doch für BKA-Mann Ralf Eley passen zu viele Puzzlesteile nicht zusammen. Heimlich beginnt er zu ermitteln. Als er begreift, dass die algerische wie auch die deutsche Regierung die Wahrheit vertuschen wollen, ist es zu spät. Und Eley begreift: Wenn er die Wahrheit ans Licht bringen will, muss er alles aufs Spiel setzen.
Der kalte Traum
1991, eine idyllische Stadt in Schwaben: Thomas Cavar hat gerade sein Abitur bestanden, die Zukunft mit seiner Freundin sieht vielversprechend aus. Doch dann bricht in Jugoslawien der Krieg aus, und plötzlich ist alles anders. Muss er nicht für Kroatien kämpfen? Für seine richtige Heimat? Thomas kämpft – und bezahlt dafür.
Jetzt, fünfzehn Jahre später, tauchen Fragen zum Fall Thomas Cavar auf: Eine deutsche Journalistin in Zagreb, ein Kriminalkommissar in Berlin und der kroatische Geheimdienst machen sich auf die Suche und eine mörderische Hetzjagd beginnt …
Virtuos verwebt Oliver Bottini politische und gesellschaftliche Themen in mitreißenden Kriminalromanen. Präzise lotet er die Untiefen von Macht und Unterdrückung aus und zeigt mit eindrücklicher Intensität, woran Systeme immer kranken werden – am Mangel an Menschlichkeit.
© Hans Scherhaufer
Über den Autor
Oliver Bottini wurde 1965 geboren. Für seine Romane erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner ›Krimifuchs‹, den Stuttgarter Krimipreis und sechsmal den Deutschen Krimipreis, zuletzt 2022 für ›Einmal noch sterben‹. Bei DuMont erschienen außerdem ›Der kalte Traum‹ (2012) und ›Ein paar Tage Licht‹ (2014) – kürzlich von ARTE/ZDF unter dem Titel ›Algiers Confidential‹ verfilmt – sowie die Kriminalromane um die Freiburger Kommissarin Louise Bonì. Oliver Bottini lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main.
OLIVER BOTTINI
Ein paar Tage Licht
Der kalte Traum
Zwei Kriminalromane in einem Band
Vollständige E-Book-Ausgabe der im DuMont Buchverlag erschienenen Werke ›Ein paar Tage Licht‹ (© 2014) und ›Der kalte Traum‹ (© 2012)
Alle Figuren und Ereignisse der Romanhandlung sind erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Firmen Meininger Rau Gewehrfabrik 1889 und Elbe Defence Systems gibt es nicht.
Ein ausführliches Glossar und eine Karte des ehemaligen Jugoslawiens finden Sie am Ende des Buches.
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung des abgebildeten Einzelromans ›Ein paar Tage Licht‹: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Covergestaltung des abgebildeten Einzelromans ›Der kalte Traum‹: Zero, München
Coverabbildungen: © plainpicture/Robert Harding und plainpicture/Johannes Caspersen
Karte: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia-Karlsruhe
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book: 978-3-7558-1094-0
www.dumont-buchverlag.de
OLIVER BOTTINI
EINPAAR TAGE LICHT
KRIMINALROMAN
In Algerien haben wir eine lange Tradition des Scheiterns. Es ist einfach, wir haben alles vermasselt, obwohl das Land reich ist und das Volk ziemlich aufgeweckt. Wir hätten es zum Guten wenden können, stattdessen haben wir alles viel schlimmer gemacht. (…) Wir haben bei der großen Frage unseres Lebens, der Unabhängigkeit des Landes, versagt. Im Juli 1962 wurde die Freiheit von ihrem Weg entführt, und wir sind wie Blinde in das schwarze Loch der Diktatur gestürzt.
BOUALEM SANSAL,
ALGIER, ALGERIEN27.SEPTEMBER 1995
An dem Tag, als sein Vater verschwand, spielten sie im Stadion von Bologhine, Djamel und ein Dutzend Freunde aus dem Viertel und noch einmal so viele aus dem nahen Bab el Oued. Schweigend waren sie über die Mauer geklettert und auf dem Kunstrasen ausgeschwärmt wie sonst die Spieler von USM Alger und deren Gegner. Die Mannschaften standen seit jeher fest: die aus Bologhine gegen die aus Bab el Oued. Während über der Bucht von Algier die Dämmerung heraufzog, rannten sie zwischen den Toren hin und her, Djamel so stumm wie die anderen, nur hin und wieder waren ein leiser Ruf oder ein verhaltenes Stöhnen zu hören. Seit die bewaffneten islamischen Gruppen und die Islamische Heilsfront den Kampf gegen den Staat aufgenommen hatten, verhielt man sich beim Spielen besser still.
»Und dein Vater?«, raunte Aziz, der Torwart. »Kommt der heute nicht?«
Djamel zuckte mit den Schultern.
Manchmal kam der Vater nach, dann ertönte irgendwann ein Pfiff, und oberhalb der Mauerkrone winkten seine energischen Hände. Sie mussten ihm hinüberhelfen, drei auf der einen, drei auf der anderen Seite, und Aziz sagte dann immer: Uff, Sie sind aber schwer geworden, ya si-Mouloud, und Djamels Vater erwiderte: Das ist das Alter, du Nichtsnutz, das zerrt an mir und wiegt für zwei. Das Alter war rund wie ein Fußball, nur deutlich größer, und sprengte dem Vater die Knöpfe von den Hemden.
Auch Djamels Großvater war ein paarmal mitgekommen, um zuzusehen, wenn er hier spielte, im Stadion zwischen dem Meer und den Toten vom europäischen Friedhof, der sich jenseits der Westtribüne am Hang hochzog bis zur katholischen Basilika. Der fremde Großvater, der vor drei Jahren vom Himmel gefallen und vor einem Jahr dorthin zurückgekehrt war … Eines Tages hatte der Vater gesagt: Sie töten auch die Ausländer, ich flehe dich an, verlasst Algerien! Und so war der Großvater mit seiner deutschen Frau über das Meer zurückgeflogen nach Deutschland, das in ganz Bologhine und sicher auch in Bab el Oued verehrt wurde, weil es den Volkswagen Golf erfunden hatte.
»Schnell, Djamel, schnell!«, stieß Aziz hervor, und er rannte, was die dünnen Beine hergaben. Wie so oft reichte es nicht. Keuchend blieb er stehen, während sich die aus Bab el Oued schweigend in die Arme sanken.
Niemand machte ihm einen Vorwurf. Er war noch nicht zwölf, das war das Problem. Seit jeher wuchsen den Benmedis erst mit zwölf Muskeln und Fleisch und Kraft an den Knochen, hatte sein Vater gesagt, und keinen Tag früher, da kannst du unsere Ahnen durchgehen bis zum Jahr 960, als Bologhine ibn Ziri das schöne Algier gegründet hat: Alle sind sie auf zwei Streichhölzern über die Fußballplätze der Zeiten gelaufen, bis sie zwölf waren, und erst dann zu unbezwingbarer Pracht erblüht.
Und der Großvater hatte gesagt: Ein Benmedi hat es sogar in die erste algerische Nationalmannschaft geschafft.
In die Nationalmannschaft? Wer?
Na, ich, Djamel. Und einmal hätte ich beinahe ein Tor geschossen.
Der Vater und der Großvater waren nicht die Einzigen, die hin und wieder zuschauten bei seinen Spielen im »kleinen San Siro«. Auf den beiden Tribünen sah Djamel an manchen Tagen die Toten vom europäischen Friedhof sitzen, die Christen und die Juden. Aber sie klatschten und jubelten nicht, auch sie blieben stumm.
Heute waren die Toten in ihren Gräbern geblieben, die Tribünen leer, und der Vater kam nicht.
Draußen, auf dem Boulevard de l’Emir Khaled, stockte der Verkehr. Erschöpft trotteten sie an den Autos entlang, die sich nicht einen Millimeter voranbewegten. Die stadteinwärts führende Spur war dagegen verwaist. Vielleicht ein Unfall, wie so oft, oder einer der Mächtigen kehrte nach ein paar luxuriösen Tagen im Club des Pins mit Eskorte in die Stadt zurück.
Rechts begann die lange Promenade, hinter der nachts die Welt zu enden schien. In der Dunkelheit dahinter leuchteten die Positionslichter geheimnisvoller Schiffe, darüber die Sterne. Unter dem am weitesten entfernten Stern, so stellte Djamel es sich vor, wohnten der Großvater und seine deutsche Frau.
Die Stimme eines Muezzins erklang, und sie beschleunigten ihre Schritte. Sie hätten längst zu Hause sein müssen, in der Dunkelheit wurden die Straßen gefährlich. In Bologhine hatten die Bärtigen noch nicht zugeschlagen, aber in Bab el Oued war vor wenigen Wochen eine Bombe explodiert. Djamel kannte einen, der einen kannte, der dabei Freunde verloren hatte.
Zehn Tote im August in Bab el Oued.
Zweiundvierzig in Alger Centre im Januar.
Neunzehn im vergangenen Jahr in Les Eucalyptus drüben beim Flughafen.
Sein Vater flüsterte Zahlen und sagte: Man darf das alles nie vergessen!
Also merkte Djamel sich die Zahlen.
Zweiundsiebzig Leichen auf der Autobahn bei Lakhdaria, eine Stunde von hier. Vierzehn in Blida hinter den Hügeln. Dann vierundfünfzig im November, sechzig im Dezember. Aber Blida, hatte sein Vater gesagt, das waren nicht nur die Bärtigen. Die Ersten in Blida, das haben andere getan.
Andere?
Soldaten. Aber sprich nicht darüber!
Zwanzig Tote in Cherarda, später noch einmal einundvierzig. Auch darüber sollte er nicht sprechen.
Die Freunde blieben stehen, verabschiedeten sich.
»Beim nächsten Mal machen wir sie fertig«, sagte Djamel.
Aziz nickte und klopfte ihm auf die Schulter und eilte mit den anderen hügelwärts davon.
Allein ging er weiter. Noch immer bewegten sich die Autos nicht. Einige Fahrer waren ausgestiegen und sprachen miteinander. Manche hatten einen Gebetsteppich auf den Gehweg gelegt und verrichteten das Nachtgebet.
Ab der Rue Hamoua sei der Boulevard gesperrt, sagte ein alter Mann.
»Die Abdelaziz Hamoua?«, fragte Djamel.
Obwohl die Beine schmerzten, begann er zu rennen. Dort wohnte er, in der Rue Abdelaziz Hamoua.
Kurz darauf sah er die Sperren, Soldaten blockierten den Boulevard. Kein Unfall, kein Mitglied von le pouvoir. Aus der Hamoua kam ein Konvoi von Militärfahrzeugen – Laster, Jeeps, Transportpanzer. Im Schritttempo bogen sie nach Süden in den Boulevard ein und fuhren an Djamel vorbei in Richtung Bab el Oued. Die Läufe von Gewehren und Maschinenpistolen glitten über ihn, er spürte feindselige Blicke, die vielleicht für einen Moment in ihrer Wachsamkeit nachließen, als sie ihn sahen, den Jungen mit den dünnen Beinen im gefälschten Milan-Dress von George Weah.
An der Kreuzung wartete er, bis das letzte Militärfahrzeug die Hamoua verlassen hatte. Die Soldaten auf der Straße stiegen in ihre Jeeps und folgten dem Konvoi. Die Fahrer stiegen in ihre Autos und fuhren weiter.
In der Rue Abdelaziz Hamoua war kein Mensch zu sehen. Die Fensterläden der Häuser waren geschlossen wie immer nach Einbruch der Dunkelheit, doch manche Eingangstüren standen offen. Obwohl drinnen Licht war, drang kein Laut an Djamels Ohr.
Er ging an der Moschee vorbei, auch dort war niemand zu sehen. Vor dem einstöckigen ockerfarbenen Eckhaus mit den hohen Fenstern, in dem er mit seinem Vater und seiner Mutter und deren Eltern wohnte, blieb er stehen.
Die Fensterläden zu, die Tür geöffnet, das Flurlicht war eingeschaltet.
Auf einer der beiden Steinstufen funkelte etwas im Schein der Lampe – die silberne Brille seines Vaters. Vorsichtig hob er sie auf. Eines der Gläser hatte einen Sprung, ansonsten war sie unversehrt.
Er fand seine Mutter und deren Eltern im Wohnzimmer. Eng aneinandergedrängt saßen sie auf dem Sofa, ihre Blicke folgten ihm, während er vor sie trat. Die Mutter keuchte, als wäre sie gerannt, und doch hatte Djamel den Eindruck, dass die drei schon seit Ewigkeiten hier saßen und Schreckliches mitangesehen hatten, ihre Augen sagten ihm das, die ihn beobachteten wie die Augen der Toten auf den Tribünen des Stadions von Bologhine, Kriege und Blut hatten die gesehen und Mörder und Ermordete.
Ein Stuhl war umgefallen, der Teppich verrutscht. Der Fernseher lief. Vor einem der Fenster lag umgedreht ein felliger Hausschuh seines Vaters, den zweiten entdeckte er nicht.
Bevor die auf dem Sofa die Sprache wiederfinden würden, verließ Djamel das Zimmer und das Haus.
Als er einen schwachen Ruf hörte, hielt er inne. Die Mutter war ihm zur Tür gefolgt, dort stand sie nun, das Haar ohne Kopftuch lang und wirr. Sie duckte sich, als fürchtete sie, in ihrer Nacktheit gesehen zu werden, und flüsterte Dinge, die er nicht hören wollte. Die Soldaten hatten seinen Vater mitgenommen und gesagt, es sei nur für einen Tag oder zwei, falls sich nichts Schwerwiegendes ergebe, man wolle mit ihm über ernste Belange der nationalen Sicherheit sprechen, doch in einem Tag oder zwei werde er zurückkehren, man werde kaum länger mit ihm sprechen, im Gefängnis von Serkadji, auch Barberousse genannt, oberhalb der Kasbah … Kein Grund also, flüsterte die Mutter, sich Sorgen zu machen.
»Komm wieder rein, ja? Kommst du? Komm.«
»Aber er braucht seine Brille.«
Djamel drehte sich um und machte sich auf den Weg, es war weit bis zum Gefängnis von Serkadji oberhalb der Kasbah, man musste durch ganz Bab el Oued und dann den Hügel halb hinauf.
Unterwegs fragte er sich wieder und wieder, weshalb ihm dieser Name so bekannt vorkam, Serkadji.
Schließlich fiel es ihm ein.
Im Februar hundert Tote im Serkadji, aber sprich nicht darüber …
I
HOFFNUNG
1
CONSTANTINE, ALGERIENOKTOBER 2012
In der Ferne kam die Stadt in Sicht, auf die er sich seit Wochen freute, Constantine, auf einem sechshundert Meter hohen Plateau gelegen. Eine Stadt der Schluchten und Hängebrücken, wie ihm die Algerier in Lüneburg erzählt hatten, mit römischen Ruinen und einer eineinhalb Kilometer langen Gondelbahn, gebaut von einer österreichischen Firma. Dafür, hatten sie gescherzt, baut ihr Deutschen die Panzer.
Peter Richter lehnte sich im Fond zurück. Er wurde erst morgen früh in der Produktionsstätte erwartet, und so nahm er sich vor, am Abend dort oben zu bummeln und zu essen, in der Altstadt auf dem Plateau, und vorher ein wenig Gondel zu fahren. Einsamkeit würde vermutlich kein Problem werden. Vier Polizisten in zwei Streifenwagen – VW Caddys – eskortierten die gepanzerte Limousine des algerischen Verteidigungsministeriums, die ein ausgesprochen freundlicher und humorvoller Fünfzigjähriger namens Sadek Madjer fuhr. Und im Gästehaus, so hatte er erfahren, arbeiteten neben einem Koch und Servicepersonal zwei Wachmänner, ein Deutscher und ein Algerier, die ihn auf Schritt und Tritt begleiten würden.
Bodyguards?
Die haben einen Al-Qaida-Ableger da drüben, Peter.
Richter hatte beschlossen, sich mit dem Unvermeidlichen abzufinden. Wenn ein Land wusste, wie es sich und seine Besucher vor Islamisten schützte, dann Algerien, so viel war ihm klar.
Und die Algerier meinten es ernst. Nach der Landung in Algier vor einigen Stunden hatte ihn noch in der Lufthansa-Maschine ein Geheimdienstmann in Empfang genommen, durch den Transitbereich geführt und in einen Kellerraum gebracht, wo sie gemeinsam auf den Anschlussflug mit Air Algérie gewartet hatten. Gemeinsam hatten sie das Gate passiert, gemeinsam die Maschine betreten, gemeinsam waren sie nach Constantine geflogen. Dort hatten zwei Polizisten und der kleine, quirlige Sadek Madjer gestanden, der sich ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift MONSIEUR ATLAS vor die Brust gehalten hatte. Richter hatte noch geschmunzelt, als sich der Geheimdienstler verabschiedete.
Au revoir, Monsieur.
Au revoir et merci beaucoup.
Allah yehfadek, Monsieur.
Merci, merci beaucoup.
Jetzt bremste das Polizeifahrzeug vor ihnen, auch die Limousine wurde langsamer. Im Schritttempo ging es weiter, alle Autos ordneten sich in die rechte Spur ein.
»Un barrage«, sagte Madjer, der ein hartes, verschliffenes Französisch sprach.
»De la police?«
»Oui, oui. Sie suchen Bomben und Terroristen.« Madjer kicherte, salutierte dann aber doch, als sie an den Polizisten vorbeifuhren. Einer von ihnen hielt ein helles, schachtelartiges Ding mit kurzer Antenne in der Hand, das Richter wenig vertrauenswürdig vorkam.
Während Madjer beschleunigte, erzählte er vergnügt, er habe gehört, dass die Amerikaner die Detektoren vor einer Weile »getestet« hätten, indem sie mit einem mit Sprengstoff beladenen Wagen durch Algier gefahren seien. Keines der Geräte habe angeschlagen. Nun wolle der algerische Staat den Hersteller verklagen. »Mit Ihren Panzern wird das nicht passieren, oder? Der ›Atlas‹ wird funktionieren.«
Richter erwiderte Madjers Lächeln. »Natürlich.«
Im Konvoi fuhren sie ins Tal hinunter, das Gästehaus befand sich in einem Vorort westlich der Altstadt. Richters Blick blieb auf den Häusern oben haften, die im weißlichen Licht der Oktobersonne leuchteten. Unterhalb einer viaduktähnlichen Straße fiel die Felszunge steil und grün ab. Richtung Küste wurde der Hang immer felsiger, bis er an der Schlucht des Flusses Rhumel abrupt nach Osten abbog.
Er lehnte sich vor. »Was bedeutet Allah yeh … yehfa …«
»Allah yehfadek? ›Gott möge Sie schützen.‹«
Wenige Minuten später hatten sie das von einer strahlend weißen Mauer umgebene Gästehaus erreicht. Die Streifenwagen entfernten sich. Ein Stahltor glitt zur Seite, Madjer lenkte die Limousine in den Hof, wo zwei Männer warteten, ein Algerier im schwarzen Anzug, ein Europäer in heller Hose und weißem Hemd.
Der Europäer öffnete die Fondtür, und Richter stieg aus.
»Ahlan wa sahlan, Herr Richter. Ich bin Toni.«
»Guten Tag, Toni.«
Sie reichten sich die Hand. Tonis Alter war schwer zu schätzen, er mochte wie er selbst Ende vierzig sein. Kein Gramm Fett, der Haaransatz kaum einen Millimeter zurückgewichen, die Augen voller Energie. Doch die Falten darum waren tiefe, ausgetrocknete Kerben.
»Sie sprechen Algerisch?«
»Arabisch. Ich bin schon lange im arabischen Raum unterwegs. Bundesgrenzschutz, Fremdenlegion, seit einer Weile privat.«
»Klingt spannend, Fremdenlegion.«
Toni zuckte mit den Schultern. »Fünfzehn Jahre, Bosnien, Kosovo, Irak, Maghreb.« Er wies auf den Mann im schwarzen Anzug. »Ahmed. Er spielt Tennis, falls Sie mal Lust haben.«
Richter nickte. »Warum nicht?«
Ahmed war deutlich größer und muskulöser als Toni, ein schlanker, leicht nach vorn geneigter Hüne.
»Ahlan wa sahlan«, sagte Richter.
»Choukran djazilan.« Ahmed ergriff seine Hand und sprach mit leiser Stimme weiter. Er wirkte schüchtern, beeindruckt von der offiziösen Umgebung, dem mehr oder weniger bedeutenden Gast des Verteidigungsministeriums. Als er schwieg, gestand Richter auf Französisch, er habe nur das wiederholt, was er eben bei Toni gehört habe.
Sie lachten.
»Ich hoffe, es war keine Beleidigung.«
»Nein, nein«, sagte Sadek Madjer, der mit dem Koffer zu ihnen getreten war. Während sie hineingingen, erklärte er, mit diesem Satz heiße man den anderen als Angehörigen der Familie willkommen und wünsche ihm einen leichten Weg. Lächelnd hob er den freien Arm. »Wir sind eine große Familie, und hier wohnen wir.«
Richter kam das Gästehaus weitläufig und luxuriös vor. Unten Bedienstetenzimmer, die Küche und ein Wohnzimmer mit Essbereich, Bar, Fensterfront, einer zweiten Treppe nach oben. Draußen eine Terrasse, ein Garten mit Tennisplatz, akkurat gepflegt. Im oberen Stockwerk lagen Schlafzimmer und Bäder, ein Arbeitszimmer mit Computer, eine kleine Bibliothek; im Keller, ergänzte Madjer, ein Raum mit Billardtisch sowie ein kleiner Swimmingpool und ein Gebetszimmer. Die Böden waren aus hellem Naturstein, die orientalischen Teppiche ein Vermögen wert, in allen Räumen nur die feinsten Stoffe und Dekors, Mahagoni, dunkelbraunes Leder.
»Ja, Algerien ist ein reiches Land«, sagte Madjer.
Und ein neugieriges, dachte Richter. Er zeigte auf eine der Kameras an der Decke im oberen Flur. »Schutz oder Überwachung?«
»Schutz.«
»Wer sitzt vor den Monitoren?«
»Das Verteidigungsministerium.«
»Das ist in der Tat beruhigend.«
Madjer deutete eine Geste der Entschuldigung an. »Leider sitzt es vier Kilometer entfernt.«
»Dann ist es also zu spät, wenn die Bösen erst mal drin sind.«
»Sie sagen es, Monsieur.« Madjer stieß eine Tür zu einem im Halbdunkel liegenden Raum auf. »Ihr Zimmer.«
»Ohne Kameras, hoffentlich.«
»Nein. Sie sehen sie nur nicht.«
Richter hielt auf der Türschwelle inne, Empörung wallte in ihm auf. Dann sah er Madjers Mundwinkel zucken.
»So haben wir auch eine Beschäftigung für die Bärtigen in unseren Reihen, Sie verstehen.« Kichernd legte Madjer den Koffer auf die Ablage, dann zog er die schweren, bunt gemusterten Vorhänge zur Seite und sagte: »Ahlan wa sahlan, ya si-Peter.«
Unten auf der Terrasse warteten Kaffee, Erdnüsse und algerisches Gebäck. Richter hatte sich umgezogen, trank und aß im Stehen. Toni war bei ihm, sie sprachen über die Abläufe. Jeden Morgen pünktlich um halb acht Abfahrt nach Ain Smara zur künftigen »Atlas«-Produktionsstätte etwa zehn Kilometer westlich des Flughafens. Madjer würde fahren, Richter saß hinten, Toni vorn, zwei Streifenwagen begleiteten sie, Ahmed blieb im Gästehaus. Auf dem Firmengelände von Elbe Algérie würde Toni keinen Zentimeter von Richters Seite weichen. Nachmittags pünktlich um halb fünf würden die Streifen sie dort abholen.
»Sicher wie in Abrahams Schoß«, sagte Richter.
»Hier sind Sie in Ibrahims Schoß«, erwiderte Toni.
Die Sonne stand tief, Garten und Tennisplatz lagen im Schatten irgendeiner Erhebung im Westen. Constantine hoch über ihnen hatte noch Licht. Vielleicht übte es deshalb eine derart starke Anziehung auf ihn aus, dachte Richter. Die spektakuläre Lage und so viel Licht. Licht beruhigte ihn.
Er gähnte verhalten, schenkte sich Kaffee nach. Auch Toni nahm eine zweite Tasse. Aus dem Obergeschoss war das Brummen eines Staubsaugers zu hören. Madjer hatte ihm den Koch und zwei Dienstmädchen vorgestellt. Die Frauen trugen hellblaue Kleider, weiße Kopftücher und glichen Krankenschwestern. Der Koch war ein französischstämmiger Italiener aus dem Aostatal und hatte versprochen, ihn fünf Tage lang zu verwöhnen.
»Ich würde später gern in die Altstadt hochfahren.«
»Das geht leider nicht«, erwiderte Toni.
»Warum nicht?«
»Außerhalb des Hauses dürfen Sie sich nur mit Polizeieskorte bewegen. Die müssen wir beantragen, und das dauert ein paar Stunden. Nichts liebt die algerische Bürokratie weniger als Spontaneität.«
»Dann fahren wir ohne Eskorte. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Constantine gefährlich ist.«
»Für Sie ist jeder Ort in Algerien gefährlich.«
»Sie übertreiben.«
»Immer«, erwiderte Toni. »Deshalb bin ich noch am Leben.«
Richter hob den Blick zu den Häusern in der Sonne. Ob heute oder morgen, spielte natürlich keine Rolle. Aber es ging ums Prinzip. Er war doch Geschäftspartner der Algerier, nicht ihr Gefangener. »Sie würden mich wohl nicht daran hindern, allein loszufahren?«
»Nein, aber ich würde an Ihr Gewissen appellieren. In dem Moment, in dem Sie nächste Woche ins Flugzeug steigen, wären Ahmed und ich unsere Jobs los. In Algerien könnten wir in unserer Branche nicht mehr arbeiten.« Toni deutete in Richtung Constantine. »Ahmed hat Familie da oben. Kleine Kinder, alte Eltern. Sechs Menschen sind von ihm abhängig.« Er zog einen Sessel unter dem Tisch hervor. »Setzen Sie sich.«
Richter gehorchte, langte nach den Erdnüssen, streckte die Beine von sich.
Toni ließ sich neben ihm nieder und stützte die Ellbogen auf die Knie. »Sie haben von AQMI gehört? AQM, wie die deutschen Behörden sagen.«
»Al-Qaida im islamischen Maghreb.«
»Entführungen, Anschläge, Drogenschmuggel, Waffenhandel, Schleusung.«
»Ein paar Hundert Krieger in der Wüste, Toni, zweitausend Kilometer entfernt.«
»Sie lesen die falschen Zeitungen.«
Tonis Stimme wurde leise und eindringlich. AQMI sei 2007 aus der GSPC hervorgegangen, erklärte er, der Groupe salafiste pour la prédication et le combat, einer der brutalsten islamistischen Terrorbanden Algeriens, 2003 verantwortlich für die Entführung der zweiunddreißig europäischen Sahara-Reisenden. Mit dem Segen der damaligen Al-Qaida-Führung dann die Umbenennung und offizielle Einbindung in den weltweiten Dschihad. Heute gehe man von zwölfhundert bis zweitausend AQMI-Kämpfern aus, etwa die Hälfte davon zurzeit in Mali aktiv, andere in Libyen und Mauretanien, viele jedoch in Nordalgerien, vor allem in der Berberregion Kabylei, keine dreihundert Kilometer von Constantine entfernt.
Pro Jahr verübe die Gruppe in Algerien fünf- bis sechshundert Anschläge. Ihre Spezialitäten im Norden: falsche Straßensperren, bei denen Angehörige der Sicherheitskräfte aus Autos oder Bussen gezogen und erschossen würden, sowie Sprengstofffallen. 2007 seien bei drei Anschlägen in Algier über sechzig Menschen getötet worden, darunter Mitarbeiter der UNO. Die Amerikaner stuften AQMI als eine der gefährlichsten Terrorgruppen überhaupt ein.
»Kein Deutscher, der in offizieller Funktion in Algerien ist, sollte ohne Eskorte über Land fahren. Das gilt für den Botschafter genauso wie für den Leiter des Goethe-Instituts und die Mitarbeiter der Deutsch-Algerischen Handelskammer. Keiner von ihnen verlässt Algier ohne Eskorte.«
Richter hob träge eine Hand. »Ich will nicht über Land, nur da rauf.«
»Nicht heute.«
»Schon gut, schon gut. Buchen Sie die Eskorte für morgen, achtzehn Uhr dreißig. Schafft die algerische Bürokratie das?«
Toni nickte. »Danke.«
»Sie übertreiben überzeugend.«
»Ich habe gute Quellen.«
»Die Algerier?«
»Von denen erfahren Sie nichts.« Toni zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Das Bundeskriminalamt hat einen Verbindungsbeamten an der Botschaft, Ralf Eley. Er gibt Antworten, wenn man ihm Fragen stellt. Sie lernen ihn am Dienstag kennen, er kommt mal rüber nach Constantine, will Sie kennenlernen, sich ein bisschen genauer informieren über das, was Ihre Firma so plant.«
»Um anderen Antworten auf deren Fragen geben zu können?«
»Das ist sein Job.«
Für eine Weile fiel kein Wort. Richters Blick lag auf Constantine, in das Licht dort oben hatte sich ein zartrosa Schimmer geschlichen. Er war in einem südbayerischen Tal ohne Sonne aufgewachsen, deshalb die Sehnsucht nach Helligkeit. Bei Meininger Rau in Altniederndorf hatte er zwei zusätzliche Fenster in die Büromauer einsetzen lassen. Bei Elbe Defence in Lüneburg waren die Mauern auf drei Seiten aus Glas.
»Und Sie«, sagte er, »haben Sie auch Familie da oben?«
»Sie sind meine Familie, Herr Richter, zumindest für die nächsten fünf Tage.«
Gegen sechs ging Richter mit Ahmed und Madjer zum Tennisplatz. Sie spielten im Flutlicht, die Dämmerung kam rasch, mit ihr ein kühler Wind. Madjer betätigte sich als Schiedsrichter. Mit Ernst und Hingabe überwachte er das Spiel von einem Stuhl aus, der Kopf flog mit dem Ball hin und her, der Blick war beinahe unbestechlich. Ahmed spielte besser und schneller als Richter und verlor doch knapp den ersten Satz. Er hätte auf diesem Platz mit diesem Schiedsrichter jedes Match der Welt verloren – Madjers Version der algerischen Gastfreundschaft.
»Out!«, schrie Madjer und sprang auf. »Advantage Richter!«
Richter sah Ahmed grinsen und musste lachen.
Im zweiten Satz wurden Madjers »Fehlentscheidungen« zunehmend grotesker. Ahmed achtete nun darauf, den Ball nicht mehr platziert in die Nähe der Linien zu spielen, sondern mitten ins Feld. Madjer behalf sich, indem er Fußfehler oder »bewusste Irritation des Gegners« beanstandete. Hin und wieder rutschten Ahmeds Bälle durch ein winziges Loch im Netz, von dessen Existenz nur der Unparteiische wusste.
Richter gewann auch den zweiten Satz.
»Gratulation«, keuchte er beim Handschlag am Netz, und Ahmed strahlte über das ganze sanfte Gesicht.
Auf der Terrasse trank Richter zwei Gläser Wasser, setzte sich, um zu verschnaufen, die Hände auf dem weichen, zitternden Bauch. Ihm war ein wenig übel, vor Erschöpfung vielleicht oder vor Hunger. Constantine war in der Finsternis nur noch zu erahnen, vereinzelte Lichter schwebten in der Höhe, Straßenlaternen, Lampen hinter Fenstern. Die Nächte in seinem südbayerischen Tal hatten selbst im Sommer von sechzehn Uhr bis elf am nächsten Tag gedauert, die Winter waren höchstens einmal hellgrau geworden.
Er wusste nicht, weshalb er ausgerechnet hier, in Nordafrika, so oft über die Dunkelheit nachdachte. Als würde sie von innen in seine Gedanken kriechen.
Toni trat neben ihn, eine Tasse in der Hand, plötzlich roch es nach starkem Kaffee.
»Könnte ich auch eine Tasse haben?«, fragte Richter.
»Nehmen Sie die.«
Toni ging, kehrte mit einer weiteren Tasse zurück. »Und Sie? Haben Sie Familie?«
»Frau und zwei Töchter.«
»Drei Frauen.«
»Die alle drei seit einer Weile pubertieren.«
Toni lachte leise.
In den Büschen und Bäumen surrten Zikaden. Ein feiner, süßlicher Geruch lag in der Luft, Nachtjasmin, hatte Madjer erklärt. Richter gähnte, leerte seine Tasse. Die Töchter gingen auf Demonstrationen gegen Rüstungsexporte und verlangten von ihm »moralisches Verhalten«. Sie hatten keine Ahnung von der Welt. Davon, wie wichtig Stabilität war.
Vor allem Algeriens Stabilität.
Ein demokratischer arabischer Mittelmeerstaat mit europäischer Vergangenheit, immensen Öl- und Erdgasvorkommen, reich und quasi ohne Auslandsschulden, mit der Sahara, in der in ferner Zukunft durch Solarkraftwerke ein Gutteil des europäischen Stroms produziert werden könnte. Doch Algerien war umgeben von Krisenländern wie Libyen, Tunesien, Mali, Westsahara, von innen bedroht durch al-Qaida, islamistische Parteien, Autonomiebestrebungen der Berber, Unruhen im Gefolge des Arabischen Frühlings in anderen Ländern. Sicherheit entstand hier nicht durch fromme Wünsche. Das verstanden die Töchter noch nicht. Und so forderten sie den Vater heraus, wie man es in der Pubertät eben tat.
Und seine Frau …
Seine Frau besuchte an den Wochenenden Reiki-Seminare. Kürzlich war sie in den Dritten Grad eingeweiht worden und konnte nun auch im astralen Bereich arbeiten. Richter hatte ihr so begeistert wie möglich gratuliert und ihr auch die Ausbildung zum Vierten Grad geschenkt.
Die Töchter hatten gefragt, wie man mit Blutgeld spirituelle Reinheit erreichen wolle. Seine Frau hatte erwidert, auf diese Weise bringe das Blutgeld wenigstens Gutes. Richter hatte schweigend auf seine bloßen Unterarme gestarrt und verfolgt, wie die Gänsehaut kam. Noch nie hatte er sich so verletzt gefühlt.
Er wandte sich Toni zu. »Wohin gehen Sie, wenn Sie frei haben?«
Toni lächelte. »Was genau wollen Sie wissen?«
»Wovon Sie abhängig sind. Wen Sie brauchen, um leben zu können.«
»Niemanden, der nicht austauschbar wäre.«
»Heute Abend ich, heute Nacht eine Prostituierte?«
Toni nickte.
»Und beide Namen haben Sie in ein, zwei Wochen vergessen.«
»Ist nichts Persönliches.«
Richter hob die Brauen. »So oder so.« Er stand auf, streckte sich. Das Tennismatch hatte ihn über alle Maßen erschöpft. Was für eine dumme Idee, nach einer achtstündigen Reise Tennis zu spielen.
Und in ihm rumorte die Finsternis.
Als Kind hatte er Steine in die Nacht geworfen, um die Geister zu vertreiben. Sie sollten wissen, dass er wehrhaft war. Mit fünfzehn hatte er sich eine Steinschleuder gebastelt. Mit Anfang dreißig war er in die Rüstungsindustrie eingetreten.
Er lächelte flüchtig ins Nichts.
»Wollen Sie’s wirklich wissen?« Toni zog eine dunkelgraue Automatikpistole mit schwarzem Griff aus dem Holster und legte sie auf den Tisch.
Richter trat näher. Im kargen Schein der Terrassenbeleuchtung waren Hersteller und Modell nicht zu erkennen.
»Eine MAC-50.«
»Eine Französin«, sagte Richter, beugte sich über die Waffe. »Eine alte Dame, auch wenn man es ihr nicht ansieht.« Die MAC-50 wurde seit 1978 nicht mehr hergestellt.
Toni lächelte. »Wir kommen bestens miteinander klar.«
»Die Pistole der algerischen Armee. Neben der chinesischen Tokarew.«
»Sie sind gut informiert.«
»Ich war lange bei Meininger Rau.«
Toni steckte die Waffe wieder ein. »Von ihr bin ich abhängig. Seit dreißig Jahren habe ich keinen Tag ohne Pistole verbracht. Seit acht Jahren keinen Tag ohne sie.« Er klopfte sich auf die Hüfte. »Nicht weil ich Angst hätte. Sie macht mich zu dem, der ich bin. Ohne sie würde nichts bleiben. Kein Verwendungszweck für den alten Toni. Sie sind also mit Waffen vertraut?«
»Nur vom Schießstand.«
»Beneidenswert.« Toni erhob sich, unterdrückte ein Gähnen. »Verzeihen Sie. In zwanzig Minuten gibt’s Abendessen. Falls Sie noch duschen wollen.«
Richter ging hinauf. Jeder Schritt fiel ihm schwer, als wären die Gelenke aus Blei. In seinem Zimmer ließ er sich auf die Seidendecke des Doppelbettes nieder, sank tief in blumig duftende orientalische Gemütlichkeit. Er hätte einen Stapel Algerische Dinare gegeben für ein Zimmermädchen, das ihm die Schnürsenkel löste, ihm Schuhe und Socken auszog, Madjer konnte er nicht darum bitten, der war heimgefahren und würde erst am Morgen zurückkommen, hockte jetzt oben im lichtdurchfluteten Constantine, wo man einen wie ihn ohne halbe Kompanie nicht einmal Gondel fahren lassen wollte …
Toni weckte ihn.
Er hob den Kopf, setzte sich verwirrt auf. Als er die Turnschuhe an seinen Füßen sah, begriff er. »Tut mir leid, ich bin ein bisschen müde, die Reise …«
»Kein Problem. Sie können das Essen ausfallen lassen.«
»Nein, nein, ich komme. Geben Sie mir zehn Minuten.«
Er duschte rasch, zog sich an, ging den Flur entlang, noch müder als zuvor.
Auf der Treppe ins Wohnzimmer hinunter nahm er den Geruch von gebratenem Fleisch und Gewürzen wahr. Stimmen drangen an sein Ohr, Toni und Ahmed, die auf Arabisch miteinander sprachen, merkwürdig angespannt klangen. Sie standen mitten im Raum, schwiegen abrupt, als sie ihn bemerkten. Ihre Blicke folgten ihm, und er spürte, dass sich etwas verändert hatte.
»Qu’est ce qui se passe?«
»Le café«, sagte Ahmed. »Ich trinke keinen Kaffee.«
»Hast du Wasser getrunken?«, fragte Toni.
»Nicht das draußen auf dem Tisch.«
»Ich verstehe nicht …«, sagte Richter.
»Die Müdigkeit«, erwiderte Toni. »Nur Ahmed ist nicht müde.«
Richter spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. Er verstand immer noch nicht, aber die Angst war schon da. Rasch trat er in den durch ein hüfthohes Mäuerchen abgetrennten Essbereich und setzte sich an den Tisch, der für eine Person gedeckt war. Jenseits der raumhohen Fensterwand lauerte das Schwarz der Nacht, diesseits glitten Schemen hin und her, Ahmed hatte den Vorhang aus einer Kordelschleife gelöst, zog ihn hastig über die ganze Breite zu, in der anderen Hand ein Telefon. Er hob es ans Ohr, sagte zu Toni: »Toujours rien.«
»Le portable!«
»Dans ma chambre.«
»Non, reste ici, on doit rester ensemble.«
Plötzlich stand Toni neben ihm, stützte sich schwer auf den Tisch.
»Ich möchte gern essen«, stieß Richter heiser hervor.
»Zu spät.«
Erst jetzt bemerkte er, wie blass und erschöpft Toni aussah, bemerkte den dünnen Schweißfilm auf seiner Stirn, das Zucken der Augenlider.
Da verstand er. Der Kaffee, das Wasser draußen auf dem Tisch, versetzt mit … irgendetwas.
»Passiert das wirklich?«, flüsterte er.
»Sieht so aus.«
»Und … wer?«
»Wollen Sie eine Waffe, Herr Richter?«
»Aber es ist doch niemand hier!«
»Es wird jemand kommen.«
»Wer, Toni? Al-Qaida?«
Toni nickte, es schien ihn Kraft zu kosten. »Sie müssen sich entscheiden. Wer eine Waffe hat und schießt, auf den wird auch geschossen.«
Richter spreizte abwehrend die Finger. Seine Arme waren schwer, ließen sich kaum noch bewegen, sein Puls raste. Er hörte Ahmeds Stimme, der wieder Algerisch sprach, mitten im Raum stehend, den Blick nach oben gerichtet, als betete er zu seinem Gott. Aber er sprach nur zu dem halbrunden Kameraauge, das über ihm in der Decke eingelassen war.
Vier Kilometer, dachte er. Ein paar Minuten, und alles ist gut.
Ahmed verschwand hinter seinen Lidern.
Er wurde hochgerissen und hart gegen die Wand gestoßen.
»Nicht ohnmächtig werden!«, sagte Toni.
Er schüttelte den Kopf, wollte wach bleiben, aber er spürte seine Beine nicht mehr, sank wieder zu Boden. Die Dunkelheit übermannte ihn, alles wurde still.
Ein Schlag ins Gesicht holte ihn zurück, er riss die Augen auf. Wieder zerrte Toni ihn hoch. »Sie sind da!«
Ein Ruf erklang, gedämpfte Schüsse fielen. Ahmed hockte jetzt unter dem Gottesauge auf den Fersen, der Kopf hing reglos nach vorn, ein letztes Gebet. Tonis Gesicht schob sich in sein Blickfeld, die Augen kalt und leer. Die Hände lagen an seinen Wangen, er spürte Lauf und Kolben der MAC. Ewigkeiten schienen zu verstreichen. Tonis Gesicht verschwamm immer mehr, der Griff wurde fester, hielt ihn im Licht.
»Die wollen Sie lebend, okay?«
Richter schüttelte den Kopf, konnte nicht aufhören damit. Ein Traum, er träumte.
»Ihre Firma wird zahlen, Sie werden freikommen.«
»Wer?«, hörte er sich krächzen.
Über ihnen waren Schritte zu hören, jemand rannte dort oben. Von der Wohnzimmertür erklang die Stimme eines Mannes, der etwas auf Arabisch rief. Toni schien antworten zu wollen, aber dann sagte er: »Denken Sie dran, die brauchen Sie lebend. So finanzieren sie sich, durch Entführungen. Ihre Firma wird zahlen, Sie werden freikommen. Vergessen Sie das nicht. Sie werden es durchstehen.«
»Und Sie?«
Richter spürte ein Achselzucken. »Ich muss jetzt arbeiten.«
»Nein!« Es gelang ihm, die linke Hand zu heben, auf die Pistole zu legen. Er spürte Tonis knochige Finger, das kühle Metall. Er sah nichts mehr, hatte vielleicht die Augen geschlossen, vielleicht waren es Tränen. »Lassen Sie mich nicht allein, bitte …«
Wieder die fremde Stimme, diesmal von weit her, fast genauso weit entfernt Toni, der auf Arabisch antwortete.
»Bitte, Toni …«
»Richten Sie Sadek aus, dass ich aus der Hölle zurückkomme, um ihn zu holen.«
»Nein!« Er presste die Hand auf die Waffe, ließ den Kopf schwer dagegen sinken. »Toni, bitte …«
Die letzten Kräfte waren verbraucht, die Beine gaben nach.
Die Dunkelheit holte ihn.
2
BERLIN
Fünfzig also. Der Countdown hatte begonnen.
Sein Urgroßvater war mit neunundfünfzig gestorben. Der Großvater mit siebenundfünfzig. Der Vater mit vierundfünfzig. Die Wegners des 20.Jahrhunderts gingen in ihren Fünfzigern, und sie gingen immer früher.
Reinhold Wegner öffnete die Augen, sog den Duft des doppelten Espresso ein, den die mächtige Maschine vor ihm zubereitete. Er stand in der Küche der Firmenvilla in Lichterfelde West, ließ den nackten, von Alkohol und sechs Stunden Schlaf erhitzten Körper in der Zugluft auskühlen, sein Wundermittel gegen den Kater: Kälte.
Fünfzig Jahre.
Mit fünfzig hatte sein Vater schwarze Steine ausgehustet.
Er selbst war anders. Lebte nicht wie seine Vorväter, die sich und die Ihren mit Schwerstarbeit durchgebracht hatten, Kohle gefördert oder Steine aufeinandergeschichtet oder Bäume geschlagen hatten.
Doch das war es nicht allein. Im selben Moment, als die Grube über ihnen geschlossen worden war, hatte die Welt ihre Gesichter vergessen, und ihre Namen waren verklungen. Niemals hatten sie mehr als das Nötigste besessen, niemals Anerkennung erfahren. Vom ersten bis zum letzten Atemzug bedeutungslos, fünfzig Jahre und ein paar wenige mehr. Die Welt hatte sie nicht gebraucht, und wer nicht gebraucht wurde, der starb eben früh.
Ihn dagegen brauchte man.
Man kannte ihn in aller Herren Länder, besonders den sandigen, windigen, heißen. Nicht in der Öffentlichkeit natürlich, sondern dort, wo es drauf ankam: in den schattigen, schallisolierten Hinterzimmern der Macht. Die Ströme der Waren und des Geldes mussten gelenkt werden, und darauf verstand er sich bestens. Wohlwollen war die Währung, eine knappe Devise, die er ein ums andere Mal generierte, was allerdings nicht weiter verwunderlich war. So, wie die harten Jungs mit den gebügelten Uniformen und den verspiegelten Sonnenbrillen deutsche Autos liebten, so liebten sie deutsche Waffen. Und weil er, Reinhold Wegner, schneller, fantasievoller und lösungsorientierter vorging als die Konkurrenz, liebten sie vor allem die Waffen von Meininger Rau.
Ja, man brauchte ihn, und deshalb würde er im Gegensatz zu seinen Vorvätern alt werden, würde Seniorenausweise, Rollatoren und Pflegepersonal kennenlernen, dritte Zähne, künstliche Hüftgelenke, den grünen Star. Er würde seine letzte Erektion beim Anblick eines Geriatriestudentinnenhinterns bekommen, seinen letzten Furz in einem blühenden Hospizgarten auf einem bayerischen Hügel lassen.
Ein sanfter Gong erklang, der Espresso war fertig. Wegner nahm die Tasse, hielt sie sich unter die Nase, schloss die Augen.
Fünfzig Jahre also. Er fröstelte.
Nackt, die Tasse in der Hand, Hausschlappen an den Füßen, ging er durch das Chaos in Richtung Wohnzimmer. In zwei Stunden kamen die Putzkolonnen, sie hatten viel zu tun. Zersplittertes Glas knirschte bei jedem Schritt, es stank nach Fleischresten, Knoblauch, dem kalten Rauch von Zigaretten und Zigarren. Das Büfett im Esszimmer ein vielfarbiges Schlachtfeld, der Teppich darunter für alle Ewigkeit verdorben. Überall lagen und standen leere Flaschen, auf dem Parkett im Wohnzimmer trockneten Alkoholpfützen, er stieß gegen achtlos abgestellte, verschmutzte Teller. An einer Stuhllehne ein vergessenes Jackett, auf dem Kaminsims ein hauchdünner braungelber Damenschal.
Hermès, ein Geschenk aus Paris.
Ach, das ist doch viel zu teuer, Reinhold.
Steht dir wunderbar. Wie für dich gemacht.
Aber ich will solche teuren Sachen nicht. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich ihn tragen soll.
Morgen zum Beispiel. Ich bringe zwei Saudis mit, Generäle.
Also gut, machen wir es so: ein Dienstschal, für solche Gelegenheiten.
Er trat an den Kamin und schlang sich den Schal um den Hals. Seine Frau war für eine Stunde gekommen. Lange genug, um da gewesen zu sein. Lange genug, um den Schal zu vergessen.
Ein Höflichkeitsbesuch.
Darin war sie unschlagbar, in Höflichkeit. Kein Abgeordneter, kein General, kein Minister, dem sie nicht durch einen freundlichen Plausch für Minuten die Sorge um den Zustand seiner Welt nehmen konnte. Eine unbezahlbare Fähigkeit.
Er ging weiter. Der Duft ihres Parfüms überlagerte den Gestank.
Er war zufrieden. Eine gelungene Feier.
Neunzig Gäste, die meisten mit dem Vorsatz, sich zu benehmen, unter ihnen die Geburtstagsdelegation von Meininger Rau und seine Frau. Der Rest hatte gewartet, bis man unter sich war. Ein Ministerialbeamter, ein Staatssekretär, ein paar Hinterbänkler, ein paar Firmenbosse, zwei Georgier, ein Mexikaner, ein Spanier, Hostessen, Wegner selbst, der fortan nichts anderes mehr getan hatte, als sich bis acht Uhr morgens um die Zufriedenheit seiner verbliebenen Gäste zu kümmern.
Nun gab es ein paar Geschichten mehr, über die man nur mit ihm sprechen konnte. Das schuf Verbundenheit.
Er ließ die Terrassentür zur Seite gleiten, folgte dem Kiespfad, der sich durch den Garten schlängelte. Der Dienstschal flatterte im Morgenwind, der Duft seiner Frau verflog.
Sein Sohn war gar nicht erst erschienen.
Selbst seine Frau hatte versucht, ihn zu überreden. Ach komm, nur ein Stündchen, es ist deinem Vater wichtig. Bestimmt werden hübsche Mädchen da sein. Vielleicht leiht er dir den Jaguar.
Anderes war wichtiger gewesen.
Am Rand des Swimmingpools schlüpfte Wegner aus den Hausschuhen, stellte die Tasse ab, ließ den Schal auf den Kies gleiten. Über die Beckenleiter stieg er ins kalte Wasser. Er folgte der Bodenschräge, bis er nicht mehr stehen konnte, dann ließ er sich treiben, spielte müde toter Mann.
Später schwamm er ein paar langsame Bahnen, tauchte vom einen Ende des Pools zum anderen. Fünfzig, dachte er unter der Wasseroberfläche. Bestimmt kam ab fünfzig die eine oder andere Vorsorgeuntersuchung dazu. Am Montag würde er seinen Hausarzt fragen. Untersuchen lassen, was mit fünfzig anfällig wurde. Endlich abnehmen.
Er holte Luft, tauchte weiter. Auf halber Strecke meinte er Stimmen zu hören. Er öffnete die Augen und hielt erschrocken inne. Schräg über ihm, am Beckenrand, schwebten zwei dunkle Gesichter. Zwei dunkle Hände winkten.
Prustend kam er hoch. Die Liberianer.
Sie lachten, er lachte mit. Mr.Reinhold, sonst im feinsten Zwirn, nun nackt und bleich und unrasiert, die Augen schattig, die schütteren dunklen Haare an der Kopfhaut klebend.
Er schwamm ein Stück auf sie zu, bis er stehen konnte, hielt sich die Linke vors Geschlechtsteil und sagte: »My friends, how nice to see you again!«
Kniend reichten sie ihm die Hand. Sie seien, sagte Joseph in seinem perfekten Oxford-Englisch, auf dem Weg zum Flughafen. Hätten ihn noch einmal sehen, sich noch einmal bedanken wollen.
Wofür? Er hatte nichts für sie tun können. Nach Liberia durfte Meininger Rau nicht liefern, weder die gewünschten MRG 45 noch die Lizenz für deren Nachbau. Natürlich war das von vornherein klar gewesen. Für Liberia galt ein striktes UN-Waffenembargo.
Zwei Tage lang hatte man Anfang vergangener Woche die Lage in Berlin besprochen, hier in der Villa, im abhörsicheren Kellerraum. Wegner hatte empfohlen, über Spanien oder, vielleicht einfacher noch, über Jordanien oder Saudi-Arabien zu kaufen, die alle die MRG-45-Lizenz erworben hatten. Er hatte angeboten, Kontakte zu vermitteln. Andere, inoffizielle Wege zu eruieren. Die Algerier hätten gerade gekauft, eventuell gebe es da Möglichkeiten? Joseph und Luseni hatten gesagt, sie müssten überlegen, sich »mit dem Chef« besprechen.
Sie standen jetzt hoch über ihm vor dem weißlichen Himmel, er kniff die Augen zusammen. Beide waren Ende dreißig, Joseph schlank und klein, der linke Arm gelähmt, Luseni größer, breiter, untersetzt. Wegner mochte sie, sie behandelten ihn freundlich und respektvoll. Sie trugen die schwarzen Caps und die grauen T-Shirts, die er ihnen geschenkt hatte. HK stand in Rot darauf, auf den Shirts dazu in Schwarz quer über der Brust der Heckler & Koch-Slogan, no compromise. Es war ihm lieber, wenn Meininger Rau nicht mit Liberia in Verbindung gebracht wurde.
»Ist Phil auch da?«
»Isst Ihren Kuchen auf«, erwiderte Luseni.
»Kommen Sie aus dem Wasser, Mr.Reinhold«, sagte Joseph, streckte ihm die Rechte entgegen. »Sonst verschrumpeln Sie.«
Wegner wehrte lächelnd ab. Er sah Phil auf die Terrasse treten, zum Pool kommen, ein Stück Kuchen in der Hand. Phil, einer der Mittelsmänner, der letzte vor Joseph und Luseni. Er war in Deutschland geboren, in London aufgewachsen, in der Welt zu Hause, so zumindest wollte es die Legende. Ein schöner, wilder Mann mit blondem Zopf, flog in Cessnas über die afrikanische Savanne. Wegner hatte Fotos gesehen und an Robert Redford gedacht.
»Tried to call you«, sagte Phil, der immer nur Englisch sprach. »Ging keiner dran.«
»Ich muss es überhört haben.«
»Die Jungs hier wollten noch mal danke sagen. Sie einladen nach Monrovia, Ferien mit der Familie.«
»Sie müssen kommen«, sagte Luseni.
»Gern!«, sagte Wegner. Niemals würde er nach Liberia reisen. Kaum ein Land ängstigte ihn mehr. Das Charles-Taylor-Land. Er konnte das nicht vergessen, auch wenn seit Jahren eine gewählte Präsidentin regierte. Mit Ruanda ging es ihm ähnlich. Elfenbeinküste. All die Gemetzel. Nein, es war ihm lieber, Interessenten aus diesen Ländern kamen zu ihm. »Sehr gern.«
»Sie sind schon ganz blau im Gesicht, Mr.Reinhold«, sagte Joseph, der sanfteste Offizier, dem er je begegnet war. Er hatte ein buntes Kleid für Wegners Frau und eine Jägerstatuette aus Mahagoni für seinen Sohn mitgebracht. Söhne mit achtzehn seien schwierig, hatte er gesagt. Sie wollten so gern etwas sein, aber sie seien noch nichts. Traurige Jäger, die noch keine Beute erlegt hätten, zwischen Jugend und Männlichkeit erstarrt.
Seine Frau liebte das bunte Kleid. Sein Sohn lockte Mädchen mit dem Mahagoni-Jäger nach Hause.
»Da liegt was im Pool«, sagte Phil und deutete neben Wegner.
Er bückte sich, fischte den Gegenstand heraus, hielt ihn hoch – sein neues, wasserdichtes Smartphone. Er hatte es im Morgengrauen testhalber in den Pool geworfen und dann dort vergessen.
Sie lachten.
»Wilde Party«, sagte Phil anerkennend.
Wegner winkte ab. »Feier im Familienkreis.«
»So eine Familie wünscht man sich.« Phil tippte sich zum Abschied an die Stirn. »Wir müssen weiter, der Taxameter läuft, der Pilot wartet nicht. Die Frau hinter dem Sofa, ich hoffe, Sie haben sie nicht totgevögelt?«
Wegner öffnete den Mund, klappte ihn zu, starrte Phil nach, der lachend davonging. Welche Frau?
Joseph und Luseni reichten ihm die Hand, wiederholten Dankesworte, Einladungen, beste Wünsche.
»No compromise«, raunte Luseni.
»No compromise«, flüsterte Joseph.
»No compromise«, wisperte Wegner.
Erneuter Handschlag, diesmal alle drei gleichzeitig, einer rechts, der andere links, während Wegner an die mysteriöse Frau hinter dem Sofa dachte.
Die Liberianer lächelten, neue Freunde fürs Leben.
3
ALGIER
Ralf Eley kam in diesen Monaten oft nach Bologhine, meistens am Wochenende, meistens zu Fuß. Nur das letzte Stück, den Hang hinauf zur Basilika, fuhr er mit dem blau-weißen téléphérique, der über den europäischen Friedhof nach oben schwebte und kaum zwei Minuten später unterhalb von Notre-Dame d’Afrique hielt. Ein, zwei Stunden lang saß er dann auf dem Vorplatz auf einer Bank, die sandsteinfarbene Kirche mit dem Band aus blau-weißen Mosaiken im Rücken, umgeben von arbeitslosen Jungs und verschleierten Frauen. Er sah auf das Meer, die weiße Stadt, die mäandernde Küstenlinie hinunter und fragte sich, was mit ihm geschehen würde, wenn er Algerien im nächsten Sommer nach fünf Jahren verlassen musste.
Mit ihm, mit Amel.
An diesem Sonntagnachmittag war er aus einem anderen Grund zur Basilika gekommen.
Auf einem anderen Weg.
Vierhundert Kilometer mit dem Mietwagen bis Casablanca, eineinhalb Stunden Flug mit Royal Air Maroc nach Algier in einer riesigen Boeing, die zu drei Vierteln leer gewesen war. Sie hatten weit voneinander entfernt liegende Plätze gebucht, sicherheitshalber, man wusste nie. Ein letzter, langer Blick an der Gepäckausgabe am Flughafen, dann hatte Eley ein Taxi genommen, Amel auf einen verspäteten Dienstwagen gewartet.
Die ganze Fahrt nach Alger Centre über hatte er sie vor sich gesehen, wie sie am Ausgang stand, Koffer und Aktentasche neben sich, in dunkelgrauer Bürokleidung und mit Kopftuch, das sie in der Öffentlichkeit trug, um nicht belästigt zu werden.
Er hatte die Reisetasche zu Hause abgestellt, war mit dem Taxi weitergefahren zur Basilika, hatte mit dem Chauffeur die letzten marokkanischen Zigaretten geteilt.
»Ah, vous êtes allé au Maroc … Avec la famille?«
»Non, seul.«
Der erste Urlaub mit Amel, Essaouira an der marokkanischen Atlantikküste, nördlich der Kanarischen Inseln gelegen. Am Ende waren es statt vier nur drei Tage gewesen. Wegen der Entführung des Elbe-Defence-Managers waren sie schon am Sonntag zurückgekehrt, nicht erst am Montag wie geplant.
Die Glocken der Kathedrale läuteten, das Portal wurde geöffnet. Zwei Männer in schwarzen Anzügen eilten heraus und liefen auf Eley zu, der an der Balustrade lehnte, Zigarette im Mund. Florian, einer der Sicherheitsbeamten der Bundespolizei, hob grüßend eine Hand, der Botschafter ergriff Eleys Arm. »Danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie hatten schöne Tage.«
»Kann man sagen.«
Der Botschafter nickte, zog die Hand zurück. »Sie wissen Bescheid?«
»Nicht im Detail. Wann ist es passiert?«
»Freitagabend gegen neun, wir haben es gestern erfahren.« Aus seiner Stimme klang verhaltene Entrüstung. Knapp vierundzwanzig Stunden waren vergangen, bevor man die deutsche Botschaft informiert hatte. Die Algerier hatten eigene Vorstellungen von Kooperation, zumal mit Ausländern. Eley hatte sich daran gewöhnt.
»Constantine?«
»Ja. Im Gästehaus des Verteidigungsministeriums.«
»Was ist mit den Sicherheitsleuten?«
»Keine Ahnung.«
Eley schnippte die Zigarettenkippe weg, blickte ihr nach. Blieb nur die Hoffnung, dass Toni und der Algerier überlebt hatten.
Und natürlich Richter.
In der Kabylei und in der Sahara musste man mit Entführungen rechnen. Aber in einem bewachten Haus des Verteidigungsministeriums in Constantine? Die Täter mussten gut informiert gewesen sein. »Irgendwelche Hinweise?«
Der Botschafter schüttelte den Kopf. Kein Bekennervideo, keine Lösegeldforderung, noch keine Zeugen.
»Und die Kameras?«
»Welche Kameras?«
»Die haben da Überwachungskameras«, sagte Eley. Toni hatte ihm davon erzählt, bei einer ihrer Begegnungen im Sheraton beim Club des Pins außerhalb der Stadt, wo die Ausländer am Wochenende tanzten und tranken.
Der Botschafter erwiderte, die Algerier hätten keine Kameras erwähnt. »Ich habe mir erlaubt, für Sie einen Termin bei der DDSE zu vereinbaren. Heute, achtzehn Uhr.«
»Toumi?«
»Und eine Untersuchungsrichterin, Mademoiselle Samraoui.«
Eley schwieg überrascht.
Zündete sich eine Zigarette an, hatte sich wieder im Griff.
»Sie halten sich bitte an die Gepflogenheiten«, sagte der Botschafter.
»Wir hören zu, informieren Deutschland, beten. Alles andere überlassen wir den Algeriern.«
»Ganz recht.«
Eley nickte, beobachtete, wie gegenüber mehrere Männer und Frauen mit Fotoapparaten die Kirche verließen und sich auf dem Platz postierten. Der Priester und das Brautpaar folgten, auf dem Treppenabsatz blieben sie stehen, ließen sich fotografieren.
Nicht einmal heiraten wäre eine Lösung, dachte er. Amel würde alles verlieren. Sie müsste Algerien verlassen. Einer Muslima war die Ehe mit einem Nichtmuslim verboten.
Der Botschafter hob die Hand, winkte, seine Tochter winkte mit dem Brautstrauß zurück. Sie hatte einen Mitarbeiter der Deutsch-Algerischen Handelskammer geheiratet, einen Algerier, der in Hannover studiert hatte. Eley hatte ihn auf Empfängen getroffen, fand ihn sympathisch, bescheiden, liberal. Der Botschafter war noch skeptisch. Man wisse nicht, hatte er gesagt, ob das traditionell Muslimische nicht doch eines Tages mit ganzer Wucht durchbreche. Ob der Schwiegersohn nicht irgendwann verlange, dass die Tochter den Schleier trage, das Haus abends nicht mehr verlasse, sich nicht mehr allein mit männlichen Freunden treffe. Sie sei hübsch, die Männer mochten sie. Das müsse man ertragen können als Ehemann. Manche seiner muslimischen Bekannten und Kollegen in Kairo hätten es nicht ertragen.
»Was meinen Sie, al-Qaida im islamischen Maghreb?«
»Sieht so aus«, sagte Eley.
»Die Algerier glauben das auch.«
»Aber?«
Der Botschafter hob das Kinn, zog sich die Fliege vom obersten Hemdknopf und steckte sie in die Seitentasche. »Was ist mit den Kabylen?«
»Die haben mit Ausländern kein Problem, nur mit der Regierung.«
»Elbe Algérie repräsentiert die Regierung.«
Eley schüttelte den Kopf. Nicht die Berber im Norden, die waren politisiert, wollten Autonomie, verteidigten ihre Kultur, sie waren keine Kriminellen. Bei den Tuareg in der Sahara verhielt es sich, zumindest im Hinblick auf manche Stämme, anders. Nichts, was durch die Wüste kam, konnte da ohne deren Wissen und Unterstützung durch, weder Menschen, noch Waffen, noch Drogen. Doch die Tuareg gingen nicht nach Constantine, um jemanden zu kidnappen. Sie verließen die Wüstenregionen nicht.
»Ansar Dine? MUJAO? Irgendeine neue Scheißislamistenbande?«
Eley musste lächeln. Kein Wort, das der Botschafter, ein distinguierter Diplomat alter Schule, sonst in den Mund nahm. Für einen Moment empfand er Mitleid. Gerade mal ein Jahr in Algier – nach fünf Jahren Kairo und zwei Jahren Berlin im Auswärtigen Amt –, schon hatte er sich mit einer derart heiklen Angelegenheit herumzuschlagen. »Glaube ich nicht.«
Ansar Dine operierten vorwiegend in Mali, und weder die algerische Armee noch AQM würden sie nach Algerien lassen. AQM wollte hier vermutlich keine Dschihadisten mit eigener Agenda, und die Armee hatte wegen des Mali-Konflikts Tausende Soldaten an die Grenze verlegt. MUJAO wiederum, ein schwarzafrikanischer AQM-Ableger, konzentrierte sich auf Südalgerien und den Sahel, und von einer neuen algerischen Gruppe hätte Eley gewusst.
Der Botschafter winkte erneut, aber die Tochter sah nicht herüber. Eine Windböe zerzauste sein allzu früh weiß gewordenes Haar. Er war mittelgroß, dreiundfünfzig, hatte eine Hakennase, verwachsene Aknenarben, ein schmales Gesicht. Ein bis in die letzte Körperfaser integrer Mann, erschreckend hart gegen sich selbst, wenn es darum ging, die diplomatischen Pflichten zu erfüllen.
»Hat er eine Chance, Eley?«
»Wenn sie auf Lösegeld aus sind, und wenn sich die Algerier zurückhalten, ja. Aber es wird dauern. Rechnen Sie nicht damit, dass wir in den nächsten Tagen etwas hören.«
Der Botschafter nickte.
»Und keine Presse«, sagte Eley. »Zumindest vorerst nicht.«
Die Tochter hatte sich umgedreht, warf den Brautstrauß. Man jubelte, lachte, klatschte.
»Wer hat ihn gefangen?«, fragte Florian.
»Eine der Französinnen«, sagte Eley. »Vom Kulturinstitut.«
»Fahren wir«, sagte der Botschafter, und sie gingen zum Parkplatz hinüber. Der gepanzerte schwarze Dienstmercedes stand an der Einfahrt, draußen warteten zwei Streifenwagen, was neu war, wohl eine Konsequenz aus der Entführung.
Zwischen den Polizeiautos fuhren sie die Serpentinen durch das ausgelaugte Bologhine hinunter.
»Wie war der Urlaub?«, fragte Florian, der am Steuer saß.
»Jahre zu kurz«, sagte Eley.
4
BERLIN
Die Frau hinter dem Sofa lebte.
Wiebke Ebert, Sekretärin im Auswärtigen Amt, Referat Exportkontrolle. Anfang fünfzig, fortgeschrittene Cellulitis an den Oberschenkeln, wenn Wegner richtig interpretierte, was er da sah. Der Rock war bis zum Bauch hochgeschoben, die Bluse stand halb offen. Das aschblonde Haar zerzaust, ein Arm lag quer über den Augen. Wiebke Ebert schlief.
Wegner begann sich zu erinnern.
Ein hellbrauner Männerhintern, die Anzughose an den Knöcheln, in beiden Socken münzgroße Löcher an den Fersen. Er hatte sich noch gefragt, was der Mexikaner da tat, hinter dem Sofa.
Hatte sich mit Ausdauer um Wiebke Ebert gekümmert.
Er gönnte ihr die Freude. Eine stille Arbeitsbiene, unverheiratet, zu grau und zaudernd für diese Welt. Ohne jeglichen Einfluss in ihrem Referat, doch mit allen aktuellen Vorgängen in Bezug auf die Genehmigung von Rüstungsexporten vertraut, weil sämtliche Unterlagen zur Weitergabe an das Wirtschafts- und das Verteidigungsministerium sowie den Bundessicherheitsrat über ihren Tisch wanderten.
Wegner hob das Smartphone. Zufrieden nahm er zur Kenntnis, dass die Kamera selbst nach Stunden im Wasser funktionierte.
Sie saßen am Küchentisch, Wegner im Morgenmantel, gegenüber Wiebke Ebert, die Bluse zugeknöpft, die Frisur wiederhergestellt. Sie hielt den Kopf gesenkt, rang die Hände. Sie hatte geweint, er hatte versucht, sie zu trösten. Dann hatte er Espresso aufgebrüht und in der Mikrowelle Croissants aufgewärmt. »So was passiert eben mal«, sagte er.
»Sie werden es niemandem erzählen, oder?«
»Aber nein.« Er hob die rechte Hand, versprach es zum fünften Mal. Er tunkte die Croissantspitze in den Espresso und biss ab. »Wollen Sie seine Telefonnummer?«
»Nein!« Ebert schlug die Hände vors Gesicht.
»Nur ein Scherz.«
»Wie peinlich! Wie furchtbar peinlich!«
Das Gespräch begann ihn zu langweilen. Er musste arbeiten, sich die Geschichten notieren, die Verbundenheit schufen. Er strahlte und sagte: »Am Donnerstag geht’s los?«
Wiebke Ebert trocknete sich die Wangen mit einem zerfransten Papiertaschentuch. »Ja.«
»Machen Sie Fotos.«
Als Staatsbedienstete verdiente Ebert nicht schlecht, doch alles Geld, was übrig blieb, wanderte in Bausparverträge, Lebensversicherungen, Bundesschatzbriefe und eine altersgerechte Zweizimmerwohnung in Charlottenburg. Sie war realistisch – sie war allein und würde es bleiben. Finanzielle Sicherheit bedeutete ihr alles, ausreichend Geld fürs Altern in Einsamkeit. Also sparte sie diszipliniert, fuhr im Urlaub nach Mecklenburg oder Polen. Größere Reisen samt Begleitung durch einen gemieteten Gentleman finanzierte Wegner über eines der Konten, die ihm zur Verfügung standen. Zwei Wochen Karibik vor drei Jahren, Capri vor eineinhalb, eine Pazifikkreuzfahrt ab Donnerstag. Wiebke Ebert liebte das Meer und distinguierte Charmeure, doch vor allem liebte sie Schiffe. Wenn sie von Schiffsreisen erzählte, wurde sie für Momente beinahe attraktiv.
»Gut«, sagte er. »Ich muss jetzt arbeiten.«
Sie stand auf, ging zur Küchentür, kehrte zurück, setzte sich wieder. »Gestern …«
Wegner seufzte. »Vergessen Sie gestern.«
»Gestern Morgen hatte Dr.Zimmermann … Der Leiter der Abteilung 3 im Auswärtigen …«
»Ich weiß, wer Zimmermann ist.«
»Er hatte gestern Morgen einen Schlaganfall.«
»Bedauerlich. Und?«
»Dr.Prinz wird seine Verpflichtungen kommissarisch übernehmen.«
»Prinz?«
»Katharina Prinz, die Beauftragte für Nah- und Mittelostpolitik und Maghreb, 3-B-1.«
Wegner war hellhörig geworden. Wiebke Ebert sprach hastig, fast tonlos, wie immer, wenn sie Interna weitergab. »Und was bedeutet das?«
Dr.Prinz, erwiderte sie, sei eine Gegnerin von Rüstungsexporten nach Nordafrika. 2011 und 2012 habe sie Dr.Zimmermann gedrängt, die Zustimmung der Abteilung 3 zu den Rüstungsgeschäften mit Algerien zu verweigern und dem Minister sowie dem Bundessicherheitsrat zu empfehlen, dasselbe zu tun. Doch Dr.Zimmermann habe unter starkem Druck von BMVg und BMWi gestanden. So gut wie alle bis hinauf in die Regierungsspitze hätten den Deal gewollt. Ihm habe der Mut gefehlt, sich dagegen zu stemmen. Deshalb habe die Abteilung letztlich ohne Einschränkungen zugestimmt.
Wegner verstand. Zimmermann lag auf der Intensivstation, der Weg für Prinz war frei.
Er rieb sich die Augen. Sein Pulsschlag beruhigte sich. Es war zu spät. Die Verträge waren längst unterzeichnet – zwanzigtausend MRG-45-Sturmgewehre innerhalb von fünf Jahren. Die Lieferung des ersten Loses stand unmittelbar bevor, knapp fünftausend Stück, hübsch verpackt, samt Munition. Noch ein paarmal schlafen im Schwäbischen, dann ging es via Hamburg auf die weite Reise.
»Dr.Prinz sitzt ab jetzt jeden Morgen in der Direktorenrunde«, sagte Ebert. »Sie hat direkten Zugang zur Staatssekretärin und, wenn sie will, zum Minister.«
Wegner presste die Lippen zusammen, kratzte sich die Brust. Es ist zu spät, dachte er, viel zu spät.
Doch die Unruhe blieb.
»Könnte es sein, dass sie etwas herausgefunden haben?«
»Ich glaube nicht«, sagte Ebert schnell.
»Gibt es Unterlagen? Gesprächsaufzeichnungen? Beweise?«
»Nur die Kopien, die ich damals für Sie gemacht habe.«
Wegner nickte. Hatten ein hübsches Feuerchen im Kamin ergeben, die Kopien. Das Angebot von … Lüden? Ulmer & Tann? Er rieb sich mit zwei Fingern die Nasenwurzel. Vergessen. Das war das Problem, wenn keine Unterlagen existierten. Er sah Wiebke Ebert an, dachte, dass sie sicherlich nie vergaß. Jeder noch so kleine Gesetzesverstoß blieb ihr für immer in Erinnerung. Meißelte ein paar weitere traurige Falten in ihre Stirn.
Er beugte sich vor und tätschelte ihr Knie. »Danke.« Gähnend fischte er das Telefon aus der Tasche des Morgenmantels, bestellte ein Taxi für sie, Rechnung aufs Haus.
Kurz darauf war er mit der Unruhe allein.
Also, dachte er. Das Worst-Case-Szenario.
Schon das Wort trieb ihm den Schweiß aus allen Poren.
Er ging in den Garten hinaus, warf den Morgenmantel auf den Kies, stieg ins Wasser und tauchte zum Grund. Vor der Welt versteckt, verharrte er.
Im schlimmsten Fall würde die Exportgenehmigung widerrufen werden. Theoretisch war das möglich, allerdings mussten gewichtige Gründe vorliegen, wie drastische Veränderungen im Empfängerland.
Die algerischen MRG 45 an die Bundeswehr umzuleiten war undenkbar. Deren Ordonnanzwaffe war das G36 von Heckler & Koch. Das Verteidigungsministerium konnte, durfte und wollte keine fünftausend oder gar zwanzigtausend Sturmgewehre des größten HK-Konkurrenten beschaffen. Meininger Rau hätte vermutlich Anspruch auf Schadenersatz. Es würde zu einem Prozess kommen, der sich über Jahre hinzöge.
Ein Desaster für die Firma, für ihn.
Noch viel schlimmer aber wäre, dass künftige Exportanfragen von Meininger Rau sicherlich wesentlich kritischer geprüft würden. Die Existenz der Firma wäre bedroht.
Er stieß sich am Boden ab und schwamm zum Bademantel. Während er eine Kurzwahl ins Handy tippte, dachte er, dass er schon das richtige Telefon gekauft hatte.
Sein Sohn hatte abgeraten.
Wozu brauchst du ein wasserdichtes Smartphone?
Wir sind in Berlin, es regnet die ganze Zeit.
Die Kamera taugt nichts.
Egal.
Kauf dir das neue Samsung Galaxy. Oder das iPhone 5.
Sind die wasserdicht?
Kein normaler Mensch braucht ein wasserdichtes Smartphone.
»Was gibt’s, Wegner?«
»Guten Tag, Herr Dr.Riehle, wie war die Messe?«
»Inspirierend. Morgen früh um halb acht, falls es wichtig ist.«
Wegner stöhnte stumm. »Ist es.«
»Bahnhof Friedrichstraße, Reichstagufer, Sie können mich über die Spree begleiten.«
Er lauschte dem Freizeichen. Nicht alle Menschen, mit denen er arbeitete, behandelten ihn so respektvoll wie Joseph und Luseni.
Er stieg aus dem Wasser, ging ins Arbeitszimmer, startete den Laptop, den Browser, tippte »Katharina Prinz«.
Die Schlacht begann.
5
ALGIER
Im Verkehrschaos der Innenstadt arbeiteten sie sich im Konvoi auf den Hügel ins wohlhabende grüne El Biar hinauf, wo viele Auslandsvertretungen lagen und viele Entsandte wohnten. Auch Eley hatte sich zunächst hier oben eine Wohnung gesucht, in einem bewachten Appartementgebäude in Botschaftsnähe, mit Metallzaun und Alarmanlage. Nach einem halben Jahr war er an den Hafen hinuntergezogen, fuhr jetzt mit dem Bus zur Arbeit. In El Biar blieb man isoliert, in Centre ließ es sich leben.
Vor dem Botschaftsgebäude drehten die Streifenwagen ab. Die beiden wachhabenden algerischen Polizisten grüßten, Florian fuhr den Daimler in die Schleuse. Ein weiterer Kollege von der Bundespolizei erschien, um den Unterboden auf Sprengstoff abzusuchen.
»Man hört viel über Essaouira«, sagte Florian, während sie warteten. »Soll sich lohnen.«
»Jimi Hendrix war mal dort«, sagte Eley.
»Wenn man allein reist, meine ich. Marokko soll liberaler sein als Algerien.«
»Schon richtig.«
»Verschonen Sie mich mit Ihren Abenteuern«, bat der Botschafter.
»Bei einem Bier«, sagte Eley zu Florian gewandt.
Der Kollege winkte sie weiter. Sie rollten in die Garage, stiegen aus, eilten durch den weitgehend ungenutzten Vordertrakt, der an der viel befahrenen Straße lag. Eine Mitarbeiterin der Politischen Abteilung stieß zu ihnen, Carola Liebig, Ende dreißig, aufgequollen vom algerischen Gebäck. Sie war wie immer stark geschminkt, wollte die faltige Raucherinnenhaut verbergen. Vor dem tiefen Dekolleté tanzte an einem Band die Brille, am Gürtel steckte das Bürotelefon. Sie hatte Mühe, Schritt zu halten, keuchte ein bisschen. »Wir haben Fotos aus dem Gästehaus, vom Nachrichtendienst.« Sie hielt dem Botschafter einen Umschlag hin.
»Danke. Haben Sie Herrn Schneider erreicht?«
»Nein, er ist wie vom Erdboden verschluckt.«
Eley lächelte. Schneider, der BND-Resident, Geheimniskrämer vor Allah. Niemand wusste je, wo er war, wenn er nicht in seinem Büro saß. Meistens hockte er nur auf dem Klo. Der Botschafter hielt große Stücke auf ihn, vor dem BND hatte man Respekt. Das Bundeskriminalamt war, was das Ausland betraf, eine andere Nummer. Ein »Verbindungsbeamter« trug die Bedeutungslosigkeit irgendwie schon in der Bezeichnung, anders als ein »Resident« des BND. Dazu kam, dass ein BND