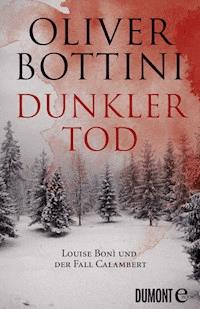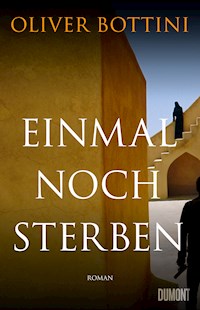8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Louise Bonì
- Sprache: Deutsch
Louise Bonì, Hauptkommissarin der Kripo Freiburg, erhält von einer Informantin den Hinweis, dass ein Mann zwei Pistolen bei russischen Kriminellen gekauft habe. Besorgt geht Bonì der Sache nach, um ein mögliches Gewaltverbrechen zu verhindern. Bald findet sie den Eigentümer des Autos, mit dem der Käufer die Waffen abgeholt hat. Der besitzt für den fraglichen Abend jedoch ein wasserdichtes Alibi. Der Fahrer war ein anderer – Ricky Janisch, Neonazi und Mitglied der rechtsextremen »Brigade Südwest«. Louise Bonì und ihr Team beginnen, Janisch zu observieren, und stoßen auf weitere Mittelsmänner, die alle der rechten Szene angehören. Je tiefer sie graben, desto erschreckender wird das Szenario: Haben sie es mit einem weitverzweigten Neonazi-Netzwerk zu tun, das vor nichts zurückschreckt? Und wie sollen sie ein Attentat verhindern, wenn ihr Gegner ihnen immer einen Schritt voraus ist und sie noch nicht einmal das Ziel kennen? Da stößt Louise auf das »perfekte Opfer«. Aber vielleicht ist es schon zu spät … Louise-Bonì-Krimireihe: Vorgeschichte: Dunkler Tod Band 1: Mord im Zeichen des Zen Band 2: Im Sommer der Mörder Band 3: Im Auftrag der Väter Band 4: Jäger in der Nacht Band 5: Das verborgene Netz Band 6: Im weißen Kreis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Louise Bonì, Hauptkommissarin der Kripo Freiburg, erhält von einer Informantin den Hinweis, dass ein Mann zwei Pistolen bei russischen Kriminellen gekauft habe. Besorgt geht Bonì der Sache nach, um ein mögliches Gewaltverbrechen zu verhindern. Bald findet sie den Eigentümer des Autos, mit dem der Käufer die Waffen abgeholt hat. Der besitzt für den fraglichen Abend jedoch ein wasserdichtes Alibi. Der Fahrer war ein anderer – Ricky Janisch, Neonazi und Mitglied der rechtsextremen »Brigade Südwest«. Louise Bonì und ihr Team beginnen, Janisch zu observieren, und stoßen auf weitere Mittelsmänner, die alle der rechten Szene angehören. Je tiefer sie graben, desto erschreckender wird das Szenario: Haben sie es mit einem weitverzweigten Neonazi-Netzwerk zu tun? Und wie sollen sie ein Attentat verhindern, wenn ihr Gegner ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint und sie noch nicht einmal das Ziel kennen? Da stößt Louise auf das »perfekte Opfer«. Aber vielleicht ist es schon zu spät …
Oliver Bottini wurde 1965 geboren. Für seine Kriminalromane erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem viermal den Deutschen Krimi Preis, den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner ›Krimifuchs‹ sowie zuletzt den Stuttgarter Krimipreis für ›Ein paar Tage Licht‹ (DuMont 2014). Oliver Bottini lebt in Berlin. Der erste und der vierte Band der Louise-Bonì-Reihe, ›Mord im Zeichen des Zen‹ und ›Jäger in der Nacht‹, wurden 2014 und 2015 mit Melika Foroutan in der Hauptrolle für die ARD verfilmt. Der vorliegende Band ist der sechste Fall für die Kommissarin Louise Bonì.
OLIVER BOTTINI
IM WEISSEN KREIS
EIN FALL FÜR LOUISE BONÌ
eBook 2016
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2015 DuMont Buchverlag, Köln
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: oben: © plainpicture/Westend61,
unten: © plainpicture/Glasshouse
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8878-8
PROLOG
April 2004
Sie fuhren die übliche Strecke, in die Südstadt hinein, hielten hier und da, wechselten ein paar Worte mit den Leuten, »unseren Leuten«, wie Timo immer sagte, »unsere Straßen, unsere Leute«, sprachen über Fußball, als wäre alles wie immer. Und für Timo, dachte Stefan Bremer, war ja auch alles wie immer.
Gegen elf ging über Funk eine Meldung ein, versuchter schwerer Raub, Werderstraße, keine zweihundert Meter entfernt. »Endlich was los«, sagte Timo und schaltete das Martinshorn ein, er mochte das, mit Kampfgeheul vorfahren.
Bremer beschleunigte den Streifenwagen nur leicht, er hatte kaum geschlafen, und das grelle Vormittagslicht blendete ihn. Er hatte die Sonnenbrille am Morgen zu Hause vergessen, hatte minutenlang im Flur gestanden, auf die vertrauten Bewegungen und Geräusche gewartet, die nicht kommen würden. In einem Anflug von Panik war er aus der Wohnung geeilt, ohne Sonnenbrille, Geldbeutel, Handy.
Timo am Funk, Bremer hörte nicht zu.
Die erste Nacht ohne Nicky, ihre Wärme fort, ihr Körper, ihr unruhiger Atem. Nur ihr Geruch war noch da gewesen, im Stoff der Bettdecke und im Laken, der Duft von Frühling, wohin er den Kopf auch drehte. Gegen drei hatte er sich auf das Wohnzimmersofa gelegt, doch ihr Geruch war mitgekommen, an ihm, in ihm, in der Erinnerung an den Tag vor sieben oder acht Jahren, als sie das Sofa gekauft hatten. In den Bildern vor seinen Augen.
Irgendwann war er doch eingeschlafen.
»Da vorn«, sagte Timo. Ein älterer Mann wartete am Straßenrand, Gesicht gerötet, die Brust pumpte vor Aufregung, die Hände fuchtelten. Um den Leib trug er eine grüne Schürze.
Bremer bremste und ließ den Wagen ausrollen.
Ich gehe jetzt, hatte Nicky am Abend zuvor gesagt. Er hatte den Blick auf die Küchenuhr gerichtet, fünf vor halb neun. Aus einem unerfindlichen Grund war das wichtig gewesen. Um fünf vor halb neun am Abend des 29.April 2004 war Nicky gegangen.
Sie stiegen aus. »Mach du das«, sagte Bremer.
»Herr Fink, ja?«, sagte Timo zu dem aufgeregten Mann.
Versuchter schwerer Raub, der mit einem Messer bewaffnete Täter über alle Berge, Routine. Bremer wollte mitschreiben, doch seine Hand zitterte, und das weiße Papier reflektierte schmerzhaft das Sonnenlicht. Die Augen halb geschlossen, konzentrierte er sich auf das Wesentliche. 11.15Uhr. Vermutl. Osteuropäer. Geschubst. Messer.
»Was hat er gemacht?«, fragte Timo. Nach acht Monaten hatte er noch Probleme, wenn die Leute hartes Karlsruher Badisch sprachen, Brigantendeutsch, schwierig für einen aus Brandenburg an der Havel.
Bremer hatte ein Jahr gebraucht, um es problemlos zu verstehen. Ein Jahr und Nicky. »Er hat Herrn Fink gegen das Regal geschubst und mit einem Messer bedroht«, sagte er.
»Sind Sie verletzt?«
»Nein!«, rief Fink eher wütend als verängstigt.
Sie betraten den kleinen Laden. Zeitungen, Süßigkeiten, Tabakwaren, Lotto, ein paar Schreibwaren. Ein Kühlschrank mit Getränken, keine Lebensmittel. Bremer fragte sich, wozu Fink eine Schürze brauchte. Er blinzelte, das helle Licht von draußen lag noch wie ein Schleier über seinen Pupillen.
Timo ließ sich zeigen, wo und wie Fink mit dem Messer bedroht worden war. Bremer zeichnete, schrieb, zitterte.
Brandenburg, dachte er. Fast das Einzige, was ihn mit Timo verband. Zwei Brandenburger in Karlsruhe.
Kümmer dich um den, hatte der Chef gesagt. Ist nicht ganz freiwillig hier, wenn du verstehst, was ich meine.
Nein, verstehe ich nicht, hatte Bremer gesagt.
Egal. Vielleicht kennt ihr ja von früher dieselben Mädchen und so.
Bremer dachte, dass er jetzt gern heimfahren würde. Die Eltern und die Geschwister besuchen, die Mädchen von früher. Sich in einem Ruderboot auf dem Breitlingsee treiben lassen wie in dem Leben vor Nicky. Am Abend würde er ans Ufer zurückrudern, das Boot vertäuen, April 1994, keine Joggerin mit kurzem blondem Haar, die auf dem Weg über ihm ins Stolpern geriet und fluchend stürzte und immer irgendwie nach Frühling duftete.
»Hat er was angefasst?«, fragte Timo.
»Mich!«, sagte Fink.
»Sonst was?«
Bremer schrieb: Türklinke außen/innen. Regalleiste unterhalb vonGEO. Hemdkragen, Schulter Hr. Fink.
»Und warum ist er weggelaufen?«
»Weil ich gesagt hab, er kriegt das Geld nicht, nur über meine Leich!«
»Nicht empfehlenswert, Herr Fink, wenn einer ein Messer hat.«
Bremer sah auf, fragte: »Wozu die Schürze, Herr Fink?« Schweigen legte sich über den Raum. Er hörte den Kühlschrank rauschen. Irgendwo tickte eine Uhr.
Schließlich hob Fink die Hände, zeigte ihnen die Innenseiten. »Weil ich immer so schwitz.«
Bremer schrieb: Schürze – schwitzt.
»Das ist jetzt mal eine Info«, sagte Timo freundlich.
Die Kollegen der Kripo betraten den Laden, ein Mann, eine Frau, übernahmen. Timo wurde einsilbig, Frauen bei der Kripo, das mochte er nicht.
Bremer trat auf den Gehsteig hinaus, dirigierte ein paar Schaulustige von Ladentür und Fenster weg. Sein Blick streifte einen Radfahrer in seinem Alter, um die dreißig, Jeans, schwarze Jacke, Basecap. Er stand, die Mittelstange zwischen den Beinen, neben einem Kiosk, las in einer Zeitschrift. Bremer war sicher, dass er den Mann schon einmal gesehen hatte, vor wenigen Minuten, irgendwo anders.
Unsere Straßen, unsere Leute.
Timo kam. »Falafel?«
»Ja«, sagte er.
Noch etwas, was sie miteinander verband. Falafel im Brot, jeden Mittag, wenn sie zusammen Dienst hatten.
Sie verließen die Werderstraße in Richtung Süden. An der nächsten Kreuzung warteten sie, eine türkische Familie eilte über die Straße, Vater, Mutter, drei kleine Töchter, alles ein bisschen chaotisch, die Mutter hektisch, eines der Kinder blieb mitten auf der Straße stehen.
»In fünfzig Jahren haben wir einen muslimischen Bundeskanzler«, sagte Timo. »Wetten?«
Bremer bog ab. »Nein.«
»Nein was?«
»Wetten.«
Aus dem Augenwinkel sah er, dass Timo die Schultern hob. »Mir ist es gleich, und meine Kinder können nach Neuseeland ziehen, wenn es ihnen nicht passt. Gibt in Neuseeland kaum Moslems, hab ich mir sagen lassen.«
»Das ging ja schnell mit den Kindern. Am Freitag hattest du noch nicht mal eine Freundin.«
»Rein hypochondrisch, meine ich.«
Bremer lächelte widerwillig, er mochte Timos Wortspielchen. Ähnlich klingende Fremdwörter austauschen, manchmal lustig, manchmal nicht. Vergangenen Monat war Timos Nachbarin gestorben. Er hatte einen Blumenstrauß für den Witwer gekauft und gesagt, er sei gekommen, um zu ondulieren.
Er hat wirklich »ondulieren« gesagt?, hatte Nicky gefragt.
Er wollte ihn aufheitern.
Komischer Kerl, dein Kollege.
Bremer lenkte den Wagen in eine Einfahrt nahe dem libanesischen Take-away und hielt.
»Wie immer?«, fragte Timo.
Bremer nickte, sah ihm nach. In den vergangenen zwei, drei Monaten hatte Timo sich einen langsamen, drohenden Gang angewöhnt, wie man es von Cops aus amerikanischen Krimis kannte, Kleinstadtbeamte in New Mexico oder Texas, die einschüchternd wirken mussten, wollten sie das Rentenalter erreichen. Weshalb Timo einschüchtern wollte, hatte Bremer noch nicht verstanden. Testosteron vielleicht. Oder das Gefühl, als Brandenburger hier nicht richtig anerkannt zu werden, das auch ihn manchmal noch überkam.
»Komisch« ist das falsche Wort.
Ach, und was wäre das richtige Wort?
Ich weiß nicht. »Unberechenbar« vielleicht.
Unberechenbar und freundlich, unangenehm und witzig, dachte Bremer und heftete den Blick auf Timos Rücken, um nicht mehr an Nicky zu denken. Doch in seinem Kopf sprach sie weiter, ein paar Wochen später, 29.April 2004, kurz vor halb neun am Abend: Ich will nicht, dass du anrufst. Oder schreibst.
Ja.
Ich will jetzt erst mal keinen Kontakt mehr.
Keinen Kontakt, dachte er. Von einem Tag auf den anderen so vollkommen aus seinem Leben verschwunden, als hätte es sie nie gegeben.
Sein Mund war trocken, Gänsehaut kroch ihm über die Arme. Er löste den Gurt, stieg aus dem Wagen, den obersten Hemdknopf öffnend. Das Sonnenlicht fuhr ihm von allen Seiten in die Augen, grelle Reflexe von Autodächern, Fensterscheiben. Unvermittelt spürte er Tränen auf den Wangen. Er zwang sich, an den See und das Ruderboot zu denken, allein auf dem Wasser, allein am Ufer, keine Joggerin damals, nur die Mädchen von früher, und heute war einfach der Tag nach damals.
Er kontrollierte den Atem, beruhigte sich. Alles vertraut, alles wie immer, dachte er, wenigstens das, die kreischenden Bremsen einer Straßenbahn am Halt Augartenstraße, der Geruch von Frittierfett. Timo, der wie so oft gegen zwölf den libanesischen Imbiss betrat. Der Radfahrer, der wieder da war, herüberblickte, das Rad lehnte an einem Laternenmast, nur das Magazin fehlte.
So ging es, dachte er. Nichts hatte sich geändert. Fast nichts.
Timo stand jetzt an der Theke, ein kantiger Hüne in schwarzer Lederjacke mit der weißen Aufschrift POLIZEI auf dem Rücken. Die Daumen im Hosenbund, der Oberkörper bewegte sich leicht, er wippte vor und zurück. Bremer dachte, dass sie reden mussten. Es war nicht ihre Aufgabe, die Menschen einzuschüchtern. Sie sollten ihnen Sicherheit vermitteln, nicht Angst.
Er wollte eben den Blick abwenden und wieder in den Wagen steigen, als unvermittelt ein Mann, der bis zu diesem Moment nicht zu sehen gewesen war, hinter Timo trat und die Hand an dessen Kopf hob, und Bremer fragte sich, warum er das tat und warum Timo mit einem Mal aus seinem Blickfeld verschwunden war, bis er begriff, dass der Mann eine Pistole mit Schalldämpfer hielt, die jetzt nach unten zeigte, auf den Boden vor ihm, wo Timo offenbar lag. Bremer öffnete den Mund, wollte um Hilfe rufen, brachte keinen Laut hervor. Er versuchte, sich zu bewegen, irgendetwas zu tun, aber es gelang ihm nicht, er war in einem bleiernen Schock gefangen, der am 29.April 2004 um fünf vor halb neun begonnen hatte und ihm noch immer den Atem raubte und jegliche Kraft. Verwirrt registrierte er, dass der Mann mit der Pistole mittlerweile nicht mehr dort war, wo er gerade noch gestanden hatte, sondern draußen vor dem Imbiss, und dass er in seine Richtung blickte und dass sich links der Radfahrer in Bewegung gesetzt hatte und zu Fuß auf den Streifenwagen zueilte, auf ihn, auch er mit einer Pistole in der Hand.
ZWEI JAHRE SPÄTER
I
1
April 2006
Ein Sonntagabend auf dem Balkon, die Nacht kam schon über den Annaplatz. Im Hintergrund lief Klaviermusik, im Kopf ein Film, Erinnerungen voller Schwermut. Kein Moment, in dem man sich Besuch wünschte.
Erneut klingelte es.
Louise Bonì zog die Decke von den Beinen und stand auf. Ihre Bewegungen ließen die Flamme der Kerze zittern, die halb heruntergebrannt war. Eine Geburtstagskerze, stämmig und blau umrandet, fast ohne Geruch. Hin und wieder spuckte sie ein bissiges Knistern in den Abend, das zum Anlass passte.
Geburtstag eines Toten.
Sie zwängte sich an dem Tischchen vorbei und blickte über die seit jeher leeren Blumenkästen zum Hauseingang hinunter. Im Dunkeln war erst nichts zu erkennen, dann ein Schemen, der sich langsam ins Licht der Straßenlaterne bewegte. Lederjacke, schulterlanges Haar, ein Männergesicht, das sie monatelang nicht gesehen hatte, ein halbes Jahr, um genau zu sein.
Sie ging zur Tür, öffnete. Kilian kam lautlos und schnell herauf.
»Hey«, sagte er leise.
»Ich hab Telefon«, erwiderte sie.
Er schob sie in die Wohnung und schloss die Tür, und sie begriff, dass er nicht gekommen war, um den Geburtstag mit ihr zu begehen. Seine Augen wirkten erschöpft und unruhig, die Haut spröde, er sah abgemagert aus. Kein Surferboy mehr wie noch vor einem halben Jahr, da hatte sie ihn um seine Jugendlichkeit und Abenteuerlust beneidet.
Sie folgte ihm in die Küche. Kein Licht, bedeutete er ihr.
»Okay«, sagte sie angespannt.
Er stand dicht bei ihr, sprach mit gedämpfter Stimme. Ein Mann, vermutlich aus Freiburg, habe vor ein paar Wochen illegal Waffen bestellt, zwei Pistolen samt Schalldämpfern, eine Makarow, eine Tokarew. Am gestrigen Abend seien sie abgeholt worden.
»Langsam, langsam«, sagte Louise. »Von vorn.«
»Ist eine lange Geschichte.«
»Kürz sie ab, ich will wieder auf den Balkon.«
Kilian rieb sich mit zwei Fingern die Nasenflanken. »Du weißt, dass ich gewechselt habe?«
Sie nickte. Vom Fahndungsdezernat zur Organisierten Kriminalität, ein Akt jugendlicher Verzweiflung, er hatte bei Ermittlungen vor einem halben Jahr Fehler gemacht. Im Winter hatte sie sich gelegentlich gefragt, weshalb er ihr in der Polizeidirektion nie über den Weg lief, in der Cafeteria, im Treppenhaus, nicht einmal bei der Weihnachtsfeier der Freiburger Kripo. Jetzt verstand sie. Er war im Dezember undercover gegangen und mittlerweile ans Landeskriminalamt abgeordnet.
»An wem seid ihr dran?«
»Russen oben in Baden-Baden.«
»Haben die Namen? Es gibt viele Russen in Baden-Baden.«
»Vergiss es«, sagte er. »In zwei, drei Wochen lassen wir sie hochgehen, bis dahin darfst du nicht mal mehr an Russen in Baden-Baden denken.« Er strich sich die strähnigen Haare zurück. »Aber darum geht es nicht.«
»Die Waffen hängen nicht mit deinem Fall zusammen?«
»Nein.«
»Woher weißt du davon?«
»Von meinem Informanten.«
»Kennt er den Käufer?«
»Nein.«
»Woher weiß er, dass er aus Freiburg ist?«
»Freiburger Kennzeichen. Er hat es aufgeschrieben. Jedenfalls einen Teil.«
»Weiß er, was der Käufer mit den Pistolen vorhat?«
»Nein.« Kilian drehte den Kopf, das Flurlicht fiel auf sein Gesicht. Für einen Moment meinte sie in seiner Miene noch etwas anderes wahrzunehmen als Erschöpfung: Angst.
Kilian und Angst, auch das war neu.
»Vielleicht bloß einer, der Waffen sammelt.«
»Nein«, sagte er wieder. Ein Mann hatte die Pistolen telefonisch bestellt, ein weiterer hatte sie abgeholt – zwei Freaks? Kaum. Die Waffen wurden für einen anderen Zweck gebraucht. Und wofür brauchte man illegal erworbene Pistolen mit Schalldämpfern?
Louise schwieg. Sie spürte, wie die Gedanken und der Körper auf Touren kamen. Die Seele hinkte hinterher, saß noch auf dem Balkon, erinnerte sich an einen Bären von Mann, der nicht mehr war. Sein Tod im Oktober letzten Jahres hatte die Flure der Freiburger Polizeidirektion still werden lassen, das Herz der Kripo schlug langsamer seitdem. Nein, eigentlich schlug es gar nicht mehr. Nicht nur sie empfand so, auch viele Kollegen. Ein Großteil der Kraft und der Energie des Organismus waren von diesem Mann ausgegangen, der immer da gewesen war und nun nicht mehr. Man hatte sich ihm unterworfen oder widersetzt, das Ergebnis war dasselbe gewesen: der Wille, alles zu geben.
»Kümmerst du dich darum?«
Sie seufzte. »Hast du noch was?«
»Nein.«
»Das reicht mir nicht.« Ratlos hob sie die Hände. »Ich müsste mit dem Informanten reden.«
Kilian lächelte vage. »Na dann, fahren wir.«
»Nach Baden-Baden?«
Er nickte, legte ihr die Hand auf den Arm. Für einen Moment war die Vertrautheit von früher wieder da, doch die Angst und die Erschöpfung in seinen Augen blieben. Er sagte, sie müssten sehr vorsichtig sein, dürften den Informanten nicht in Gefahr bringen. Fliege er auf, sei sein Leben keinen Pfifferling mehr wert und die Operation gescheitert, eine Katastrophe für alle Beteiligten. »Fünf Minuten, nicht eine Sekunde länger. Und niemand darf mitbekommen, dass du mit ihm sprichst, nicht die Russen, nicht unsere Leute.«
»Okay.«
Er zog die Hand zurück. »Hast du was zu trinken?«
»Wasser.«
»Tut’s auch.«
Er nahm das Glas, das sie mit Leitungswasser gefüllt hatte. Seine Hand zitterte leicht.
Als er es abgestellt hatte, trat sie zu ihm und umarmte ihn. Sein Körper kam ihr kalt und knochig vor und seltsam scheu. »Du siehst beschissen aus«, sagte sie. »Riechst beschissen. Deine Haare, meine Güte.«
Sie hörte ihn atmen, seine Hände an ihrem Rücken waren verkrampft. Nach einer Weile murmelte er: »Nur noch ein paar Wochen.«
»Oder Monate oder Jahre.«
»Dann ist es eben so.«
»Willst du duschen?«
»Keine Zeit.«
Im Flur wandte sie sich dem Balkon zu. Die Kerze war ausgegangen, im Zug vielleicht, als sie die Wohnungstür geöffnet hatte. Sie dachte, wie das Leben so spielte – ausgerechnet an Rolf Bermanns Fünfzigstem tauchte Kilian wieder auf, der vor einem halben Jahr im Ermittlungsteam gewesen war und den sie bei Bermanns Beerdigung zum letzten Mal gesehen hatte.
Sie langte nach ihrer Tasche, doch Kilian sagte: »Keine Waffe, kein Dienstausweis. Gar kein Ausweis.«
»Nackt also.« Sie legte die Tasche zurück.
»Wie Gott dich schuf.«
Sie lachte. »Gott hat mich mit Dienstausweis erschaffen, Kilian.«
Kurhäuser, Thermalquellen, Casino, Festspielhaus, Parks und natürlich die Russen seit dem 19.Jahrhundert, sehr viel mehr fiel Louise zu Baden-Baden nicht ein. Eine der wenigen Städte mit über fünfzigtausend Einwohnern in Baden, die sie nicht kannte, nicht ein Mal betreten oder durchfahren hatte.
Und eine bemerkenswerte Zahl aus der Kriminalstatistik: null Straftaten gegen das Leben im vergangenen Jahr, 2005, als einziger Stadt- oder Landkreis in Baden-Württemberg. Im fünfmal größeren Freiburg waren es zehn gewesen.
Sie waren über die A5 gekommen, hatten sie vorsichtshalber erst bei Rastatt verlassen und waren von Norden nach Baden-Baden zurückgekehrt. Auf labyrinthischen Umwegen war Kilian in eines der Villenviertel gefahren, seit zehn Minuten parkten sie in einem stummen Sträßchen im Schutz eines dicht belaubten Baumes und warteten. Hinter Hecken sah Louise vereinzelt Lichter, doch die meisten Häuser lagen im Dunkeln, die Herrschaften schliefen bereits.
»Erzähl mir von dem Informanten«, sagte sie.
»Später. Ich will, dass du unvoreingenommen bist.«
»Dann erzähl von dir.«
»Geht nicht. Im Moment gibt’s mich nicht.«
»Auch privat nicht?«
»Vor allem privat.« Er zuckte mit den Schultern. »Na ja, Urlaub wär nicht schlecht.«
»Freundin?«
»Weg, glaube ich.« Er lächelte kurz. »Und du? Ben?«
»In Potsdam, glaube ich.«
»Ihr seid nicht mehr zusammen?«
»Er kommt manchmal runter, dann sind wir zusammen.«
Kurz vor Mitternacht traf eine SMS ein.
»Schnell jetzt«, sagte Kilian.
So leise wie möglich liefen sie einen schmalen, gepflasterten Weg zwischen Hecken entlang, der im kühlen Schein einiger Parklampen lag. Nach etwa einhundert Metern bogen sie ab, bewegten sich auf schwarze Hänge zwischen helleren Giebeln zu. Gedämpfte Stimmen irgendwo, Kilian blieb sofort stehen, legte den Arm um ihre Schultern, und Louise umfasste seine Hüfte. Schweigend schlenderten sie weiter, sie spürte sein Herz hämmern, angespannte Muskeln. Erneut bogen sie ab. An einem mannshohen Gartentor, das in die Hecke eingelassen war, hielt Kilian inne, umarmte sie zögernd.
Ben, dachte Louise, die Augen schließend. Kannst wieder öfter runterkommen.
Aber es funktionierte nicht. Sie liebte ihn nur, wenn er da war. War er fort, fehlte er nicht. Was fehlte, war die große Liebe, der Partner für die zweite Hälfte des Lebens. Als kehrten die Träume der Jugend zurück, wenn man Mitte vierzig war. Ein bisschen Hoffnung.
Sie hörte die Scharniere des Tores leise quietschen und begriff, dass sie nicht allein waren. Wortlos zog Kilian sie in einen Garten, an einer dunkel gekleideten Frau vorbei, die das Tor rasch wieder schloss.
Die Frau führte sie an der Hecke entlang, weg von einer filigranen Villa hinter Bäumen und Büschen. An der Rückwand eines Gartenschuppens hielt sie inne und drehte sich um. Sie mochte Mitte dreißig sein, das Gesicht so hell, dass Louise ihre Züge auch ohne Licht deutlich erkannte.
»Irina«, flüsterte Kilian. »Der Informant.«
Louise nickte überrascht, spürte im selben Moment Irinas Hand an ihrer. Ein Zettel, das Autokennzeichen.
»Die letzten zwei Zahlen fehlen«, wisperte Irina. »Ein weißer Polo oder Golf, sehr sauber, wie sagt man … gepflegt.« Ihr Atem roch nach Alkohol, Rotwein vielleicht, nach Espresso, die Stimme war belegt, sie schien erkältet zu sein. Eine auf klassische Weise schöne Frau, Hollywood in den fünfziger Jahren, nur auf Russisch, alles ein wenig kräftiger, stolzer, selbstbewusster.
Aber auch ängstlich.
»Fragen Sie!«
»Der Käufer …«, begann Louise.
»Schmal, groß wie Alex, maximal zweiunddreißig.«
Sie wollte nachhaken, besann sich rechtzeitig. Kilian war wohl Alex. »Deutscher?«
»Von hier, Baden-Württemberg.«
»Er hat Dialekt gesprochen?«
Irina nickte. »Weiter, fragen Sie schnell!«
»Wie sieht er aus?«
Irina hob die Hände an die Kopfseiten. »Haare hell und kurz, fast Glatze, aber nicht ganz. Einfacher Mann, bisschen nervös. Ein … Bote, kein Chef.«
»Wann und wo hat er die Waffen geholt?«
»Gestern Abend, vielleicht halb zwölf, in einem Restaurant von meinem Mann in Altstadt, ›Iwan und Pauline‹. War schon geschlossen, ich habe Abrechnung gemacht, mein Mann war unterwegs, da ist er gekommen.« Ein Leibwächter hatte den Käufer zum Sicherheitschef ihres Mannes geführt, Niko. Nur wenige Worte waren gefallen. Ein Umschlag mit Geldscheinen wurde auf den Tisch gelegt, dann ein fest verschlossener Schuhkarton mit den Pistolen, die Niko zuvor hineingetan hatte, eine Makarow, eine Tokarew, wie bestellt. Der Käufer öffnete den Karton nicht, nahm ihn nur und ging.
»Telefonisch bestellt?«
»Ja, Anfang April.«
»Von wem wissen Sie nicht?«
Irina schüttelte den Kopf, die Hände signalisierten Bedauern. Sie wusste nur, dass zumindest Niko den Anrufer kannte und sich für ihn verbürgt haben musste. Andernfalls hätte ihr Mann das finanziell unbedeutende Geschäft niemals erlaubt. Den »Boten« wiederum, der die Waffen geholt hatte, kannte Niko nicht.
Kilian war zur Ecke des Schuppens gegangen, kam nun zurück, sagte: »Du musst rein.«
Irina erwiderte seinen Blick, sah dann Louise an. »Schnell!«
»Wenn Niko den Anrufer kennt, liegt es doch nahe, dass er …«
»Kein Russe. Kein Geschäftspartner. Niko hat zu meinem Mann gesagt: ›Ein deutscher Bekannter, du kennst ihn nicht.‹«
Aus der Villa drang gedämpft das Lachen zweier Männer. Dann ein leises Surren, eine elektrische Jalousie.
»Irina«, drängte Kilian, die Hand an ihrem rechten Arm. Irina legte die linke Hand auf seine, trat einen Schritt zurück.
»Können Sie herausfinden, wer der Anrufer ist?«
»Wie? Ich kann nicht fragen!«
Bevor Louise sich bedanken konnte, hatte Irina sich abgewandt und lief auf das Haus zu.
»Komm«, flüsterte Kilian.
»Kennst du Niko?«
Ohne zu antworten, schob er sie in Richtung Gartentor. Seine Hand blieb an ihrem Rücken, als wollte er sicherstellen, dass sie nicht stehen blieb.
»Also?«, sagte sie draußen auf dem Fußweg.
Ein verärgerter Seitenblick, dann legte er den Finger an die Lippen und zog sie mit sich.
Als sie wieder im Wagen saßen, sagte er: »Er heißt nicht Niko. So wie Irina nicht Irina heißt.«
»Ein ›deutscher Bekannter‹, Kilian. So viele werden da nicht infrage kommen.«
»Vergiss es.«
»Und nachdem ihr sie hochgenommen habt?«
»Wenn Niko dann noch lebt, kannst du ihn vernehmen.«
Auf anderen labyrinthischen Umwegen verließen sie Baden-Baden, und Louise dachte, dass sie nun ein wenig mehr wusste über diese kleine Stadt. Baden-Baden hatte jetzt ein Gesicht, ein blasses, schönes Gesicht voller Sanftmut und Angst.
»Irina und Alex«, sagte sie, als sie auf der Autobahn waren.
Kilian reagierte nicht.
»Hast du dich in sie verliebt?«
Sein Blick streifte sie. »Versprich mir, dass du sie nicht kontaktierst. Dass du nicht allein herkommst. Wenn du was brauchst, schick eine SMS.«
»Ja, ja, versprochen. Hast du?«
Er hatte sich wieder der Straße zugewandt, schwieg. Kilian, sperrig und unnahbar, wie er früher nicht gewesen war. Die Angst um Irina allein war dafür keine Erklärung. Natürlich lag es auch an den zehrenden Ermittlungen, undercover gegen die organisierte Kriminalität, und das über Monate. Vor allem aber, dachte Louise, lag es an Kilian selbst, der in seinem Enthusiasmus für den Beruf nicht gegen eigene Fehler gewappnet gewesen war. Vor einem halben Jahr hatte eine Zeugin, deren Haus er observierte, nachts einen Suizidversuch unternommen. Drei Stunden lang brannte das Licht in ihrem Bad, Kilian unternahm nichts, weshalb auch, wer hatte nicht schon einmal vergessen, das Badlicht auszuschalten? Der Mann, den sie damals suchten, holte die Zeugin aus dem roten Badewasser, und Kilian sagte: Ich hab’s vermasselt. Und weil er ein Draufgänger war, stürzte er sich in den schwärzesten Job, den die Kripo zu vergeben hatte, um seinen Fehler wiedergutzumachen.
In Freiburg sagte Louise: »Lass mich im Stühlinger raus, beim ›Babeuf‹.«
»Wolltest du nicht auf deinen Balkon zurück?«
»Die Chefs sind im ›Babeuf‹.«
»Du nimmst es also ernst?«
»Keine Ahnung. Ja.«
»Gut«, sagte Kilian zufrieden.
Sie hatten die Egonstraße erreicht, hielten vor dem »Babeuf«. Quer über der Eingangstür hing ein Schild, GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT. Hinter den Fenstern inmitten von Rauchschwaden ein paar bekannte Gesichter, ein paar vertraute, man schien sich zu amüsieren. Louise war froh, dass sie nicht mitgegangen war.
»Hat jemand Geburtstag?«
»Rolf.«
»Rolf? Welches Dezernat?«
»Rolf Bermann.«
Kilian musterte sie überrascht.
»Wäre heute fünfzig geworden.«
Er wandte den Blick ab, sagte: »Die Kerze auf dem Balkon?«
Louise antwortete nicht. Es ging ihn nichts an, fand sie. Den Kilian von früher schon, den von heute nicht, mit dem wollte sie nicht über diese Dinge reden.
»Kannst du meinen Namen raushalten?«
»Mal sehen«, erwiderte sie. »Graeve wird fragen.«
»Okay. Solange nur er es weiß.« Als sie die Autotür öffnete, berührte er ihre Hand. »Menschen sterben. So ist das eben.«
»Es gibt Menschen, die nicht sterben dürfen, weißt du das nicht, Kilian?« Sie stieg aus, beugte müde lächelnd den Kopf. »Doch, ich glaube, du weißt es.«
Zwei angetrunkene Chefs, nach Zigarettenrauch stinkend, das hatte man nicht alle Tage, den distinguierten Reinhard Graeve mit verrutschter Krawatte und hochgekrempelten Hemdsärmeln schon gar nicht. Den anderen, Leif Enders, kannte Louise noch nicht lange genug, um überrascht oder nicht überrascht zu sein. Er war erst vor einer Woche aus Aachen in den Südwesten gekommen, hatte die Nachfolge Bermanns als Dezernatsleiter angetreten. Vier Monate lang hatten die Herren an der Spitze gesucht, ohne recht suchen zu wollen, bis Louise zu Graeve gesagt hatte: Es gibt keinen zweiten Bermann, lassen Sie das Elfer doch einfach schließen.
Eine Woche später hatte sie Enders’ Namen zum ersten Mal gehört.
Sie standen vor dem »Babeuf«, Enders mit Bier und Zigarette in den Händen, während der große, schmale Graeve sichtlich irritiert die Ärmel hinunterrollte. »Ziemlich viele Unbekannte«, sagte er mit gedämpfter Stimme.
Louise nickte ungeduldig. »Ist nun mal so.«
»Ein Kollege ohne Namen. Ein Informant ohne Namen. Eine Organisation ohne Namen. Ich meine ja nur.«
»Nüchtern sind Sie nicht so umständlich.«
Er lachte verkniffen.
»Alkohol, gefährliches Terrain«, sagte sie zu Enders.
»Ich weiß, hab Ihre Akte gelesen.« Er hatte eine angenehme Stimme, warm, ein wenig heiser.
»Hier im Süden sagen wir ›du‹.«
»Leif.« Er stieß Rauch aus. »Mir egal, was da drinsteht, in deiner Akte.«
»Wir werden sehen.«
Enders schmunzelte, seine Hände gerieten in Bewegung, er verschüttete Bier. Louise und Graeve wichen rasch zurück, Enders trank, um künftige Gefahren zu bannen. Eine kurze Pause trat ein, Graeve war mit seinen Ärmelknöpfen beschäftigt, Enders mit seinem Bier. Louise musterte ihn, seine Züge, seine Augen. Irgendetwas stimmte nicht mit diesem Gesicht. Etwas fehlte.
Der Schnurrbart. Der Leiter des D11 ohne Schnauzer – schier undenkbar. Und er trank anders als Bermann, selbstvergessen, ein wenig zu genüsslich.
Sie traten wieder näher zueinander. »Der Kollege und der Informant sind zuverlässig?«, fragte Enders.
»Soweit ich es beurteilen kann.«
»Und wenn du benutzt wirst?«
Louise hob die Schultern. »Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube es nicht.«
»Wie soll es jetzt weitergehen?«, fragte Graeve, der Mühe hatte, die Knöpfe zu schließen, weil er das Sakko umständlich zwischen Ellenbogen und Rippen geklemmt hielt. »Die halbe Direktion ist mit der WM beschäftigt. Die Niederländer werden in Hinterzarten wohnen.«
»Ich brauche erst mal nur Natalie.« Louise nahm ihm das Sakko ab, legte es sich über den Arm, strich darüber wie eine Hausfrau in Filmen aus den Fünfzigern.
»Meinen Segen hast du«, sagte Enders.
Graeve, der Leiter der Kripo, war langsamer, vielleicht betrunkener. Sie spürte, dass er sich in der Situation nicht zurechtfand – dienstliche Belange an einem solchen Abend, der wohl ein wenig außer Kontrolle geraten war. Seine große Stärke war seine Vernunft, die wie der Lichthof des Mondes in jede Richtung strahlte und schier alles berücksichtigte. Im Moment taugte sie nicht allzu viel, das wusste er, und es verunsicherte ihn. »Was genau befürchten Sie, Louise? Ein … Attentat? Einen Mord?«
»Hat keinen Sinn zu spekulieren, Chef, in Ihrem Zustand.«
»Könnte mit der WM zu tun haben«, sagte Enders. »Der Verfassungsschutz warnt schon jetzt vor Anschlägen.«
»Dann müssten wir Stuttgart informieren.«
Louise seufzte. »Lasst uns doch erst mal den Wagenhalter ermitteln.«
»Ich will den Namen des Kollegen«, sagte Graeve und strich die Krawatte glatt. »Morgen reicht.«
»Okay. Aber nur Sie, niemand sonst.« Wieder musterte sie Enders, der gelassen reagierte, die Augen flüchtig schloss, mit den Achseln zuckte. »Nichts gegen dich«, sagte sie.
»Ich kenne den Kollegen nicht, was soll ich also mit seinem Namen?«
»Gut.« Graeve zog das Sakko von ihrem Arm, schlüpfte hinein. »Taxi?« Er langte nach dem Handy.
Louise nickte.
»Wir sehen uns«, sagte Enders, ging wieder ins »Babeuf«.
Graeve bestellte das Taxi, fragte dann: »Was halten Sie von ihm?«
»Er wird’s schwer haben.«
»Geben Sie ihm eine Chance, ja?«
Sie musste schmunzeln. Ein Chef, der ihre Andeutungen verstand.
Halb drei am Montagmorgen, die Nacht lag schwer über dem Annaplatz. Louise blickte auf die erloschene Kerze, dann trat sie ins Zimmer zurück. Sie begann, sich auszuziehen, das Telefon zwischen Ohr und Schulter, lauschte dem Freizeichen, wählte erneut, doch Ben nahm nicht ab.
2
Natalie, dreiundzwanzigjährige IT-Expertin und Kommissaranwärterin, ein fröhliches, fleißiges Mädchen, liebte das Leben und die Männer und stand doch jeden Sonntagmorgen um acht auf einer Wiese nahe dem Rhein, um mit einem schlichten Langbogen geduldig Pfeil um Pfeil in Zielscheiben aus Stroh zu jagen. Louise war im vergangenen Sommer einmal mitgefahren, hatte es sich zeigen lassen. Um neun war sie in der Sonne eingeschlafen. Um elf hatte Natalie sie geweckt, eine Art vollkommene Zufriedenheit um die Lippen, die Louise auf ewig versagt bleiben würde.
»Drei«, sagte Natalie, legte Ausdrucke auf den Schreibtisch.
Louise nahm sie, stand auf, zog die Jacke von der Stuhllehne. Drei weiße Polos oder Golfs, weniger, als sie befürchtet hatte. Ein Frauenname, zwei Männernamen, der Mann war vierundachtzig. »Passt nicht ganz zu der Beschreibung.«
»Vielleicht hat sich der Informant getäuscht«, sagte Natalie.
»Spiel ein bisschen rum. Zahlen drehen und so.«
»Bis ein männlicher Halter um die dreißig rauskommt?« Natalie öffnete die Tür, murmelte: »Oh!« Leif Enders stand da, war offenbar im Begriff gewesen zu klopfen. Sie ging, Enders trat ein. Ab dem Hals aufwärts sah er verkatert und zehn Jahre älter aus, als er war, Ende vierzig. Doch sein Hemd war faltenfrei und blütenweiß.
»Wie viele habt ihr?«
»Drei.«
»Fahren wir.«
Louise stutzte. »Wir?«
»Du und ich.«
»Hier im Süden sind wir hierarchisch organisiert. Einer leitet das Dezernat, das bist du, die anderen fahren herum, das bin ich.«
»Die Hierarchien werden jetzt flacher«, sagte Enders.
Sie gingen den Flur entlang, die Wände leuchteten weiß im künstlichen Licht. In den ersten Wochen nach Bermanns Tod hatte Louise in diesen Gängen permanent damit gerechnet, dass er um irgendeine Ecke biegen würde. Rolf Bermann, das war ein düsteres Gesicht im Neonlicht, eine kräftige Stimme hinter halb geöffneten Bürotüren, ein bedrohlich zuckender Schnauzer. Keiner, der einfach nicht mehr da war.
»Mir liegt das nicht, dieses Teamgetue«, sagte sie.
Enders lächelte. »Willst du auf eine Fortbildung?«
»Fortbildung in Teamgetue?«
»Stärkung der sozialen Kompetenz, Konfliktmanagement, Umgang mit Vorgesetzten.«
Sie lachte. »Hab ich so einen schlechten Ruf?«
»Du verbreitest Angst und Schrecken.« Im Hof gab Enders ihr seinen Wagenschlüssel, zeigte auf einen silbernen Daimler. »Restalkohol, du fährst.«
Sie stiegen ein. Louise ließ den Motor an, das Fenster herunter, sagte: »Wenn du jemals wieder nach Alkohol stinkst, setze ich mich nicht mehr mit dir ins selbe Auto.«
Marie Heim, wohnhaft in Merzhausen, nicht zu Hause. »Marie und Nina Heim« stand auf dem Klingelschild, Nina ist das Baby, sagte der Hausmeister, nannte ein Reisebüro im Zentrum. Sie fuhren in die Stadt zurück. Auf dem Firmenparkplatz fanden sie den weißen Wagen, einen Polo, der Louise allerdings eher verwahrlost als sauber und gepflegt vorkam. Enders schoss Fotos, dann gingen sie ins Gebäude. Sie hatten sich nicht abgesprochen, doch Louise spürte, dass er ihr nicht hineinpfuschen würde. Er wollte sie nicht kontrollieren, sich nicht profilieren, er wollte einfach dabei sein, warum auch immer.
Marie Heim war mager und völlig übermüdet. Blass saß sie vor dem Computer, eine Hand auf dem Bauch des Babys, das neben ihrem Stuhl in einer Tragetasche schlief. Als Louise sich und Enders vorstellte, erhob sie sich hastig, stand schräg da, um die Hand nicht von Nina nehmen zu müssen. Ihre Augen waren voller Sorge, sie hatte zu zittern begonnen. Ein Windhauch hätte genügt, um sie ins Wanken zu bringen.
Louise stellte ihre Fragen, hakte nach. Angeblich war Marie Heim am fraglichen Abend mit dem Polo bei ihrem Bruder in Lahr gewesen.
»Niedlich«, sagte Enders, auf das Baby deutend.
»Ja«, sagte Louise. »Sehr niedlich.«
Marie Heim nickte erschrocken.
Draußen rief Enders Lahr an, schickte Kollegen zu dem Bruder.
Sie warteten in der Sonne.
»Angst und Schrecken, ja?«
»Gelegentlich auch Bewunderung.« Er lachte.
In etwa so hatte Rolf Bermann all die Jahre auf sie reagiert, dachte sie. Verschreckt, bewundernd.
Enders’ Telefon klingelte. Die Bestätigung aus Lahr.
»Da waren’s nur noch zwei«, sagte er.
Friedrich Krüger, der Vierundachtzigjährige, lebte in einer kleinen, verqualmten Dreizimmerwohnung in der ECA-Siedlung Haslach, neun zweistöckige Gebäuderiegel im südlichen Freiburg, 1962 von der amerikanischen Economic Cooperation Administration mit Geldern aus dem Marshallplan errichtet und längst sanierungsbedürftig. Krügers Erdgeschosswohnung kam Louise auffallend ordentlich und sauber vor, als hätte er sich dem langsamen Verfall seiner Umgebung mit aller Kraft entgegengestemmt. Doch die Substanz hatte er nicht verbessern können – durch die Fenster zog es, in der Luft lag der Geruch nach Moder, aus anderen Wohnungen waren deutlich Stimmen und Geräusche zu hören.
Missmutig hatte Krüger sie ins Wohnzimmer geführt. Die Deckenleuchte brannte, vor einem der beiden Fenster stand draußen ein wuchernder Busch, ließ kaum Licht herein. Die Einrichtung war die eines anspruchslosen, desinteressierten alten Menschen, funktional, vage aufeinander abgestimmt, aus anderen Epochen. An den Wänden ein paar verblasste Reproduktionen von Landschaftsgemälden, auf Regalborden zahlreiche Fotos, die auf frühere Zeiten verwiesen und auf eine Frau, die es vermutlich nicht mehr gab.
»Wo soll ich gewesen sein?« Krügers Stimme klang empört, die Wangen hatten sich gerötet. Er war eher groß, das Haar glatt gekämmt, hellblaues Hemd, beigefarbene Strickjacke.
Enders hob beschwichtigend die Hände. »War nur eine Frage, keine Behauptung.«
»Baden-Baden«, sagte Louise. »Samstagabend gegen elf, halb zwölf.«
»Und was genau unterstellen Sie mir?«
Enders seufzte. »Nichts, Herr Krüger.«
Mit starrem Blick zog Krüger ein Päckchen Zigaretten aus der Brusttasche des Hemdes, zündete sich eine an, ließ sie warten. Die Fingerkuppen seiner rechten Hand waren bräunlich-gelb verfärbt, auch seine Gesichtshaut und die weißen Haare wiesen gelbliche Flecken auf, ob vom Rauchen oder nicht. »Samstagabend spiele ich Skat.«
»Mit Freunden?«, fragte Louise.
»Skat spielt man nicht allein.«
»Hier?«
»Selbstverständlich nicht hier.« Krüger stach mit dem Zeigefinger in ihre Richtung. »Glauben Sie wirklich, ich bitte Freunde in dieses lumpige Viertel, das die Roten verfallen lassen, damit sie es irgendwann abreißen und den Grund teuer verkaufen können?«
»Die Wohnung ist doch hübsch«, murmelte Enders.
»Sind Sie mit dem Auto gefahren?«
»Wie sollte ich sonst nach Zähringen kommen? Zu Fuß?«
»Wir brauchen einen Namen und eine Telefonnummer.«
Enders machte eine vage Handbewegung in den Raum. »Sauber und nett geschnitten, vermutlich nicht zu teuer …«
»Jeder Pfennig, den man in dieser Siedlung zahlt, ist einer zu viel.«
»Herr Krüger«, sagte Louise.
»Einzelöfen, kosten mich ein Vermögen!« Der Zeigefinger stach wieder, Asche fiel auf den Teppich, ohne dass Krüger es bemerkte. »Wenn Sie mich dann in Ruhe lassen, gebe ich Ihnen einen Namen und eine Telefonnummer, unter Protest, es ist eine Zumutung, dass Sie meine Freunde belästigen!«
»Wer ist J.Krüger?«, fragte Enders.
»Mein Sohn.«
»Er wohnt über Ihnen?«
»Wie Sie dem Klingelschild entnehmen konnten: ja. Mit seiner Frau und meinem Enkelsohn.«
»Steht Ihr Auto in der Garage?«, fragte Louise.
»Ich kann mir keine Garage leisten.« Krüger ging in den Flur. Louise hörte ihn telefonieren, er kündigte einem »Herbert« ihren Anruf an, entschuldigte sich für die Belästigung.
Kurz darauf fiel die Wohnungstür hinter ihnen ins Schloss.
Am Straßenrand ein weißer Golf, so gepflegt wie die Wohnung.
Im Wagen wählte Enders die Telefonnummer, Herbert bestätigte die Angaben – Samstagabend Skat in Freiburg-Zähringen bis Mitternacht.