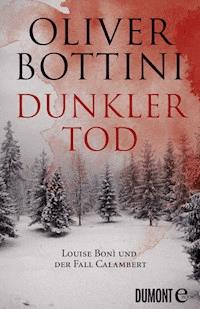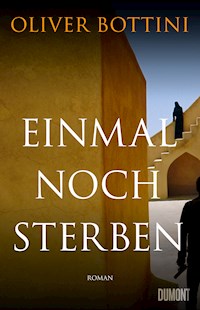8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Louise Bonì
- Sprache: Deutsch
In einem kleinen Ort östlich von Freiburg taucht im dichten Schneetreiben ein japanischer Mönch auf. Woher kommt er? Was hat er vor? Klar scheint nur: Er ist verletzt und auf der Flucht. Louise Bonì von der Freiburger Kripo soll herausfinden, was geschehen ist - und kommt einem schrecklichen Verbrechen auf die Spur. Über die Reihe: Louise Bonì ist Hauptkommissarin der Kriminalpolizei in Freiburg. Sie ist Anfang vierzig, geschieden, und sie kämpft mit den Geistern ihrer Vergangenheit. Bonì hat die Härten des Lebens zu spüren bekommen – und ist vielleicht gerade deshalb so gut in ihrem Job. Intuitiv, kompromisslos, aber auch einfühlsam geht sie vor, um ihre Fälle zu lösen, und schont dabei weder sich noch ihr Team. Der einzige Weg, den menschlichen wie politischen Abgründen zu begegnen, die sich ihr täglich eröffnen. Für die ARD verfilmt mit Melika Foroutan in der Hauptrolle. Louise-Bonì-Krimireihe: Vorgeschichte: Dunkler Tod Band 1: Mord im Zeichen des Zen Band 2: Im Sommer der Mörder Band 3: Im Auftrag der Väter Band 4: Jäger in der Nacht Band 5: Das verborgene Netz Band 6: Im weißen Kreis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Louise Bonì, Hauptkommissarin der Freiburger Kripo aus dem Dezernat Kapitalverbrechen, 42Jahre alt, geschieden, steht vor einem tristen Winterwochenende und den Schatten der Vergangenheit. Doch dann stört ein Anruf des Dezernatsleiters die Erinnerung an die Toten und Verflossenen, und Louise bekommt den merkwürdigsten Auftrag ihrer Karriere als Polizistin: Sie soll einen japanischen Mönch suchen, der in Sandalen und Kutte durch die verschneite Winterödnis östlich von Freiburg geht, und herausfinden, was er vorhat. Widerwillig macht sie sich auf den Weg. Als sie den Mönch eingeholt hat, wird ihr rasch zweierlei klar: Er ist verletzt, und er ist auf der Flucht. Mühsam kann Louise die Hintergründe aufdecken und kommt so einem schrecklichen Verbrechen auf die Spur, in dessen Sog sich auch ihr eigenes Leben entscheidend verändern wird. Oliver Bottini wurde 1965 geboren. Für seine Kriminalromane erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem viermal den Deutschen Krimi Preis, den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner ›Krimifuchs‹ sowie zuletzt den Stuttgarter Krimipreis für ›Ein paar Tage Licht‹ (DuMont 2014). Oliver Bottini lebt in Berlin. Der erste und der vierte Band der Louise-Bonì-Reihe, ›Mord im Zeichen des Zen‹ und ›Jäger in der Nacht‹, wurden 2014 und 2015 mit Melika Foroutan in der Hauptrolle für die ARD
OLIVER BOTTINI
MORD IM ZEICHEN DES ZEN
EIN FALL FÜR LOUISE BONÌ
Von Oliver Bottini sind im DuMont Buchverlag außerdem erschienen:
Der kalte Traum
Ein paar Tage Licht
Im weißen Kreis
Jäger in der Nacht
eBook 2015
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2015 DuMont Buchverlag, Köln
Deutsche Erstveröffentlichung 2004 bei S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: Bild oben: p1057m817854 © plainpicture/Stephen Shepherd
Bild unten: Collage von p1100m875515 (Hintergrund) © plainpicture/Mint Images und p429m821757 (Figur, Freisteller) © plainpicture/Cultura
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8889-4
Für Chiara
Wer den Mitmenschen kennt, ist ein Wissender;
wer sich selbst kennt, ist ein Weiser.
KUEI-FENG TSUNG-MI (780–
PROLOG
ALS JOHANN GEORG HOLLERER am Samstagmorgen einen ersten Blick aus dem Küchenfenster auf die verschneite Hauptstraße von Liebau warf, hatte er eine Vision. Aus dem dichten Schneetreiben manifestierte sich ein asiatischer Mönch, der nur mit einer dunklen Kutte und Sandalen bekleidet war. Sein fast kahler, feuchter Schädel glänzte im trüben Morgenlicht. Langsam schritt er an Hollerers Küchenfenster vorbei Richtung Kirchplatz. Mit der linken Hand stützte er sich auf einen einfachen, mannshohen Stock, in der rechten hielt er eine kleine Schale. Hollerer dachte eben: Den hat mir die Amelie geschickt, als sich die Vision im Schnee wieder entmaterialisierte.
Hollerer kehrte an den Frühstückstisch zurück. Dort saß er minutenlang, ohne sich zu bewegen, und dachte darüber nach, welche Botschaft ihm Amelie wohl hatte übermitteln wollen. Vor allem irritierte ihn, dass sie, zu Lebzeiten eine gottesfürchtige Katholikin, sich ausgerechnet einen buddhistischen Asiaten ausgesucht hatte, um zu ihm zu sprechen.
Schließlich stand er erbost auf. Selbst im Tod sprach Amelie in Rätseln und verdarb ihm die Laune.
Dass er keiner Vision aufgesessen war, begriff Hollerer erst eine halbe Stunde später.
Während er die Uniformjacke über dem ausladenden Bauch zuknöpfte, fiel ihm ein, dass er über dem rechten Ohr des Mönchs einen großen, dunklen Fleck bemerkt hatte. Im ersten Schreck hatte er nicht weiter darauf geachtet. Im Nachhinein kam ihm der Fleck merkwürdig vor – eine längliche, dunkelblaue Verfärbung der Haut. Hollerer kannte solche Flecken zur Genüge, in allen Stadien der Verfärbung, in allen Größen, in allen Körperregionen.
Der Mönch hatte eine Wunde am Kopf. Als wäre er irgendwo dagegengestoßen – oder geschlagen worden.
Beunruhigt trat er zum Nachttischchen. Unter dem verstaubten Alten Testament lag seine Dienstpistole. Er hatte sie in dreißig Jahren kein einziges Mal getragen, geschweige denn benutzt. Jetzt hob er sie mit Daumen und Zeigefinger heraus.
Hollerer fand den Mönch auf dem Kirchplatz. Obwohl es noch immer stark schneite, saß er im Schneidersitz vor den Stufen der katholischen Kirche. Seine Augen waren geschlossen. Er bewegte den Mund, als spräche er. Zu hören war nichts.
Vor dem Mönch stand die kleine Schüssel. Sie schien aus Holz zu sein und war leer. Auf dem schmalen Rand sammelten sich Schneeflocken zu einem weißen Kreis.
Zwanzig, fünfundzwanzig Liebauer hatten sich im Halbkreis um den Mönch versammelt. Flüchtig nickte Hollerer in die Runde. Der Bürgermeister war da, die beiden Pfarrer, andere Honoratioren, ein paar Bauern, ein paar Kinder. Niemand sprach. Nicht einmal ein erstauntes Flüstern vernahm Hollerer. Er hatte das Gefühl, alle warteten darauf, dass etwas geschah. Dass der Mönch die Augen aufschlug und erklärte, was er da machte und woher er kam. Oder dass jemand die Initiative ergriff.
Hollerer trat von der Seite bis auf zwei Meter an den Mönch heran. Da war die Wunde. Zehn Zentimeter lang, fünf Zentimeter hoch. Ein bläuliches Mal, an den Rändern gelbgrün, im Zentrum blaurot, von einem heftigen, versehentlichen Stoß oder einem gezielten Schlag. Hollerer wusste nicht weshalb, aber er tippte auf einen Schlag. Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Er reihte sich in den Halbkreis ein. Jetzt bemerkte er, dass der Mönch auf der linken Wange eine weitere Wunde hatte. Eine Platzwunde, die noch vor kurzem geblutet haben musste. Schorf hatte sich gebildet, der im Schneefall nicht trocknen konnte.
»Wir müssen was tun, der erfriert uns ja«, sagte Hollerer zu niemand Bestimmtem. In die Menge kam Bewegung, verhaltenes Stimmengewirr setzte ein.
Der Mönch rührte sich ebenfalls. Er hob den Kopf und schlug die Augen auf. Sie waren sehr schmal und wirkten, fand Hollerer, leblos und traurig. Langsam glitten sie über die Liebauer. Hin und wieder schien der Blick des Mönchs für einen Moment auf einem Gesicht zu verweilen, dann bewegte er sich weiter.
Auch auf Hollerer ruhten die schmalen Augen sekundenlang. Der Blick war merkwürdig. Nicht unfreundlich, aber merkwürdig. Wissend. Hollerer konnte sich den Blick nicht erklären. Der Mönch sah ihn an, als würde er ihn kennen. Als wüsste er etwas über ihn, das Hollerer selbst nicht wusste.
Dann wandte der Mönch den Blick ab.
»Und was sollen wir tun?«, fragte Ponzelt, der Bürgermeister. »Sollen wir ihm sagen, dass Betteln bei uns verboten ist?« Ein paar Liebauer schnaubten belustigt.
Hollerer trat wieder zu dem Mönch. Einen Meter vor der Schale blieb er stehen. Jetzt sah er, dass sich auf ihrem Grund Wasser angesammelt hatte. Er beugte die Knie ein wenig, bückte sich und stützte die Hände auf die Oberschenkel. Am rechten Ellbogen spürte er das Pistolenhalfter. Plötzlich kam er sich lächerlich vor. »Sie müssen ins Warme«, sagte er. »Sie sind doch ganz nass, Sie holen sich ja den Tod.«
Der Mönch zeigte den Ansatz eines Lächelns. Hollerer bemerkte, dass er noch jung war. Zumindest sah er jung aus. Hollerers Kollege Niksch war Anfang zwanzig und sah nicht viel jünger aus.
Der Mönch deutete auf die Schale, dann auf seinen Mund. Dabei senkte er den Kopf mehrmals, als wollte er sich verbeugen oder bedanken oder einfach nur nicken.
»Er will Geld«, sagte jemand aus dem Halbkreis hinter Hollerer.
Hollerer stieß ein Knurren aus, griff nach der Schale und drehte sie um. Nachdem das Wasser herausgelaufen war, trocknete er sie mit dem Jackenärmel, so gut es ging. Dann legte er ein Zwei-Euro-Stück hinein und stellte die Schale wieder vor den Mönch, der ihn reglos beobachtet hatte.
Hollerer hob einen Finger und zeigte auf die eigene linke Wange und dann auf seine rechte Schädelseite. »Was – sein – passiert?«
Aber der Mönch legte nur die Hände vor der Brust zusammen, verneigte sich leicht und schloss die Augen. Hollerer wollte ihn bitten, sie wieder zu öffnen und ihn noch einmal so anzusehen wie vorhin. Doch weil der Mönch ihn wohl nicht verstanden hätte, sagte er nur: »Lasst ihn in Ruhe, ich bin gleich wieder da.«
Als Hollerer mit zwei Käsebrötchen aus der Metzgerei zurückkehrte, schien auf den ersten Blick alles wie vorher zu sein. Der Mönch saß mit geschlossenen Augen da, die Liebauer, inzwischen etwa vierzig, standen im Halbkreis um ihn herum. Doch Hollerer spürte, dass sich die Stimmung verändert hatte.
Wie zur Bestätigung ergriff Ponzelt ihn am Arm, zog ihn unter seinen Regenschirm und führte ihn ein Stück beiseite. »Unsere Leute werden unruhig«, sagte er, den Blick auf den Mönch gerichtet. »Du musst ihn wegschaffen.«
Hollerer starrte schweigend auf einen Wassertropfen, der an Ponzelts Nasenspitze hing.
»Sie fragen sich«, fuhr Ponzelt fort, »ob da, wo der herkommt oder hingeht, noch mehr von seiner Sorte sind. Ob jetzt jeden Samstagvormittag solche Typen nach Liebau kommen, um zu betteln. Du weißt schon, Hare-Krishna-Typen und Baghwan-Typen und so. Unsere Leute finden, sie haben genug Probleme, auch ohne dass sich hier irgendwelche Sekten breitmachen.«
Endlich fiel der Wassertropfen von Ponzelts Nasenspitze. Auch Hollerer wandte sich jetzt dem Mönch zu.
»Verstehst du?«, fragte Ponzelt. »Die Leute sind unruhig in diesen Zeiten. Woher wissen wir, dass er und seine Kollegen nicht was vorhaben?«
Hollerer nickte, aber er schwieg. Er fragte sich, ob er auch das war, was Ponzelt war, ein Opportunist, der vieles in die Wege leitete und nie schuld war. Der so glatt war, dass die Schuld sich nicht an ihm festhalten konnte.
Seit Amelies Tod kamen ihm öfter merkwürdige Gedanken. Gedanken wie: Bin ich ein Pessimist? Ein Optimist? Bin ich ein Egoist? Ein Opportunist? Früher, ohne solche Gedanken, war das Leben einfacher gewesen, fand er. Er hatte gegessen, gearbeitet, geschlafen und mit Amelie gestritten. Aber er hatte keine merkwürdigen Gedanken gehabt.
»Könnte ja auch sein, dass …«, sagte Ponzelt, doch in diesem Moment schlug der Mönch die Augen wieder auf, und er verstummte.
Schweigend warteten sie, was geschehen würde. Hollerer hatte den unbestimmten Eindruck, dass der Mönch spürte, was um ihn herum vorging. Spürte, dass die Stimmung umgeschlagen war.
»Am besten«, sagte Ponzelt, »gehst du zu ihm und lässt dir seinen Ausweis zeigen und notierst dir seine Daten und so. Dann sehen unsere Leute, dass du sie nicht allein lässt mit denen. Und seine Hare-Krishna-Freunde wissen, dass sie in Liebau keinen Fuß auf die Erde kriegen.«
»Am besten«, murmelte Hollerer, während er auf den Mönch zuging, »leckst du mich am Arsch.« Missmutig überlegte er, ob ihn allein die Tatsache, dass er Ponzelt gewählt hatte, zum Opportunisten machte. Er beschloss, die Frage bis zur nächsten Wahl aufzuschieben. Wenn er Ponzelt wieder wählen würde, wäre es Zeit, intensiver über sich nachzudenken.
Der Mönch folgte ihm mit dem Blick. Wieder hatte Hollerer das Gefühl, dass er ihn durch und durch kannte. Dass er überhaupt alle und alles kannte. Trotzdem – vielleicht gerade deshalb – wirkte der Blick schwermütig und erschöpft.
Und noch etwas glaubte Hollerer in den fremden Augen wahrzunehmen: Angst.
Er hielt dem Mönch die mittlerweile durchnässte Papiertüte mit den Käsebrötchen hin. »Hier, was zum Essen«, sagte er. Ohne dass er es beabsichtigt hatte, klang seine Stimme beruhigend.
Der Mönch nickte und sah in die Tüte hinein.
»Käse aus der Region«, sagte Hollerer. »Ich dachte, Sie sind bestimmt Vegetarier.«
Der Mönch nahm eines der beiden Brötchen und gab ihm die Tüte mit dem anderen zurück. Hollerer wollte protestieren, aber der Mönch nickte erneut und machte mit der Hand, die die Tüte hielt, ungeduldige Bewegungen.
Hollerer ergriff die Tüte. Ratlos faltete er das Papier um das Brötchen. »Ja, also, dann auf Wiedersehen«, sagte er.
Das Brötchen in der rechten Hand, kehrte er zu Ponzelt zurück. Ab er trat nicht unter den Regenschirm.
»Und?«, fragte Ponzelt.
»Jetzt macht er erst mal Brotzeit«, knurrte Hollerer und stapfte in die Schneewand hinein.
I.
Der Mönch
1
LOUISE BONÌ hasste Schnee. Ihr Bruder war im Schnee ums Leben gekommen, ihr Mann hatte sie im Schnee verlassen, und im Schnee hatte sie einen Menschen getötet. Vor allem die Erinnerung an diesen Menschen machte ihr zu schaffen. Während der vergangenen Sommer war es ihr manchmal gelungen, sie zu verdrängen. Während der Winter, im Schnee, begleitete sie sie unerbittlich. Zu Hause, in der Polizeidirektion, unterwegs. Ein Bluthund, der sich nicht abschütteln ließ.
Auch jetzt, als sie von ihrem Bett aus den Vorhang zur Seite schob und minutenlang ins Schneegestöber hinausblickte, dachte sie an diesen Mann. Sie sah ihn auf einer schneebedeckten Straße liegen, inmitten eines wachsenden Flecks aus wunderschönen hellroten Kristallen. René Calambert, Lehrer aus Paris, attraktiv, verheiratet, eine Tochter, eine Kugel im Bein, eine Kugel im Bauch, beide aus ihrer Dienstwaffe.
Sie ließ den Vorhang los und sank aufs Kopfkissen zurück. Seit gestern Mittag schneite es ununterbrochen. Für heute und Sonntag stand keine Besserung in Aussicht. Freiburg erstickte im Schnee. Ihre Kollegen freuten sich aufs Skifahren, die Frauen ihrer Kollegen auf den Winterurlaub im Familienkreis, die Kinder ihrer Kollegen auf Schneeballschlachten. Louise freute sich auf einen Moment ohne den verblutenden René Calambert.
Sie warf einen Blick auf die Digitaluhr. 11:30. Sie schloss die Augen.
Eine Stunde später klingelte das Telefon. Sie ging ins Wohnzimmer. Auf dem Display stand Bermanns Handynummer.
»Ja?«
»Luis?« Manche ihrer Kollegen nannten sie »Luis«. Ihr französischer Hintergrund und ihr biologisches Geschlecht wurden neutralisiert. Bermann legte seine ganze Bodybuilder-Kraft in das »U«, vielleicht, weil er der Leiter des Dezernats 11 war.
»Ja.«
»Du musst raus nach Liebau.«
»Heute ist Samstag.«
»Trotzdem.«
»Nein«, sagte sie und legte auf. Sie wunderte sich über ihren Mut. Seit ein paar Wochen wehrte sie sich gegen die Gewohnheit Bermanns, sie auszunutzen, sie herumzukommandieren. Etwas schien zu Ende zu gehen. Was, wusste sie nicht. Sie hatte nicht den Eindruck, dass ihr Mut sie in ein neues Leben führen würde. Eher in einen Abgrund.
Sie blickte in den Schneesturm hinaus. Flüchtig sah sie vor ihrem geistigen Auge drei Gesichter. Zwei gehörten zu Toten, eines zu einer schmerzhaften Erinnerung.
Meine drei Männer, dachte sie. Meine Schneemänner.
Als sie mit geschlossenen Augen unter der Dusche stand, hatte sie Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Sie öffnete die Augen einen Spalt, aber es wurde nicht besser. Durch das Rauschen des Wassers und die geschlossene Tür hörte sie wiederholt das Klingeln des Telefons.
Später saß sie mit nassen Haaren im Bademantel auf dem Sofa. Bermann hatte zweimal auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie drückte die Play-Taste.
Die erste Nachricht bestand aus einem Befehl: »Ruf mich an, Luis, und zwar sofort. Ich brauche dich.«
Die zweite Nachricht bestand aus einer Drohung: »Luis, wenn du nicht innerhalb von fünf Minuten zurückrufst, leite ich ein Disziplinarverfahren gegen dich ein und streich dich von der Soko-Liste.« Bermanns Stimme klang eiskalt vor Zorn.
Sie unterdrückte den Impuls, nach dem Mobilteil zu greifen. Stattdessen kehrte sie ins Bad zurück und versuchte, nicht an die Soko-Liste zu denken. Nicht in die Liste aufgenommen zu werden war für einen Kripobeamten unangenehm genug. Von der Liste gestrichen zu werden war die Höchststrafe. An die zwei, drei Sokos jährlich erinnerte man sich sein Leben lang. Der Rest war Alltag.
Als sie Bermann anrief, zeigte die Digitaluhr »13:00«. Bermann war sofort dran. »Zwanzig Minuten, Luis«, sagte er. »Das Disziplinarverfahren ist eingeleitet.« Im Hintergrund waren Stimmen zu hören. Eine Lautsprecheransage verkündete Sonderangebote. Bermann stand im Supermarkt.
Sie schloss die Augen. »Rolf, ich hab frei.«
»Und ich hab die Nase voll von dir«, sagte Bermann.
Louise wurde bewusst, dass sie ihn verstand. Sie überlegte einen Moment, weshalb sie das nicht erstaunte, nicht einmal deprimierte. »Was sagt der KDD?«
»Der KDD sagt nichts, weil er nicht vor Ort war.«
»Der KDD war nicht vor Ort?«
Bermann schnaufte verärgert. »Es ist nicht direkt was passiert. Und weil nicht direkt was passiert ist und weil der KDD unterbesetzt ist, war er nicht vor Ort. Und weil wir auch unterbesetzt sind, fährst du raus.«
»Kann das nicht Anne machen?«
»Nein.« Während Bermann die Personalsituation des Kriminaldauerdienstes sowie des Dezernats 11 samt Krankenstand, Erziehungsurlaub und regulärem Urlaub referierte, fragte sie sich, wie er im Supermarkt ein Disziplinarverfahren einleitete. Gab es neben der Fleischabteilung eine Disziplinarverfahren-Abteilung? Formulare lagen in Blechbehältern hinter einer gerundeten Glasscheibe. Disziplinarverfahren ist heute im Sonderangebot, sagte eine Frau mit blutverschmierten Wegwerfhandschuhen.
Sie grinste.
»Also?«, fragte Bermann ruppig.
»Also«, sagte sie. Immerhin, dachte sie, würde sie dann unter Leute kommen. Nicht das ganze Wochenende zu Hause verbringen. Vielleicht nicht das ganze Wochenende an René Calambert denken.
Dann konzentrierte sie sich auf Bermann, der jetzt von Liebau sprach und überaus merkwürdige Dinge sagte.
Die Gleichgewichtsstörungen hielten an, als sie fünfzehn Minuten später in der Tiefgarage in ihrem roten Mégane saß und ins Halbdunkel blickte. Die Auffahrt wackelte, die Betonpfeiler bewegten sich. Sie schloss die Augen, öffnete sie, wartete einen Moment. Sie hatte Sodbrennen und Kopfweh.
An der Seitenwand glitten die Aufzugtüren auseinander, grelles Neonlicht floss in die Garage. Ronescu, der Hausmeister, trat aus dem Licht und schlurfte zerfließend an ihr vorbei. Sie kniff die Augen zusammen, aber er blieb unscharf. Die Konturen seines umfangreichen Körpers wiederholten sich, als besäße er eine spirituelle Aura. Fasziniert blickte sie ihm nach. Der mysteriöse Ronescu offenbarte sein Geheimnis: Er war ein Medium.
Sie kicherte und stieg aus. Sie würde ein Taxi nehmen.
Um Ronescu nicht zu erschrecken, drückte sie die Wagentür leise zu. »Herr Ronescu«, sagte sie.
Ronescu wandte sich um. »Ah, Frau Louise.« Er nickte, und in sein langes graues Hundegesicht kam Bewegung. Die vertikalen Fleischwülste erzitterten, die tiefen Stirnrunzeln glätteten sich für einen Moment. Die Aura blieb.
»Ich hab ein Fläschchen Tuica besorgt.«
Ronescu hob die graubraunen Augenbrauen. »Dann lassen Sie es uns miteinander leeren.« Seine Augen blieben wässrig und leblos. Er rollte das »R«, und die Vokale wurden in seinem runden Mund dunkel, breit und sehnsüchtig. Louise fand, sie klangen, als wollten sie aus der fremden Sprache in die eigene zurück.
Niemand wusste genau, woher Ronescu kam und was er dort gemacht hatte. Im Viertel kursierten wenig feine Gerüchte. Sie besagten, er sei ein ehemaliger Agent, der in Rumänien für Israel spioniert habe.
Jetzt war er alt, verwitwet und verarmt.
Ronescu hob eine Hand zum Gruß und wandte sich ab. Für einen Augenblick verschwammen die Konturen seines Körpers ineinander. Dann ordneten sie sich wieder zu Leib und Aura.
Sie ging die Auffahrt hoch. Auf dem Betonboden waren schwarze Reifenspuren aus Feuchtigkeit zu sehen. Sie öffnete die schmale, ins Garagentor eingelassene Tür. Draußen war alles weiß, und der Schnee fiel unverändert dicht. Sie stieß einen Fluch aus und stapfte auf den Taxistand zu.
Während das Taxi durch die Stadt rutschte, versuchte sie, sich einen Reim auf das zu machen, was Bermann gesagt hatte. Er hatte von einem Japaner gesprochen, der draußen im Schwarzwald in Sandalen durch den Schnee laufe. »Ein Japse«, hatte er gesagt. Bermann war kein Rassist, nur bequem. Er sagte das, was ihm in den Kopf kam. Er hatte weder Lust noch Zeit, vorher nachzudenken. Und er war wütend auf sie gewesen.
»Ein glatzköpfiger Japse mit schwarzer Kutte«, hatte er gesagt. Dann hatte er »Nehmen Sie auch Kreditkarten?« geflüstert.
Hollerer, der Kollege aus Liebau, hatte die Polizeidirektion angerufen. Er wusste nicht, was er mit dem Mönch anfangen sollte. Der Mönch hatte nichts getan. Andererseits würde er mit ziemlicher Sicherheit erfrieren, wenn er weiter durch den Schnee spazierte »mit kaum was an«.
Außerdem, hatte Hollerer gesagt, stand Liebau kopf. Womöglich, fürchtete man, war eine Sekte im Begriff, sich in der Nähe niederzulassen. Etwas musste unternommen werden – rechtzeitig, verlangte Liebau. Der Bürgermeister machte Druck. Er hatte die Honoratioren versammelt, telefonierte herum und ließ Hollerer keine Ruhe. Er wollte, dass der Fall, den es nicht gab, untersucht wurde.
»Du machst ein ernstes Gesicht, schreibst möglichst viel auf und verziehst dich wieder«, hatte Bermann gesagt. Das Piepen des Kassenscanners hatte seine Worte untermalt.
Louise wurde bewusst, dass sie die Kopfstütze vor sich fixierte, seit sie in das Taxi gestiegen war. Vorsichtig hob sie den Blick. Die Gleichgewichtsstörungen schienen nachgelassen zu haben. Die Dinge hatten, bemerkte sie bedauernd, ihre Aura verloren.
Sie überlegte, ob sie Hollerer kannte. Der Name kam ihr bekannt vor. War sie ihm schon einmal begegnet? Sie erinnerte sich nicht.
Die Fahrt zog sich endlos hin. Der Samstagsverkehr war wegen der Schneemassen halb zusammengebrochen. Menschen kämpften sich mit gesenkten Köpfen und weißen Regenschirmen über die Dreisam-Brücken. Aristoteles und Homer waren unter unförmigen Schneekleidern verschwunden. Sie kamen an einem Auffahrunfall vorbei und standen in unübersichtlichen Staus. Streufahrzeuge waren unterwegs, gelbe ADAC-Autos gaben Starthilfe. Der junge Taxifahrer ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Gelassen pfiff er monotone Melodien durch die Zähne.
Als die Häuser zu beiden Seiten der Straße verschwanden, wurde das Weiß des Schnees beinahe unerträglich grell. Der Fahrer setzte eine Sonnenbrille auf, Louise kniff die Augen zusammen. Sie fuhren ins Nichts.
René Calambert war im Nichts gestorben, auf einer schmalen Straße außerhalb von Munzingen. Bermann und die anderen waren in die falsche Richtung gelaufen. Nur sie war in die richtige Richtung gelaufen.
Nein. Sie war in die falsche Richtung gelaufen.
»Was?«, fragte der Taxifahrer.
»Ich hab nichts gesagt.«
»Sie haben gesagt: falsche Richtung.«
»Hab nicht Sie gemeint.«
»Okay.« Der Fahrer nickte. Sie spürte, dass sein Blick hinter den dunklen Gläsern im Rückspiegel auf ihr lag. Er war jung, sah nach Student aus, hatte wild gelocktes Haar. Ihr fiel auf, dass seine Ohrläppchen unglaublich groß waren, etwa so groß wie der Schraubverschluss einer Wodkaflasche. Von der Wärme im Wageninneren waren sie leicht gerötet. Plötzlich hatte sie Lust, das rechte zu berühren, es zwischen Daumen und Zeigefinger zu nehmen und ein bisschen damit zu spielen.
Sie hob schon die Hand, als das Ohrläppchen in Bewegung geriet. Der Fahrer beugte sich vor und nahm eine weitere Sonnenbrille aus dem Handschuhfach. »Hier«, sagte er.
»Danke.«
Die Brille war eiskalt. Ihre Gläser bestanden aus zwei schmalen, dunklen Rechtecken. Aus irgendeinem Grund erinnerte sie die Brille an Bob Marley, Rastafaris und Haschischexzesse. Vor fünfzehn Jahren hätte sie sie in den Diskotheken getragen.
»Geben Sie sie mir zurück, wenn wir uns wieder sehen«, sagte der Fahrer.
Sie setzte die Diskotheken-Brille auf. »Wie heißen Sie?«
»Anatol Ebing.«
»Wir sehen uns nicht wieder, Anatol.«
»Sie sitzen zum vierten oder fünften Mal innerhalb von einem Jahr bei mir im Taxi, da sind die Chancen nicht so schlecht, oder?« Anatol lächelte flüchtig.
Sie starrte ihn erschrocken an. Er kam ihr nicht einmal vage bekannt vor.
Dafür begann sich in ihrem Gedächtnis ein anderes Männergesicht zu formen. Es war rund, gemütlich, nachgiebig. Ein Körper kam dazu, der ebenso rund, gemütlich und nachgiebig war. Weiße, dicke Finger, die alle zwei Minuten die rutschende Hose hochzogen. In ihrer Erinnerung verlor das Gesicht plötzlich die Gemütlichkeit und färbte sich dunkelrot. Der Mann, zu dem es gehörte, stand schnaubend in einer kleinen Wohnküche vor einem Vater, der Tochter und Exfrau als Geiseln genommen hatte und mit einem Küchenmesser bedrohte. Wie, Sie könnten jemand umbringen, den Sie lieben?, sagte der Mann mit dem roten Gesicht erbost zu dem Vater. Der Vater starrte ihn verwirrt an, dann senkte er das Küchenmesser rasch. Na, das möcht ich auch hoffen, knurrte der Mann.
Hollerer.
Hollerer war nicht in Liebau. Er folgte dem Mönch, der weitergezogen war, im Streifenwagen. Über Funk gab er seine Positionen an den Polizeiposten Liebau durch.
Ein eifriger junger Beamter mit dem merkwürdigen Namen Niksch brachte Louise auf unsichtbaren Straßen tiefer ins Nichts hinein. Sie hatte den Eindruck, über ein unendliches Feld aus Schnee zu gleiten. Häuser, Bäume, Zäune gab es hier nicht. Nur Strommasten und Raben.
Nicht einmal René Calambert verirrte sich hierher.
Niksch hatte Schnupfen und zierliche Hände und fuhr absichtlich zu schnell. Fast in jeder Kurve brach das Heck des Streifenwagens aus. Strahlend fing er den Wagen ab.
»Großartige Reflexe«, sagte sie und überlegte, ob er ihr imponieren wollte, weil sie eine Frau war oder weil sie beinahe seine Mutter hätte sein können.
»Ich fahr Rallyes«, sagte Niksch.
»Nicht jetzt, bitte«, sagte Louise.
Zehn Minuten später tauchte in der weißen Einöde links von ihnen ein Streifenwagen auf. Er stand am Fuß eines kahlen Hügels. Auf halber Höhe, in einer geraden Linie oberhalb des Wagens, bemerkte Louise einen schwarzen Punkt. Sie brauchte einen Moment, um zu erkennen, dass sich der Punkt langsam nach oben bewegte.
Niksch betätigte das Funkgerät und rief: »Chef, wir sehen ihn, er ist direkt über Ihnen!«
»Was du nicht sagst.« Hollerers Stimme klang undeutlich, als spräche er mit vollem Mund. »Hast du den Foto dabei, Niksch?«
»Natürlich«, rief Niksch strahlend und riss das Steuer nach links.
Hollerer war ausgestiegen. Während sie auf ihn zuging, nickte er, als hätte er sie gleich erkannt. Sie gaben sich die Hand. »Setzen wir uns einen Moment ins Warme«, sagte er ein bisschen grimmig und hielt ihr den Schlag auf. Als sie saßen, fragte er: »Sie sind allein gekommen?«
»Ja.«
Schweigend beobachteten sie den Mönch durch die Windschutzscheibe. Es hatte aufgehört zu schneien, der Himmel war lichter geworden. Sie war froh über die Sonnenbrille. Hollerer hatte Mühe, die Augen wenigstens einen Spalt weit offen zu halten. Der Mönch hatte etwa drei Fünftel des Hügels hinter sich gebracht und ging jetzt nicht mehr senkrecht, sondern schräg nach oben. Er war gut einhundert Meter von ihnen entfernt.
»Wo der bloß hin will?«, brummte Hollerer. Seine Stimme klang, als hätte er seit Stunden über diese Frage nachgedacht.
»Was ist hinter dem Hügel?«
»Nichts«, sagte Hollerer. Er stellte den Motor ab. Das Gebläse arbeitete weiter.
Niksch war dem Mönch etwa zehn Meter weit nachgestiegen. Jetzt hob er einen Fotoapparat an die Augen. Dann drehte er sich um und zog fragend die Schultern in die Höhe. Hollerer bedeutete ihm mit der Hand, weiterzumachen. Er zeigte nach links, nach rechts, zuckte die Achseln. Niksch zuckte ebenfalls die Achseln.
»Der Niksch hat viele Talente«, sagte Hollerer, »zum Beispiel ist er ein guter Autofahrer. Leider ist er ein beschissener Polizist. Er arbeitet, wie er Auto fährt: konzentriert, aber viel zu schnell. Außerdem ist er süchtig nach Kurven und hat keine Lust, gradaus zu arbeiten. Am liebsten arbeitet er querfeldein, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Nicht ganz.«
»Seine Ergebnisse sind, na ja, kreativ, aber unbrauchbar.«
Louise lächelte.
Sie hatten sich im Sommer vor René Calambert kennengelernt. Hollerer war schon damals dick gewesen, doch wenn ihr Gedächtnis sie nicht trog, hatte er seitdem noch einmal zugenommen. Und er sah unordentlicher aus, fast ein wenig verwahrlost. Er war schlecht rasiert, die Uniformjacke fleckig. Auf seinem Bauch lagen Brotkrümel.
»Warum bin ich hier?«, fragte sie.
»Es gibt Menschen, die haben einen sechsten Sinn für Gefahren«, antwortete Hollerer. »Die sehen etwas oder jemanden, und dann klingelt eine Alarmglocke in ihrem Kopf, und sie spüren: Gefahr im Verzug. Die sehen jemanden wie den da« – er nickte in Richtung Mönch – »und spüren, dass da was nicht stimmt.«
»Und so einer sind Sie.«
»Nein. Aber der Ponzelt ist so einer. Unser Bürgermeister.«
Louise lachte, und Hollerer fiel grimmig mit ein. Doch er wurde schnell wieder ernst.
Für Ponzelt, erklärte er, stelle der Mönch mittlerweile den Antichrist dar, der einer Sippschaft von Teufeln den Weg nach Liebau ebne. »Deshalb sind Sie hier«, sagte er. »Um Ponzelt zu beruhigen und dem Antichrist Angst zu machen. Aber irgendwie hat der Ponzelt auch recht … irgendwas ist schon komisch.« Wieder nickte er in Richtung Mönch. »Er hat Angst. Und er ist verletzt.«
Hollerer beschrieb die Wunden. Er gab zu, dass sie von einem Unfall stammen konnten. Wer wusste schon, wie lange der Mönch bereits im Freien unterwegs war. Vielleicht war er im Erleuchtungsdelirium gegen einen Baum gelaufen. Vielleicht hatten ihn ein paar Jugendliche verprügelt. »Trotzdem«, sagte Hollerer.
»Sie sind ja doch so einer«, entgegnete Louise.
Hollerer lachte. »Und Sie?«
Sie zuckte die Achseln. Früher mal, dachte sie. Seit René Calambert war immer weniger Verlass auf ihre innere Stimme.
Hollerer betrachtete die Brotkrümel auf seiner Brust. Er wischte sie nicht weg. »Also dann«, sagte er und öffnete die Tür.
Sie verspürte überhaupt keine Lust, in die Kälte hinauszugehen und dem Mönch hinterherzulaufen. Am liebsten wäre sie mit Hollerer nach Liebau zurückgefahren. Sie hätten sich in ein Lokal setzen, sich unterhalten können. Louise fand, sie hatten ein Recht darauf, sich Menschen wie Ponzelt und Bermann und deren Eigensinn wenigstens am Wochenende zu widersetzen. Seufzend stieg sie aus.
Am Fuß des Hügels stapften sie nebeneinander durch den Schnee. Sie sanken bis zu den Knöcheln ein. Hollerer begann nach zwanzig Metern laut zu schnaufen. Niksch war ein Stück weitergegangen und fotografierte den Mönch aus einer anderen Perspektive. Hollerer winkte ihn zu sich. »Jetzt ist’s gut«, sagte er, »du kannst zurückfahren.«
Louise spürte, dass Hollerer mit ihr allein sein wollte. Er hatte etwas auf dem Herzen. Sie ahnte, was es war.
Sie sahen Niksch nach, während er zu seinem Wagen ging. Dann sagte Hollerer: »Ich hab von der Sache mit dem Franzosen gehört.«
»So?«
»Das war immer meine größte Angst. Dass ich mal zu spät komm.«
»Dass Sie …« Louise brach ab. An das Mädchen hatte sie lange nicht gedacht. Sie hatte immer nur an Calambert gedacht, nicht an das tote Mädchen.
Calambert hatte das Mädchen wie ein Stück Papier in der Mitte gefaltet, damit es in den Kofferraum seines Wagens passte. Annetta. Vergewaltigt, geschlagen, stranguliert. Trotzdem hatte sie noch vier Tage gelebt.
An der Heckscheibe des Autos war ein Aufkleber angebracht gewesen – It’s a man’s world.
Sie erinnerte sich nicht mehr daran, wie sie Annetta gefunden hatte. Dass sie den Kofferraum geöffnet, ihre Fesseln gelöst, den Notarzt gerufen hatte. So stand es in ihrem Bericht, also musste es so gewesen sein. Sie hatte alles vergessen, bis auf den Anblick des sterbenden Calambert.
»Sie haben es sich scheint’s auch zu Herzen genommen«, sagte Hollerer mit einem Blick über ihr Gesicht und ihren Körper.
Sie errötete. Viereinhalb Kilo waren nicht zu verbergen. Schlafstörungen und alles andere auch nicht.
Aber sie war Hollerer dankbar, dass er sie an das Mädchen erinnert hatte.
Als Niksch in seinen Wagen stieg, gingen sie weiter. Louises Turnschuhe waren durchnässt, und die Kälte kroch ihr von den Füßen in die Beine. Sie trug einen Anorak, der gegen den eisigen Wind kaum Schutz bot. Auch Hollerer, der nur die Jacke seiner Polizeiuniform anhatte, fror sichtlich.
Sie schob die rechte Hand in die Anoraktasche. »Hoppla«, sagte sie, »was haben wir denn da?« Sie zog ein Fläschchen Jägermeister heraus.
»Sie sind mir eine«, brummte Hollerer.
»Gegen die Kälte.« Sie öffnete das Fläschchen. Auch Hollerer trank einen Schluck.
Während sie weitergingen, rief Hollerer dem Mönch mehrfach zu, er solle stehen bleiben und warten. Doch der Mönch reagierte nicht.
Schließlich folgten sie ihm den Hang hinauf. Louise begann rasch zu schwitzen, gleichzeitig fror sie. Der Wind schien immer kälter zu werden. Sie warf einen Blick auf Nikschs Streifenwagen, der schlingernd davonbrauste, dann auf Hollerer, dessen Gesicht so stark gerötet war wie in dem Sommer vor zweieinhalb Jahren, als sie sich kennengelernt hatten. Sie musste grinsen, als sie an seine Wut damals dachte. Sie könnten jemand umbringen, den Sie lieben?
Wenige Meter weiter konnte Hollerer nicht mehr. Nach Luft ringend, stützte er die Hände auf die Oberschenkel. Mit dem Kopf bedeutete er ihr, allein weiterzugehen. »Aber … aufpassen«, keuchte er. »Haben Sie eine …« Er hustete.
»… Waffe?« Sie schüttelte den Kopf.
»Irgendwas … ist … komisch«, keuchte Hollerer.
Sie sah den Hang hinauf. Sie hatten ein gutes Stück aufgeholt, der Mönch war nur noch etwa dreißig Meter entfernt. Schwerfällig arbeitete er sich mit Hilfe seines Stocks durch den Schnee nach oben. Er wirkte klein und schmal. Kein einziges Mal blickte er in ihre Richtung. Hollerer hielt diesen Kerl für gefährlich? Der Vater in der Küche war gefährlich gewesen. Calambert war gefährlich gewesen. Aber der Mönch?
In der Ferne bog Niksch auf die Landstraße ab. Von hier oben aus war die Straße andeutungsweise zu erkennen. Die Fahrbahn lag etwas höher als die Schneefelder, die sie durchschnitt. Ein schmaler Schattenstreifen, der parallel zum Horizont verlief, markierte den unteren Straßenrand.
»Hier.« Hollerer reichte ihr seine Waffe. Es war noch eine SIG SAUER, keine Walther P5. Sie überprüfte die Sicherung und steckte die Waffe hinten in den Hosenbund. Bermann hatte die SIG geliebt. Eine tolle Stanze, hatte er sie genannt. Die erste Pistole, die sie seit Calamberts Tod in den Händen hielt, war Bermanns Lieblingstyp.
Sie bedankte sich und stapfte weiter.
2
EIN PAAR MINUTEN SPÄTER hatte sie den Mönch eingeholt. Er nickte ihr zu, blieb aber nicht stehen. Sie warf Hollerer, der vierzig Meter unterhalb von ihr stand, einen entnervten Blick zu. Dann folgte sie dem Mönch. Er roch stark nach Schweiß, Körper, Fremdheit. Sie legte ihm eine Hand auf den Arm. Endlich hielt er inne. Die Kutte unter ihrer Hand war klamm vor Feuchtigkeit. Sie lächelte beruhigend. Während sie die Wunden betrachtete, lag der Blick des Mönchs auf ihr. Sie kam sich albern vor mit der Rastafari-Sonnenbrille.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!