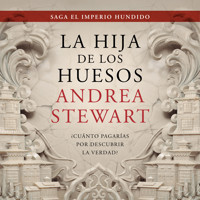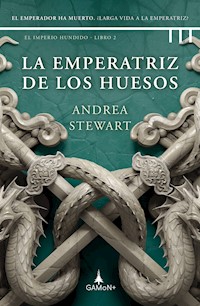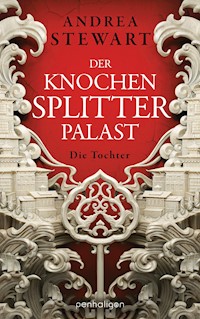
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Drowning Empire
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein böser Kaiser erweckt Monster zum Leben, um sein Reich zu knechten – und seine eigene Tochter wird ihn aufhalten ... Die große High Fantasy-Saga aus den USA!
Lin ist die Tochter des Kaisers und Erbin des Phönixreiches. Ihr tyrannischer Vater jedoch versklavt seine Untertanen und erschafft schreckliche Monster – mithilfe der geheimnisvollen Knochensplittermagie. Doch die Gabe, diese zu wirken, hat Lin durch eine Krankheit verloren, und seitdem versucht ihr Vater, sie als Thronfolgerin zu entmachten. Gefangen in einem Palast voller Geheimnisse und verschlossener Türen will Lin heimlich die Knochensplittermagie wiedererlernen – um ihren grausamen Vater und seine entsetzlichen Kreationen zu stoppen. Doch als die Revolution die Tore ihres Palastes erreicht, muss Lin entscheiden, ob sie ihr Geburtsrecht einfordert – oder ihr Volk rettet.
Der Auftakt zur fesselnden High Fantasy-Reihe, in der eine starke Frau über Sieg oder Niederlage eines Reiches entscheiden muss.
Alle Bände der Reihe:
1. Der Knochensplitterpalast – Die Tochter
2. Der Knochensplitterpalast – Der Kaiser
3. Der Knochensplitterpalast – Der Krieg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Ähnliche
Buch
Ein böser Kaiser erweckt Monster zum Leben, um sein Reich zu knechten – und seine eigene Tochter wird ihn aufhalten … Die große High-Fantasy-Saga aus den USA!
Lin ist die Tochter des Kaisers und Erbin des Phönixreiches. Ihr tyrannischer Vater jedoch versklavt seine Untertanen und erschafft schreckliche Monster – mithilfe der geheimnisvollen Knochensplittermagie. Doch die Gabe, diese zu wirken, hat Lin durch eine Krankheit verloren, und seitdem versucht ihr Vater, sie als Thronfolgerin zu entmachten. Gefangen in einem Palast voller Geheimnisse und verschlossener Türen will Lin heimlich die Knochensplittermagie wiedererlernen – um ihren grausamen Vater und seine entsetzlichen Kreationen zu stoppen. Doch als die Revolution die Tore ihres Palastes erreicht, muss Lin entscheiden, ob sie ihr Geburtsrecht einfordert – oder ihr Volk rettet.
Der Auftakt zur fesselnden High-Fantasy-Reihe, in der eine starke Frau über Sieg oder Niederlage eines Reiches entscheiden muss.
Die Autorin
Andrea Stewart ist die Tochter von Einwanderern und wuchs an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten auf. Ihre Eltern legten großen Wert auf Wissenschaft und Bildung, sodass sie ihre Kindheit mit Star Trek und alten Büchern aus der Bibliothek verbrachte. Als ihr (zugegebenermaßen ehrgeiziger) Traum, eine Drachentöterin zu werden, nicht in Erfüllung ging, wandte sie sich stattdessen dem Schreiben von Büchern zu. Heute lebt sie im sonnigen Kalifornien, wo sie nicht nur schreibt, sondern auch Katzen hütet, Vögel beobachtet und sich in jedes Abenteuer stürzt, das ihr in den Weg kommt.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Andrea Stewart
Der Knochensplitterpalast
Die Tochter
Roman
Ins Deutsche übertragen von Urban Hofstetter
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Bone Shard Daughter« bei Orbit, London, 2020.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Andrea Stewart
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Penhaligon, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.denach einer Originalvorlage von © 2020 Hachette Book Group, Inc.
Coverdesign: Lauren Panepinto
Covermotiv: Sasha Vinogradova
Kartenillustration © Charis Loke 2020
LO · Herstellung: mar
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-27038-4V001
www.blanvalet.de
Für meine Schwester Kristen, die fast alles gelesen hat, was ich jemals geschrieben habe. Ich schulde dir was.
Kapitel 1
Lin
Kaiserinsel
Vater sagte mir, ich sei kaputt.
Er drückte seine Enttäuschung zwar nicht mit Worten aus, aber ich erkannte sie in seinen zusammengekniffenen Augen, an der Art, wie er seine ohnehin hohlen Wangen einsaugte, und auch daran, wie sich sein linker Mundwinkel halb vom Bart verdeckt ein klein wenig nach unten verzog.
Er hatte mir beigebracht, die Gedanken anderer Menschen an ihren Gesichtern abzulesen. Und er wusste, dass ich wusste, was in ihm vorging. Also bedeutete es für uns beide so viel, als hätte er es laut ausgesprochen.
Die Frage hatte gelautet: »Mit wem bist du in deiner Kindheit am engsten befreundet gewesen?«
Meine Antwort: »Ich weiß es nicht.«
Ich konnte so schnell laufen, wie ein Spatz flog, und ebenso geschickt mit einem Abakus rechnen wie die besten Buchhalter des Reiches. Außerdem war ich in der Lage, innerhalb der Zeitspanne, die eine Tasse Tee zum Ziehen benötigte, sämtliche bekannten Inseln aufzuzählen. Aber ich erinnerte mich nicht an die Zeit vor der Krankheit. Manchmal glaubte ich, sie würde mir nie mehr einfallen und dass das Mädchen von damals für immer verloren war.
Vaters Stuhl knarzte, als er das Gewicht verlagerte und langsam den Atem ausstieß. Er klopfte mit einem Messingschlüssel auf die Tischplatte. »Wie kann ich dir meine Geheimnisse anvertrauen und dich zu meiner Nachfolgerin bestimmen, wenn du nicht mal weißt, wer du bist?«
Ich wusste ganz genau, wer ich war. Ich war Lin, die Tochter des Kaisers. Innerlich schrie ich diese Worte, aber sie kamen mir nicht über die Lippen. Im Gegensatz zu meinem Vater verbarg ich meine Gedanken hinter einer nichtssagenden Miene. Manchmal mochte er es, wenn ich ihm die Stirn bot, aber nicht in diesem Fall, nicht, wenn es um meine Vergangenheit ging.
Ich gab mir alle Mühe, nicht den Schlüssel anzustarren. »Stell mir noch eine Frage«, sagte ich.
Die salzige Meeresbrise, die an den Fensterläden rüttelte, roch nach Seegras und fermentiertem Fisch. Als sie mir über den Nacken strich, musste ich ein Schaudern unterdrücken. Ich hielt Vaters Blick stand und hoffte, dass er die Angst in meinen Augen nicht bemerkte und stattdessen nur meine stählerne Entschlossenheit wahrnahm. Denn es lag nicht nur der Geruch von Fischbottichen, sondern unverkennbar auch Rebellion in der Luft. Ich würde sie abwenden können, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Wenn er mich nur ließe.
Klopf.
»Na dann«, sagte Vater. Die hinter ihm aufragenden Teakholzsäulen rahmten sein verwittertes Gesicht ein, sodass er eher wie ein Unheil verkündendes Porträtbild als wie ein lebendiger Mensch aussah. »Du hast Angst vor Seeschlangen. Wieso?«
»Ich bin als Kind mal von einer gebissen worden«, erwiderte ich.
Ich hielt bewusst nicht den Atem an, während er mein Gesicht musterte. Dann merkte ich, dass ich die Finger verschränkte, und nahm die Hände wieder auseinander. Es war, als wäre ich ein Berg und er schlüge das Gestein um die Pfahlwurzeln des Wolkenwacholders weg, um meinen weißen kalkhaltigen Kern zu finden.
Und schließlich entdeckte er ihn.
»Lüg mich nicht an, Mädchen«, knurrte er. »Hör auf zu raten. Du magst zwar mein eigen Fleisch und Blut sein, aber das macht dich noch nicht zwangsläufig zu meiner Erbin. Schließlich kann ich auch meinen Ziehsohn zum Thronfolger ernennen.«
Leider konnte ich mich nicht daran erinnern, ob mir dieser Mann jemals über die Haare gestrichen und einen Kuss auf die Stirn gegeben hatte. Hatte er mich geliebt, als ich noch ganz – und nicht kaputt – gewesen war? Wie gern hätte ich jemanden gehabt, den ich danach hätte fragen können, jemanden, der mir Antworten gegeben hätte. »Vergib mir.« Ich beugte den Kopf. Dabei fielen mir meine schwarzen Haare wie ein Vorhang über die Augen, und ich warf einen verstohlenen Blick auf den Schlüssel.
Die meisten Türen im Palast waren zugesperrt. Vater hinkte von einem Raum zum nächsten und wirkte mit seiner Knochensplittermagie Wunder. Und diese Magie brauchte ich, wenn ich regieren wollte. Bislang hatte ich sechs Schlüssel errungen. Der Ziehsohn meines Vaters, Bayan, besaß sieben. Manchmal fühlte sich mein ganzes Leben wie eine einzige Prüfung an.
»Na schön«, sagte Vater und ließ sich auf seinen Stuhl zurücksinken. »Du darfst gehen.«
Ich erhob mich, doch dann zögerte ich. »Wann wirst du mich in deiner Knochenmagie unterweisen?« Ohne seine Antwort abzuwarten, fuhr ich fort: »Du sagst zwar, dass du Bayan zum Thronfolger bestimmen kannst, aber bisher hast du es noch nicht getan. Ich bin also nach wie vor deine Erbin, und ich muss wissen, wie du die Konstrukte kontrollierst. Ich bin dreiundzwanzig, und du …« Ich hielt inne, da ich nicht wusste, wie alt er war. Er hatte Altersflecken auf den Handrücken, und seine Haare waren stahlgrau. Ich hatte keine Ahnung, wie lange er noch zu leben haben mochte. Doch ich stellte mir vor, wie er sterben und mich unwissend zurücklassen würde. Unfähig, das Kaiserreich vor den Alanga zu beschützen, und ohne Erinnerungen an einen Vater, dem etwas an mir lag.
Er hustete gedämpft in seinen Ärmel. Sein Blick zuckte zu dem Schlüssel hinüber, und seine Stimme wurde weich. »Sobald du wieder eine vollständige Person bist.«
Ich verstand ihn nicht, erkannte aber die Schwachstelle. »Bitte«, sagte ich. »Was ist, wenn ich nie wieder vollständig sein werde?«
Er sah mich an, und sein trauriger Blick nagte wie ein Zahn an meinem Herzen. Meine Erinnerungen reichten fünf Jahre zurück. Davor war alles ein einziger Nebel. Ich hatte etwas Kostbares verloren. Wenn ich doch bloß wüsste, was es gewesen war. »Vater, ich …«
Es klopfte an der Tür, und er wurde wieder so kalt wie ein Stein.
Ich verfluchte Bayan, als er unaufgefordert mit hängenden Schultern hereingeschlichen kam. Wäre er jemand anders gewesen, ich hätte seinen Gang für zögerlich gehalten, tatsächlich wirkte er jedoch wie eine jagende Katze. Er trug eine Lederschürze über seiner Tunika, seine Hände waren blutverschmiert. »Ich bin mit dem Umbau fertig«, sagte er. »Ihr wolltet, dass ich sofort zu Euch komme, nachdem ich alles erledigt hätte.«
Hinter Bayan trippelte ein Konstrukt herein. Seine kleinen Hufe klickten auf dem Boden. Abgesehen von seinem geringelten Affenschwanz und den langen Fangzähnen sah es wie ein Reh aus. Aus den Schultern ragten ihm zwei kleine Flügel. Das Fell um sie herum war blutig.
Vater drehte sich auf dem Stuhl herum und legte dem Geschöpf eine Hand auf den Rücken. Es sah ihn mit großen feuchten Augen an.
»Schlampig«, urteilte Vater. »Wie viele Splitter hast du verwendet, um ihm den Folgebefehl einzupflanzen?«
»Zwei«, antwortete Bayan. »Einen, um es dazu zu bringen, dass es mir folgt, und einen zweiten, mit dem ich es wieder anhalte.«
»Es sollte aber nur einer sein«, sagte Vater. »Solange du es ihm nicht verbietest, folgt dir das Konstrukt überallhin. Der dazu nötige Befehl steht in dem ersten Buch, das ich dir gegeben habe.« Er hob einen der Flügel an und zog daran. Als er ihn wieder losließ, sank er langsam auf die Flanke des Wesens zurück. »Deine Konstruktion ist allerdings exzellent.«
Bayan sah zur Seite, und ich schaute ihm in die Augen. Keiner von uns beiden wollte den Blick abwenden. Das war ein ständiger Wettkampf. Seine Augen wirkten schwärzer als meine, sein Lächeln betonte den Schwung seiner Lippen. Er war wohl hübscher, als ich es je sein würde, doch ich hielt mich für die Klügere von uns beiden, und das war schließlich das Einzige, was wirklich zählte. Anstatt seine Gefühle zu verbergen, trug Bayan seine Verachtung für mich so deutlich vor sich her, wie ein Kind seine Lieblingsmuschel herumzeigen würde.
»Versuch es noch einmal mit einem neuen Konstrukt«, sagte Vater.
Bayan schlug die Augen nieder. Sieh mal an, dieses kleine Kräftemessen hatte ich also gewonnen.
Vater griff in die Kreatur hinein. Ich hielt den Atem an. Das hatte ich ihn erst zweimal tun sehen. Zumindest erinnerte ich mich nur an zwei Male. Das Wesen blinzelte lediglich ruhig, während Vaters Faust bis zum Handgelenk in ihm verschwand. Dann zog er die Hand wieder heraus, und das Konstrukt erstarrte, als wäre es zu einer Statue geworden.
Vater hielt zwei kleine Knochensplitter. An seinen Fingern klebte kein Blut. Er ließ die Knochen in Bayans Hand fallen. »Geht jetzt, beide.«
Ich war schneller an der Tür als Bayan. Vermutlich erhoffte er sich mehr als nur harsche Worte. Ich dagegen war an Vaters Kritik gewöhnt und hatte außerdem noch etwas vor. Draußen im Korridor hielt ich Bayan die Tür auf, damit er sie nicht mit seinen blutigen Händen anfassen musste. Vater achtete sehr auf Sauberkeit.
Während Bayan an mir vorüberging, sah er mich an. Der Luftzug, den er erzeugte, roch nach Kupfer und Weihrauch. Er war nur der Sohn eines kleinen Inselgouverneurs und konnte sich glücklich schätzen, dass Vater ihn überhaupt entdeckt und zu sich genommen hatte. Bayan hatte die Krankheit mitgebracht, irgendein exotisches Leiden, das im Zentrum des Reiches unbekannt war. Man hatte mir gesagt, ich sei kurz nach seiner Ankunft daran erkrankt und nicht lange nach ihm wieder genesen. Aber Bayan hatte nicht so viele Erinnerungen verloren wie ich und einen Teil seines Gedächtnisses auch schon wiedergefunden.
Sobald er um die Ecke gebogen war, wirbelte ich herum und rannte zum Ende des Korridors. Als ich die Fensterläden entriegelte, konnte ich gerade noch verhindern, dass sie an die Wand krachten. Die Ziegeldächer sahen wie Berghänge aus. Ich trat hinaus und schloss das Fenster hinter mir.
Vor mir breitete sich die Welt aus. Vom Dach aus konnte ich die Stadt und den Hafen überblicken. Ich sah sogar die Boote, die auf dem Meer nach Kalmaren fischten. Ihre Laternen leuchteten in der Ferne wie erdgebundene Sterne. Der Wind zupfte an meiner Tunika, wehte unter den Stoff und biss mir in die Haut.
Mittlerweile würde das Dienerkonstrukt das Reh entsorgt haben. Ich rannte halb, halb schlitterte ich die Dachschräge hinunter auf die Seite des Palastes zu, auf der mein Vater sein Schlafgemach hatte. Seine Kette mit den Schlüsseln und die Wächterkonstrukte brachte er niemals in den Befragungsraum mit. Ich hatte die kleinen Hinweise in seinem Gesicht erkannt. Er mochte mich zwar anblaffen und auch mit mir schimpfen, aber es machte ihm Angst, mit mir allein zu sein.
Unter meinen Füßen knackten die Ziegel. Auf dem Wehrgang der Palastmauer lauerten Schatten – noch mehr Konstrukte. Ihre Befehle waren simpel. Haltet nach Eindringlingen Ausschau. Schlagt Alarm, wenn ihr welche seht. Aber keiner von ihnen achtete auf mich. Ich sollte zwar nicht hier sein, aber ein Eindringling war ich nicht.
Das Bürokratiekonstrukt würde ihm nun die Berichte vorlegen. Vor ein paar Stunden hatte ich dabei zugesehen, wie es sie ordnete. Seine haarigen Lippen hatten sich über den Zähnen bewegt, während es sie leise las. Es waren eine ganze Menge: Aufgrund von Gefechten kam es zu Lieferengpässen; die Ioph Carn stahlen und schmuggelten Geistgestein; Bürger drückten sich vor ihrer Pflicht gegenüber dem Reich.
Ich schwang mich auf den Balkon meines Vaters. Die Tür zu seinem Gemach stand einen Spaltbreit offen. Normalerweise war es leer, heute aber nicht. Von drinnen ertönte ein Knurren. Ich erstarrte. Eine schwarze Schnauze schob sich in den Spalt und öffnete die Tür etwas weiter. Gelbe Augen starrten mich an, die Pinselohren darüber drehten sich nach hinten. Klauen kratzten über den Holzboden, während die Kreatur auf mich zuschritt. Bing Tai, eines der ältesten Konstrukte meines Vaters. Seine Hängebacken waren grau gesprenkelt, aber er hatte noch all seine Zähne. Die Fänge waren so lang wie meine Daumen.
Er fletschte die Lefzen und stellte die Nackenhaare auf. Bing Tai war ein Geschöpf wie aus einem Albtraum, eine Mischung aus mehreren großen Raubtieren, mit einem zotteligen schwarzen Fell, das mit der Dunkelheit zu verschmelzen schien. Er machte einen weiteren Schritt auf mich zu.
Womöglich war Bayan gar nicht der Dumme, sondern ich. Vielleicht würde Vater mich, nachdem er seinen Tee ausgetrunken hatte, in blutige Fetzen gerissen auf seinem Balkon vorfinden. Bis zum Boden war es zu weit, und ich war nicht groß genug, um zur Regenrinne hinaufzugreifen. Mein einziger Ausweg führte durch Vaters Gemächer in den Korridor. »Bin Tai«, sagte ich ruhiger, als ich mich fühlte. »Ich bin’s, Lin.«
Ich konnte fast spüren, wie im Kopf des Konstrukts seine Befehle miteinander rangen. Erstens: Bewache meine Gemächer. Zweitens: Beschütze meine Familie. Welcher der beiden würde die Oberhand gewinnen? Eigentlich hätte ich auf das zweite Kommando gewettet, aber im Augenblick war ich mir nicht mehr so sicher.
Ich wich lieber nicht zurück und versuchte, mir meine Angst nicht anmerken zu lassen. Schließlich hielt ich Bing Tai eine Hand vor die Schnauze. Er konnte mich zwar sehen und hören, aber vielleicht musste er mich auch beschnuppern.
Er könnte sich natürlich auch dazu entscheiden, von mir zu kosten, aber darüber wollte ich gar nicht nachdenken.
Seine feuchtkalte Schnauze stieß an meine Finger, und aus seinem Brustkorb drang ein tiefes Knurren. Ich glich Bayan überhaupt nicht, der mit den Konstrukten raufte, als wären sie seine Brüder. Im Gegensatz zu ihm konnte ich nicht vergessen, was sie waren. Es schnürte mir die Kehle zusammen, bis ich kaum noch Luft bekam und mir die Brust schmerzhaft eng wurde.
Endlich setzte sich Bing Tai auf die Hinterläufe, stellte die Ohren auf und schloss das Maul. »Guter Bing Tai«, sagte ich mit zittriger Stimme. Ich musste mich beeilen.
Ein Gefühl von tiefer Traurigkeit lastete auf dem Raum, dick wie die Staubschicht auf der Garderobe meiner Mutter. Ihr Schmuck lag unberührt auf der Kommode. Neben dem Bett warteten immer noch ihre Pantoffeln auf sie. Was mich allerdings noch mehr bedrückte als die Fragen meines Vaters und dass ich nicht wusste, ob er mich als Kind geliebt hatte oder nicht, war, dass ich mich nicht an meine Mutter erinnern konnte.
Ich hatte die noch verbliebenen Diener darüber flüstern hören, dass er an dem Tag, als sie starb, alle ihre Porträts verbrannt und ihre Kammerzofen mit dem Schwert getötet habe. Eifersüchtig hütete er ihr Andenken, als wäre er der Einzige, der sie im Gedächtnis behalten durfte.
Konzentrier dich.
Ich wusste nicht, wo er die nachgemachten Schlüssel aufbewahrte, die er Bayan und mir aushändigte. Er zog sie immer aus seiner Schärpentasche, und ich wagte es nicht, sie von dort wegzunehmen. Doch nun lag die originale Schlüsselkette vor mir auf dem Bett. So viele Türen. So viele Schlüssel. Ich wusste nicht, welcher zu welcher Tür gehörte, und so wählte ich willkürlich irgendeinen aus – einen goldenen Schlüssel mit einem Jadestück im Kopf – und steckte ihn ein.
Ich trat in den Korridor hinaus und klemmte ein dünnes Holzstück in die Tür, damit sie nicht zufiel. Inzwischen würde der Tee ziehen, während Vater die Berichte durchlas und Fragen stellte. Ich hoffte, dass er damit noch eine Zeitlang beschäftigt sein würde.
Die Sohlen meiner Pantoffeln wetzten über die Dielenbretter, während ich rannte. Die großen Korridore des Palastes waren leer, an den rotgestrichenen Deckenbalken flackerten Lampen. Im Eingangsbereich ragten vom Boden bis zur Decke Teakholzsäulen auf. Im ersten Stock hing ein verblichenes Wandgemälde. Ich stürmte die Treppe zur Palasttür hinunter und nahm dabei immer zwei Stufen auf einmal. Jeder Schritt fühlte sich wie ein kleiner Verrat an.
Ein Teil meines Verstandes sagte mir, ich hätte lieber warten und weiterhin gehorsam versuchen sollen, die Fragen meines Vaters zu beantworten und meine Erinnerungen wiederzuerlangen. Doch ein anderer, klügerer Teil von mir ignorierte meine Schuldgefühle und konfrontierte mich schonungslos mit der Wahrheit: Ich würde niemals seinen Vorstellungen entsprechen, wenn ich mir nicht nahm, was ich wollte. Da ich mich nicht erinnerte, gleichgültig, wie sehr ich es versuchte, ließ mir Vater gar keine andere Wahl, als ihm auf meine eigene Weise zu zeigen, dass ich würdig war.
Ich schlüpfte durch die Palasttür in den stillen Hof hinaus. Das Eingangstor war zwar verschlossen, aber ich war klein und stark, und wenn Vater mir seine Magie nicht beibringen wollte … Nun, während er sich mit Bayan in einem geheimen Raum einsperrte, hatte ich die Zeit dazu genutzt, andere Dinge zu lernen. Zum Beispiel, wie man klettert.
Die Wand war zwar glatt, aber nicht schwer zu erklimmen, da an verschiedenen Stellen der Putz abgeplatzt war und die darunter liegenden Mauersteine entblößt hatte. Das affenartige Konstrukt auf der Mauerkrone warf mir nur einen kurzen Blick zu, bevor es die glasigen Augen wieder auf die Stadt richtete.
Als ich auf der anderen Seite den Boden berührte, wurde ich ganz aufgeregt. Ich war zwar bereits in der Stadt gewesen – zumindest ging ich davon aus –, aber jetzt fühlte es sich wie das erste Mal für mich an. In den Straßen stank es nach Fisch, heißem Öl und Essensresten. Die Steine unter meinen Pantoffeln waren dunkel und rutschig vom Waschwasser. Töpfe klapperten, der Wind trug gedämpftes Stimmengewirr an meine Ohren. Die hölzernen Fensterläden der ersten beiden Geschäfte, zu denen ich gelangte, waren geschlossen.
War ich etwa zu spät? Ich hatte die Fassade der Schmiede vom Palast aus gesehen. So war ich überhaupt erst auf die Idee zu diesem Ausflug gekommen. Mit angehaltenem Atem rannte ich die schmale Gasse entlang.
Der Schmied befand sich zwar noch dort, hatte aber bereits einen Beutel über die Schulter geschlungen und zog gerade die Tür zu.
»Warte bitte«, sagte ich. »Ich brauche noch etwas.«
»Wir haben schon geschlossen«, gab er verärgert zurück. »Komm morgen wieder.«
Ich kämpfte gegen die Verzweiflung an. »Ich zahle dir den doppelten Preis, wenn du noch heute Abend damit anfängst. Es geht nur um einen einzigen Nachschlüssel.«
Er ließ den Blick über meine bestickte Seidentunika gleiten und dachte mit mahlenden Kiefern darüber nach, ob er mir einen falschen Preis nennen sollte. Doch dann seufzte er bloß. »Zwei Silberstücke. Normalerweise berechne ich eines.« Er war ein anständiger Mann.
Erleichtert kramte ich die Münzen aus meiner Schärpentasche und legte sie ihm auf die schwielige Handfläche. »Hier. Ich brauche ihn aber ganz schnell.«
Das hätte ich nicht sagen sollen. Ein verärgerter Ausdruck huschte über sein Gesicht. Dennoch machte er die Tür wieder auf und ließ mich ins Ladeninnere ein. Er war wie ein Eisenbarren gebaut – kantig und schwer. Sein breiter Rücken schien den halben Raum auszufüllen. An den Wänden und von der Decke hingen Metallwerkzeuge. Er nahm seine Zunderbüchse und zündete die Lampen an. Dann wandte er sich zu mir um. »Vor morgen früh schaffe ich es nicht.«
»Musst du den Originalschlüssel behalten?«
Er schüttelte den Kopf. »Von dem kann ich heute Abend noch einen Abdruck machen. Der Zweitschlüssel wird morgen fertig sein.«
Wieso geriet ich bloß immer wieder in Situationen, in denen ich den Mut verlieren und es mir anders überlegen konnte? Ich zwang mich dazu, Vaters Schlüssel in die Hand des Schmieds fallen zu lassen. Der Mann drehte sich damit zu einem Steintrog um und holte einen Lehmklumpen heraus. Als er den Schlüssel hineindrückte, erstarrte er plötzlich.
Ohne nachzudenken, trat ich auf ihn zu, um ihm den Schlüssel wieder abzunehmen. Sobald ich dichter herangekommen war, erkannte ich, was seinen Blick angezogen hatte. Am unteren Ende des Schlüsselkopfes, gleich über dem Halm, war ein kleiner Phönix ins Metall eingeprägt.
Der Schmied drehte sich zu mir um, sein Gesicht war so rund und blass wie der Mond. »Wer bist du? Was hast du mit einem Schlüssel des Kaisers vor?«
Ich hätte ihm den Schlüssel entreißen und wegrennen sollen. Ich war flinker als er und hätte damit verschwinden können, bevor er den nächsten Atemzug tat. Dann hätte er nichts mehr vorzuweisen gehabt außer einer Geschichte, die ihm niemand geglaubt hätte.
Doch wenn ich das tat, stünde ich ohne Nachschlüssel da und wüsste immer noch nicht mehr. Ich wäre wieder genau dort, wo ich den Tag begonnen hatte: Mein Gedächtnis bliebe in Nebel gehüllt, und die Antworten, die ich meinem Vater zu geben hätte, würden immer ungenügend bleiben. Immer außer Reichweite. Immer kaputt. Aber dieser Mann – er war ein guter Mann. Und Vater hatte mir beigebracht, was man zu guten Männern sagen musste. »Hast du Kinder?«, fragte ich vorsichtig.
In sein Gesicht kehrte etwas Farbe zurück. »Zwei.« Seine Augenbrauen zogen sich zusammen, als überlegte er, ob es eine gute Idee gewesen war, darauf zu antworten.
»Ich bin Lin«, offenbarte ich mich ihm. »Die Erbin des Kaisers. Seit dem Tod meiner Mutter hat er sich verändert. Er bleibt für sich, verfügt nur noch über wenige Diener und trifft sich nicht mehr mit den Inselgouverneuren. Eine Rebellion braut sich zusammen. Die Splitterlosen haben bereits Khalute eingenommen. Sie wollen ihren Einflussbereich ausdehnen. Und dann gibt es da noch die Alanga. So mancher scheint nicht zu glauben, dass sie wiederkommen, aber tatsächlich verhindert meine Familie ihre Rückkehr. Möchtest du, dass Soldaten durch die Straßen marschieren? Möchtest du, dass sie den Krieg zu uns tragen?« Er wich nicht zurück, als ich ihn sanft an der Schulter berührte. »Zu deinen Kindern?«
Unwillkürlich berührte er die Narbe, die er wie jeder Bürger hinter dem rechten Ohr trug. Es war die Stelle, an der die Knochensplitter für die Vorratskammer des Kaisers entnommen worden waren. »Treibt mein Splitter ein Konstrukt an?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte ich. Da ich kaum etwas wusste, gab ich immer dieselbe Litanei von mir. »Aber wenn ich in die Vorratskammer meines Vaters gelange, werde ich nach ihm suchen und ihn wenn möglich zu dir zurückbringen. Ich kann dir aber nichts versprechen. Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich werde es versuchen.«
Er leckte sich über die Lippen. »Meine Kinder?«
»Ich werde es versuchen.« Mehr konnte ich dazu nicht sagen. Keiner war von den Zehntfeiern der Inseln ausgenommen.
Sein Gesicht sah aus, als glühte es. »Ich werde es tun.«
Vater würde ungefähr in diesem Augenblick die Berichte beiseitelegen und die Teetasse nehmen. Dann würde er daraus trinken und durch das Fenster die Lichter der Stadt unter ihm betrachten. Schweiß sammelte sich zwischen meinen Schulterblättern. Ich musste den Schlüssel zurückbringen, bevor Vater sein Fehlen bemerkte.
Wie durch einen Nebelschleier sah ich zu, wie der Schmied den Gussabdruck machte. Nachdem er mir den Schlüssel endlich zurückgereicht hatte, lief ich damit zur Tür.
»Lin«, sagte er.
Ich blieb stehen.
»Ich heiße Numeen. Mein Ritual hat 1508 stattgefunden. Wir brauchen einen Kaiser, der sich um uns kümmert.«
Da ich nicht wusste, was ich dazu sagen sollte, rannte ich einfach los. Zur Tür hinaus und die Gasse entlang, bis zu der Stelle, an der ich über die Mauer geklettert war. Mittlerweile würde Vater die immer noch warme Tasse an die Lippen führen und den letzten Schluck trinken. Ein Stein lockerte sich unter meinen Fingerspitzen. Ich ließ ihn fallen und biss die Zähne zusammen, als er krachend auf dem Boden aufschlug.
Nun würde er die Tasse abstellen und die Stadt betrachten. Wie lange blickte er auf die Stadt hinaus? Für den Abstieg brauchte ich weniger lange als für den Aufstieg. Ich konnte die Stadt nicht mehr riechen, nur noch meinen eigenen Atem. Ich raste an den äußeren Gebäuden vorbei – am Dienstbodenquartier, an der Halle des Ewigen Friedens, der Halle der Irdischen Weisheit und der Mauer des Palastgartens. Alles war kalt, dunkel und leer.
Ich betrat den Palast durch den Dienstboteneingang und rannte, erneut zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf. Der enge Gang mündete in den Hauptkorridor, der um den ersten Stock des Palastes herumführte. Die Gemächer meines Vaters befanden sich dem Dienstboteneingang fast genau gegenüber. Wieso waren meine Beine nicht länger und ich nicht klüger?
Während ich rannte, knarzten die Dielen unter meinen Füßen. Das Geräusch machte mich nervös. Schließlich erreichte ich die Gemächer meines Vaters und trat rasch ein. Bing Tai lag wie eine alte Katze auf dem Läufer vor dem Fußende des Bettes ausgestreckt. Ein muffiger Geruch stieg von ihm auf, der mich an ein Bärenkonstrukt in einem mottenverseuchten Kleiderschrank denken ließ.
Ich brauchte drei Versuche, um den Schlüssel wieder an der Kette zu befestigen. Meine Finger fühlten sich wie glitschige Aale an.
Beim Hinausgehen bückte ich mich, um den Türkeil aufzuheben. Dabei blinzelte ich, immer noch ganz außer Atem, gegen das grelle Flurlicht an. Morgen würde ich irgendwie in die Stadt zurückkehren und den neuen Schlüssel abholen müssen. Doch da nun der Türkeil in meiner Schärpentasche verstaut war, hatte ich fürs Erste alles erledigt. Ich seufzte tief.
»Lin.«
Bayan. Meine Arme und Beine fühlten sich an, als wären sie aus Stein. Was hatte er gesehen? Ich drehte mich zu ihm um. Er runzelte die Stirn und hielt die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ich versuchte, meinen Herzschlag zu beruhigen, und bemühte mich um einen gleichmütigen Gesichtsausdruck.
»Was tust du vor den kaiserlichen Gemächern?«
Kapitel 2
Jovis
Hirschkopfinsel
Hoffentlich war das einer meiner weniger schweren Fehler. Ich zog am Jackensaum. Die Ärmel waren zu kurz, die Taille zu weit und die Schultern ein klein wenig zu breit geschnitten. Ich schnupperte am Kragen. Ein Schwall des nach Moschus und Sternanis riechenden Parfüms stieg mir in die Nase und brachte mich zum Husten. »Wenn du damit eine Frau anziehen möchtest, solltest du ein bisschen weniger auflegen«, sagte ich. Es war ein guter Rat, aber der Soldat zu meinen Füßen antwortete nicht.
Führte man ein Selbstgespräch, wenn man sich mit einem Bewusstlosen unterhielt?
Nun, die Uniform saß einigermaßen, und »einigermaßen« war das, womit ich mich in der Regel zufriedengeben musste. Ich hatte zwei Standardkisten voller Geistgestein auf meinem Boot. Genug, um meine Schulden zu begleichen, drei Monate lang gut zu essen und mein Boot von dem einen Ende des Phönixreiches zum anderen zu verfrachten. Doch mit »einigermaßen« würde ich niemals bekommen, was ich wirklich brauchte. An den Docks hatte ich ein Gerücht über eine Frau aufgeschnappt, die unter ähnlichen Umständen wie meine Emahla verschwunden war, und ich würde mir für den Rest meines Lebens Vorwürfe machen, wenn ich dem nicht auf den Grund ging.
Ich trat aus der Gasse und widerstand dem Drang, erneut am Jackensaum zu ziehen. Im Vorübergehen nickte ich einer Soldatin zu. Als sie mein Nicken erwiderte und sich abwandte, stieß ich den Atem aus. Ich hatte vor meiner Ankunft nicht den jährlichen Zehntfeierkalender überprüft, und da mir das Glück selten hold war, fand die Zeremonie natürlich gerade hier statt.
Auf der Hirschkopfinsel wimmelte es von kaiserlichen Soldaten. Und mittendrin war ich – ein Händler ohne Reichskontrakt, der schon ein paarmal mit ihnen aneinandergeraten war. Während ich mir einen Weg durch die Straßen bahnte, hielt ich einen der Ärmel zwischen den Fingern fest, um den Hasen an meinem Handgelenk zu verbergen. Diese Tätowierung hatte ich mir nach dem Bestehen der Navigationsprüfung nicht aus Stolz, sondern aus praktischen Erwägungen stechen lassen. Wie hätte man mich sonst identifizieren sollen, wenn meine aufgedunsene Leiche an der Küste angespült wurde? Doch da ich nun ein Schmuggler war, konnte mir der Hase gefährlich werden. Ebenso wie mein Gesicht. Sie hatten auf dem Steckbrief mein Kinn nicht richtig getroffen, und meine Augen standen in Wirklichkeit weiter auseinander. Außerdem trug ich meine Locken inzwischen deutlich kürzer. Dennoch sah mir die Zeichnung ähnlich. Ich hatte ein paar Waisenkinder aus der Gosse dafür bezahlt, dass sie die Plakate abrissen, doch fünf Tage danach hatte ich beobachtet, wie irgend so ein verdammtes Konstrukt sie überall wieder aufhängte.
Leider gehörte zur kaiserlichen Uniform kein Hut.
Ich hätte mich mit meinem Geistgestein aus dem Staub machen sollen, doch Emahla war wie eine straff gespannte Saite in meinem Herzen, an der das Schicksal immer wieder zupfte. Also setzte ich einen Fuß vor den anderen und bemühte mich, so wenig wie möglich aufzufallen. Der Mann an den Docks hatte gesagt, dass die junge Frau erst vor Kurzem verschwunden sei. Also war die Spur noch frisch. Der Soldat hatte mich zwar nicht gesehen, bevor ich ihm eins überbriet, aber er würde den Flicken erkennen, den er auf den linken Ellbogen seiner Uniformjacke genäht hatte.
Durch Gebäudelücken und zum Trocknen aufgehängte Wäschestücke fiel das Sonnenlicht in die immer enger werdende Straße. »Trödel nicht so herum!«, rief jemand in einem der Häuser. »Wie lange brauchst du denn, um ein Paar Schuhe anzuziehen?« Da ich nicht weit vom Ozean entfernt war, roch die Luft nach wie vor nach Seegras. Dazu duftete es nach garendem Fleisch und Bratöl. Sicher machten sie die Kinder gerade für die Feierlichkeiten fertig und bereiteten das Festessen vor, das sie ihnen nach ihrer Rückkehr servieren wollten. Gutes Essen konnte die Wunden an Leib und Seele zwar nicht heilen, aber wenigstens die Schmerzen lindern. Am Tag meiner Schädelbohrung hatte mir meine Mutter ein Schlemmermahl aus gebratener Ente mit knuspriger Kruste, gegrilltem Gemüse, gewürztem Duftreis und einem Fisch in einer köchelnden Sauce vorgesetzt. Bevor ich etwas davon essen konnte, hatte ich mir erst die Tränen abwischen müssen.
Doch das war schon lange her, und die Narbe hinter mei-nem rechten Ohr war längst verheilt. Ich duckte mich unter einem niedrig hängenden feuchten Hemd durch und entdeckte die Schänke, die mir der Mann an den Docks beschrieben hatte.
Die Tür schabte knarrend über den Holzboden, als ich sie aufschob. Zu so früher Stunde hätte das Lokal eigentlich noch leer sein müssen, doch als ich durch die von der Decke hängenden Dörrfische lugte, sah ich die kaiserlichen Wachleute in staubigen Ecken zusammensitzen. Ich ging mit gesenktem Kopf dicht an der Wand entlang in den hinteren Bereich des Raumes. Dabei verbarg ich das Handgelenk hinter meinem Oberschenkel. Wäre ich ein besserer Planer, ich hätte die Tätowierung einbandagiert. Nun ja. Mein Gesicht war ohnehin das größere Problem, und das konnte ich nicht bandagieren.
Hinter der Theke stand eine Frau. Sie wandte mir ihren breiten Rücken zu. Aus dem Tuch, das sie sich um den Kopf gebunden hatte, hingen ihr ein paar lose Strähnen in den Nacken. Sie beugte sich über ein hölzernes Schneidebrett und faltete mit flinken Fingern Teigtaschen.
»Tante«, sprach ich sie respektvoll an.
Sie drehte sich nicht um. »Nenn mich nicht so«, sagte sie. »Ich bin nicht alt genug, um die Tante eines erwachsenen Mannes zu sein.« Seufzend wischte sie ihre mehlbestäubten Hände an der Schürze ab. »Was kann ich dir bringen?«
»Ich bin gekommen, um etwas mit dir zu bereden«, erwiderte ich.
Daraufhin wandte sie sich um und sah meine Uniform an. Mein Gesicht schien sie gar nicht zu beachten. »Ich habe meinen Neffen bereits zum Platz geschickt. Inzwischen müssten ihn die Volkszähler markiert haben. Bist du deswegen hier?«
»Du heißt Danila, nicht wahr? Es geht um deine Ziehtochter.«
Sie verzog das Gesicht. »Ich habe alles zu Protokoll gegeben, was ich weiß.«
Ich wusste, dass sie mit ihrer Aussage nur Schulterzucken und verärgerte Blicke geerntet hatte, denn Emahlas Eltern war es genauso ergangen. Manchmal rissen junge Frauen eben aus, oder? Und was stellte sie sich eigentlich vor, was der Kaiser deswegen unternehmen sollte?
»Lass mich in Frieden«, sagte sie und wandte sich wieder zu ihren Teigtaschen um.
Vielleicht wachte der Soldat in der Gasse genau in diesem Augenblick mit schrecklichen Kopfschmerzen und einer Menge drängender Fragen auf. Aber … Emahla. Ihr Name schoss mir immer wieder durch den Kopf und ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Ich glitt um das Ende der Theke herum und stellte mich neben Danila vor das Holzbrett.
Ohne auf ihre Zustimmung zu warten, nahm ich Teig und etwas von der Füllung und begann, eine Tasche zu formen. Nach kurzem erstaunten Zögern machte sie ebenfalls weiter. Hinter uns wetteten zwei Soldaten auf den Ausgang ihres Kartenspiels.
»Du bist gut«, gab sie widerwillig zu. »Sehr ordentlich und schnell.«
»Meine Mutter. Sie war – sie ist – eine Köchin.« Ich schüttelte den Kopf und lächelte betrübt. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause gewesen. Fast ein ganzes Leben schien das her zu sein. »Sie macht die besten Teigtaschen der Inseln. Ich war ständig unterwegs, beim Segeln und auch, weil ich für das Navigationsexamen lernen musste. Aber ich habe ihr immer gern geholfen. Sogar nachdem ich die Prüfung bestanden hatte.«
»Wenn du die Navigationsprüfung geschafft hast, wieso bist du dann Soldat geworden?«
Ich wägte meine Möglichkeiten ab. Ich war ein guter Lügner – sogar der beste. Das war der einzige Grund, wieso ich immer noch einen Kopf auf den Schultern trug. Andererseits erinnerte mich diese schroffe, aber gutherzige Frau an meine Mutter, und sie musste mir dabei helfen, meine Gemahlin zu finden. »Ich bin keiner.« Ich schob meinen Ärmel so weit hinauf, dass sie den Hasen sehen konnte.
Danila schaute erst auf die Tätowierung und mir dann ins Gesicht. Ihre zu Schlitzen verengten Augen wurden groß. »Jovis«, flüsterte sie. »Du bist dieser Schmuggler.«
»Mir wäre ›erfolgreichster Schmuggler der letzten hundert Jahre‹ zwar lieber, aber ich gebe mich mit ›dieser Schmuggler‹ auch zufrieden.«
Sie schnaubte. »Das ist doch immer alles relativ. Deine Mutter würde dich vermutlich nicht als erfolgreich bezeichnen.«
»Damit hast du wahrscheinlich recht«, sagte ich leichthin. Tatsächlich wäre sie ziemlich verletzt, wenn sie herausfände, wie tief ich gesunken war. Danila entspannte sich. Ihre Schulter berührte nun meine, und ihr Gesichtsausdruck wurde weicher. Sie würde mich nicht verraten. Dafür war sie nicht der Typ. »Bitte erzähl mir von deiner Ziehtochter. Wie ist sie verschwunden?«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, erwiderte sie. »Von einem Tag auf den anderen war sie plötzlich fort. Auf ihrer Tagesdecke lagen neunzehn Silbermünzen – als wäre ihr Leben nicht mehr als einen Silberphönix wert. Das ist vorgestern gewesen. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass sie gleich wieder zurückkommt.«
Das würde sie nicht. Ich wusste es, weil ich selbst ein ganzes Jahr lang das Gleiche gedacht hatte. Ich konnte immer noch die neunzehn auf Emahlas Bett verteilten Silbermünzen vor mir sehen und spüren, wie heftig mein Herz schlug und mein Magen rumorte in dem Augenblick, als ich erkannte, dass sie fort war – auch wenn ich es nicht glauben konnte.
»Soshi war eine kluge junge Frau«, sagte Danila mit zitternder Stimme. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen, bevor sie auf die Wangen herabrollten. »Ihre Mutter starb bei einem Grubenunglück. Ihren Vater kannte sie nicht. Ich habe nie geheiratet und keine eigenen Kinder. Ich habe sie bei mir aufgenommen. Ich brauchte jemanden, der mir hilft.«
»War …?«, platzte es aus mir heraus. Den Rest der Frage brachte ich nicht über die Lippen.
Danila nahm ein weiteres Stück Teig in die Hand und sah mir ins Gesicht. »Ich bin zwar nicht alt genug, um dein Tantchen zu sein, aber eines weiß ich doch ganz bestimmt: Wenn das Kaiserreich irgendetwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat, ist sie bereits tot.«
Ich bin noch nie verliebt gewesen. Wir haben uns nicht als Kinder kennengelernt. Ich habe es nie gewagt, sie zu küssen. Ich bin niemals von der Kaiserinsel zurückgekehrt. Diese Lügen sagte ich mir immer und immer wieder vor. Und ich musste sie glauben, obwohl ich mich nur zu gut an ihr keckes Lächeln erinnerte, an die Art, wie sie die Augen verdrehte, wenn ich mir eine besonders alberne Geschichte ausdachte, und auch daran, wie sie nach einem langen Tag den Kopf auf meine Schulter legte und seufzte. Denn sobald ich mir vorstellte, den Rest meines Lebens ohne sie verbringen zu müssen, stieg jedes Mal Panik in meiner Brust auf und schnürte mir die Kehle zu. Ich schluckte. »Hast du nach ihr gesucht? Hast du irgendwelche Spuren gefunden?«
»Natürlich habe ich nach ihr gesucht«, antwortete sie. »Ich habe herumgefragt. Einer der Fischer sagte, sie hätten frühmorgens ein Boot in See stechen sehen. Nicht von den Docks, sondern von einer nahegelegenen Bucht aus. Es war klein, dunkel gestrichen und hatte blaue Segel. Es ist nach Osten gefahren. Mehr weiß ich nicht.«
Es war dasselbe Boot, das ich am Tag von Emahlas Verschwinden um die Insel hatte biegen sehen. Der Nebel war damals so dicht gewesen, dass ich unmöglich hatte sicher sein können, ob mich meine Augen trogen. Und sieben Jahre später schien es nun plötzlich zum Greifen nahe. Wenn ich mich beeilte, würde ich es vielleicht noch einholen.
Einer der Männer im Schankraum lachte, ein anderer stöhnte. Karten wurden auf den Tisch geworfen. Stuhlbeine schabten über den Boden, während sich die Soldaten erhoben. »Es war ein gutes Spiel.« Als sie die Tür öffneten, fiel ein warmer Sonnenstrahl auf meinen Nacken. »He, du. Kommst du mit? Der Hauptmann reißt dir den Kopf ab, wenn du dich verspätest.«
Als eine Zeitlang niemand antwortete, fiel mir wieder ein, dass ich die Jacke des Soldaten trug. Also sprach er mit mir.
Danila packte mich an dem Handgelenk mit der Tätowierung. Sowohl ihre Stimme als auch ihr Griff waren so unnachgiebig wie Baumwurzeln. »Ich habe dir einen Gefallen getan, Jovis. Jetzt musst du mir auch einen tun.«
O nein. »Gefallen? Von Gefallen war nicht die Rede.«
Während sich von hinten Schritte näherten, sprach sie einfach weiter, als hätte ich nichts gesagt. »Ich habe einen Neffen. Er lebt auf einer kleinen Insel östlich von hier. Wenn ich mich nicht irre, ist das genau die Richtung, in die du willst. Finde ihn, bevor das Ritual stattfindet, und bring ihn zu seinen Eltern zurück. Er ist ihr einziges Kind.«
»Ich bin kein Splitterloser«, zischte ich. »Ich schmuggle keine Kinder. Das ist unmoralisch und außerdem nicht profitabel.« Ich versuchte, mich aus ihrem Griff zu befreien, aber sie war stärker als ich.
»Mach es einfach.«
Dem Geräusch der Schritte nach zu urteilen befand sich hinter mir nur ein einziger Soldat. Mit dem konnte ich es aufnehmen. Ich brauchte ihm bloß ein paar Lügen aufzutischen. Doch nach all den Jahren erinnerte ich mich immer noch an das Blut, das mir aus den Haaren getropft und den Hals hinuntergelaufen war. Und an den kalten Meisel auf meiner Haut. Die Wunde brannte wie Feuer. Der Kaiser sagte, die Zehntfeier wäre nur ein geringer Preis, den wir alle für unsere Sicherheit entrichten müssten. Doch so gering fühlte sich dieser Preis gar nicht an, sobald man den eigenen Kopf beugen und die Knie in die Erde bohren musste.
Ich bin dem Leiden anderer gegenüber abgestumpft. Noch etwas, das ich mir einredete, weil ich nicht jeden retten konnte. Ich war ja nicht einmal in der Lage gewesen, meinen Bruder zu beschützen. Wenn ich zu intensiv über all das Leid der vielen Leute nachdachte, denen ich nicht helfen konnte, hatte ich das Gefühl, im Unendlichen Meer zu ertrinken. Diese Bürde konnte ich nicht tragen.
Meistens schaffte ich es, mich selbst zu belügen. Aber nicht heute. Ich stellte mir vor, wie meine Mutter mir die Hände an die Wangen legte. »Aber was ist die Wahrheit, Jovis?«
Die Wahrheit war, dass mich jemand gerettet hatte und es manchmal genügte, einem einzigen Menschen zu helfen. »Ich werde ihn holen«, sagte ich.
Was war ich nur für ein Idiot!
Danila ließ mein Handgelenk los. »Er muss noch einen Becher Wein bezahlen«, sagte sie zu dem Soldaten. »Er kommt bald nach.«
Die Schritte des Mannes entfernten sich.
»Mein Neffe heißt Alon. Er trägt ein rotes Hemd. Der Saum ist mit weißen Blumen bestickt. Seine Mutter ist Schusterin auf Phalar, die einzige auf der Insel.«
Ich klopfte mir das Mehl von den Händen. »Rotes Hemd. Blumen. Schusterin. Ich werde es mir merken.«
»Du solltest dich beeilen.«
Wäre sie nicht so offenkundig traurig gewesen, hätte ich sie angeschnauzt. Doch da sie ihre Tochter und ich meine Ehefrau verloren hatte, blieb ich freundlich. »Ich finde heraus, was mit deiner Ziehtochter passiert ist, und werde dir irgendwie darüber berichten.«
Sie wischte sich die Augen, nickte und begann – wie eine Kriegerin, die sich in die Schlacht stürzte –, erneut Teigtaschen zu falten. Anscheinend redete sie sich ein, dass es im Augenblick nichts Wichtigeres auf der Welt gab als ihre Teigwaren.
Als ich mich zum Gehen umwandte, erzitterte der Boden unter meinen Füßen. In den Regalen klirrten die Becher, Danilas Teigrolle fiel hinunter, und die getrockneten Fische schwangen an den Schnüren hin und her. Ich streckte die Hände aus, hatte jedoch keine Ahnung, woran ich mich festhalten sollte, da sich alles bewegte. Und dann wurde es mit einem Mal wieder ruhig.
»Nur ein Erdbeben«, erklärte Danila überflüssigerweise und wohl vor allem, um sich selbst zu beruhigen. »Manche sagen, dass die Geistgesteinsmine sie verursacht. Die Stollen reichen ziemlich tief hinab. Aber mach dir keine Sorgen. Das geht schon seit ein paar Monaten so.«
Redete sie sich das auch bloß ein? Erdbeben mochten zwar nichts Ungewöhnliches sein, aber ich hatte schon lange keines mehr erlebt. Ich machte einen vorsichtigen Schritt und erkannte, dass der Boden wieder fest war. »Ich sollte jetzt gehen. Mögen die Winde günstig stehen.«
»Und der Himmel wolkenlos sein«, erwiderte sie.
Dieses Kind vor der Zehntfeier verschwinden zu lassen würde nicht einfach werden. Da die Volkszähler dafür sorgten, dass jeder Achtjährige daran teilnahm, würde ich es irgendwie schaffen müssen, seinen Namen von der Liste zu streichen. Aus Erfahrung wusste ich aber, dass ich mit Volkszählern, kaiserlichen Soldaten und sogar Konstrukten des Kaisers fertigwerden konnte.
Ich strich die Uniformjacke glatt und ging auf die Tür zu. Normalerweise hätte ich vor dem Öffnen erst die Vorhänge beiseite geschoben oder zumindest nur einen Spaltbreit aufgemacht und hinausgelugt. Aber das Erdbeben hatte mich durcheinandergebracht, und außerdem hatte ich eine heiße Spur zu dem Boot, das Emahla entführt hatte. Und so fand ich mich, als ich mit großen Augen und so unsicher wie ein neugeborenes Lamm in die enge sonnendurchflutete Gasse hinaustrat, inmitten einer Phalanx aus kaiserlichen Soldaten wieder.
Kapitel 3
Jovis
Hirschkopfinsel
Wenn die Straße doch nur belebt oder laut gewesen wäre! Tatsächlich war es hier draußen aber still, und nichts rührte sich. Also richteten die zehn uniformierten Männer und Frauen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf mich. Ich spürte, wie mir der Schweiß den Rücken hinunterlief.
»Soldat«, sagte eine von ihnen, den Rangabzeichen an ihrem Kragen zufolge musste diese Frau ein Hauptmann sein. »Du bist keiner von meinen Leuten. Wer ist dein Hauptmann?«
Es ist gut, wenn man seine Lügen mit irgendetwas unterfüttern kann. »Ich gehöre zur ersten Kompanie, die an Land gegangen ist, Frau Hauptmann.«
Sie betrachtete mich mit gerunzelter Stirn und gab nicht zu erkennen, ob sie mir glaubte.
»Lindaras?«, fragte ein anderer Soldat in der Phalanx.
»Ja«, entgegnete ich in einem Tonfall, der besagte, dass das ja wohl offensichtlich war und ich den Soldaten für einen Idioten hielt, weil er sich erst vergewissern musste.
Die Offizierin musterte mein Gesicht weiterhin so eingehend, dass ich am liebsten den Kopf in die Jacke gezogen hätte. »Du solltest bei deinem Hauptmann sein. Das hier ist keine Vergnügungstour.«
»Verstanden. Es kommt nicht wieder vor.«
»Hast du zufällig noch einen anderen Soldaten hier in der Gegend gesehen? Er ist klein, stämmig und stinkt nach Sternanis.«
Wir waren einander nicht vorgestellt worden, aber ich hatte ihn natürlich gesehen, und seine Uniform und ich waren uns sehr nahe. Ich hoffte inständig, dass der Geruch nach Fisch und Seegras den immer noch in der Jacke hängenden Parfümduft überdeckte. »Nein, leider nicht. Aber du hast recht: Ich sollte bei meinem Hauptmann sein.« Damit wandte ich mich zum Gehen.
Eine Hand landete auf meiner Schulter. »Ich habe nicht gesagt, dass du wegtreten darfst«, sagte die Offizierin.
Oh. Ich wäre wirklich kein guter Soldat geworden. »Frau Hauptmann?« Ich drehte mich rasch wieder um und hoffte, dass mein ergebener Gesichtsausdruck nicht so schlecht zu mir passte wie die Uniformjacke.
Ihre Finger schlossen sich fester um meine Schulter, während sie mich erneut mit zusammengekniffenen Augen musterte. »Ich habe dich schon mal gesehen.«
»Wahrscheinlich beim Ausheben der Latrinen. Lindara mag mich nicht besonders.« Die anderen konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen, doch die Offizierin ließ sich keineswegs erheitern. In Gedanken ging ich all meine altbewährten Tricks durch. Ihr schöne Augen zu machen würde mich vermutlich den Kopf kosten. Selbstironie schien bei ihr nicht zu verfangen. Sollte ich vielleicht versuchen, ihr zu schmeicheln?
»Nein«, sagte sie. »Es ist dein Gesicht.«
Das Kaiserreich sollte verdammt sein, weil es auf das bisschen gestohlene Geistgestein so kleinlich reagierte. Und wegen der Macht, die es sowohl über die Menschen als auch über die Magie ausübte. Aber vor allem verfluchte ich es wegen seiner dämlichen Steckbriefe. »Mein Gesicht?«, fragte ich, um Zeit zu schinden. »Also, es ist …«
Wieder bebte der Boden, diesmal heftiger. Alle schauten zu den Gebäuden hinauf und streckten die Arme aus, auch wenn die Hoffnung, eventuell herabstürzende Wände mit den Händen abzuwehren, natürlich vergeblich war. Vom Dach hinter mir fiel ein Ziegel und zersprang neben meinen Füßen auf dem Pflaster. Das Beben hörte auf.
»Noch eines«, sagte einer der Soldaten. »Schon das zweite heute.« Er klang nervös. Um ehrlich zu sein, ich war auch nicht gerade begeistert davon. Manchmal ereigneten sich kleine Nachbeben, doch dieses war stärker gewesen als das erste.
Die Offizierin wandte sich wieder mir zu und sah mich mit verengten Augen an.
»Sollten wir nicht am Platz sein, Hauptmann? Die Feierlichkeiten gehen bald los.« Endlich hatte ich den richtigen Ton getroffen – Respekt und Disziplin.
Die Offizierin nickte. »Wir müssen unseren Kameraden später suchen. Jetzt ruft erstmal die Pflicht.« Sie ging die Straße hinauf und bedeutete den anderen, ihr zu folgen.
Ich sah, wie sich ein paar der Soldaten hinter das rechte Ohr griffen und die Bohrungsnarben berührten. Ob sie sich wohl genauso lebhaft an diesen Tag erinnerten wie ich? Ich schloss mich ihnen an. Schließlich musste ich auch zur Zehntfeier. Ich mochte ein Lügner sein, aber ich hielt mein Wort. Und zwar immer. Also strengte ich mich an und erklomm zusammen mit den anderen den Hügel. Die Pflastersteine, auf die ich trat, bewegten sich. Das Erdbeben hatte sie gelockert. Auf dem Gipfel des Hügels gabelte sich die Straße.
Oben angekommen drehte der Mann vor mir den Kopf, um das Panorama zu betrachten. Er erbleichte und riss die Augen auf. »Hauptmann!«
Neugierig, was er wohl sehen mochte, drehte ich mich ebenfalls schnell um.
Links und rechts von der Straße, die sich hinter uns den Hügel hinabwand, ragten wie zwei Zahnreihen dicht an dicht Gebäude auf. Staub glitzerte in der Luft. Doch das war es nicht, was den Soldaten so gefangen hielt. Unten am Meer hatte sich etwas verändert. Der Umriss des Hafens war breiter geworden. Die Docks lagen in merkwürdigen Winkeln zueinander. In Küstennähe schauten dunkle Gebilde aus dem Wasser.
Das waren die Spitzen von Büschen. Der Hafen war versunken.
Die Offizierin nahm das alles mit zusammengepressten Lippen in sich auf. »Wir müssen zum Platz«, sagte sie. »Dort geben wir den anderen beiden Phalangen Bescheid. Bewahrt Ruhe, und bleibt in Reih und Glied. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir halten an der Marschordnung fest.«
Es sprach für ihre Führungsqualitäten, dass die Soldaten sich ihr anschlossen.
Ich sah zu den Docks hinter uns zurück. Ein Versprechen zu halten war ja schön und gut, aber ich hatte auch Emahla versprochen, dass ich sie finden würde – und tot würde ich das kaum schaffen. Ich dachte daran, wie Danila Teigtaschen für das Festmahl ihres Neffen gefaltet hatte. Nach meinem Ritual hatte meine sonst so zurückhaltende Mutter mich fest umarmt und auf den schweißnassen Scheitel geküsst. »Ich wünschte, ich hätte dich beschützen können«, hatte sie gesagt. Ihr war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass ich verschont worden war. Es war mir damals ja selbst kaum bewusst gewesen.
Zum Platz war es nicht mehr weit, und ich war ein flinker Läufer. Trotz meiner Angst folgte ich den Soldaten. Es war ausgesprochen ruhig geworden. Keine Stimmen, kein Vogelgezwitscher, nur unsere Füße, die über die Pflastersteine scharrten. Nach einer Biegung und einem weiteren Aufstieg wurde die Stille von Gemurmel durchbrochen. Vor uns mündete die Straße auf den Stadtplatz.
Die Hirschkopfinsel war nicht die größte der bekannten Inseln, aber eine der wohlhabendsten. Ich hatte Einheimische prahlen hören, wie würzig ihre Fischsuppe sei und wie groß ihre Märkte. Einer hatte sogar behauptet, der Hirschkopf läge höher im Wasser als die anderen Inseln. Mit dem Geistgestein aus ihrer Mine belieferten sie einen Großteil des Imperiums, und der daraus resultierende Reichtum zeigte sich auch auf dem Stadtplatz. Die Pflastersteine waren glatt und zu Mustern gelegt. Ein erhöhter Teich zierte die Mitte des Platzes, und in seinem Zentrum stand ein Pavillon, der über Brücken zu erreichen war. Die rankenartigen Schnitzereien des Pavillons kennzeichneten ihn als eines der wenigen noch vollständig erhaltenen Bauwerke aus der Alanga-Ära. Diesen Ort hätte ich gerne mit Emahla besucht. Ich stellte mir vor, wie sie mir einen verschlagenen Seitenblick zuwarf. »Und warum haben die Alanga das gebaut?« Ich hätte behauptet, dass dieses Gebäude nur eines ihrer Plumpsklos gewesen wäre. Sie hätte gelacht und die Geschichte weiter ausgeschmückt. »Natürlich. Wer träumt nicht davon, sich in einem Pavillon zu erleichtern?«
Doch in Wirklichkeit war sie gar nicht hier.
Ich blieb am Ende der Straße stehen und wartete ab, bis die Soldaten vor mir die andere Seite des Platzes erreichten. Dort wurden Dutzende Kinder von kaiserlichen Soldaten eingepfercht. Wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt wurden. Ein paar blieben ruhig, aber die meisten sahen nervös aus, und einige weinten unverhohlen. Man hatte ihnen gewiss Opium verabreicht, um sie fügsam zu machen und damit sie den Schmerz nicht so stark spürten. Rotes Hemd mit geblümtem Saum. Zu viele von ihnen trugen rote Kleidung.
Nicht ich hätte das tun sollen, sondern die Splitterlosen mit ihren romantischen Idealen von der Freiheit und einem vom Volk regierten Reich. Ich war kein Idealist. Das konnte ich mir gar nicht leisten.
Die Erde bewegte sich. Von den Ziegeldächern stieg Staub auf, und ich hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Panik durchflutete mich bis in die Fingerspitzen. Ein Nachbeben, na klar. Drei Beben an einem Tag und dazu noch der versunkene Hafen, das schien mir alles andere als normal. Am anderen Ende des Platzes kauerten sich die Soldaten um ihre Schützlinge und griffen nach den Waffen, als würde das irgendetwas nützen. Der Volkszähler, der die Feierlichkeiten leitete, beugte sich über sein Buch. Mit großen Augen betrachteten die Kinder die schwankenden Gebäude.
Ich hielt mich am Rand des Teiches fest und zählte. Eins, zwei, drei, vier …
Bei fünf schnürte es mir die Kehle zusammen. Bei zehn wurde mir klar, dass das Beben vielleicht nicht mehr aufhören würde. Etwas Schreckliches braute sich zusammen. Als mich diese Erkenntnis mit voller Wucht traf, konnte ich wieder gehen. Falls die Welt unterging, würde es nichts nützen, wenn ich untätig auf das Ende wartete – vor allem mir selbst nicht.
Rotes Hemd mit geblümtem Saum. Alon, Danilas Neffe. Klein für seine acht Jahre, mit einem kaum zu bändigenden dichten schwarzen Haarschopf.
Die Soldaten wurden von ihrem Pflichtgefühl zusammengehalten. Wie bei einer Angelschnur würde ein einziger starker Ruck genügen, um diese Verbindung zu zerreißen. Stolpernd rannte ich über den wogenden Boden auf sie zu. »Die Insel versinkt, so etwas habe ich schon einmal erlebt!«, log ich. Es fiel mir nicht schwer, panisch zu klingen. »Lauft zu den Schiffen, und verschwindet von hier, bevor sie uns alle mit sich reißt!« Ich war mir nicht sicher, ob ich übertrieb oder nicht, aber ich hatte nicht vor zu bleiben, um es herauszufinden.
Die Soldaten sahen mich einen Moment lang aufgewühlt an. In den Gebäuden hinter ihnen rumorte es.
»Du!«, rief mir die Offizierin zu. »Zurück ins Glied mit dir.«
Mit lautem Donnern stürzte eines der Häuser auf der anderen Seite des Platzes ein. Damit riss die Verbindung der Soldaten, und sie ergriffen die Flucht. Sie rempelten mich so heftig an, dass ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. Ich griff durch die Kinder hindurch und packte Alon. Er war so dünn, dass ich seinen Arm vollständig umfassen konnte. »Deine Tante Danila hat mich geschickt«, erklärte ich ihm. Ich musste schreien, um mich über die grollende Erde hinweg verständlich zu machen. Ich weiß nicht, ob er mich hörte, aber er versuchte nicht, sich von mir loszureißen. Das war doch schon mal was. »Wir müssen rennen. Schaffst du das?«
Diesmal nickte er.
Ich ließ den Blick über die Gesichter der anderen Kinder gleiten – sie mochten zwar panisch sein, wirkten aber immer noch friedlich und bewegten sich mit unsicheren Schritten. Ihre Eltern, Tanten und Onkel würden kommen, um sie zu holen. Eine Lüge, eine Lüge, hörte ich die Stimme meiner Mutter. Doch ich ignorierte sie. Schließlich konnte ich nicht allen helfen. »Tief einatmen«, sagte ich und rannte, die Finger immer noch fest um Alons Arm geschlossen, einfach los. Der Junge war zwar klein, legte aber ein ordentliches Tempo vor. Wir hasteten um den Teich herum und auf den Hafen zu.
Ich spürte meinen Herzschlag in den Ohren. Die enge Straße fühlte sich wie ein Abgrund an, in den wir ohne Hoffnung auf ein Entkommen stürzten. Zu unserer Linken geriet ein weiteres Gebäude ins Schwanken. Ich hörte Balken bersten. Während die Soldaten hinter uns schrien, riss ich Alon ruckartig vorwärts, sodass ihn die einstürzende Fassade knapp verfehlte. Staub fegte über die Pflastersteine und schoss mir in die Nase. Ich versuchte, nicht an die Soldaten zu denken, die unter den Trümmern begraben lagen, und auch nicht an die Leute, die sich möglicherweise noch in dem Haus aufgehalten hatten. Ich musste mich darauf konzentrieren, uns am Leben zu erhalten. Alon begann, laut zu weinen. »Ich will zu meiner Mama!«, schluchzte er und stemmte sich gegen mich.
Oh, mein Kleiner. Das wollte ich auch. Meine Mutter saß inmitten von Wirbelstürmen einfach nur da und ließ sich von den krachenden Fensterläden und heulenden Winden genauso wenig aus der Ruhe bringen wie von einem Haufen überdrehter Kinder. Ich schwor mir, dass ich einen Weg finden würde, sie wieder einmal zu besuchen, wenn ich das hier erst einmal überlebt hatte. »Hör zu«, schrie ich, »du musst weiterrennen. Wenn du das nicht tust, wirst du sie nie wiedersehen.« Mit diesen Worten brachte ich ihn wirkungsvoller zum Schweigen, als ich es mit einer Ohrfeige geschafft hätte. Und leider war das notwendig gewesen, da wir keine Zeit hatten und ich weder groß noch stark genug war, um ihn zu tragen.
Ich glaubte zwar, dass ich den Eingang zur Schänke wiedererkennen würde, aber ich konnte Danila nicht helfen. Sie würde selbst zusehen müssen, dass sie entkam. Der Boden bäumte sich auf und schleuderte mich mit der Schulter voran an eine Wand. Ich zog Alon am Arm, damit er nicht hinfiel. Die Luft war so voller Staub, dass meine Augen tränten. Zwischen den Gebäuden konnte ich jedoch das blaue Meer und den wolkenlosen Himmel sehen. Wir schlitterten auf den unebenen Steinen den Hang hinunter. Alon wurde von einem Ziegel an der Schulter getroffen und wollte schon nach der verletzten Stelle greifen, doch ich zog ihn unnachgiebig weiter, ehe er sie berühren konnte.
Plötzlich besserte sich die Sicht, und wir waren an den Docks. Hinter uns wogte die Staubwolke, als hätten wir die Katastrophe im Schlepptau. Trotz des Bebens und der Zerstörungen war im Hafen nicht viel los. Die Leute schienen noch unentschlossen: Ist es wirklich so schlimm? Werde ich mir dumm vorkommen, wenn alles vorbei ist? Was wird aus den Dingen, die ich zurücklasse?
Doch mir saß die Angst im Nacken, und ich hatte längst gelernt, auf sie zu hören. Die Vorstellung, auf der Insel zu bleiben, erfüllte mich mit einem Grauen, das ich nicht in Worte hätte fassen können. Womöglich würde es aufhören, und die Insel sank nicht weiter ab. Vielleicht aber auch nicht. Und diese zweite Möglichkeit war alles, woran ich denken konnte.
Ein paar schutzsuchende Menschen versuchten, an Bord der kaiserlichen Boote zu gelangen, doch die Soldaten wiesen sie ab. Diejenigen, die auf die Fischerboote zuliefen, wurden von einem schwerfälligen Konstrukt mit einem langen Vogelschnabel aufgehalten, das sich große Mühe gab, jeden Einzelnen von ihnen abzufertigen. »Bitte meldet vor dem Verlassen der Insel all eure Waren an«, krächzte es. »Der Transport und der Verkauf unautorisierter Waren kann mit Geld- und Haftstrafen geahndet werden. Halt, mein Herr, ich muss stichprobenartig deinen Frachtraum durchsuchen.« Bürokratiekonstrukte mochte ich am allerwenigsten.
Ich wandte mich an den Jungen. »Das dahinten am Ende des Docks ist mein Boot, Alon.« Unter unseren Füßen knarzte und ächzte das Holz. Steine rieben aneinander. »Die Dockpfähle sind gebrochen. Wir müssen schwimmen. Ich lasse jetzt dein Handgelenk los, aber du musst mir folgen. Zieh deine Schuhe aus, wenn sie dich nach unten ziehen.«
Ich sah, dass uns das Bürokratiekonstrukt den Rücken zuwandte, und rannte, ohne auf Alons Bestätigung zu warten, zum Wasser. Solange die Soldaten es nicht unterstützten, konnte es zwar nicht viel gegen uns ausrichten, aber ich wollte keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns lenken. Die vom Beben aufgewühlte Meeresoberfläche verzerrte mein Spiegelbild. Als ich auf meine Handrücken hinuntersah, stellte ich schockiert fest, dass sie nicht nur staubgrau, sondern auch von Blutflecken übersät waren. Doch ich hatte jetzt keine Zeit, mich nach Verletzungen abzusuchen. Stattdessen sprang ich ins Meer, das hier im Hafen am Ende der Trockenzeit genauso warm war wie die Luft. Sobald ich mich im Wasser befand, beherzigte ich als Erstes meinen eigenen Rat und streifte die Schuhe ab.
Da die Docks noch immer von Ankern am Meeresboden festgehalten wurden, schlingerten sie zwar, trieben aber nicht vollständig ab. Obwohl hinter mir gerade die Insel auseinanderbrach, musste ich merkwürdigerweise bei jedem Armzug daran denken, wie ich als Kind im Meer geschwommen war. Schließlich erreichte ich das Dock, an dem mein Boot festgemacht war. Als ich hinaufkletterte, zog ich mir Spreißel unter die Fingernägel.
Alon war nur ein kleines Stück hinter mir. Guter Junge – er hatte die Schuhe ausgezogen. Ich bückte mich, um ihm heraufzuhelfen.
Mein Boot schaukelte sanft im Wasser. Es war klein – gerade groß genug für ein wenig Fracht und ein paar Wochen auf See. Dadurch war es aber schnell und brauchte nur wenig oder gar kein Geistgestein, um voranzukommen.
Da wir nun ein Stück vom Staub und den einstürzenden Gebäuden entfernt waren, konnte ich allmählich wieder klarer denken. »Das da ist mein Boot«, sagte ich zu dem Jungen, den ich nun auch nicht mehr anschreien musste. »Damit fahren wir zu deinen Eltern.«
Er folgte mir wie ein verirrtes Lämmchen.
Sobald ich an Bord war, machte ich wie von selbst die üblichen Handgriffe: Ich überprüfte die Taue, löste die Halteleine und setzte das Segel. Während dieser Verrichtungen nahm ich die Kakophonie auf der Insel kaum noch wahr. Da mir mein Vater das Segeln beigebracht hatte, als ich gerade mal laufen konnte, stand ich hier an Deck fester als auf der bebenden Insel.
Alon hatte eine Sitzgelegenheit im Bug gefunden, wo er nun stumm und zitternd kauerte.
Ein Krachen erfüllte die Luft, lauter als ein Donnerschlag. Ich drehte mich um und schluckte. Die Insel sank tatsächlich. Der Hafen war fast vollständig untergegangen, mittlerweile schwappte das Wasser bereits um die vordersten Gebäude. Einfach nur die Segel zu setzen würde nicht genügen. Ich musste irgendetwas unternehmen, damit wir schneller davonkamen.