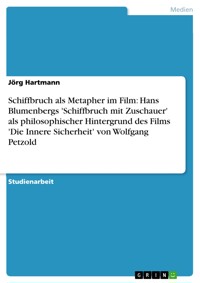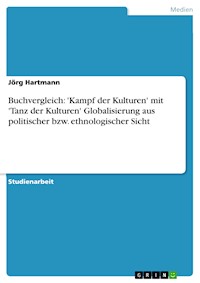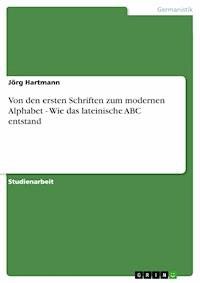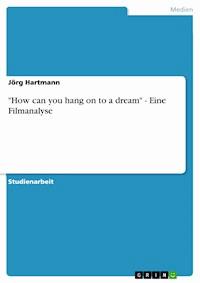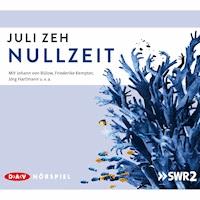19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In «Der Lärm des Lebens» erzählt Jörg Hartmann auf hinreißende Weise seine Geschichte und die seiner Eltern und Großeltern. Es ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Familie – und an den Ruhrpott. Ob es um die Situation seiner gehörlosen Großeltern im Nationalsozialismus geht, die Lebensklugheit seiner Mutter, die für kurze Zeit eine Pommesbude betrieb, die Demenzerkrankung seines Vaters, der Dreher und leidenschaftlicher Handballer war, die vielen skurrilen Erlebnisse in der Großfamilie oder um Schlüsselbegegnungen, die er als Schauspieler hatte – immer hält Hartmann die Balance zwischen Tragik und Komik. Er hat dabei einen kraftvollen Erzählton – persönlich, berührend, humorvoll. Und fragt: Warum kehren wir immer wieder zu unseren Wurzeln zurück? Es geht Hartmann darum, den Kreislauf des Lebens zu fassen: Eltern und Kinder, Anfang und Ende, Aufbruch und Ankunft, Werden und Vergehen – eben alles, was zum geliebten Lärm des Lebens gehört. Ein weises, geschichtenpralles Buch über Herkunft und Heimat – und den Wunsch, sich davon zu lösen und in die Welt zu ziehen. Eine Éducation sentimentale und, wie nebenbei, eine Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jörg Hartmann
Der Lärm des Lebens
Über dieses Buch
In «Der Lärm des Lebens» erzählt Jörg Hartmann auf hinreißende Weise seine Geschichte und die seiner Eltern und Großeltern. Es ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Familie – und an den Ruhrpott. Ob es um die Situation seiner gehörlosen Großeltern im Nationalsozialismus geht, die Lebensklugheit seiner Mutter, die für kurze Zeit eine Pommesbude betrieb, die Demenzerkrankung seines Vaters, der Dreher und leidenschaftlicher Handballer war, die vielen skurrilen Erlebnisse in der Großfamilie oder um Schlüsselbegegnungen, die er als Schauspieler hatte – immer hält Hartmann die Balance zwischen Tragik und Komik.
Er hat dabei einen kraftvollen Erzählton – persönlich, berührend, humorvoll. Und fragt: Warum kehren wir immer wieder zu unseren Wurzeln zurück? Es geht Hartmann darum, den Kreislauf des Lebens zu fassen: Eltern und Kinder, Anfang und Ende, Aufbruch und Ankunft, Werden und Vergehen – eben alles, was zum geliebten Lärm des Lebens gehört. Ein weises, geschichtenpralles Buch über Herkunft und Heimat – und den Wunsch, sich davon zu lösen und in die Welt zu ziehen. Eine Éducation sentimentale und, wie nebenbei, eine Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik.
Vita
Jörg Hartmann gehört zu den bedeutendsten deutschen Charakterdarstellern. 1969 geboren, wuchs er in Herdecke, im Ruhrpott, als Sohn eines Drehers und einer Verkäuferin auf. Nach seiner Schauspielausbildung und verschiedenen Engagements wurde er 1999 Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne, wo seine Rollen, oft in Zusammenarbeit mit Regisseur Thomas Ostermeier, großes Echo fanden. Das gilt auch für seine Fernsehproduktionen, sei es «Weissensee» oder der Dortmund-Tatort, in dem er Kommissar Faber spielt; im Kino glänzte er in «Wilde Maus», «Tausend Zeilen» und zuletzt in «Sonne und Beton». Jörg Hartmann erhielt unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, die Goldene Kamera und den Grimme-Preis. Für den Tatort «Du bleibst hier» (2023) schrieb er das Drehbuch. Er hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Potsdam.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Marti Friedlander «Simon Buis Throwing Martin». Marti Friedlander Archive. E H McCormick Research Library, Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, on loan from the Gerrard and Marti Friedlander Charitable Trust, 2002
ISBN 978-3-644-01940-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Eltern
Für meine Kinder
EinsAm Lehniner Platz
Im Westen Berlins, dem Grunewald so nah und doch im Gewimmel der Stadt, gibt es einen Bau, der jünger aussieht, als er ist. Wie ein Schiff liegt er da, mit kühnem, rundem Schwung zur Straße hin. Dieses Schiff war ursprünglich mal ein Kino, es wurde im Krieg beschädigt, verfiel, und was weiß ich, was noch alles mit ihm passierte, bis es letztendlich wachgeküsst wurde von einigen eifrigen Theaterleuten. Und seitdem ankert es hier im Hafen des Lehniner Platzes am berühmten Kurfürstendamm, hat gute, mitunter sogar herausragende – ach, was rede ich, legendäre! –, aber auch schwierige Zeiten erlebt und nennt sich bis heute: Schaubühne.
Neben diesem Theater gab es mal ein Restaurant, einen Italiener mit Namen Ciao. Und da die Theaterleute das Ciao zu ihrer Kantine, nein, zu ihrem Wohnzimmer auserkoren hatten – sie also, traf man sie nicht im Theater an, mit Sicherheit dort zu finden waren –, hieß die Schaubühne bei vielen bald nur noch Ciao-Bühne.
Das wussten wir damals noch nicht.
Aber wir wussten, die Chancen standen nicht schlecht, die Chefin der Ciao-Bühne im Ciao anzutreffen.
Und so war es auch.
Wir standen vor den großen Scheiben des Italieners, lugten hinein, und es gab keinen Zweifel, das musste sie sein: Andrea Breth. Die berühmte Intendantin und Regisseurin des Hauses. Sie saß da mit einer älteren Dame und einem älteren Herrn.
Konnten wir jetzt einfach so rein? Einfach so stören?
Aber wir wollten stören, wir mussten es, mussten es unbedingt, denn schließlich war es unser letzter Abend in Berlin. Seit vier Tagen waren wir in der großen Stadt, hatten Volksbühne, Maxim Gorki und das Deutsche Theater abgegrast und versucht, dort die richtigen Leute zu finden – leider erfolglos –, doch das Haus am Lehniner Platz blieb für uns das verlockendste Objekt der Begierde. Jeden Abend waren wir um die Schaubühne und das Ciao herumscharwenzelt, in der Hoffnung, die Breth zu sehen, sie anquatschen zu können: «Frau Breth, wir sind zwei Schauspielschüler aus Stuttgart und wollen an die Schaubühne! Nehmen Sie uns! Sie werden es nicht bereuen! Wir sind die Besten!» So oder so ähnlich.
Wir hatten das Haus umschlichen und zugleich gehofft, niemanden anzutreffen. War leider keiner da. An die Breth kein Rankommen. Dumm gelaufen. So hätten wir es den Kommilitonen in Stuttgart verklickern können. Lieber das als eine Abfuhr. Als das Eingeständnis und die Schmach, dass es nicht gereicht hatte für die Schaubühne. Jeden Abend also auch die Erleichterung darüber, unverrichteter Dinge wieder von dannen zu ziehen und sich ohne das flaue Gefühl einer bevorstehenden Prüfung in die aufregende Millionenstadt stürzen zu dürfen, die ja vor allem deshalb so aufregend war, weil fast auf den Tag genau vier Jahre zuvor diese beschissene Mauer gefallen war.
Und jedes Mal die Gewissheit, am darauffolgenden Abend wieder hierherzukommen an den Lehniner Platz. Nicht hinzugehen, war undenkbar, das hätte man uns im fernen Stuttgart als Feigheit ausgelegt – und wir uns auch. Wir wollten an dieses große Haus, gleich an die Spitze, ganz nach oben, etwas anderes war nicht drin.
Heute Abend also unsere letzte Chance.
Andrea war da.
Es gab kein Zurück.
Noch einmal tief Luft holen und dann ab ins Ciao. Ich voran, Hüseyin hinter mir her, oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr, wir also rein, durch den ganzen edlen Laden – unter zehn Mark gibt’s hier bestimmt kein Glas Wein, dachte ich – und zack, bis zu Andrea.
Und dann standen wir da. Direkt vor ihr.
Andrea blickte auf. Sie war ja nicht unsensibel, die Theaterlegende, merkte also, da ist was im Busch, da wollen zwei Dahergelaufene was von ihr. Sie starrte uns an. Durchbohrender Blick.
«Entschuldigen Sie bitte», sagte ich. «Tut uns leid, dass wir Sie stören, aber … sind Sie Frau Breth?»
Was für eine bescheuerte Frage, ich wusste doch, dass sie es war!
Sie musterte uns.
Meine Hände waren feucht.
«Jaaa», sagte sie gedehnt. «Und wer seid ihr?»
«Wir sind zwei Schauspielschüler aus Stuttgart, und wir wollten Sie fragen, ob wir Ihnen vorsprechen können.»
Andrea machte:
«Hm …»
Wie aus dem Kellerloch.
Dann eine Pause.
Die weißhaarigen Unbekannten neben ihr betrachteten uns mit wohlwollendem Schweigen.
«Wie lange seid ihr denn noch hier?»
Ich wusste, das konnte jetzt schwierig werden – und zögerte. Hüseyin sprang für mich ein:
«Na ja», sagte er, «wir müssen morgen früh wieder zurück. Um sechs startet unsere Mitfahrgelegenheit.»
«Ihr seid ja witzig.»
Stille.
Horváthsche Totenstille.
Sie tastete uns ab mit ihrem Blick. Von oben bis unten.
«Jetzt passt mal auf», sagte Andrea ruhig und bestimmt. «Ich sitze hier mit meinen Eltern.»
Wie blöd kann man sein, dachte ich, wir Dorftrottel platzen direkt ins Brethsche Wohnzimmer.
«Die sehe ich sehr selten.»
Ich ahnte, was kommen würde: Also verpisst euch!
«Die gehen gleich in die Vorstellung. Seid um halb acht an der Pforte!»
Ich vergaß kurz zu atmen. Dann fiel es mir wieder ein.
«Danke! Vielen Dank!», stammelten wir und lächelten brav – auch in Richtung Mama und Papa, konnte ja nicht schaden.
Dann zogen wir ab und landeten draußen am Kudamm, panisch-hysterisch gackernd, immer wieder Luftsprünge machend: «Ach du Scheiße! … Scheißeee!»
Zwanzig Minuten darauf, einiges vor der verabredeten Zeit, schlichen wir wieder über den Lehniner Platz. Bloß nicht zu spät kommen, war die Devise. Aber auch nicht zu früh, das würde so wirken, als hätten wir es nötig. Eine Punktlandung, das war das Ziel, wäre Ausdruck höchster Souveränität. Bis zur Punktlandung hatten wir noch einen Moment, also blickten wir mehrfach hinein in den Ort unserer Sehnsucht. Hinter den großen Scheiben im Halbrund des Hauses die Besucher, die ins langgezogene Foyer strömten, dann rechts in den Theatersaal. Draußen folgten wir der Bewegung der Masse, der elegante Bug des Theaterbaus jetzt hinter uns.
Waren ihre Eltern irgendwo zu sehen? Es wäre sicher hilfreich, ihnen noch mal zuzuwinken, dachte ich. Ihnen zuwinken und zulächeln als vorbeugende Maßnahme. Sollten wir bei der Tochter keine Glanzleistung abliefern, würden die beiden zweifellos ein gutes Wort für uns einlegen. Doch zu spät. Keine Eltern in Sicht.
Die letzten Zuschauer betraten den Theatersaal. Dann ein paar Nachzügler im Foyer, aufkommende Hektik, beruhigende Worte der Einlassdame, hat noch nicht angefangen, dann, schwupp, hinein und die Türen zu. Das Personal setzte sich auf die Bänke im langgestreckten Vorraum, bereit, die folgenden Stunden mit geflüstertem Geplauder zu füllen oder mit der noch ungelesenen Tageszeitung.
Gleich halb acht. Zeit, an die Pforte zu gehen!
Wir wollten gerade los, da bewegte sich etwas hinter der Scheibe. Im Foyer rechts öffnete sich eine Tür, und eine Frau trat heraus. Kam auf uns zu. Hielt uns gefangen mit ihrem Blick.
Die sieht ja aus wie die Breth, war mein erster Gedanke.
Mein zweiter war: Es ist die Breth.
Sie öffnete die Glastür und grinste uns an.
«Na, wollt ihr rein? Oder habt ihr’s euch anders überlegt?»
Hüseyin schoss ein Lachen in die Luft:
«Jaja, klar, wollen wir! Unbedingt! Lustig, dass wir Sie hier treffen!»
«Wo sonst? An der Volksbühne?»
Diesmal lachten wir beide.
Die Breth blieb ernst.
«Na los!»
Die Meisterin ließ uns hinein, und wir betraten mit ihr die heilige Halle. Die Einlassdamen und -herren blickten auf. Wen schleppt die Chefin denn da an?
«Wir haben mal geguckt, ob wir Ihre Eltern noch sehen. Haben wir aber nicht.»
Die Breth marschierte das lange Foyer nach hinten, wir hinterher.
«Und wenn ihr sie gesehen hättet, was dann?»
Gute Frage.
«Ähm … Gar nix.»
«Wir hamm nur geguckt.»
Am Ende des Foyers folgten wir ihr rechts durch eine Tür, nach wenigen Metern ab nach links, und schon standen wir vorm Pförtner.
«Haben Sie mal den Schlüssel für die Achilles-Straße?», fragte sie in die enge Pförtnerstube, die ein dicker Glatzkopf fast komplett ausfüllte. «Die beiden Herren hier meinen, sie müssten mir unbedingt vorsprechen.»
Das saß.
Während der Pförtner behäbig ans Schlüsselbrett griff, sagte ich mir, das ist nur ein Trick: Andrea will prüfen, wie standhaft wir sind, ob schon eine Bemerkung wie diese uns umpustet, unsere Untauglichkeit für die ersehnte Bühne beweist. Sah ich nicht sogar ein leicht verschmitztes Lächeln in ihren Augen? Ein Aufleuchten? Eine geradezu mädchenhafte Leichtigkeit? Wir waren auf alles gefasst gewesen, aber darauf nicht. Schließlich hatte man viel über die große Breth erzählt, über ihre Unberechenbarkeit, ihre Launen, ihre urplötzlichen Stimmungswechsel, ihre absolute Gnadenlosigkeit, aber auch über ihr Charisma und ihre faszinierend-einschüchternde Intelligenz.
Die Breth nahm den Schlüssel entgegen und marschierte los. Richtung Albrecht-Achilles-Straße. Und wir hinterher.
Eine stattliche Erscheinung, dachte ich. Stiernacken. Zigarette im Mundwinkel. So groß wie wir, nur etwas breiter, sodass wir Schwierigkeiten hatten, uns zu sehen, Hüseyin jetzt links und ich rechts von ihr.
«Aber wenn ihr schlecht seid», sagte sie, «seid ihr nach fünf Minuten wieder draußen.»
Jetzt konnte ich einen Blick von Hüseyin erhaschen, der seinen Hals extra langmachte. Der Schalk im Blaugrau seiner Augen noch größer als sonst, die dunkelblonde Lockenmähne wie unter Strom, auf seinen Lippen der vergebliche Versuch, nicht zu grinsen. War das Galgenhumor oder jugendliche Hybris? Zwischen uns die Breth, die an ihrer Zigarette zog, als sei sie ein fest verwachsener Teil ihres Körpers.
Was dann folgte, im Proberaum der Achilles-Straße, war ein Wirklichkeit gewordener Jungschauspielertraum. Ganze drei Stunden arbeitete sie mit uns; tief entspannt vergaßen wir Zeit und Raum und wer uns da eigentlich gegenübersaß. Wir sahen uns schon angekommen im Olymp der großen Mimen, sahen uns den Staffelstab übernehmen von Bruno Ganz, Otto Sander und Co.
Als sie uns danach sogar noch mitnahm ins Ciao, Rotwein kredenzte, uns nicht mal davonjagte, als ihre Eltern nach der Theatervorstellung zu uns stießen, sichtbar erfüllt vom Erlebten, mit unverkennbarem Stolz auf die Tochter, da war unser Glück perfekt, und alle Zweifel waren wie weggewischt. Es war sonnenklar: Die Breth hatte einen Narren an uns gefressen. Wie sonst ließ sich erklären, dass sie uns so viel ihrer kostbaren Zeit widmete, zum gemeinsamen Weingenuss einlud und zu allem Überfluss Einlass in den engsten Zirkel der Familie gewährte? Die zwei Alten strahlten uns an, und die Breth war von einer Leichtigkeit, die jedes Reden über sie Lügen strafte. Das lag an uns, da gab es keinen Zweifel, wir waren adoptiert, der Vertrag über zwei Jahre Festengagement längst aufgesetzt, zur Unterschrift bereit. Hüseyin und ich im siebten Himmel. Aus uns strahlte eine Sonne, die nicht nur das Ciao, sondern den gesamten herbstlichen Kudamm erhellte, ja sogar das ganze zusammenwachsende Berlin aufleuchten ließ.
«Ich habe eine Hausaufgabe für euch!»
«Hausaufgabe?»
«Clavigo!»
«Clavigo?»
Das Wort hing mächtig in der Luft.
«Macht mal den Carlos und Clavigo», sagte sie. «Und dann kommt ihr wieder.»
Der Vertrag war noch nicht aufgesetzt. Die Prüfung sollte weitergehen.
«Kennt ihr die Inszenierung vom Kortner? Mit Holtzmann und Boysen?»
Kortner, schoss es mir durch den Kopf, das muss ein paar Jahre her sein, aber klar, Fritz Kortner, eine Legende, ist auch uns ein Begriff. Nur, wie meinte sie das – ob wir die Inszenierung kennen? Wie sollte das gehen? Waren wir da überhaupt schon auf der Welt?
Die Breth half uns auf die Sprünge, als könne sie Gedanken lesen:
«1969.»
Aha. In meinem Geburtsjahr also. Wahrscheinlich war meine Mutter direkt nach der Entbindung mit mir zur Premiere gedüst.
«Ja … also», sagte ich, «leider haben wir es damals nicht gesehen. Aber viel von gehört!»
«Muss toll gewesen sein!», pflichtete Hüseyin mir bei.
Und wieder dieser alles durchbohrende Blick. Ein flackerndes Grinsen in ihren Augen. Man konnte ihr nichts vormachen, sie entlarvte jeden falschen Ton und wusste, wir hatten nicht den blassesten Schimmer.
«Guckt euch das mal an», sagte sie, «und dann kommt ihr wieder. Macht mal die allererste Szene, den Beginn.» Sie deutete auf mich: «Du bist Clavigo.» Dann auf Hüseyin: «Und du machst den Carlos.»
Mir war nicht klar, ob ich darüber glücklich sein sollte, ich kannte ja nicht mal das Stück; aber eigentlich klang Clavigo super, war schließlich die Hauptfigur.
«Alles klar.»
«Spitze. Machen wir.»
Ein wohlwollender Blick der Meisterin; und in ihm die stumme Aufforderung, langsam abzudampfen.
Ein Glück, dass wir es schnallten. Ein letzter Blick in die Runde, dann verabschiedeten wir uns.
Auf dem nächtlichen, novemberkalten Kudamm stellte sich uns die Frage, wie um alles in der Welt wir an eine Aufzeichnung dieser uralten Clavigo-Inszenierung kommen sollten. Es ratterte in unseren Hirnen, dann hatte Hüseyin die entscheidende Idee: Seine ehemalige Freundin war als Studentin der Otto Falckenberg Schule auch an den Münchner Kammerspielen gewesen, wo Thomas Holtzmann und Rolf Boysen im Ensemble waren. Vielleicht konnte sie ja eine Videokassette auftreiben.
Zurück in Stuttgart, wurden wir empfangen wie heimkehrende Olympiasieger, wie Rückkehrer aus der siegreichen Schlacht. Es hatte schnell die Runde gemacht, was wir in Berlin erlebt hatten, und die meisten Mitstudenten sahen uns bereits an der Schaubühne. Unsere Lehrer waren naturgemäß skeptischer und weniger euphorisch. Der Direktor lächelte und tat alles, um uns auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Aber Henry, unser Rollenlehrer, sah seine Mission darin, mit uns an den von der Breth erteilten Hausaufgaben zu arbeiten, uns durch seine Erfahrung, sein fachliches Urteil, Zugang zu den höchsten Bühnenkreisen zu ermöglichen. Er wollte teilhaben an Ruhm und Ehre und war geradezu übermotiviert.
Die Aufgaben der folgenden Wochen waren klar umrissen: Mit Henry wurde an einer Szene aus Botho Strauß’ Trilogie des Wiedersehens gearbeitet; als Monolog schon länger in Hüseyins Repertoire, sollte sie in einen Dialog verwandelt werden. Und was die Szene aus Clavigo betraf, so waren Hüseyin und ich uns völlig einig, dass es, da Fritz Kortner nicht mehr unter den Lebenden weilte, nur zwei Menschen auf der Welt gab, die in der Lage wären, sie mit uns einzustudieren oder zumindest einen Blick auf das Einstudierte zu werfen, ein Urteil zu sprechen und uns dadurch auf die geforderten Höhen zu hieven. Es war geradezu zwingend. Es gab nur diese eine Möglichkeit.
Nachdem Hüseyins Verflossene tatsächlich eine Videoaufzeichnung des legendären Clavigo hatte auftreiben können – wie schwierig das war, kann man sich in Zeiten des Internets kaum mehr vorstellen – und wir das Band immer und immer wieder durchsahen, um hinter das Spielgeheimnis von Holtzmann und Boysen zu kommen, bereiteten Hüseyin und ich die nächste Reise vor.
Nach München.
Zu den berühmten Kammerspielen.
Zu Thomas Holtzmann und Rolf Boysen.
Sie mussten wir treffen.
Einer von ihnen, so der Plan, würde sich erweichen lassen und mit uns an dem klassischen Goethe-Drama feilen, so wie Fritz Kortner es mit ihnen gemacht hatte. Dann hätten wir den Jackpot. Mit diesem Trumpf im Ärmel würden wir zurück nach Berlin und der Breth den Atem nehmen. Mit dem Segen von Holtzmann und Boysen ausgestattet, wären wir unbezwingbar und unwiderstehlich. Die Breth hätte keine andere Wahl, sie würde alle Tore weit öffnen und uns einlassen in den Theaterolymp.
Und damit in die Stadt, die die optimale Bühne bot für den Eintritt in ein Künstlerleben. Und die vier Jahre nach dem Fall der Mauer der spannendste Ort auf diesem Planeten war.
ZweiEndstation
Im April 2018 ging ich wieder diesen Berg hinauf, so wie häufiger in jüngster Zeit, immer weiter bis zu diesem letzten ernüchternden Bau ganz oben. Jedes Mal überkam mich ein Gefühl der Beklommenheit, weil ich nie wissen konnte, was mich dort erwartete, und weil es keine andere Wahl gab, als hierherzukommen, in diesen deprimierenden Vorraum zum Himmel. Die Anlage war erst zwei Jahre zuvor auf der Kuppe errichtet worden, mit weitem Blick ins Tal und tief ins bergige Land. Am Fuße des Berges waren die Türme der zwei Kirchen und des Rathauses zu sehen, die schwarzen Dächer der Altstadt, das vertraute Fachwerk und der dunkelgraue Schiefer, das Beigebraun des Ruhrsandsteins, zum Greifen nah die Stadt, in der die meisten, die jetzt hier oben wohnten, ihr halbes oder ganzes Leben verbracht hatten und die doch unerreichbar für sie geworden war. Das Einzige, was ihnen blieb, war der Blick zurück, hinunter auf den Ort. Vielleicht hatten viele vergessen, dass sie dort unten gelebt hatten. Vielleicht wussten sie es nicht mehr.
Mein Vater wusste es noch. Er wusste viel mehr, als er eigentlich wissen durfte. Ein Grund, warum ich die Diagnose manchmal in Frage stellte. Konnte das überhaupt sein, dass sich mein Vater noch an unsere Wohnung im fernen Berlin erinnerte, an seinen anderthalb Jahre alten Enkel, wenn bei seiner Krankheit – wie es in dem Haus da oben mal jemand auf einer Informationsveranstaltung allen Angehörigen erklärt hatte – der Verlust des Gedächtnisses so fortschritt, als würden nacheinander Bücher aus dem Regal fallen, zuerst die, in denen stand, was heute, gestern und letzte Woche geschehen war, dann die vom letzten Jahr, vom vorletzten, von vor drei, vier Jahren, und immer weiter zurück, bis schließlich das allerletzte Buch herausfiel, jenes, das mit der Geburt begann. Bei ihm schien der Verlauf der Krankheit nicht nach Lehrbuch voranzuschreiten. Er erinnerte sich an Dinge, die weit zurücklagen, und an solche, die erst vor kurzem stattgefunden hatten. Er konnte sich nur schlecht artikulieren. Sein Hirn, sein Gedächtnis funktionierten in großen Teilen noch immer, so mein Eindruck, aber er war nicht mehr in der Lage, die Erinnerungen in Sprache zu verwandeln. Doch manchmal gab es Lichtblicke. Und es öffnete sich urplötzlich eine Tür, durch die er wieder zu uns kam, und wir zu ihm, dann schien er ganz der Alte zu sein. Bis sich die Tür wieder schloss, überraschend und unerklärlich, unerbittlich auch. Er fragte nie nach seinem Zuhause, erkundigte sich nie nach der Wohnung, in der er bis vor zehn Monaten noch gelebt hatte, dort unten in der Stadt mit den drei Türmen, immerhin fast fünfzig Jahre lang, seit dem Jahr meiner Geburt. Darüber war meine Mutter froh. Wie hätte sie es ertragen sollen, wenn ihr Mann beim Abschied jedes Mal gefragt hätte, warum er nicht mit runtergehen darf in sein Zuhause, warum er hier oben in diesem trostlosen Zimmerchen ausharren muss. Diese Frage blieb meiner Mutter erspart.
Als mein Vater auf die Welt kam, war dieser Berg kaum bebaut, dachte ich und nahm den letzten steilen Weg. Die Sonne hing schwer und tief, drückte alles auf den Boden; der Asphalt ein einziger Flickenteppich, alles in die Jahre gekommen hier, vernachlässigt, unbeachtet, ausrangiert, wie die Bewohner auf dem höchsten Punkt. Im Jahr seiner Geburt hatte es einige wenige Häuser weiter unten gegeben, etwas über der Altstadt. Alles hier oben war einfach nur Feld gewesen, Wiese, ein großer, runder Schädel mit grünem kurzgeschorenem Haar, der über dem Städtchen thronte, in dem die Nazis herrschten. Erst nach dem Krieg beachtete man diesen Hausberg, erkannte sein Potential als Wohngebiet und pflasterte ihn bis zur halben Höhe mit satteldachgekrönten Eigenheimen, oben schließlich mit den typischen Kisten der Sechziger- und Siebzigerjahre. Seitdem ist diese hingewürfelte Oberstadt schon von weitem sichtbar, winkt bis tief ins Land und lenkt von der Altstadt unter ihr ab.
Der Frühling nahm dem Ort, auf den ich zusteuerte, etwas von seiner Trostlosigkeit. Nach dem Kälteeinbruch zu Ostern war mir die Sonne nur recht. Vor anderthalb Stunden war ich mit dem Zug aus Dortmund hergekommen, hatte mit meiner Mutter gefrühstückt – in der kleinen Wohnung, unten in der Altstadt, in der ich aufgewachsen war und nach der mein Vater nicht mehr fragte – und war jetzt allein auf dem Weg zu ihm. Meine Mutter würde ihn gegen dreizehn Uhr besuchen, so wie fast jeden Tag. Da ich zu dieser Zeit schon wieder fortmusste, kam eine Aufteilung sehr gelegen; mein Vater würde heute fast den ganzen Tag Gesellschaft haben.
Neun Tage drehten wir in Dortmund. Meist fiel die Anzahl der Drehtage dort viel geringer aus, da Dortmund, zwar Schauplatz unserer Geschichten, «Spesengebiet» war, für den Sender und die Produktionsfirmen also einiges teurer als der Drehort Köln, wo sie angesiedelt waren. Ich hatte mir immer mehr Zeit in Dortmund gewünscht, und diesmal sollte es so sein. Allerdings würden die Zuschauer trotzdem nicht viel von der Stadt zu sehen bekommen, anders als es sich der Oberbürgermeister und die Lokalpatrioten immer wünschten, denn ein Großteil der Dreharbeiten fand drinnen statt, in einem Krankenhaus. Die lange Drehzeit in Dortmund verdankten wir nur der Tatsache, dass diese Klinik die idealen Bedingungen für unsere Arbeit bot und sich als einzige dazu bereiterklärt hatte, bei laufendem Betrieb ein Filmteam zu beherbergen. Es war Zufall, mehr nicht. Doch der Zufall brachte mich länger als üblich in die alte Heimat. Und dadurch zu meinem Vater.
Oft hatte ich mir Vorwürfe gemacht, weil ich so selten bei ihm gewesen war. Die Familie im fernen Berlin, die beruflichen Verpflichtungen, all das hatte mich stets so in Beschlag genommen, dass für andere Dinge kaum mehr etwas übrigblieb. Selbst die Freunde vernachlässigte ich, pflegte Freundschaften nicht so, wie man es tun sollte. Jeder war zu sehr mit sich und seiner Arbeit beschäftigt. Der Alltag drohte alles zu ersticken, und der persönliche Kontakt litt zuerst. Aber schließlich war mein Vater ja mein Vater, und ich wusste nicht, wie viel Zeit uns noch blieb. Trotzdem gab es immer irgendeinen Grund, warum eine Reise zu den Eltern schwer zu realisieren schien. Einmal forderte die Schaubühne ihren Tribut, die Krankheit eines Schauspielkollegen zwang mich, mir in kürzester Zeit dessen Rolle anzueignen und die Vorstellungen für ihn zu übernehmen, dann waren die Kinder krank, manchmal zur selben Zeit, meist aber im Wechsel, ich hatte Termine für alles Mögliche, für dies und das, Interviews, Anfragen, Mails, auf die ich reagieren musste (zumindest glaubte ich, dies tun zu müssen). Nie schien es einen Zeitraum zu geben, der eine Fahrt in die Heimat erlaubt hätte. Und falls doch, so hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, Franka wieder mit den Kindern allein zu lassen, schließlich war ich oft genug von zu Hause fort. Mir zwei oder drei Tage freizuschaufeln, um meinen kranken Vater zu besuchen, so dachte ich, wäre einfach nicht möglich. Ich hätte es machen können, hätte Prioritäten setzen müssen – Franka hatte mich auch immer gedrängt, ich solle fahren, meinetwegen kannst du fahren, fahr ruhig, hatte sie gesagt –, aber irgendetwas in mir hatte es mir verboten, hatte ihr nie ganz glauben wollen; zudem war mein Hang zu gewissenhafter Pflichterfüllung zu mächtig und schob all meine Bedürfnisse beiseite.
Doch nun hatte ich Dreharbeiten in der Heimat, war etliche Tage in der Nähe meiner Eltern. Ein Trostpflaster auf die Wunde der verrinnenden Zeit.
Der Dreh bei laufendem Krankenhausbetrieb brachte es mit sich, dass das Arbeiten und Leiden und Hoffen in solch einer Riesenklinik für uns sehr präsent waren, und eines Tages sprach mich Richard an, unser Regisseur:
«Du, dahinten steht ein Patient», sagte er. «Der würde dir wahnsinnig gerne mal Hallo sagen, ist ein Riesenfan von Dortmund, sagt er, und der Faber sei überhaupt der Beste. Also, wenn du mal eine Minute hast, diesem Menschen würdest du eine große Freude machen.»
«Klar, mach ich», sagte ich. «Wer isses denn?»
«Der da mit der grünen Jacke.»
«Sehe ich.»
«Wilfried heißt er.»
«Alles klar.»
Ich ging hinüber zu Wilfried, und er konnte es kaum glauben. Ich schätzte ihn auf Ende sechzig. Sein rechtes Auge fixierte mich, während das linke weit an mir vorbei ins Außen schielte. Eine lange Narbe prangte auf seinem kahlen Schädel, verlief vom verschwundenen Haaransatz mittig nach hinten, so als markiere sie, für alle sichtbar, die darunter verborgene Grenze zwischen linker und rechter Hirnhälfte. Ein Fünftagebart versuchte, mit mattem Grau dagegenzuhalten.
«Oh, hömma», sagte er mit geballter Faust und lächelnder Inbrunst und glich damit alles Verlorengegangene seiner Artikulation wieder aus, «das glaubt mir keiner auf Station, dass ich jetz den Faber kenne!»
Ich gab ihm die Hand.
«Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Wilfried!»
«Das is nich der Burner – das is der Oberburner!»
Er lachte und seufzte in einem. Jede Pore seines Wesens erzählte offen und einsehbar vom schweren Schicksal, das er nicht erst seit seiner Krankheit zu tragen schien, aber sein Kern pulsierte unverdrossen und unerschütterlich gegen jede Form von Niedergeschlagenheit an. Man musste Wilfried einfach ins Herz schließen, also tat ich es. Er erzählte mir, warum er hier sei. Es bestätigte, was seine Narbe vermuten ließ.
«Ich sach dir ma was. Der Tumor hier drinnen», sagte er und führte den Zeigefinger an die Stirn, «der kann mich am Arsch lecken! Wir in Dortmund, wir lassen uns nich unterkriegen! So wie der Faber, der lässt sich au nich unterkriegen. Der is wie ich. Wir zwei verstehen uns.» Er fasste mit der Rechten meine Hand und mit der Linken meine Schulter: «Du und ich, wir sind Kumpels. Und das is hier bei uns im Ruhrpott viel mehr als Freunde.»
Ich war sein Kumpel. Und ich wusste, ich hatte Verantwortung. Durfte nicht leichtfertig mit diesem Freundschaftsangebot umgehen. Ich wollte es auch gar nicht, denn Wilfried war eine Ruhrgebietsnatur wie aus dem Bilderbuch. Ich versprach, ihn so bald wie möglich zu besuchen.
«Das werden die mir alle nich glauben auf Station, dass ich den Faber kennengelernt hab!», lachte er in diebischer Vorfreude. Dann ergriff er meine Hand: «Ich wünsch dir alles, alles Gute, mein Kumpel! Mach dir ’n schönen Tach! Glück auf!»
Seitdem war Wilfried ein treuer Begleiter der Dreharbeiten, unter den Schaulustigen immer der erste, der ihnen beiwohnte, mit seiner grünen Jacke ein unübersehbarer Farbtupfer. Mit ihr sollte es Wilfried sogar in den fertigen Film schaffen. Eines Tages kam Richard mit dem Vorschlag, ihn als Komparsen mitwirken zu lassen, was ich denn davon halten würde. Ich hielt sehr viel davon. Und war ihm dankbar für diese Idee. Wilfried sollte es die Kraft geben, noch einige Monate länger gegen das Gewucher in seinem Kopf zu bestehen.
Und da war es wieder. Dieses Gefühl. Mehr noch, diese nur kurz greifbare Erfahrung. Ganz plötzlich.
Die Gedanken an Wilfried und die Tatsache, nur noch wenige Meter von der Endstation entfernt zu sein, mochten hervorgeholt haben, was ich sonst nur von wenigen Momenten des Aufwachens kannte, von manchem Dämmerzustand, im Bett liegend, wenn der Verstand noch nicht wach genug ist, diese sich der Sprache widersetzende Erkenntnis zu überdecken, diese Verbindung mit – dem Ganzen? Nur kurz da, doch so eindrücklich und körperlich, als könnte ich sie nie wieder verlieren, um sie dann doch nicht halten, nicht einmal in Worte fassen zu können. Für einen Augenblick sehe ich mein ganzes Leben, begreife die erschütternde Kürze der Existenz, den Wimpernschlag meiner Anwesenheit auf dieser Welt, nehme zeitgleich die schon gelebten und die noch kommenden Jahre wahr, empfinde mit erschreckender Intensität diese Minisekunde meines Daseins und das unmittelbar bevorstehende Ende, kaum dass alles begonnen hat. Als bündele sich alles in einem winzigen Kern, den ich umfassen kann. Ein Sandkorn im kosmischen Getriebe. Ein winziger, nicht sichtbarer Teil des Ganzen. Als Gedanke immer klar, als Wahrnehmung im ganzen Körper ein Schock. Tröstlich, dass der Moment nur kurz ist und nicht haltbar, sich das Gefühl niederschmetternder Bedeutungslosigkeit rasch wieder verflüchtigt.
Kaum ist es vergangen, versuche ich, mich zu trösten, rede mir ein, die Endlichkeit überlisten zu können, indem ich jeden Moment nur intensiv genug wahrnehme. Lächerlich. Ich weiß, ich bin zum Scheitern verurteilt. Ich sollte akzeptieren, dass alles entsteht und vergeht, mein Vater, meine Mutter, ich selbst, meine Kinder und Urenkel, alle Lebewesen auf dieser Welt, alle Häuser, alle Städte und Länder, auch dieser Planet wird eines Tages Geschichte sein, selbst dann, wenn nie jemand den roten Knopf drücken sollte; dem Universum wäre auch das egal, die Erde ist ein unbedeutendes Nichts in ihm. Es ist das ewige Spiel des Lebens, das ich annehmen sollte, aber ich will es einfach nicht wahrhaben. Ich verdränge diesen Scheiß. So wie die meisten.
Die Endstation ganz oben ist ein Schuhkarton in blasser Sandsteinfarbe, der dank der verordneten Wärmedämmung hohl und pappig klänge, würde man dagegenklopfen. Ein typisches Beispiel für den fehlenden Gestaltungswillen heutiger Architekten. Eine Pappschachtel als Dankeschön an die Alten. Ein hingerotzter Renditewürfel. Früher zeugte selbst ein Kuhstall von größerem Schöpfungsehrgeiz. In Momenten wie diesen konnte ich verzweifeln an der Zeit, in der ich lebte, an dieser Epoche, die alte Menschen in Billigkisten abschob, die den ganzen Planeten mit ähnlich deprimierenden Scheußlichkeiten zukleisterte; ein Zeitalter, in dem die Menschen diese Dürftigkeit gar nicht mehr wahrzunehmen schienen oder sie zumindest stillschweigend hinnahmen. Ich fragte mich, was die der menschlichen Gier ausgelieferten Tiere wohl empfinden, wenn sie unsere degenerierte, haltungsgeschädigte, mordhungrige Spezies betrachten. Ob der Neandertaler oder all die anderen Menschenarten die Erde auch so unterjocht und verunstaltet hätten?
Ach, hör auf zu meckern!
Als ob alles schlechter geworden wäre!
Wir können wählen, haben fließend Warmwasser, reisen ans Ende der Welt, müssen nicht verhungern oder an der Pest krepieren, werden stattdessen achtzig Jahre oder älter und dürfen dann hier oben auf die Demenz anstoßen und in Ruhe den Tinnitus genießen.
Mein Blick fiel hinab ins Tal.
Dort war ich aufgewachsen.
Die kleine Stadt da unten hatte meinen Vater mit Leben erfüllt – und er sie. Herdecke war sein Kosmos gewesen, er war nie von hier fortgegangen. Er war gerne gereist, nie auf den Mund gefallen und schnell im Gespräch mit Wildfremden – «Von wo kommt ihr denn wech?» –, doch wäre ihm nie der Gedanke gekommen, seiner Heimatstadt den Rücken zu kehren und woanders zu leben. Er kannte fast jeden im Ort, und fast jeder kannte ihn. Über die Jahrzehnte war ein Netz der helfenden Hände entstanden, welches an das anknüpfte, das bereits mein Großvater gesponnen hatte. Vielleicht war das der Grund dafür gewesen, dachte ich, warum ich als Kind nie die Angst gehabt hatte, auf wirklich harten Boden zu fallen. Egal welche Sprünge ich machte, ich würde aufgefangen werden, so mein Gefühl. Uns fehlte nie etwas, auch wenn andere mehr hatten. Ständig zauberte mein Vater jemanden aus dem Hut, der uns Dinge besorgen oder hier und dort aushelfen konnte, für einen Freundschaftspreis, versteht sich. Doch Geiz war meinem Vater verpönt, gerade weil das Geld nicht bedenkenlos zur Verfügung stand, und in seiner Stammkneipe war jeder mal dran, eine Runde zu schmeißen. Wer «einen Igel inner Tasche hatte», wie er zu sagen pflegte, also geizig war, saß an der Theke schnell einsam und von allen guten Geistern und Kumpels verlassen da. Auch wenn faule Eier unter den Leuten waren – «Der is falsch, das is ’ne linke Wehe, bei dem musse aufpassen!», hatte mir mein Vater gesagt, wenn ihn sein siebter Sinn zur Vorsicht mahnte –, Herdecke schmiegte sich an mich wie eine warme Decke.
Der Eingang der Endstation lag auf der Hofseite. Man hätte diesen Hof angemessen gestalten können, stattdessen kämpfte ein bemitleidenswerter, erst vor kurzem gesetzter Baum mutig gegen das ihn umgebende Grau von Asphalt und Betonsteinen an und diente dem kleinen Bürgerbus, der die meist hochbetagten Besucher einmal pro Stunde auf den Berg kutschierte und sie direkt vor dem Eingang ausspuckte, als Markierung, die er umkreiste, um postwendend wieder hinunterzufahren. Das Grau des Bodens erfüllte den gesamten Hof, und an das Haus gedrängt standen kühlglänzende Metallstühle, auf denen ein paar alte Menschen, ihrer Lethargie ausgeliefert, dahindämmerten. Warum können sie nicht im kleinen Garten auf der anderen Seite des Heims sitzen, fragte ich mich, schon seit Monaten war dort die Erde aufgerissen, ohne erkennbaren Grund. Das einzige Fleckchen Grün hier oben war seit gefühlten Ewigkeiten eine Baustelle, auf der nichts voranging; für die Bewohner nur zu empfehlen, wenn sie vorhatten, sich in ein tiefes Bauloch zu stürzen, um die Wartezeit auf den Tod drastisch zu verkürzen. Es blieb ihnen keine andere Wahl, als mit dem grauen Gefängnishof vorliebzunehmen, dem Wendekreis des Bürgerbusses. Als ich an den Dahindämmernden vorbeiging und den Eingang durchschritt, hoffte ich, dass ihnen der Graue oder Grüne Star den Blick auf die Tristesse verwehrte. Falls nicht, so konnten sie hier immerhin beobachten, wer alles ein und aus ging. Das letzte bisschen Teilnahme am öffentlichen Leben.
Ich betrat den Aufzug und sah mich im großen Spiegel. Müdigkeit blickte mir entgegen; die viele Arbeit der letzten Zeit, das Wissen darum, dass noch mehr folgen würde – und Respekt vor dem, was hier und jetzt auf mich wartete.
Wann war uns zum ersten Mal etwas komisch an ihm vorgekommen, fragte ich mich. Wann hatte die Demenz angefangen? Erste Wortfindungsstörungen waren uns nach seinem Herzinfarkt aufgefallen, sechseinhalb Jahre zuvor, aber wir hatten sie damals ignoriert, abgetan als gewöhnliche Begleiterscheinungen des Alterns. Sein Verfall hatte uns leicht und unmerklich an die Hand genommen; erst spät hatten wir begriffen, dass es eine Kralle war, die uns hielt. «Ich glaub, ich werd dement», hatte mein Vater eines Tages zu meiner Mutter gesagt, als er seine Lesebrille nicht finden konnte, wohl mehr aus Spaß, und sie hatte abgewinkt: «Ach, Blödsinn.» Doch als er angefangen hatte, sich um neunzehn Uhr auszuziehen und bettfertig zu machen, war der Spaß vorbei. Im Pyjama verließ er eines Abends die Wohnung, als sie auf dem Sofa eingenickt war, und irrte durch die Stadt. Nachbarn sahen ihn und klingelten meine Mutter aus dem Schlaf. Einmal setzte er sich auf den Badewannenrand, im Glauben, auf der Toilette zu sitzen, rutschte in die Wanne und kam nicht mehr heraus. Meine Mutter schaffte es nicht, ihn hochzuhieven, legte ihm Kissen unter und wartete auf die alarmierte Feuerwehr, die ihn befreite. «Kuck do’ ma, da is dein Sohn!», sagte sie aufmunternd zu ihm, wenn ich im Fernsehen zu sehen war, aber er schaute gar nicht mehr hin. Irgendwann nistete sich die qualvolle Gewissheit ein, dass sie ihn nicht länger pflegen konnte. Auch eine ambulante Hilfe war keine Lösung. Als einziger Ausweg blieb die Endstation auf dem Berg.
Als sich die Aufzugstür öffnete, war es ein Schock. Der Schrei drang sofort zu mir. Ich erkannte seine Stimme gleich, aber solch einen Ton hatte ich noch nie von ihm gehört. Ein Klagelaut, der Schlimmstes befürchten ließ. War er gestürzt?
Wenige Tage zuvor hatte mir meine Mutter erzählt, wie sie in seinem Zimmer erschienen war, pünktlich um dreizehn Uhr, so wie jeden Tag, und ihn im Bett vorfand, hilflos in seinem vollurinierten Schlafanzug. Klitschnass lag er da und war bedenklich ausgekühlt, seit dem Morgen war niemand bei ihm gewesen. Wie zum Teufel konnte so was passieren? War es Personalmangel, Überforderung der Pflegekräfte? Desinteresse? Auf jeden Fall ein Schock für meine Mutter. Wäre sie nicht gekommen, hätte er womöglich noch ewig so dagelegen. Nach diesem Vorfall verkniff ich es mir, meiner Mutter nahezulegen, an einem Tag pro Woche auf einen Besuch zu verzichten; sie müsse sich schließlich mal erholen und abschalten, hatte ich ihr eigentlich sagen wollen, und dass er ja auch gut aufgehoben sei dort oben. Mein Rat wäre fahrlässig gewesen.
Während zwei direkt aufeinanderfolgende Automatiktüren sich summend und quälend langsam öffneten – die lästige Verkörperung strengster Brandschutzregeln –, bohrten sich seine Schreie immer tiefer in meine Ohren.
Die Tür zu seinem Zimmer stand offen. Ich eilte hinein. Zwei Pflegerinnen, meinem Vater links und rechts unter die Arme greifend, versuchten mit aller Kraft, ihn aus dem Bett zu hieven. Die drei wirkten wie festgefahren in der Position, es ging weder vor noch zurück. Der Hintern meines Vaters hing in der Luft, knapp oberhalb des Bettes, aber jeder Versuch, ihn in eine stehende Position zu bringen, schien mit größten Schmerzen verbunden zu sein, er schrie wie am Spieß. Ich wusste von keiner schwerwiegenden Verletzung am Rücken oder in den Gelenken, die einen solchen Schrei hätte erklären können. Es war eher, als hätten sich alle inneren Dämonen entladen, als wäre ihm die Ausweglosigkeit seiner Lage schlagartig und aufs Quälendste bewusst geworden, als wollten Schmerz, Trauer und Wut sich lauthals Gehör verschaffen. Die Situation war für alle drei so anstrengend, dass es nur noch eine Frage von Sekunden war, bis die Pflegerinnen aufgeben würden.
«Papa!», sagte ich, und mir fiel auf, dass ich ihn seit Ewigkeiten nicht mehr so genannt hatte. In einem gewissen Alter des Erwachsenwerdens war mir dieses Wort nur noch schwer über die Lippen gekommen. In meiner Vorstellung hatte es aus mir das Kind gemacht, das ich nicht mehr sein wollte, also hatte ich mir angewöhnt, ihn bei seinem Spitznamen zu nennen. Doch jetzt, das Ende unseres Miteinanders in Sichtweite, wollte ich keine Anrede mehr, die jeder nutzte. Ich wollte eine, die meiner Schwester und mir vorbehalten war. Mein Vater hatte mich noch nicht bemerkt, doch kaum schallte ihm das Wort Papa entgegen, blickte er auf, und sein Geschrei erstarb.
«Och!», sagte er. «Mein Junge!»
Seine Augen begannen zu leuchten, und wie von Geisterhand geführt, von den Pflegerinnen weiterhin gestützt, stand er, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt, mit einem Mal vor seinem Bett. Er lächelte, strahlte mich an wie ein kleines Kind; die erschöpften Pflegerinnen konnten kaum glauben, was passiert war.
«Sagensema, Sie Wirbelwind», rief die Korpulentere der beiden stimmgewaltig, «wat machen Sie für Sachen? Kaum kommt Ihr Sohn hier reingeschneit, springse auf wie ’n junges Reh!»
«Mein Junge!», sagte er.
«Ja, Ihr Junge!», sagte die andere. «Das is Ihr Junge!»
Und wandte sich zu mir:
«Sie glauben ga nich, wie lange wir schonn versucht haben, ihn ausm Bett zu kriegen. Er soll ja schließlich au ma ’n paar Schritte laufen.»
Und wieder an meinen Vater gerichtet:
«Nich wahr!? Wir wollen ja nich einrosten! Gerade Sie! Sie warn do’ immer sonne Sportskanone!»
«Ja … ja … jaja», murmelte mein Vater.
«Handball, wonnich?», munterte die Korpulente ihn lautstark auf. «Ja klar, Sie warn ’n großer Handballer, weiß do’ ganz Herdecke!»
Damit traf sie ins Tor, und in ihm gewannen Freude und Stolz die Oberhand.
«Ja … jaja.»
«Komm, Papa, wir gehen mal ein paar Schritte», sagte ich und ging auf die Dreiergruppe zu.
«Jaja», sagte die Korpulente, «machense ma ruhich. Bei Ihnen läufta bestimmt wie geschmiert.»
Und sie drehte wieder am Lautstärkeregler, sich meinem Vater zuwendend:
«Wonnich, Sie junger Hüpfer!?»
Sie hätte gar nicht schreien müssen, schließlich hörte mein Vater noch gut. Aber vermutlich war eine laute Stimme unter den Pflegekräften im Altenheim zur Gewohnheit geworden, da wurden keine Unterschiede gemacht, ob die Betagten schwerhörig waren oder nicht. Oder sie war Ausdruck eines nicht eingestandenen Aberglaubens, einer letzten und vagen Hoffnung, mit ihr bis zum tief ins Meer gesunkenen Bewusstsein der Demenzkranken vordringen zu können. Ein unbewusster Versuch, dem durch die Demenz ausgelösten Gefühl der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen.
Mein Vater strahlte mich an, während ich die Pflegerinnen ablöste und wir beide wundersam leichtfüßig auf die offene Tür zusteuerten. Wir hatten den Flur schon erreicht, da rief uns die Korpulente, wie ihre Kollegin erschöpft auf der Bettkante sitzend, hinterher:
«Vielleicht solltenwe uns ab jetz Masken aufsetzen! Mit Ihrm Gesicht drauf!»
Das Gelächter der beiden konnte ihre Verstimmtheit nicht verbergen.
Kurz darauf saßen wir im Gemeinschaftsraum, wo jeder Heimbewohner der Etage einen Stammplatz hatte. Mein Vater hockte wie immer mit dem Rücken zur kleinen Küchenzeile, mit Blick zu den Fenstern. Die Vorhänge dort verdeckten den einzigen Reiz des schlichten Raums, die Aussicht auf die Heimatstadt unten im Tal und die grüne Bergkette am Horizont. Auch der Balkon war keine Alternative, die Tür verrammelt und verriegelt, ein Austritt für die Alten nur unter Aufsicht möglich.