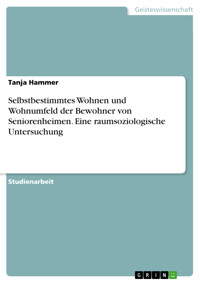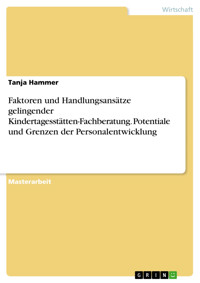Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In einer Welt beherrscht von ewiger Nacht kann jeder Schritt vor die Tür der letzte sein. Seit Jahren versteckt sich Tighan O'Brannick hinter einer falschen Identität. Nur sein langjähriger Freund Ira O'Mally weiß, wer er wirklich ist. Nachdem die beiden während der Jagd auf ein gefräßiges Schattenwesen in Schwierigkeiten geraten sind, beginnt O'Brannicks Tarnung zu bröckeln. Eingeholt von den dunklen Pfaden seiner Vergangenheit erkennt er, dass er keine andere Wahl hat. Er muss dem alten Ruf folgen und seine Aufgabe endlich zu Ende bringen. Die Gesamtausgabe mit allen drei Bänden inklusive Extras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1304
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
TEIL I: Enttarnt
Kapitel: 1
Kapitel: 2
Kapitel: 3
Kapitel: 4
Kapitel: 5
Kapitel: 6
Kapitel: 7
Kapitel: 8
Kapitel: 9
Kapitel: 10
Kapitel: 11
Kapitel: 12
Kapitel: 13
Kapitel: 14
TEIL 2: ENTFLOHEN
Kapitel: 15
Kapitel: 16
Kapitel: 17
Kapitel: 18
Kapitel: 19
Kapitel: 20
Kapitel: 21
Kapitel: 22
Kapitel: 23
Kapitel: 24
Kapitel: 25
Kapitel: 26
TEIL 3: ENTFACHT
Kapitel: 27
Kapitel: 28
Kapitel: 29
Kapitel: 30
Kapitel: 31
Kapitel: 32
Kapitel: 33
Kapitel: 34
Kapitel: 35
Kapitel: 36
TEIL I
‒ ENTTARNT ‒
»War ja zu erwarten, dass das nicht ewig gut geht.«
‒ Tighan O’Brannick
1
Die Natur hat die Entstehung des Menschen nie vorgesehen. Der Ursprung unseres Geschlechts findet sich statt in ihrem Willen vielmehr in den Lenden eines Zwerges und dem Schoß einer Elfe. Ihre Verbindung war unmöglich, gleichermaßen in den Augen seines wie ihres Volkes. Dennoch blieben sie zusammen, und sie zeugten ein Kind, das es unter anderen Umständen wohl nie gegeben hätte. Elfe und Zwerg waren glücklich. Zumindest eine Weile. So lange, bis sie bemerkten, dass ihrem Sohn etwas fehlte. Dass er zwar lebte, aber dass er nicht existierte. Er dachte nicht. Er fühlte nicht. Alles, was er tat, war zu Essen und zu Trinken und zu Atmen. Doch das sämtlich war einzig der Instinkt, der dem Blut eines jeden von uns innewohnt. Für Zwerg und Elfe wurde eine dunkle Ahnung zu finsterer Gewissheit: Ihr Sohn besaß keine Seele. Die Natur hatte ihm den Grundstein des Empfindens nicht gegeben, so wie jedes andere Geschöpf auf der Welt ihn von ihr für seinen Lebensweg bekommt. Denn sie konnte den Jungen nicht finden. Er entstammte nicht ihrem Willen, und so wusste sie weder um seine Geburt noch um seine Not. Flehentlich wandten sich Elfe und Zwerg an die Sonne, unser aller Schutzpatronin. Sie erbarmte sich der jungen Familie und sandte einen Strahl auf die Welt hinunter ‒ Gwylain, ihre Tochter. Diese half dem Jungen, wurde für kurze Zeit zum Bindeglied zwischen ihm und der Natur. Der Sohn von Elfe und Zwerg erhielt seine Seele. Er wurde groß, er wurde stark, fand eine Frau und sie bekamen ein Kind. Ohne Seele. Neuerlich war Gwylains Eingreifen vonnöten. Auch diesmal half sie. Von jenem Tag an war sie stets zur Stelle, sobald ein neuer Mensch das Licht der Welt erblickte. Und nachdem alle Zwerge, alle Elfen, alle übrigen Völker der Welt vergangen waren, da überdauerte einzig noch unser Geschlecht. Behütet von Gwylain, ehrfürchtig auch benannt als ›Das Leben‹, begannen wir ein neues Zeitalter.
Semias CraydunneDer Mythos von Leben, Tod und Menschheit
GRAPHIT UND ROGEN
Ist dir eigentlich klar, was für ein verdammtes Glück du hast?« Tighan O’Brannick schüttelte den Kopf. Eine Strähne schwarzbraunen, leicht gewellten Haares löste sich aus dem im Nacken zusammengebundenen Zopf und fiel ihm ins Gesicht. Er schnaubte ungehalten, als sie in seinem ordentlich gestutzten, dunklen Vollbart hängen blieb und ihn an der Wange kitzelte. Tighan hasste sein langes Haar, und er hasste diesen elenden Bart. Es war ihm egal, wenn andere so was trugen. Sollten sie doch herumlaufen, wie sie wollten. Damit hatte er nun wirklich kein Problem. Womit er allerdings eins hatte, war er selbst. Dass er für seine Verhältnisse ziemlich verlottert aussah, war notwendig. Nur bedeutete das noch lange nicht, dass es ihm auch gefiel.
Begleitet von einem missmutigen Brummen strich er die aufdringliche Haarsträhne hinters Ohr und rückte das offen auf seinem Schoß liegende Tagebuch zurecht. Mit dem Ende seines Stiftes tippte er ein paar Mal auf das Papier, dann zuckte er die Schultern und widmete sich wieder seiner Zeichnung. Sanftes Kratzen durchdrang die staubige Luft, wobei ein Lächeln über Tighans Gesicht huschte. Wie das Zeichnen gehörte dieser Stift zu den wenigen Dingen, die er liebte. Aber nicht nur deshalb hütete er ihn wie seinen Augapfel. Das gute Stück bestand aus gepresstem Graphit, und schon ein einzelner dieser Stifte war unsagbar teuer. O’Brannick gehörten sechs davon. Sie waren das Mitbringsel einer langen Reise, die er sich zum Zeitpunkt ihres Antritts ebenso wenig gewünscht hatte, wie die seinen Kopf verunstaltende Haarpracht.
Es lag Jahre zurück, dass Tighan auf einem Marktplatz mit Tusche und Feder Portraits fertigen musste, um seine gähnend leere Geldkatze aufzufüllen. Einer seiner ersten Kunden war ein alter Alchemist gewesen. Nach getaner Arbeit hatte der Mann sich das Bild unter den Arm geklemmt und O’Brannick ein Stoffündel in die Hand gedrückt. Er erinnerte sich noch gut daran, was der Alte zu ihm sagte, bevor er auf Nimmerwiedersehen verschwand: ›Ein außerordentlicher Dienst bedarf außerordentlicher Gegenleistung.‹ Damals war Tighan weder die Zeit geblieben, sich für das Bündel zu bedanken, noch hatte er die Gelegenheit bekommen, den für seine Leistung vereinbarten Preis einzufordern. Entsprechend schwer wogen Verwirrung und Ärger. Bald erkannte er jedoch, dass das Geschenk des Alchemisten für ihn wesentlich größeren Wert besaß als ein paar schnöde Münzen. Nie zuvor war ihm ein Zeichengerät in die Finger geraten, mit dem er so schnell und sauber arbeiten konnte. Fortan war er jeden Abend mit einem prall gefüllten Geldsäckchen nach Hause gegangen.
»Lass mich raten«, sagte Tighan. »Du hast nicht die geringste Ahnung, was ich meine. Richtig?«
Erwartungsvoll schaute er auf. Ein wissendes Funkeln machte sich in seinen stahlgrauen Augen breit, als er die über dem Fußende seines Bettes sitzende Spinne betrachtete. Sie war so groß wie seine Hand. Roter, dichter Flaum bedeckte den voluminösen Hinterleib des Tieres. Dessen lange, kräftige Beine trugen locker verteilte Haare derselben Farbe, während sich der abgeflachte, runde Vorderkörper nackt und schwarz präsentierte. Mit ihren acht hinter den imposanten Beißklauen prangenden Augen erwiderte die sogenannte Rote Weberin Tighans Blick und drehte sich ein wenig nach rechts.
›Nein.‹
»Wusste ich’s doch«, schmunzelte er. »Alles andere hätte mich auch gewundert.«
Die Spinne hob die Vorderbeine und schwenkte sie sachte auf und ab. Dabei schien der durch das Fenster hereinfallende Lichtstrahl den Pelz des Tieres in einen Schauer dunkelroten Blutnebels zu verwandeln. Ein faszinierender Anblick, der in der Vergangenheit sicherlich einer Menge Insekten zum Verhängnis geworden war. Ungeachtet ihres Namens spann die Rote Weberin für den Beutefang nämlich keine Netze, sondern ging auf die Jagd. Das sich bei Bewegung an ihren Haaren brechende Licht lockte das begehrte Opfer an ‒ tja, und dann Lebewohl Gevatter. Abseits der Nahrungssuche glänzte ihre Art dagegen mit perfektionierter Feigheit. Kreuzte etwas den Weg einer Weberin, das größer war als sie selbst, ergriff sie die Flucht. Nicht so aber bei Tighan, der das Privileg einer besonders intensiven Verbundenheit zur Tierwelt genoss. Neben einer noch weitaus eindrucksvolleren Fähigkeit war besagte Gabe seit jeher ein fester Bestandteil seines Daseins. Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte waren andere aufgrund derselben Talente bitter zur Kasse gebeten worden. O’Brannicks Rechnung stand bis heute offen, und er setzte alles daran, dass es dabei blieb. Schließlich bezahlt niemand gerne mit seinem Leben.
»Wenn du willst, kann ich es dir erklären«, schlug er vor. »Hat was mit Seelen zu tun. Wie ihr Tiere eure bekommt und wie das Ganze bei uns Menschen abläuft.«
Die Spinne zuckte ein Stück nach rechts. ›Kein Bedarf.‹
Auch diesmal wusste Tighan ihre Reaktion richtig zu deuten. »Du scheinst nicht von der redseligen Sorte zu sein, was?«
Ihre Antwort bestand aus einer leichten Linksdrehung. ›Gut erkannt.‹
O’Brannick nickte verstehend. Er beschloss, den Mund zu halten, und konzentrierte sich wieder auf seine Zeichnung. Inzwischen waren auf dem Blatt vier Beine und der halbe Oberkörper der Roten Weberin zu erkennen. Er war gut vorangekommen und hegte die Hoffnung, das Bild fertigzustellen, bevor das Tier die Lust verlor oder ein vorüberkrabbelnder Käfer alles verdarb. Außerdem war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sein Freund und Zimmergenosse Ira O’Mally der in ihrer Unterkunft vorherrschenden Ruhe ein jähes Ende bereiten würde.
Inzwischen lag der Weckruf für die Tagesschicht eine halbe Stunde zurück, und Ira war unmittelbar nach dem Klopfen des Weckburschen zur morgendlichen Aufgabenverteilung gegangen. Als Vorsteher ihrer Jägerloge hielt er es für seine heilige Pflicht, dort einer der Ersten zu sein, der einen gut bezahlten Auftrag ergatterte. Deshalb war es ihm zur Gewohnheit geworden, die Bettwärme schon lange vor der üblichen Weckzeit aufzugeben und sich so früh wie möglich auf den Weg zu machen. Entsprechend zeitig kehrte er zurück. Für O’Brannick ein Grund mehr, sich zu beeilen.
Während er zeichnete, blendete Tighan die Welt um sich herum allmählich aus. Zuerst verblasste das Zimmer samt der spärlichen, aus zwei Betten, einem einfachen Tisch mit zwei Stühlen und zwei schmalen Kleiderschränken bestehenden Einrichtung. Danach stahlen sich die auf der Etage befindlichen Flure und Räume aus seiner Wahrnehmung, die sich hinter der Zimmertür erstreckten. Ihnen folgte das mehrgeschossige Haus, in dem er und Ira wohnten. Dasselbe galt für den Rest des vier weitere Häuser gleicher Bauart zählenden Komplexes, der den Fiagi jer Scáth von Mar-Dinye zur Verfügung stand. Eben jener Gemeinschaft, die die Bürger des Landes Rokhanos vor den Übergriffen fleischgewordener Schatten beschützte und der Tighan seit acht Jahren angehörte.
Am Ende vergaß er sogar das. Er schob beiseite, warum er sein Gesicht hinter einem Übermaß an Haaren versteckte. Er verdrängte den Grund, weshalb er seit einer gefühlten Ewigkeit ständig fingerlose Lederhandschuhe trug und mit Ausnahme von Ira gegenüber jedem Menschen den Namen ›Gusvig Jones‹ für sich verwendete. Er dachte nicht mehr daran, dass er vierundsiebzig Lenze zählte, dass er aussah, als wäre er nicht älter als Ende dreißig, und dass er noch immer die körperliche und geistige Verfassung eines etwa zwanzigjährigen Burschen aufwies. All das trieb weit von ihm fort. Für eine Weile gab es nur noch die Rote Weberin, sein Tagebuch, den Graphitstift und ihn.
Als O’Brannick sein Bild mit den letzten Feinheiten versehen hatte und den Stift beiseitelegte, fühlte er sich wie aus einem Traum erwacht. Wie lange hatte er hier gesessen? Eine Stunde? Zwei? Einen Tag? Im ersten Moment hätte er die Frage unmöglich beantworten können, so sehr hatte ihn seine Arbeit gefesselt. Allerdings wusste er aus Erfahrung, dass er für eine kleine Zeichnung wie diese kaum eine Viertelstunde brauchte. Ein Seufzen glitt über Tighans Lippen, während sein Geist viel zu schnell wieder aufklarte. Er hatte die Realität nicht vermisst und wäre ihr gerne noch länger ferngeblieben. Bevor ihn jedoch trübe Gedanken heimsuchen konnten, polterte Ira O’Mally ins Zimmer. Er war sechsunddreißig Jahre jünger, einen knappen Kopf kleiner und von muskulöserer Statur als der drahtig gebaute Tighan. Unter seinem kinnlangen, ständig zerzausten rotbraunen Haarschopf blitzten wachsame, hellgrüne Augen hervor, und auf seiner linken Halsseite erstreckte sich eine doppelt fingerlange Narbe. Sie war ein Andenken an Iras erste Begegnung mit einem Scáth. In der Hand hielt O’Mally ein notdürftig wieder zusammengerolltes Pergament, mit dem er Tighan grinsend zuwinkte. Dabei brach ein Stück des unter dem Text aufgedrückten Wachssiegels ab und fiel zu Boden.
Das Siegel war nicht gelb für Wachdienst auf den Feldern. Oder rot für die Eskorte von Boten oder irgendwem sonst in eine der anderen Königsstädte. Auch nicht grün für Patrouillengänge in einem der drei umliegenden Dörfer oder weiß für sonstige anfallende Arbeiten.
Nein, dieses Siegel war blau.
Das bedeutete, O’Mally hatte einen Auftrag für die Jagd auf einen speziellen Scáth mitgebracht.
»Bald platzen unsere Geldkatzen aus allen Nähten, Tigs«, verkündete er feierlich, nur um beim nächsten Atemzug zu erstarren, den Blick fest auf die Wand vor Tighans Bett geheftet. »Bei Gevatter Tods Pisspott!«
»Ich wage zu bezweifeln, dass er so was jemals gebraucht hat«, gab O’Brannick lachend zurück. Sein Einwand wurde ignoriert.
»Wehe, du sagst mir jetzt, du hast das Spinnenvieh da noch nicht gesehen!«, rief Ira aus. Er wich einen Schritt zurück und klammerte die freie Hand fest genug um den Türknauf, dass er bei der ersten falschen Bewegung abzubrechen drohte. »Das Ding ist so groß wie ein Teller, verflucht!«
»Ein kleiner Teller.«
»Also hast du sie gesehen!«
»Aye, hab ich.« Lächelnd hielt Tighan sein Tagebuch hoch und präsentierte die aufgeschlagene Seite. »Ich hab sie sogar gezeichnet.«
»Mach das beschissene Buch zu, sonst muss ich kotzen«, stöhnte Ira, der noch blasser um die Nase wurde, als es ohnehin der Fall war. Dann verfiel er ins Jammern. »Acht daumendicke Beine. Und so riesig wie der Deckel von ‘nem Weinfass. Mann, Tigs, du weißt ganz genau, wie ich diese ekelhaften Biester hasse.«
»Mhm«, grinste O’Brannick.
Er betrachtete die reglos auf ihrem Platz hockende Rote Weberin und hob verwundert eine Augenbraue. Sie hätte verschwinden sollen, sobald Ira die Tür aufriss. Aber das Tier war immer noch da. Tighan konnte nicht anders, als der Sache auf den Grund zu gehen. Er rutschte ans Ende seines Bettes und streckte die Hand aus.
»Er fasst es an«, murmelte O’Mally entgeistert. »Bei allem, was ein Mann in die Finger bekommen kann, fasst er ausgerechnet eine Spinne an. Warum geb ich mich eigentlich immer nur mit Verrückten ab?«
»Weil es außer denen kein anderer länger als einen halben Tag in deiner Nähe aushält?«, schlug O’Brannick vor.
Ohne auf eine Antwort zu warten, berührte er den glatten Vorderkörper der Roten Weberin, worauf das Tier wie ein Stein herunterfiel. Begleitet von einem dumpfen Geräusch schlug es auf dem hölzernen Fußboden auf. Ein Blick in Iras Richtung zeigte, dass er einen Satz rückwärts gemacht hatte und nun auf dem Flur stand. Tighan verkniff sich eine passende Bemerkung, obwohl ihm gleich mehrere eingefallen wären. Stattdessen gab er sich mit einem amüsierten Schmunzeln zufrieden, sprang vom Bett und holte die Spinne darunter hervor.
»Tja«, sagte er und betrachtete sie interessiert. Hier hatte das Schicksal überraschend schnell zugeschlagen. »Die ist ziemlich tot, würde ich meinen.«
»Wenn du mich verscheißerst, erschlag ich dich mit deinen dämlichen Stiften«, brummte O’Mally aus sicherer Entfernung.
»Da steht ein Mann, der ohne mit der Wimper zu zucken einen Scáth nach dem nächsten erledigt. Aber im Angesicht einer toten Spinne kneift er die Hinterbacken zusammen«, lachte Tighan. Dann setzte er eine versöhnliche Miene auf. »Die rührt sich nicht mehr, Ira. Ehrlich.«
»Der Sonne Gnade sei Dank.« Erleichtert deutete O’Mally zum Fenster. »Wenn du mich glücklich machen willst, wirf das Ding raus.«
»Ich finde, heutzutage sollte man nichts verkommen lassen.«
»Was bitte?«
»Flint«, erklärte O’Brannick. »Der freut sich doch immer über einen Leckerbissen. Ähm ... Wo steckt er überhaupt?«
»Wo soll der um die Zeit schon sein.«
»Unten in der Küche?«
Ira nickte, während er abermals das Pergament schwenkte. »Was hältst du davon, wenn wir uns ein ordentliches Frühstück genehmigen, während wir den Auftrag besprechen?«
Dem Vorschlag konnte Tighan eine Menge abgewinnen. Nachdem er sein Tagebuch versteckt hatte, machten sich die Freunde auf den Weg. Die tote, in ein Tuch gewickelte Rote Weberin nahm O’Brannick in der Hosentasche mit.
Leeom Hamsay ‒ Küchenjunge des Th’Each jer Fiagi Dhá (dem zweiten Haus der Jäger) in Mar-Dinye ‒ balancierte auf jeder Hand ein mit Rührei, gebratenem Speck, frischem Brot, Milch und heißem Kräutertee befülltes Tablett. Geschickt schob er sich zwischen den im Speisesaal aufgestellten Bänken und Tischen und den übrigen, nur für das ungeübte Auge wahllos umher wuselnden Küchenjungen voran. Zu dieser frühen Stunde gaben sich Tag- und Nachtschicht hier die Hand, weshalb die vorhandenen Plätze größtenteils besetzt waren und der Saal in einem Dunst aus lautem Gelächter, dem Klappern von Geschirr, mancherlei deftigem Wortwechsel und allgemeinem Geplapper unterging. Leeom ließ sich davon nicht beeindrucken. Im Winter war er dreizehn Jahre alt geworden. Seit vieren davon arbeitete er fast täglich in der Küche des Th’Each jer Fiagi Dhá, und das übliche Durcheinander stellte für ihn keine Herausforderung mehr dar. Außerdem rückte er mit jeder Stunde, die er seinem Dienst nachging, seinem großen Traum ein bisschen näher. Denn eines Tages würde er Koch sein. Allerdings nicht in einem Jägerhaus. Nein, Leeom würde am Hof von König Allister var Greagen, dem Herrscher von Mar-Dinye, eine wundervolle Kreation nach der nächsten hervorbringen und die Gaumen der Königsfamilie mitsamt ihrem Hofstaat verwöhnen, wie es noch niemand zuvor getan hatte. Laut den Mitgliedern dieses Jägerhauses besaß er genug Talent dafür, also musste es stimmen. Die Worte eines Fiagi hatte Hamsay noch nie bezweifelt.
Seit seiner Anstellung als Küchenjunge hatte Leeom aber nicht bloß Putzen, Bedienen und die Grundlagen des Zubereitens von Speisen gelernt, sondern auch eine Menge über Geld und Zahlen. Längst nicht jeder in dieser Stadt konnte rechnen, von den Dörflern ganz zu schweigen. Leeoms Mutter ‒ die Frau eines Bauern, mit dem sie insgesamt drei Kinder, fünf Schweine, drei Kühe, ein paar Hühner und ein hübsches Weizenfeld ihr Eigen nannte ‒ gehörte ebenso dazu wie seine beiden Schwestern. Sein Vater konnte rechnen, hatte aber nie die Muße besessen, seine Familie in die geheime Welt der Zahlen einzuweihen. Von den Frauen war das auch niemals verlangt worden. Der kleine Hamsay war jedoch ganz wild darauf, weshalb es nach Beginn seiner Lehre nicht lange dauerte, bis er den Vater im Rechnen übertraf. Noch dazu war er der einzige Angehörige seiner Familie, der schon mal einen echten Silberrogen in der Hand gehalten hatte. Ach, was hieß einmal? Mehrfach sogar! Die meisten Fiagi zahlten ihr Essen in Silber und gaben ein wenig von ihrem Wechselgeld an die Küchenjungen ab. Auf diese Weise hatte Leeom inzwischen eine stattliche Summe von fünfzig Kupferrogen und einem Bronzerogen zusammengetragen. Dies, obwohl er für seine Verpflegung und neue Kleider selbst aufkommen musste und den gesamten Verdienst, den er für seine Arbeit vom Koch erhielt, an die Eltern abtrat. Für den kleinen Hamsay bildeten seine gesammelten Münzen ein wahres Vermögen. Noch jedenfalls. Denn wer konnte sagen, wie die Dinge standen, wenn er in einigen Jahren in König var Greagens Küche Töpfe und Pfannen schwang?
»Das ist ziemlich irrsinnig, findest du nicht?«, drang es unvermittelt an Leeoms Ohren.
Rasch kramte der Junge in seinem Gedächtnis und erkannte die Stimme als jene von Mr. Gusvig Jones. Dem drahtigen Kerl mit seinem immer im Nacken zu einem Zopf gebundenen, schwarzbraunen Haar und dem für einen Fiagi recht ordentlichen Äußeren. Gemeinsam mit dem rothaarigen und ständig blassen Mr. Ira O’Mally formte er eine der wenigen Jägerlogen, die nur aus zwei Mitgliedern bestand und trotzdem viele erfolgreiche Kämpfe austrug. Leeom grinste in sich hinein, froh, dass er seine dampfende Last auf dem Tisch der beiden Männer loswerden würde.
»Der Auftrag bringt uns hundertsiebzig Rogen in Silber ein«, hörte er Mr. O’Mally sagen. »Pro Nase, mein Freund. Pro. Beschissene. Nase.«
»Ehrlich gesagt, ich bin wenig scharf darauf, nach einer solchen Jagd auch noch den Kopf in irgendeine Latrine hängen zu müssen, um meinen Lohn zu bekommen.«
Hamsay hörte das Niederschlagen einer Faust auf die hölzerne Tischplatte und ein unterdrücktes, dadurch jedoch nicht minder freches Lachen.
»Du bist ein Arsch, Gus.«
»Und du bist von sämtlichen guten Geistern verlassen, wenn du dir so was hier aufschwatzen lässt.«
Der beim Tisch angelangte Küchenjunge sah, wie Mr. Jones mit einem Pergament vor der Nase seines Jagdgenossen herumwedelte. Am unteren rechten Rand blitzte ein blaues Wachssiegel hervor, von dem ein Stückchen fehlte. Wenn man wie Leeom mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend lief, dann hatte man längst gelernt, welche Bedeutung die jeweiligen Siegelfarben innehatten. Er hätte mit keinem der Fiagi tauschen wollen, besonders nicht mit Mr. O’Mally und Mr. Jones. Denn gezielt einen Scáth zu provozieren, damit er sich zeigte, und ihn dann zur Strecke zu bringen, hielt Leeom für um Längen schlimmer als eine rein zufällige, im Verlauf einer Wache entstandene Begegnung. Ihn schauderte allein der Gedanke daran, was diesen beiden Männern bevorstand, und plötzlich fühlte er sich ziemlich klein.
Früher, als er noch bei den Eltern auf dem Hof lebte, hatte er oft gleich mehrere dieser Schattenwesen gesehen und sich jedes Mal schrecklich gefürchtet. In den Dörfern gab es nicht so starkes Licht wie in der Stadt und auf den Feldern, sodass die Bestien sich immer wieder nah an die Häuser heranwagten. Manchmal kamen sie sogar hinein, wurden sie von den Fiagi nicht rechtzeitig aufgehalten. Aus irgendeinem Grund, den Leeom nicht kannte, töteten und fraßen die Scáth mit Vorliebe Menschen. Zwar verschmähten sie auch kein Tierfleisch. Wenn sie aber die Wahl hatten, fiel sie auf menschliche Beute. Darunter litten vor allem die Dörfler, denn Feuer oder Kerzenschein vermochte die grässlichen Kreaturen mitsamt ihrem Hunger niemals ganz in Schach zu halten.
»Von wegen, aufgeschwatzt«, holte Mr. O’Mallys mürrische Stimme den Jungen in die Gegenwart zurück. »Der alte Leighs wollte ausdrücklich uns beide für den Auftrag. Ablehnen ausgeschlossen. Außerdem können wir das Geld gut gebrauchen, nach der Sache mit meiner Schulter.«
Die zwei Fiagi rückten ein wenig vom Tisch ab, als sie Leeom bemerkten. Behutsam stellte er die beiden Tabletts vor ihnen auf das fleckige, wurmstichige Holz.
»Danke, Junge.«
Hamsay erwiderte Mr. Jones’ Lächeln und ertrug gefasst dessen lästige Angewohnheit, ihm das Haar zu zerzausen. Auch Mr. O’Mally nickte grinsend und deutete auf das Rührei.
»Hast du die gemacht oder hatte der olle Stanton seine Finger da dran?«, fragte er.
»Mr. Stanton, Sir«, antwortete Leeom.
Der Fiagi seufzte gedehnt und schüttelte den Kopf. »Ein Jammer. Die armen Eier.« Mit diesen Worten langte er in seine am Gürtel befestigte Geldkatze. Er drückte dem Küchenjungen das Silber für das Frühstück und einige zusätzliche Kupferrogen in die Hand. Dabei zwinkerte er ihm verschwörerisch zu. »Sind ein paar mehr als sonst. Als Ansporn, damit nächstes Mal du dich an den Herd stellst.«
Leeom verbeugte sich artig und verstaute die Münzen in seiner Tasche. »Ich werde mein Bestes geben, Sir.«
»Davon sind wir überzeugt«, befand Mr. Jones, der ihm ebenfalls etwas Geld zusteckte. »Und wenn du schon dabei bist, beeil dich bitte mit dem Älter werden. Wird Zeit, dass du Meister Magenvernichter ablöst.«
»Jawohl, Sir«, kicherte der Junge.
Er brachte es nicht übers Herz, den Männern von seinen Zukunftsplänen zu berichten. Stattdessen bedankte er sich höflich und gab die neuen Münzen zu den anderen. Er spürte an ihrem Gewicht in seiner Hand, dass es weniger waren als die, die er von Mr. O’Mally erhalten hatte. Doch da er sie mitsamt einer Mischung aus Flusen und Krümeln in seine Tasche gleiten ließ, wusste er, dass hier kein Geiz im Spiel gewesen war. Vielmehr waren die Rogen vom Boden eines jetzt womöglich leeren Beutels geklaubt worden. Begleitet von diesem Gedanken verbeugte der Küchenjunge sich ein zweites Mal. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und begab sich wieder an die Arbeit.
»He, Bursche!« Mitten in der Bewegung hielt Leeom inne und sah Mr. Jones fragend an. »Wenn du kannst, scheuch Flint aus der Küche und schick ihn her, ja?«
»Das mach ich, Sir.«
Tighan und Ira sahen dem davoneilenden Leeom Hamsay lächelnd nach, bis er in der Menge verschwunden war. Unabhängig voneinander hofften beide, dass der Knabe es später einmal besser treffen würde, statt auf ewig in Stantons verlotterter Küche zu arbeiten. Er war ein schlaues Kerlchen und hatte es nicht verdient, im Dunstkreis von Essensgerüchen, Abfallgestank und einer lauten Schar grobschlächtiger Männer zu versauern. Nicht einmal dann, wenn sie bis an ihr Lebensende verwürztes, halb angebranntes Rührei würden essen müssen. Tröstlich blieb, dass es den Fiagi der übrigen Häuser in dieser Hinsicht kaum anders ging. In allen Speisesälen gab es genügend Auswahl, um einen knurrenden Magen zu besänftigen. Deren Qualität ließ allerdings in den meisten Fällen zu wünschen übrig.
»Leighs wollte also unbedingt uns für den Auftrag?«, griff O’Brannick die abgebrochene Unterhaltung wieder auf. »Nachdem du drei Wochen ausgefallen bist und erst seit einer Woche wieder auf den Übungsplatz gehst? Willst du meine ehrliche Meinung dazu hören?«
»Nein«, brummte Ira. Er beugte sich tiefer über seinen Teller und gab vor, beschäftigt zu sein.
»Mir gefällt das nicht«, fuhr Tighan unbeirrt fort. Skeptisch stocherte er in den Eiern herum. Er spießte eine Portion auf die Gabel, roch vorsichtig daran und verzog das Gesicht. »Wir haben mehr als genug erfahrene Jägerlogen, die so einen Auftrag ausführen können. Zum Beispiel Crails und seine fünf Jungs. Die machen neuerdings fast nur noch solche Jagden. Oder Casper, Darren, Harver und die zwei Bryans. Kaum Wachdienst und Patrouillen, aber dafür eine Jagd nach der anderen. Im Gegensatz zu dir, der drei Wochen in der Heilstätte verbracht hat. Und zu mir, der vier Wochen lang nichts anderes gemacht hat, als bei irgendeiner drittklassigen königlichen Wachmannschaft auszuhelfen und mit den Pfeifen auf einem verdammten Feld am Stadtrand rumzustehen. Mir sind in dieser Zeit ganze fünf Scáth vor den Bogen gekommen, vor das Schwert kein einziger. Und jetzt sollen wir zwei unbedingt heute noch einen Kategorie Fünf erledigen? Nachdem dir neulich ein Kategorie Vier fast die Schulter zertrümmert hätte? Das kann doch nicht sein Ernst sein!«
»Die Schulter ist wieder in Ordnung«, murrte O’Mally zwischen zwei Happen Ei und einem Bissen Brot. »Sonst hätte Hortis, der verfluchte Quacksalber, mich niemals vor die Tür geschickt. Geschweige denn, dass ich auf den Platz gedurft hätte. Du weißt doch, wie streng der Übungswart die Wiederzulassungslisten der Verletzten kontrolliert.«
»Mag schon sein, aber was ist mit der Praxis?«, blieb O’Brannick beharrlich. »Du kannst noch so ein guter Jäger sein, wenn du nicht dauernd in Übung bist, grenzt ein Auftrag wie der hier an Selbstmord. Vor allem nach drei Wochen Zwangspause.«
»Sorg lieber dafür, dass deine Eierpampe nicht kalt wird«, erwiderte Ira ungerührt. »Solange das Zeug warm ist, ist es noch einigermaßen erträglich. Außerdem jagt es sich schlecht auf leeren Magen.«
»Du hast wirklich vor, das durchzuziehen, ja?«
»Kommt ganz drauf an, wie viele Nächte du noch bei verbotenen Faustkämpfen deinen Jägerstand und deinen Hals riskieren willst.« O’Mally zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Ist ja nicht so, dass du bei den letzten Schlägereien ein paar Rogen gewonnen hättest, statt welche zu verlieren.«
Unwillkürlich berührte Tighan eine Stelle über seinem linken Wangenknochen, die zwei Nächte zuvor eine böse Prellung davongetragen hatte. Er konnte froh sein, dass er von blauen Flecken oder Blutergüssen verschont blieb, auch wenn das nicht auf den damit verbundenen Schmerz zutraf. Immerhin fiel seine derzeitige nächtliche Nebenbeschäftigung dadurch nur solchen Jägern auf, die ebenfalls bei den Kämpfen zugegen waren, und untereinander bewahrte man darüber eisernes Schweigen. Den Fiagi jer Scáth war es streng untersagt, sich bei den in stickigen Hinterzimmern diverser zwielichtiger Pubs ausgetragenen Faustkämpfen blicken zu lassen ‒ sei es nun als Teilnehmer oder um bei den Wetten mitzumischen. Auf einen Verstoß gegen dieses Verbot folgte der sofortige unehrenhafte Ausschluss aus der Gemeinschaft der Fiagi. Hierfür musste man aber erst einmal von den Wachleuten des Königs, dem die gesamte Jägerschaft der Stadt unterstellt war, auf frischer Tat ertappt werden.
Der Sonne Gnade sei Dank ließ sich das mit der nötigen Portion Umsicht vermeiden. Nicht vermeiden ließ sich hingegen das Pech, von dem O’Brannick jüngst heimgesucht worden war. Seine zurückliegenden vier Kämpfe waren ordentlich danebengegangen und hatten ein gähnendes Loch in seinen Geldbeutel gerissen. Die Teilnahme erforderte von jedem der beiden Kontrahenten eine happige Gebühr, die am Ende zusammengerechnet und im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel zwischen dem Pub-Besitzer und dem Sieger des Kampfes aufgeteilt wurde. Da Tighan und Ira ihren jeweiligen Verdienst als gemeinsame Logenkasse behandelten, war von dieser also nicht mehr viel übrig. Genau genommen hatte sie das erbärmlich schmeckende Frühstück den Rest ihrer Ersparnisse gekostet.
»Und?«, hakte Ira nach.
»Ich bleib dabei. Mir gefällt das nicht.«
»Tja, wenn wir uns lange genug sträuben, wird Leighs sich bestimmt ‘ne andere Loge suchen. Ich frag mich bloß, ob auch nur einer von uns beiden danach jemals wieder einen anständigen Auftrag abbekommt.«
Leise seufzend vertilgte Tighan ein paar Happen seiner Mahlzeit. Das Rührei machte das Rumoren in seiner Magengegend keinen Deut besser, obwohl er sofort mit etwas Brot und Tee nachspülte. Er schüttelte sich innerlich. Einerseits ob des Essens, vor allem aber wegen der vor ihnen liegenden Aufgabe, die zugleich Iras ersten Arbeitstag seit seiner Verletzung darstellte. Ein Scáth der Kategorie Fünf war eine Mordsbestie, die normalerweise von einer mindestens vier bis fünf Mann starken Jägerloge erlegt wurde. Leighs konnte für sie jedoch zu einem weitaus größeren Problem werden, sollten sie sich weigern, seinen explizit an ihre Loge gerichteten Auftrag durchzuführen. Außerdem waren sie blank, und wenn Tighan ehrlich sein wollte, hatte er die Nase gestrichen voll davon, sich als Aushilfswache und Teilzeitschläger zu verdingen. Welch andere Wahl konnte ein Mann da noch haben?
»Wir brauchen einen guten Köder«, sagte er schließlich.
»Hast du an Leighs’ Auflistung der Absude jetzt auch noch was zu meckern?«
»Blödsinn.« O’Brannick schüttelte energisch den Kopf. »Die Liste für den Hausalchemisten ist vollkommen in Ordnung. Was das angeht, macht unser Herr Stadtoberalchemist keine Fehler. Allerdings neigt er manchmal dazu, bei der Wahl seiner Logen sehr, sehr tief in die Jauche zu greifen.«
Ira schnaufte gequält. »Du kannst damit einfach nicht aufhören, oder?«
Tighan pflichtete ihm mit einem Grinsen bei. Dann winkte er ab und wurde wieder ernst.
»Wie gesagt, auf den Köder kommt es an«, erklärte er. »Und damit meine ich nicht das Zeug, mit dem wir das Vieh anlocken. Wir brauchen noch was anderes. Irgendwas, das interessant genug ist, um den Schatten abzulenken.«
Für einen Moment herrschte Schweigen zwischen den beiden Männern, und die sie umgebende Geräuschkulisse verschaffte sich stärkeres Gehör. Es wurde gefaselt und diskutiert. Teller, Besteck und Becher klirrten. Aus irgendeiner Ecke drang lautes Fluchen hervor. Dem Wortlaut nach war wohl jemand mit seiner Leistung bei einer frühen Partie Siebenschläfer unzufrieden. Ein anderer schimpfte auf Stanton, wovon die mit ihm am Tisch sitzenden Fiagi kaum Notiz nahmen. Während des Essens über den alten Koch herzuziehen, gehörte im Th’Each Dhá schon seit Jahren zum guten Ton und bedurfte keiner zusätzlichen Kommentierung mehr.
»Vielleicht Flint?«, meldete sich Ira unvermittelt zu Wort. »Ich glaube, der kann selbst einen Kategorie Fünf genügend aus der Fassung bringen, dass wir dem Viech so lange egal sind, bis wir den ersten Schlag führen. Und wenn der richtig sitzt, dann haben wir den schlimmsten Teil schon hinter uns.«
Zuerst wollte O’Brannick aus tiefster Seele widersprechen. Als er jedoch etwas genauer darüber nachdachte, erschien ihm der Einfall seines Freundes gar nicht mal so verkehrt. Normalerweise ließen sie den Burschen bei Buck Bouwler oder einem seiner Gehilfen im Zeugkeller, wenn sie ihren Aufträgen nachgingen. Langsam aber sicher war es allerdings an der Zeit, dass Flint seinen Anteil zum Fortbestehen ihrer Jägerloge beitrug. Immerhin hatten Ira und er ihn seinerzeit nicht nur zum Spaß aus der Gosse gezogen und bei sich aufgenommen.
»Aye, warum eigentlich nicht«, befand Tighan. Er schob den mittlerweile geleerten Teller von sich und ließ einen satten Rülpser ertönen, ehe er mit dem restlichen Tee und der Milch dem aufwallenden Sodbrennen Einhalt gebot. »Am besten gehe ich ihn holen.« Er lachte leise. »Vielleicht ahnt der Gute schon, was ihm blüht, und zögert den Moment der Wahrheit absichtlich hinaus.«
»Oder er ist dumm genug, dass er es vor Freude kaum abwarten kann.«
Mit einem Nicken deutete Ira in Richtung der auffliegenden Küchentür. Hindurch sprang nicht etwa einer der Jungen, sondern ein wahrer Riese von einem Hund. In strammem Trab ‒ was in diesem Fall der Geschwindigkeit eines gestreckten Galopps nahekam ‒ zwängten sich in raues, mittellanges, graurot gestromtes Fell gehüllte einhundertdreißig Pfund zwischen Bänken und Jägern hindurch und hielten schnurstracks auf Ira und Tighan zu.
Je näher das eine Schulterhöhe von knapp drei Fuß innehabende Tier den beiden kam, umso eindringlicher wurden sein aufgeregtes Fiepen und das Wedeln der kräftigen Rute. Kurz vor seinem Ziel mäßigte der Hund seine Geschwindigkeit zu verhaltenem Schritt. Er senkte Lefzen leckend den Kopf und klappte die kleinen Schlappohren unterwürfig nach hinten, worauf O’Brannick wie immer als Erster begrüßt wurde. Sachte drückte Flint seinen mächtigen Schädel in die Hände des Fiagi. Der Hund verstummte, schloss die hellbraunen Augen und genoss es, sich Wangen und Hals kraulen zu lassen.
»Na, du alter Stinkfisch?«, schmunzelte Tighan, dem eine deftige Fahne aus Hundeatem und altem Fleisch entgegenschlug. »Hast dich wieder gut an Stantons Abfällen bedient, hm?«
Zur Antwort schnaubte Flint gedämpft und wich ein wenig zurück. Anschließend schnupperte er in der über den Tabletts stehenden Luft herum, rümpfte die Nase, schüttelte sich und bedachte Tighan mit eindeutigem Blick.
›Klar, na und? Was ihr da gefressen habt, kann unmöglich frischer gewesen sein.‹
Lachend tätschelte O’Brannick dem Hund den Kopf. Der leckte ihm zur Antwort über die Finger, wandte sich ab und wiederholte die Begrüßungsprozedur bei Ira. Seiner Miene nach zu urteilen, konnte auch der Fiagi Flints Maulgeruch nichts abgewinnen. Da hierzu jedoch alles gesagt war, begnügte er sich damit, dem Hund eine Portion Streicheleinheiten zu gönnen und dabei in eine andere Richtung zu atmen. Überraschenderweise besserte sich der Gestank, nachdem Flint die tote Rote Weberin verschlungen hatte.
Hauptzeugwart Buck ›der Schleifer‹ Bouwler, gut sechs Fuß groß, beleibt, dreiundsechzig Jahre alt und faltig, quälte den morschen Schemel unter seinem ausladenden Gesäß nicht grundlos. Vor ihm auf dem abgenutzten, mit einem dick eingewachsten Tuch bedeckten niedrigen Tisch stapelten sich zweiundzwanzig Schwerter samt Scheiden, die in der vergangenen Nacht ihren Besitzern ohne jeden Zweifel das Leben gerettet hatten. Jede der Klingen war über und über besudelt mit einer klebrigen, tiefschwarzen Masse, die träge auf das Wachstuch tropfte und dort zähe Pfützen bildete. Dem Schleifer sei Dank würde die ganze Sauerei in zahlreichen Lappen verschwinden, mit denen die Wäscherei später bestimmt ihre wahre Freude hatte. Oder eher das Gegenteil. Schon die Fiagi gaben sich nur ungern mit dem Blut der Scáth ab. Eine Abneigung, die auf die Waschfrauen ungleich mehr zutraf. Buck rückte sein Hinterteil auf dem protestierend knarzenden Schemel etwas bequemer zurecht und griff sich einen dicken, grauen Lappen von dem am Boden liegenden Stapel. Der Geruch scharfer Bleiche und einer mit speziellen alchemistischen Stoffen angereicherten Lauge stieg ihm in die Nase und verursachte ein stechendes Brennen hinter seiner Stirn. Geräuschvoll zog der Schleifer einen Klumpen Rotz hoch, spuckte saftig neben den Tisch und steckte den Zeigefinger in die Brusttasche seiner abgewetzten Lederweste. Als der Finger wieder zum Vorschein kam, klebte ein Tropfen einer zähen, fast durchsichtigen Paste daran. Wie beiläufig schmierte Buck sich das Mittel unter die Nase, holte tief Luft und atmete erleichtert auf. Die in der Paste verarbeiteten Öle taten sofort ihre Wirkung und vertrieben den Kopfschmerz, bevor er sich unter seinem schütteren, grauen Haar ausbreiten konnte. Bouwler vertrug den Gestank von Lauge und Bleiche nicht mehr besonders. Aber wo ein gesundheitliches Problem war, da gab es meistens auch irgendeinen Quacksalber, der es lösen konnte.
Mit besänftigtem Schädel und einem fröhlich gepfiffenen Lied auf den Lippen nahm Buck das erste Schwert zur Hand. Ein einziger Blick seiner geschulten, blauen Augen genügte, um zu wissen, dass sich die ganze Mühe hier nicht mehr lohnte. Der vormals glänzende Stahl war verdammt hart rangenommen worden und die Schneide dermaßen beschädigt, dass einfaches Nachschleifen ebenso sinnlos war wie das Putzen. Der Hauptzeugwart vermutete (durchaus richtig, obschon er es nicht wusste), dass die Waffe Bekanntschaft mit einem Knochenpanzer gemacht hatte und ihr diese Begegnung zum Verhängnis geworden war. Schulterzuckend legte er das Schwert beiseite, wohl wissend, dass er am Abend mehr als bloß dieses eine auf seinen Eselskarren laden und zum Einschmelzen in die Schmiede fahren würde. Doch vorerst galt es, sich dem Stahl zu widmen, den er noch retten konnte. Unbeirrt griff der Schleifer sich die nächste Klinge und nickte zufrieden. Man sah ihr die Strapazen des letzten Kampfes an, in ihrem Fall konnte er den Spuren mit Lappen und Schleifstein aber zu Leibe rücken. Sein Pfeifen fortsetzend, begann er die Waffe sorgfältig vom Scáthblut zu befreien.
Das schwarze Zeug war hartnäckig, pappte am Stahl fest wie Kletten in Hundefell. Nur an einer Stelle des Schwertes befand sich kein einziger Tropfen davon, und das war die Hohlkehle. In die Schwerter der Fiagi und der königlichen Soldaten wurde heutzutage regelmäßig eine Stange des in angenehm hellem aber blendfreiem Licht erstrahlenden Sonnenglases eingeschmiedet. War die Klinge fertiggestellt, wurde in einem langwierigen Schleifgang nachträglich die Hohlkehle so tief eingearbeitet, dass das Sonnenglas auf beiden Seiten des Schwertes freigelegt wurde. Auf diese Weise erhielt man die einzig wirkungsvolle Waffe gegen einen Scáth. Natürlich war es auch möglich, die Biester mit Hilfe einer herkömmlichen Klinge zu verletzen oder gar in die Flucht zu schlagen. Allerdings regenerierten sich durch einfachen Stahl geschlagene Wunden bei den Schatten innerhalb kürzester Zeit, ohne dauerhaften Schaden zu hinterlassen. Erst das Licht aus dem Sonnenglas beschied den Scáth ihr verdientes Ende. Gleiches galt für mit dem Glas versehene Pfeile und Armbrustbolzen, bei denen sich das Material in den Spitzen und Schäften befand.
Während Buck putzte und pfiff, begutachtete und aussortierte, behielt er das geschäftige Treiben im Zeugkeller im Auge und hörte aufmerksam zu. In dem üblichen Brimborium der zwischen den dicht stehenden Reihen schmaler Waffenschränke umherwuselnden Jägerlogen gab es oftmals interessante Gespräche zu belauschen. Heute hatte sich die für ihre Aufträge rüstende Tagesschicht die Loge von Ira O’Mally und Gusvig Jones als Hauptthema ausgesucht. Offenbar hatte diese dämliche, sich Stadtoberalchemist schimpfende Hundsfott von Reamonn Leighs die zwei Jäger dazu bestimmt, ihm die Innereien eines Kategorie Fünf zu besorgen. Bouwler hielt diese Wahl für idiotisch, womit er keineswegs allein war. Das allgemeine Gerede im Zeugkeller bot den besten Beweis dafür. Nicht, dass die beiden Männer keine guten Jäger abgaben, oh nein. Zweierlogen zählten zu den Besten ihres Fachs; eine Auszeichnung, die auch Jones und O’Mally anhaftete.
Jeder, der mit den Fiagi jer Scáth zu schaffen hatte oder sich halbwegs für ihr Tun interessierte, wusste, worauf sich Ruf und Erfolg der Zweierlogen begründeten. Der Schleifer gehörte freilich dazu. Zum einen lag es an den Scáth. Als Schattenwesen, die sie waren, besaßen sie zahlreiche unangenehme Eigenschaften, von denen eine für die Zusammenarbeit der Fiagi besonders bedeutsam war: Wer auch immer einen Scáth betrachtete, sah nicht zwangsläufig dieselbe Gestalt, welche die Menschen um ihn herum sahen. Also war es wichtig, dass die Mitglieder einer Jägerloge möglichst ähnliche Wesen vor sich hatten, sobald sie einem Schatten gegenüberstanden. Nur auf diese Weise konnte vermieden werden, dass ein Mann von einem durch einen anderen Jäger als sechsköpfiges Ungeheuer erkannten Schatten angegriffen wurde, obwohl er selbst nur zwei Köpfe sah. Passierte so was, konnte der Scáth den Jäger überrumpeln, noch bevor der bedauernswerte Tropf begriff, was vor sich ging. Sahen die Schatten für eine Loge aber nahezu gleich aus, wurde die Gefahr böser Überraschungen auf ein Mindestmaß reduziert.
Der große Vorteil der Zweierlogen bestand darin, dass sie jeden Scáth in derselben Form wahrnahmen. Selbst im Detail gab es keine Abweichungen, weshalb gerade die Jagden der Zweier besonders erfolgreich waren. Wie in den meisten Fällen brachten die Vorteile aber auch gewisse Nachteile mit sich. Gleiches äußerte sich bei den Zweierlogen darin, dass sie aufgrund der geringen Größe ihres Verbundes maximal auf Schattenwesen der Kategorie Vier angesetzt werden konnten ‒ und schon das galt in Fachkreisen als zu riskant. Aus diesem Grund gingen die Aufträge für Zweiertrupps nicht über die Kategorie Drei hinaus. Wohlgemerkt, normalerweise.
Was Jones und O’Mally betraf, so schien zumindest Reamonn Leighs eine Vorliebe dafür zu haben, die beiden in größere Gefahr zu bringen als nötig. Immerhin war jeder Fiagi ein wertvoller Kämpfer, und Buck Bouwler hielt es für ausgesprochen schwachsinnig, nur einen einzigen davon sinnlos zu verheizen. Leighs beharrte da offenbar auf einer anderen Meinung. Zuletzt hatte er das bewiesen, indem er die Jungs einen Vierer hatte jagen lassen, der O’Mally für mehrere Tage ins Krankenbett beförderte. Das neueste im Zeugkeller kursierende Gerücht setzte der ganzen Sache allerdings die Krone auf. Pah! Einen Fünfer sollten sie kleinmachen! Der Schleifer spuckte abermals aus. Die armen Schweine konnten froh sein, wenn es nicht andersrum ausging.
Während Buck noch mit sich verhandelte, ob er genügend Rotz für einen dritten Spuckfleck übrig hatte, betraten Tighan und Ira den Raum, dicht gefolgt von Flint, der sehnsüchtig zum Hauptzeugwart herüber schielte. Schließlich steckte in den Taschen des alten Mannes immer ein Stück Wurst oder Käse, über das er sich hermachen durfte. Zu seinem Leidwesen gab ihm jedoch keiner der beiden Männer die Erlaubnis, sich von ihnen zu entfernen. Stattdessen waren sie wie angewurzelt am Treppenabsatz stehen geblieben, und jetzt bemerkte auch der Hund die plötzlich eingetretene Stille samt der in ihre Richtung gewandten Blicke. Schnaubend hockte er sich auf die Hinterpfoten und wartete ab, was als nächstes passieren würde.
»Was denn, eh?«, rief O’Mally. »Tut nicht so, als wären wir hier die einzigen Todgeweihten! Wir haben uns die Scheiße alle selber ausgesucht, und heute sitzen Gus und ich halt mal ‘n bisschen tiefer drin als sonst! Kümmert ihr euch um euren Haufen, wir kümmern uns um unseren!«
Das allgemeine Schweigen wurde von kollektivem Gemurmel abgelöst. Herauszuhören war, dass die meisten der anwesenden Fiagi Ira recht gaben. Nur Sekunden später lebte die gewohnte Geräuschkulisse wieder auf, und neuerlich wurde es laut im Zeugkeller. Jeder beschäftigte sich mit seinen eigenen Angelegenheiten. Doch den zwei Freunden entging keineswegs, dass sie mit manch heimlicher Mitleidsmiene betrachtet wurden.
»Man will fast meinen, wir hätten schon den Bestatter hinter uns herlaufen«, knurrte Ira leise. »Würde mich nicht wundern, wenn die Hälfte von den Spinnern drauf spekuliert, dass sie sich bald was von unserem Zeug unter den Nagel reißen können.«
»Aye«, brummte Tighan missmutig.
Der Gemeinschaftssinn der Fiagi mochte groß sein. Dennoch gab es unter ihnen nicht wenige, die jede Gelegenheit nutzten, mit den Hinterlassenschaften eines gefallenen Jagdgenossen ihren spärlichen Besitz aufzuwerten. Sei es nun, dass sie sich dessen Kleidung, Waffen und Geld aneigneten oder im wahrsten Sinne des Wortes dessen Seele verkauften ‒ so sie diese denn vor den Suchern fanden.
»Bevor mein Arsch nicht alt und runzlig ist, bekommt ihr von mir gar nichts, ihr verdammten Hurensöhne!«, brüllte O’Mally in die Runde. Sein unvermittelter Ausruf erntete ein paar beschämte Blicke, aber auch zahlreiche Lacher.
Grinsend hob Grady Naith den Kopf. »Als ob irgendeiner von uns deine durchgefurzten Altmännerhosen haben will.«
»Besser durchgefurzte Hosen, als gar keine.«
Iras trockener Kommentar verursachte noch mehr Gelächter, da Grady für seinen scherzhaften Einwurf beim Umkleiden innegehalten hatte und nun mit blankem Hintern im Raum stand. Eine Tatsache, die ihn nicht im Mindesten interessierte. Vielmehr gehörte er zu denen, die deswegen am Lautesten grölten.
»Komm, wir schauen beim Schleifer vorbei«, schmunzelte Tighan und klopfte seinem Freund auf die Schulter.
»Aye. Mal sehen, was er dazu sagt, dass unser Stinkfisch heute mit auf die Jagd geht.«
Zwei Minuten später spuckte Buck Bouwler den Freunden vor die Füße. Er kraulte Flint selig lächelnd im Nacken und steckte ihm ein zweites Stück Käse zu. Der Hund schluckte es im Ganzen, schmatzte danach jedoch weiter, als hätte er den gesamten Laib zwischen den Zähnen.
»Der wird beißen«, befand Buck. »Der is’ nich’ so ausgebildet wie die andern. Das is’n Halbwilder. Wenn der mal frisches Scáthblut gerochen hat ‒ ich schwör‘s dir in die nackte Hand, Jones ‒, dann hört der nich’ mal mehr auf dich. Ihr wisst genau, dass die Köter nur beißen dürfen, wenn ‘se sollen. Der alte Leighs reißt euch die Ärsche bis zum Nacken auf, wenn der Stinker seine Zähne in dem schwarzen Drecksvieh versenkt und irgendwas erwischt, was die Hundsfott braucht. Und den Köter lässt er mit dem Schwanz zuerst den nächstbesten Baum raufziehen.«
»Ich hab Flint auf dem Weg hierher alles erklärt«, widersprach Tighan ruhig. Er verpasste dem Hund einen freundschaftlichen Klaps gegen die Rippen, worauf das Tier endlich mit dem Schmatzen aufhörte. Flint verzog die Lefzen wie zu einem Grinsen und wedelte sachte mit der Schwanzspitze. »Er hat durchaus begriffen, worum es geht.«
»Du magst vielleicht ‘n komischen Draht zu dem ganzen Viehzeug haben«, gab der Schleifer zurück. »Aber du kannst mir nich’ weismachen, der Köter würd von dem, was du sagst, Wort für Wort kapieren.«
»Werden wir ja sehen.« Ira warf Buck einen herausfordernden Blick zu. »Ich nehm noch Wetten an. Bist eingeladen.«
»Schreis mal nich’ so laut, O’Mally«, mahnte Bouwler. »Hier unten gibt’s Ohren, die hören das tausend Meilen gegen ‘nen Sturm, und zack ...« Er schlug sich mit der Faust in die Handfläche. »... hat’s euch erwischt. Außerdem weiß ich, dass eure Geldkatzen so leer sind wie ‘n Darm nach ‘nem ordentlichen ...«
»Schon gut, schon gut«, unterbrach Tighan ihn hastig. »Spar dir das, ja? Ich hab für heute genug bildhafte Vergleiche aus deinem Schandmaul gehört, danke. Und Ira, auf den Auftrag wetten wir nicht. Verstanden?«
»Och, die Quote würde sich aber lohnen«, ertönte Gradys Stimme hinter den beiden Freunden, während er seine Hosen zurechtrückte und den Gürtel schloss. Anschließend zog er ein zerfleddertes Notizbuch und ein Stück Kohle aus der Hosentasche und begann, auf einer leeren Seite herumzukritzeln. »Das wäre eine saubere Wette. Ich rechne hoch zwei für lebend, hoch fünf für tot. Da kann ich euch jetzt schon verraten, worauf die meisten unserer Jagdgenossen setzen werden.«
»Und ich kann dir verraten, wer gleich seine Kohle durch die Nasenlöcher atmet, wenn er nicht sofort verschwindet.«
O’Brannick und Naith starrten einander erzürnenden Auges an. Ira seufzte langgezogen. Flint fiepte einmal und wedelte etwas stärker mit der Rute. Der Schleifer stopfte ihm den dritten Brocken Käse ins Maul, zog die Nase hoch, behielt das Resultat allerdings für sich. Die übrige Belegschaft ignorierte das Szenario.
»Hab es ja gesagt«, murmelte Bouwler. »Ohren überall. Hässliche noch dazu.«
»Sagt wer?«, knurrte Grady.
»Sag ich«, erwiderte Buck düster.
»Weißt du, Gusvig, im Grunde ist es doch so«, warf O’Mally ein. »Wenn wir für lebend wetten, machen wir keinen Verlust. Entweder kommen wir zurück und heimsen die gewonnenen Rogen ein oder wir verrecken da draußen. Dann kann uns das Ergebnis sonst wo dran vorbei gehen. Wir bekommen es ja eh nicht mehr mit.«
»Wahre Worte, O’Mally«, stimmte Grady ihm zu, ohne den Blick von Tighan abzuwenden. Derweil begann sein linker Mundwinkel verdächtig zu zucken.
»Wie schade, dass wir blank sind«, erwiderte O’Brannick gefährlich leise. In seinen Augen funkelte es verräterisch, und er trat einen Schritt auf Naith zu. Damit verkürzte er die Distanz zwischen ihnen auf anderthalb Armeslängen.
»Dann geb ich euch eben Kredit«, sagte Naith. Das Zucken im Mundwinkel wurde etwas stärker.
»Vergiss außerdem die Quote nicht, mein Freund«, fügte Ira hinzu. »Egal, wie viel du setzt, du bekommst es doppelt zurück. Selbst nach Abzug der geliehenen Rogen ist das immer noch ein netter Gewinn.«
Abermals entstand ein Moment des Schweigens, der von O’Brannick beendet wurde.
»Ach, bei des Henkers Bart, was soll’s«, rief er, warf die Hände in die Luft und schenkte seinem mühsam unterdrückten Grinsen die Freiheit. »Das Leben ist kurz. Wetten wir.«
»Nichts anderes hab ich erwartet«, lachte Grady. Er war sichtlich froh, von seiner gespielt eisernen Miene erlöst worden zu sein. Demonstrativ wedelte er mit dem Wettbuch. »Meine Herren, die Einsätze, wenn ich bitten darf.«
»Fünf für lebend«, entschied Tighan.
»Fünf was?«
»Fünf in Bronze.«
Grady Naith hielt inne und ließ die Schreibkohle sinken. Er machte ein Gesicht, als hätte man ihm eröffnet, dass seine Mutter ihn mit einem Esel gezeugt hatte. Eine Vorstellung, die manchmal gar nicht so abwegig schien. »Willst du mich auf den Arm nehmen?«
O’Brannick grinste schelmisch. »Aye.«
»Jetzt aber im Ernst.«
»Zwanzig in Silber.«
»Das ist doch mal ein Wort!« Naith schlug auf sein Buch, dass die Kohle staubte. Sein Eselsvatergesicht verwandelte sich in das eines Wolfes, der vor einem frisch erlegten Kaninchen saß. »O’Mally?«
»Ich geh mit.«
»Schön, schön.« Grady notierte eifrig. »Schleifer?«
»Lass mich bloß in Frieden. Ich hab noch ‘n paar Schwerter zu putzen.«
»Also zehn in Silber auf die höhere Quote. Wie üblich.«
Bouwler grunzte einsilbig. Grady nickte zufrieden und schrieb weiter. Tighan und Ira bedachten den Hauptzeugwart mit fassungslosem Blick.
»Männer!«, ließ sich Naith vernehmen, wobei er sein Buch über dem Kopf schwenkte. »Heute wird gewettet! Hoch zwei für lebend zu hoch fünf für tot auf O’Mally und Jones!«
»Ausgerechnet du setzt auf tot?«, sprach Ira den Gedanken beider Freunde aus.
Buck Bouwler zuckte bloß gleichgültig mit den Schultern. »Nimm’s mir nich’ krumm, aber ich bin halt ‘n Realist.«
2
Wir alle waren Zeuge. Wir alle sahen, wie die Sonne fiel. Wir versteckten uns vor dem goldroten Scherbenregen, der die Hälfte unserer Stadt zerstörte, eines unserer Dörfer dem Erdboden gleichmachte und zahlreiche Leben beendete. Seitdem gibt es über unseren Köpfen nichts weiter außer rabenschwarzer Nacht, während wir uns an das wärmespendende Licht des Sonnenglases klammern und um das Überdauern unseres Geschlechts bangen! Doch wer, so frage ich euch, wer trägt die Schuld daran? Wer kommt in Betracht? Meine Freunde, die Antwort liegt so nahebei. Denn niemand anderes als die Dharoi’Sola, deren Mitglieder sich selbst so vollmundig die Sonnenfunken nennen, zehrten jahrhundertelang an den Kräften unserer geliebten Sonne! Ich sage, die Dharoi’Sola haben sie durch ihre Gier nach Macht zerstört, und dafür gehören sie gejagt! Ich sage, die gerechte Strafe für dieses Verbrechen darf nicht geringer sein als der Tod! Lasst sie uns rächen, meine Freunde! Rächen wir den Niedergang unserer Sonne!
Anonymer Aushang eines Bürgers
der Stadt Ardys vom Dezember des Jahres 1378 MZ
Vermutlicher Anfang der Feindseligkeiten
gegenüber den Dharoi’Sola
Bürger und Bürgerinnen von Rokhanos! Hiermit sei folgender Beschluss verkündet: In Verständigung mit sämtlichen Herrschern der vier Kontinente des Weltenrunds wurde ‒ begründet durch den Fall der Sonne vor einem Jahr ‒ der Beginn eines neuen Zeitalters entschieden. Der Beschluss wird vollzogen zur Wende des Jahres 1379 Menschenzeitalter (MZ). Nach der Letzten Nacht wird der Erste Tag des Jahres 1 Dunkelzeitalter (DZ) eingeläutet und die ausschließliche Allgemeingültigkeit dieser Zeitrechnung in Kraft gesetzt. Fortan sei dem Volk geboten ... (weiteres unleserlich).
Dearan O’Larning
Über die Zeitalter des Weltenrunds Band II ‒ Fundstücke aus königlichen Archiven
SCHATTEN UND LICHT
Dort, wo heute die Th’Each jer Fiagi standen, die zusammen mit den angrenzenden Pferdeställen das bis zur südöstlichen Stadtmauer reichende Übungsgelände der Jäger vom Rest Mar-Dinyes trennten, hatte sich vor zweiunddreißig Jahren ein ausgedehnter Park befunden. Es hatte Bäume gegeben, hochgewachsen, dicht belaubt und penibel gepflegt. Saftige, sauber geschnittene und von hellgrau gekiesten Wegen durchzogene Wiesen hatten kleine, klare Teiche voll mit Goldfischen und Fröschen umschlossen. Überall fanden sich üppige Beete, farbenfroh bestückt mit den schönsten Blumen, die Rokhanos’ Flora zu bieten vermochte. Ein feiner, süßer Duft hatte dieses Fleckchen Erde regiert und weiß gestrichene, wohlplatzierte Pavillons hatten die vorbeiziehenden Spaziergänger zum Verweilen auf schlank gezimmerten Bänken eingeladen. In der Tat erwies sich der Park von Mar-Dinye damals als ein Ort des Müßiggangs und der Erholung. Er bildete die Geburtsstätte zahlloser, aus klangvollen Bardenkehlen gesungener Balladen. Er war Treffpunkt junger wie alter Verliebter, das verwunschene Dickicht, in dessen Sicherheit manch ein Jüngling den Mut gefunden hatte, um die Hand seiner Liebsten anzuhalten. Der Hort tausender Geheimnisse, Tanzfläche bunter Schmetterlinge, die ihren Reigen zum Rhythmus verschiedenster Singvögel vollführten, und noch so viel mehr.
Dann kam die Stunde, zu der die Sonne zerbarst und das ewige Dunkel seinen traurigen Anfang nahm.
Einen Tag und eine Nacht lang stürzten in goldfarbenem Licht erstrahlende Splitter vom Himmel herab. Die Kleinsten vom Ausmaß einer durchschnittlichen Handfläche, die Größten zehnmal höher und zweimal breiter als das prunkvollste Königsschloss. Tief gruben sie sich in Rokhanos’ Leib, schufen neue Schluchten, zerstörten Häuser, Dörfer und halbe Städte. Auch der berühmte Park von Mar-Dinye fiel dem glühenden Schauer zum Opfer. Ebenso geschah es mit einem erheblichen Teil des Ostviertels und dreien der fünf zum Herrschaftsgebiet des Hauses var Greagen gehörenden Dörfer, von denen nur eines wieder aufgebaut werden sollte.
Da waren sie nun, die Scherben der Sonne, die landesweit bekannt wurden als das Sonnenglas, das riesigen Zähnen gleich allerorts aus der Erde ragte. Kühl in der Berührung und dennoch warm im Licht begannen die Scherben schon bald, das schockstarre Rokhanos mit zaghaft keimender Hoffnung zu tränken. Während das Weltenrund nur noch ein tiefschwarzes, sternengespicktes Firmament überspannte, während in dessen finster gewordenen Ecken die Erde gefror, die Felder verkümmerten, Menschen und Tiere erkrankten und immer mehr von ihnen starben, stellte sich heraus, dass im Leuchtkreis des Sonnenglases alles wuchs und gedieh, als sei niemals etwas geschehen.
Es dauerte ein halbes Jahr, ehe der findige Glaser Leewood Droghter und sein Freund Wayland Calwaggen – ein angesehener Alchemist – einen Weg fanden, das Sonnenglas zu zerlegen und zu verarbeiten. Droghter baute eine mit Diamantsplittern bewehrte Säge, die in Verbindung mit einer von Calwaggen erfundenen Säure in der Lage war, den widerstandsfähigen Scherben zu Leibe zu rücken. Hilfsbereit, wie beide Männer waren, behielten sie das Geheimnis ihrer Werkzeuge und Chemikalien nicht für sich. Sie verbreiteten die Neuigkeit im gesamten Land, damit sich jede Stadt selbst helfen konnte.
Wenig später erblühte die gestreute Saat junger Zuversicht in vollem Glanz, denn im Verlauf der Aufräumarbeiten offenbarte das Sonnenglas eine weitere positive Eigenschaft. Durch das Zerlegen schwanden weder seine Leuchtkraft noch seine Wärme. So dauerte es nicht lange, bis man die ersten Lichtpfähle auf fruchtlose Felder, vom Frost zerfressene Viehweiden und in die Nähe der Häuser stellte. Und siehe da: Korn, Gemüse, Obst, Gras und Pflanzen begannen neuerlich zu sprießen, kräftiger als je zuvor. Menschen und Tiere überwanden langsam die nagende Trübnis der Ewigen Nacht und fassten wieder frischen Lebensmut. In der Folge gingen Leewood Droghter und Wayland Calwaggen, der Glaser und der Alchemist aus Rionn, als Bewahrer des Überlebens der Menschen von Rokhanos in die Geschichte ein; in ihrer Verantwortung noch weitere Erfindungen tragend, die die Handhabung des Sonnenglases entschieden erleichterten.
Das Dasein der Rokhaner hätte trotz aller Widrigkeiten zufrieden fortbestehen können. Wären da nicht die Kriege, die Verfolgungen und die Sache mit den Seelen gewesen. Und die Rückkehr der Scáth.
Von dem aus Mar-Dinyes Herzen emporragenden Glockenturm schlug die siebte Stunde, als Tighan und Ira auf den Rücken ihrer Pferde den Stall verließen. Mit Ausnahme der Fiagi, den vom Schichtwechsel aufgescheuchten königlichen Soldaten sowie einer Handvoll umher eilender Bediensteter war auf den Straßen noch keine Menschenseele zu sehen. Üblicherweise verließen die im Südviertel der Stadt ansässigen Mitglieder der Adelsfamilien frühestens zur neunten Stunde ihre Häuser. Den hinter zahlreichen Fenstern flackernden Kerzen nach zu urteilen, war jedoch das allmorgendliche Aufhübschen der titeltragenden Gesichter längst in vollem Gange.
Froh darüber, dass sie im Gegensatz zu den meisten anderen Jägerlogen entschieden hatten, die Stadt durch das Südtor zu verlassen, genoss O’Brannick die Ruhe, solange sich noch die Gelegenheit bot. Immerhin erwartete Ira und ihn eine harte Jagd, für die es sich auch mental zu wappnen galt. Und sollten sie aller Erwartungen zum Trotz tatsächlich wieder heimkehren, würde das für einigen Trubel sorgen. Schon beim Gedanken daran fuhr Tighan ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Er hatte seine Gründe, nicht gerne im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu stehen. Doch im Fall des Falles würde er sich auf Ira verlassen ‒ wie immer. Sein alter Freund besaß ein unschlagbares Talent dafür, sämtliche Blicke schaulustiger Menschen allein auf sich zu lenken. Auf diese Weise drängte er Tighan weit genug in den Schatten, dass er bei den Umstehenden in Vergessenheit geriet und sich unbemerkt aus dem Staub machen konnte.
Leise seufzend warf O’Brannick einen flüchtigen Blick zum Himmel. Verfremdet durch den Tag und Nacht über der Stadt hängenden, hellgoldenen Lichtschleier erwartete ihn dort nur mehr die gewohnte Schwärze. Nicht einmal die Sterne ließen sich heute sehen. Sie zogen es vor, hinter einer Wand aus regenschwangeren Wolken zu kauern und Rokhanos mit Ignoranz zu strafen. Aber mal ehrlich, was interessierten ihn schon die Sterne? Sie konnten ohnehin niemandem helfen. Weder jetzt noch irgendwann. Geschweige denn, dass sie es früher jemals getan hätten. Ein Stern formte bloß den stillen Beobachter des Laufes der Zeit und allem, was daraus folgte. Und manchmal, da verschlossen selbst sie, die alles sahen, ihre Augen vor den Ereignissen auf dem Weltenrund.
Mal bloß gut, dass ich nicht an Vorzeichen glaube, dachte Tighan. Er zog seinen breitkrempigen Hut tiefer ins Gesicht, ließ die Zügel locker und die Lider zufallen. Daran, dass seine schwarz und weiß gescheckte Kaltblutstute Vala sich selbständig machte, wenn er sie nicht lenkte, brauchte er keinen Gedanken zu verschwenden. Einerseits kannte sie die Marschrichtung. Andererseits trottete sie Iras Wallach, einem gelegentlich etwas störrischen, kastanienbraunen Kaltblut namens Norin, sowieso überall hinterher.
Abgeschottet von den visuellen Eindrücken der Stadt, die in Gestalt von geschmackvollen bis protzigen Herrenhäusern, schmalen, ordentlich begrünten Vorgärten und im Abstand von je fünfhundert Fuß zueinander den Gehsteig säumenden Lichtpfählen daherkamen, drangen die vorhandenen Geräusche ungleich intensiver zu O’Brannick vor.
Da war das sanfte Knirschen von Sattelleder und Zaumzeug. Das helle Klicken, verursacht durch Flints auf dem glatt gelaufenen Kopfsteinpflaster aufschlagende Krallen, vermischt mit von den Häuserwänden widerhallendem Klappern eisenbeschlagener Pferdehufe. Er hörte das flüsterleise Klirren der drei gläsernen Absudphiolen, die sie vom Hausalchemisten des Th’Each Dhá bekommen hatten. In einer von Iras Satteltaschen schaukelten sie im Einklang mit Norins Bewegungen gemächlich hin und her. Ab und zu huschten eilige Schritte auf ledernen Sohlen vorüber. Einmal vernahm er eine liebliche Melodie, gesummt von zwei trödelnden Mägden, und kurz darauf kreuzte in strammem Marsch eine königliche Kompanie die Straße. Wahrscheinlich waren sie auf dem Weg zu den Wachtürmen am südlichen Abschnitt der Stadtmauer, um dort mit ihren Kameraden die Plätze zu tauschen.
Tighan spürte, wie er sich zusehends in Mar-Dinyes rauem, morgendlichen Gesang verlor und seine Gedanken in die Vergangenheit abdrifteten. Eigentlich hatte er vorgehabt, sich an etwas Schönes zu erinnern. Irgendwas, das ihm für die bevorstehende Jagd zusätzliche Kraft geben, ihn zum Durchhalten anspornen würde. Wenn man sich zu zweit einem Kategorie Fünf entgegenstellte, war jede Form der Motivation willkommen, die den eigenen Überlebenswillen stärker machte. Doch an diesem Morgen vermochte er in den Tiefen seines Gedächtnisses auf nichts als finstere Abgründe zu stoßen.
Tighan O’Brannick hatte im Laufe seines Lebens in viele solcher Schluchten blicken müssen. Er war als Kämpfer aufgewachsen, dessen einzige Bestimmung darin lag, zu schützen und zu verteidigen. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte er das getan, indem er seine Geburtsstadt Ludvijen mitsamt ihren Bürgern und ihrem König vor Unheil bewahrte, so gut es eben ging. Es war eine Aufgabe gewesen, die ihn voll und ganz erfüllte und in gewisser Weise sogar glücklich machte. Dennoch hatte er Träume gehabt. Sein Sehnlichster war es gewesen, zuerst jeden Winkel von Rokhanos und danach das Weltenrund zu bereisen. Er hatte geplant, die übrigen drei Kontinente zu erkunden und engere Kontakte mit Seinesgleichen zu knüpfen.
Irgendwann, so hatte er sich damals immer wieder vorgebetet. Irgendwann, Tighan, wirst du all das tun können, und dein Herz wird vor Freude platzen wollen.
Worte, die seinerzeit einen schwachen Trost formten. Allerdings gaben sie ihm selbst dann noch einen Grund, jeden Morgen aus dem Bett zu steigen und seiner Bestimmung zu folgen, wenn er drohte, ihr vollends überdrüssig zu werden. Denn im Grunde seines Herzens war er der festen Überzeugung gewesen, dass er eines Tages im Norden von Rokhanos sterben würde, ohne je den Fuß über dessen Grenzen gesetzt zu haben.
Am Ende war alles anders gekommen. Wider seiner Prinzipien hatte er jeglichen Pflichten entsagt, seinem König den Rücken gekehrt, ganz Ludvijen im Stich gelassen. Er war dem verzweifelten Ruf einer höheren Macht gefolgt und hatte sich einer neuen Mission verschrieben, die von größerer Bedeutung war, als die Belange sämtlicher Königsstädte des Weltenrunds zusammen.
Tighan hatte jeden Funken Kraft auf diese Sache verwendet, sich redlich bemüht, sämtlichen Widrigkeiten zu trotzen und den schwarzen Klüften, die ihm allerorts entgegenschrien, mit seinem Licht den Garaus zu machen. Aber nichts davon genügte. Die Klüfte blieben düster, der Ruf unerfüllt, und schließlich stellte er das letzte Mitglied einer uralten Gemeinschaft dar, das sich nicht länger fähig sah, der desolaten Lage dieser Welt noch etwas entgegenzusetzen. Kurzum, er hatte es versaut und zwar gründlich. Also war er nach zweiundzwanzig Jahren Exil in sein Heimatland zurückgekehrt. Er hatte sich den Fiagi jer Scáth von Mar-Dinye angeschlossen, im Bestreben, aus dem Rest seines kläglichen Lebens das Beste zu machen. Denn ungeachtet der erlittenen Fehlschläge war ihm eines niemals verloren gegangen: sein ausgefeiltes Talent im Umgang mit dem Bogen und dem Schwert.
Tja, dachte er betrübt. Wer zu sonst nichts taugt, hält eben für den Rest der Welt den Kopf hin, bis er ihm von den Schultern gefressen ...
Iras leichter Fauststoß, der O’Brannick in die Seite traf, riss ihn aus seinen unangenehmen Tagträumen. Erst jetzt bemerkte er, dass die Pferde stehen geblieben waren, und warf seinem Freund einen verwunderten Blick zu. Unter versteinerter Miene deutete Ira auf das nur mehr hundert Schritte entfernt liegende Südtor. Als Tighan den Kopf in die gewiesene Richtung wandte, erübrigte sich jede weitere Frage. Die beiden Wachen gewährten gerade vier Männern mit einem hölzernen Eselskarren Einlass. Es waren Sucher.
Zum zweiten Mal an diesem Morgen überlief O’Brannick ein eisiger Schauer. Während sie sich im Zeugkeller für ihre Jagd rüsteten, hatten er und O’Mally davon gehört, dass im Verlauf der letzten Tagesschicht eine komplette Sechserloge vom Th’Each Cúig, dem fünften Jägerhaus, verschwunden war. Wie in derlei Fällen üblich, hatte man auf die Vermisstenmeldung einen Suchertrupp ausgesandt, dessen Auftrag jedes Mal derselbe war: Nach Hause zu schaffen, was die Scáth von den Jagdgenossen übrig gelassen hatten, ehe sich jemand anderes etwas davon unter den Nagel riss und es heimlich an den Höchstbietenden verschacherte.