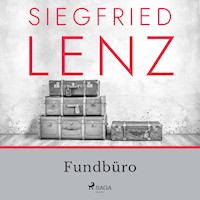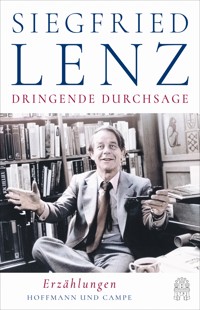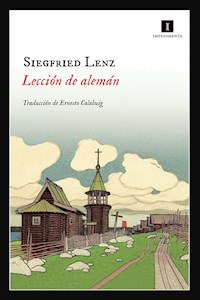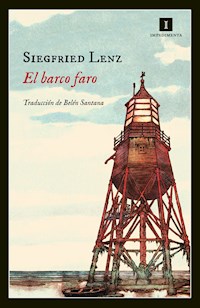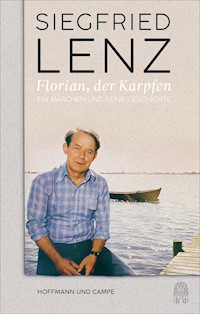10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hinrichs ist Taucher; in diesem Beruf ist er alt geworden. Fast zwanzig Jahre ist er Tag für Tag hinuntergestiegen in das trübe Wasser des Hafenbeckens, um dort seiner gefahrvollen Arbeit nachzugehen. Jetzt will er sich nicht ausbooten lassen. Um seine Anstellung nicht zu verlieren, fälscht er seine Papiere und macht sich jünger. Er tut dies mit der Entschlossenheit eines Mannes, der seine letzte Chance wahrnimmt. "Es ist ein Roman ohne Pathos, ohne Aufschrei ... Diese völlig effektlos wirkende Kunst des Erzählens, dieses betont distanzierte Untertreiben jeglicher Dramatik, diese souveräne Stille, das alles verleiht dem Buch eine geradezu unheimliche, leise Kraft ..." (Hans Hellmut Kirst) Diese E-Book-Ausgabe von "Der Mann im Strom" wird durch zusätzliches Material zu Leben und Werk Siegfried Lenz' ergänzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Siegfried Lenz
Der Mann im Strom
Roman
Literatur
Hoffmann und Campe Verlag
»Komisch, nicht? Nach all den Jahren auf der Landstraße und in den Eisenbahnzügen, nach so viel Abschlüssen und Geschäften endet man damit, daß man tot mehr wert ist als lebendig.«
ARTHUR MILLER Der Tod des Handlungsreisenden
Der Mann im Strom
Er lag ruhig im Sand, er lag allein in der Dunkelheit vor dem Strom, sein Kopf ruhte in den aufgestützten Händen, und sein Blick lief über das Wasser, ernst und genau. Es war trübes, drängendes Wasser, das der Strom heranbrachte, es floß glatt vorbei und schnell, es floß vorüber ohne Strudel und Behinderung, und der Junge blickte darüber hin zum anderen Ufer. Er beobachtete die Lichter unterhalb der Böschung, er verfolgte ihre Bewegungen, die Lichter kreuzten und schnitten sich, sie wanderten starr und sanft durch die Dunkelheit, grüne und gelbe Lichter. Und dann sah er, wie ein Dreieck aus Lichtern sich von der Böschung löste, es löste sich von den anderen Lichtern, es löste sich von der Stadt und ihrer hohen Helligkeit, die hinaufzureichen schien bis in den Himmel, und drehte in den Strom.
Das Lichterdreieck der alten Fähre kam schräg auf ihn zu, lautlos und langsam, es bewegte sich mit feierlicher Starrheit durch den Abend über dem Strom, und der Junge sah der Fähre entgegen und blieb liegen im feinen, kalten Sand.
Er wartete, bis die Fähre festmachte am Holzsteg, er verfolgte ruhig, wie sie die schweren Manila-Trossen von Bord aus über die Poller warfen; die letzte Bewegung der Fähre fing sich jetzt in den Leinen, sie kam zur Ruhe, sie lag knarrend und scheuernd am hölzernen Landungssteg.
Es stieg nur ein Mann aus, ein hochgewachsener, magerer Mann, er trug eine alte Lederjoppe, Baumwollhosen, genagelte Stiefel, er ging über die Laufplanke und den Steg hinab, er ging den Uferpfad entlang und bog dann ab zu dem alten Haus auf dem Sandhügel. Der Junge sah ihn den Pfad heraufkommen, er erkannte ihn sofort; er erhob sich und lief die Rückseite des Sandhügels hinauf, und als der Mann den kleinen Schuppen erreicht hatte, stand der Junge in der dunklen Stube am Fenster und sah hinaus. Er sah, wie der Mann am Schuppen stehenblieb, nur sein Oberkörper ragte aus dem Schatten heraus, er stand einsam und unbeweglich da und blickte zur Fähre zurück, die losgemacht hatte und schräg gegen die Strömung mahlend davonfuhr.
Das Haus war klein, es war niedrig und zeitgeschwärzt, und es lag allein auf einem Sandhügel, von einem schäbigen Zaun bewacht, der an der Rückseite aufhörte. Auf der Rückseite war ein offener Platz, zugig und sandüberweht, mit wenigen Schritten zu überqueren, und da stand der Schuppen, da lagen Holz und alte Bootsteile, und auf der Rückseite war auch der Eingang.
Der Junge wartete, bis der Mann aus dem Schatten hervortrat und auf das Haus zuging, und als er die genagelten Stiefel auf dem Steinflur hörte, lief er nach hinten und schlüpfte unter die Bettdecke. Er rollte sich zusammen, nur sein junges, ernstes Gesicht und das sonnengebleichte Haar sahen unter der Decke hervor, seine Hände waren zu Fäusten geballt und gegen den Leib gepreßt. Als das Licht aufflammte, warf er sich auf die Seite und zog die Decke nach. Er zog sie ganz über den Kopf und beobachtete durch einen schmalen Spalt den Mann, und er sah, wie der Mann die Joppe auszog und sie an einen Haken hängte, und wie er in eine Tasche der Joppe griff und einen Packen Papiere herausholte. Der Mann ließ die Papiere durch seine Hände gleiten, er betrachtete und prüfte sie der Reihe nach, weiße, blaue Papiere, dann stopfte er sie, bis auf ein blaues Heft, wieder in die Tasche zurück und ging langsam zum Fenster. Er hob eine Fußbank auf, stellte sie vor eine Kiste, die mit bedrucktem Wachstuch bedeckt war, und setzte sich hin. Er legte sein blaues Taucherbuch auf die Kiste und begann zu blättern, er las mit ausdruckslosem Gesicht alle Eintragungen, und es war sehr still in der Stube. Und nachdem er alles gelesen hatte, blätterte er zur ersten Seite zurück, preßte das Buch mit der Hand auseinander und ließ es aufgeschlagen vor sich liegen. Dann stand er auf und zog eine Rasierklinge aus dem Spiegelrand, er holte Tinte vom Küchentisch, er holte ein Messer und ein Stück Holz und legte alles auf die Kiste.
Der Junge vergrößerte den Spalt zwischen Decke und Bett, und jetzt sah er, wie der Mann die Rasierklinge mit dem Messer in ein Holzstück klemmte und sie vorsichtig auf das Papier setzte, seine Finger bewegten sich, ein dünnes, kratzendes Geräusch entstand, und während er von Zeit zu Zeit die Papierkrümel auf die Erde blies, blitzte die Rasierklinge schnell und scharf auf.
Das Gesicht des Mannes war weit nach vorn gebeugt, er sah sehr alt aus mit seinem mageren Nacken, mit dem dünnen Haar und den großen, rissigen Händen, die das Holzstück mit der Rasierklinge führten; er hat in seinem ganzen Leben noch nie so alt ausgesehen, dachte der Junge, sein Hals ist alt, sein Rücken ist alt, alles an ihm.
Die Rasierklinge fuhr fein und energisch über das Papier, es war gutes Papier, glattes Vorkriegspapier, das kaum faserte, und die Ecke der Klinge biß sauber an einer Zahl herum, folgte sorgfältig ihrem Bogen, tilgte sie aus, und dann setzte die Klinge bei einer anderen Zahl an, ein kleiner Druck zwang sie ins Papier, sie bewegte sich, scharf und blitzend, sie kratzte sich mit all ihrer wunderbaren Schärfe durch die zweite Zahl hindurch und löschte sie aus. Von den vier Zahlen waren jetzt nur noch zwei übriggeblieben, sie allein standen noch für das Geburtsjahr, und der Mann blies über die leere Stelle und säuberte mit dem Handrücken nach. Er schob das Taucherbuch dicht unter die Lampe, hob es hoch, hob es nah vor die Augen und begutachtete die leere Stelle: sie war nicht makellos, sie hatte ein paar rauhe Kratzer, aber die beunruhigten den Mann nicht. Er legte das Taucherbuch wieder auf die Kiste und nahm das Messer in die Hand, es war ein großes Messer mit breiter, starker Klinge, und er umschloß es fest mit seinen Fingern und drückte die flache Klinge auf die leere Stelle. Das tat er mehrmals, dann ließ er die flache Klinge über die Kratzer gleiten, immer nach einer Seite, und schließlich erhob er sich und preßte die Klinge mit aller Kraft auf das Buch: jetzt waren die Rauheiten und Kratzer verschwunden. Er ließ das Buch aufgeschlagen liegen.
Er holte sich eine halbe Zigarette aus der Joppe und zündete sie an, setzte sich wieder auf die Fußbank und rauchte und blickte unverwandt auf die unvollständige Zahl.
Plötzlich kniff er die Zigarette aus und warf die Kippe auf das Fensterbrett, er zog sich die Tinte heran, einen Federhalter, ein Blatt Papier, und während er in das Taucherbuch starrte, begann er zu schreiben. Er schrieb Zahlen, er schrieb sie unter- und nebeneinander, verglich sie mit angestrengtem Gesicht, und auf einmal schob er das Übungsblatt zur Seite und schrieb zwei neue Zahlen in das Taucherbuch. Er war wieder geboren.
Er wartete, bis die Tinte eingezogen war, wischte sich die Hände an den Hosen ab, legte Messer, Rasierklinge und Tinte weg, und dann schwenkte er das Buch hin und her und drückte es zuletzt behutsam gegen die Fensterscheibe.
Der Junge bewegte sich unter der Decke und versuchte, den Spalt nach oben zu vergrößern; er fingerte vorsichtig herum, aber da wurde die Decke jäh von ihm fortgerissen, so daß er bloß dalag. Der Mann ließ die Decke auf den Boden fallen und stand groß neben dem Lager des Jungen und blickte auf ihn herab, blickte auf die angezogenen Beine, auf den Leib, auf die zur Abwehr erhobenen Hände, und er bückte sich und bog die Hände des Jungen auseinander und setzte sich neben ihn. Er hielt die dünnen Handgelenke umschlossen und sagte:
»Warum schläfst du nicht?«
Der Junge schwieg und sah ihn unentwegt an.
»Antworte«, sagte der Mann.
»Ich war unten am Steg«, sagte der Junge. »Ich habe auf dich gewartet.«
Der Mann ließ die Handgelenke des Jungen los, er erhob sich, er nahm die Decke auf und breitete sie über den Jungen aus, und dann sagte er:
»Du bist noch jung, Timm. Du mußt viel schlafen.«
Sie blickten einander an, sie sahen sich ruhig und abwartend in die Augen, der Mann hielt das blaue Taucherbuch in der Hand, und plötzlich änderte sich sein Blick, er wurde mißtrauisch und prüfend, er entdeckte den Mitwisser.
»Du hast es gesehen, Timm.«
»Ja, Vater«, sagte der Junge. »Ja.«
»Du verstehst nichts davon«, sagte der Mann, »das sind keine Sachen für dich.«
»Ja.«
»Du wirst mit keinem Menschen darüber reden, Timm. Du wirst auch deiner Schwester nichts sagen. Lena braucht das nicht zu wissen. Das mußt du mir schwören.«
»Ich werde es keinem erzählen«, sagte der Junge. »Das schwöre ich.«
»Da«, sagte der Mann, »nimm das Buch.«
Timm zögerte.
»Nimm das Buch«, befahl der Mann.
Der Junge gehorchte und nahm das Taucherbuch in die Hand. Seine Finger zitterten, er sah ratlos aus, er wollte das Buch auf das Kopfkissen legen, aber der Mann befahl ihm, es zu öffnen.
»Schlag es auf«, sagte er.
Timm schlug das Buch auf, ohne es anzusehen.
»Siehst du was?«
Der Junge warf einen schnellen, scheuen Blick auf das Buch und sah sofort wieder zu dem Mann auf und schüttelte den Kopf.
»Du sollst genau hinsehen«, sagte der Mann. »Du sollst es untersuchen. Laß dir Zeit dabei.«
»Dein Bild«, sagte der Junge. Er zeigte rasch auf die alte, eingestanzte Photographie, die einen jüngeren Mann zeigte, forsch lächelnd, gesund und wohlgenährt.
»Ja«, sagte der Mann. »Das ist mein Bild, du kennst es. Ein feines Bild, was? Das ist achtzehn Jahre her. Aber sieh dir nicht das Bild an, Junge, halt dich nicht damit auf. Du weißt genau, was wichtig ist, worauf es uns beiden ankommt.«
»Du hast radiert«, sagte der Junge, »mit einer Rasierklinge.«
»Wo?«
»Ich weiß nicht«, sagte Timm.
»Dann such es, Junge; komm, zeig mir die Stelle, wo ich radiert habe. Sieh dir alles genau an, so wie die andern es sich ansehen werden. Sag mir, ob man die Stelle erkennt.«
Timm hielt das Buch so, daß das Licht der elektrischen Birne auf das Papier fiel, er sah die neue Zahl im Geburtsdatum, er entdeckte, daß die Rasierklinge hier gearbeitet hatte, aber er tat, als mache es ihm Mühe, die Stelle herauszufinden. Schließlich deutete er mit dem Finger auf die neue Zahl und sagte:
»Hier.«
»Ja«, sagte der Mann, »da ist es. Glaubst du, daß sie es finden werden?«
»Es ist schwer zu erkennen«, sagte der Junge. »Wer es nicht weiß, findet es nicht so leicht.«
»Gott sei Dank«, sagte der Mann. »Ich habe die Geburtszahl geändert, Timm, ich habe mich ein paar Jahre jünger gemacht, und vielleicht werden sie mir jetzt Arbeit geben.«
»Warst du wieder umsonst da?«
»Ja, Junge, es war wieder nichts. Sie brauchen überall Leute heutzutage, sie können nicht genug bekommen, aber sie wollen alle nur jüngere haben. Den Jüngeren brauchen sie weniger zu zahlen, das ist das Entscheidende. Wenn sie einen Alten einstellen, dann müssen sie ihm mehr geben, dann können sie ihm weniger sagen, und vor allem wissen sie nicht, wie lange ein Alter noch bei ihnen bleibt. Bei einem Alten ist zuviel Risiko, der rentiert sich nicht genug. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man zum alten Eisen geworfen wird. Sie sind alle sehr höflich zu dir. Sie behandeln dich, wenn du hinkommst, sehr eilig, und sie sagen auch nicht gleich, was los ist. Zuerst schicken sie dich von einer Personalstelle zur andern, und sie sind alle sehr anständig und bieten dir einen Platz an, und sie meinen alle, daß sie sehr viel tun wollen für dich, und sie reichen dich mit sehr großen Hoffnungen weiter. Du darfst auf den verschiedensten Stühlen sitzen, und du kannst nichts sagen, weil sie heutzutage sehr höflich sind, und wenn du endlich etwas sagen willst, dann merkst du, daß du schon draußen stehst in der Sonne und daß ein höflicher Portier dir nachsieht. Und bei allem hast du nicht einmal gespürt, daß sie dich unentwegt taxiert haben und daß sie dir nicht mehr zugestehen konnten als den Wert für altes Eisen. Das Wrack steckt zu tief im Schlick, eine Bergung ist nicht rentabel. Du gehst sogar weg mit dem Gedanken, daß sie nur dein Bestes wollen, wenn sie dir keine Arbeit geben, sie schicken dich weg aus lauter Güte und Rücksicht, weil sie dir die Arbeit nicht zumuten möchten; denn gerade die Arbeit eines Tauchers verlangt viel und macht einen Mann fertig, und sie wissen aus sehr zuverlässigen Gutachten, daß ein Taucher mit fünfzig eine Menge Stickstoff im Blut hat und ein Risiko ist.
Aber ich gebe es nicht auf, ich kann es noch nicht aufgeben, weil wir noch allerhand brauchen, Lena und du, und darum werde ich noch einmal hingehen, Junge, zu einer anderen Firma. An der Ostküste kannten sie mich, aber hier, in der Stadt, weiß kaum einer, wer ich bin. Ich werde es schaffen, Timm.«
»Sie werden es nicht merken, Vater«, sagte der Junge. »Wer es nicht weiß, findet es nicht.«
Sie schwiegen, denn sie hörten einen leichten Schritt; sie blickten zur Tür, und die Tür öffnete sich nach einer Weile, und Lena kam herein. Sie war sehr jung und blaß, sie hatte schwarzes, kräftiges Haar und hochliegende Backenknochen. Lena war neunzehn und erwartete ein Kind. Sie blieb neben der Tür stehen und sah zu dem Mann und dem Jungen hinüber, sie sah sie erwartungsvoll an aus ihren schwarzen Augen, und als keiner von ihnen sprach, sagte sie:
»Ich schlief schon. Ich träumte, es sei jemand gekommen. Dann wachte ich auf und hörte euch sprechen. Soll ich Tee kochen, Vater?«
»Nein«, sagte der Mann, »nein, Kind. Wir gehen jetzt alle schlafen. Ich bin zufrieden heute, oh Gott, seitdem wir hier sind, bin ich zum erstenmal zufrieden.«
»Ich habe dein Bett schon gemacht«, sagte das Mädchen.
»Gut«, sagte er, »ich gehe hinauf.«
Der Mann stand neben dem Bett des Jungen, er stand unschlüssig da für einen Augenblick, aber plötzlich streckte er seine Hand aus, die große, braune, zitternde Hand, er streckte sie dem Jungen hin in lächelndem Komplizentum, und der Junge ergriff sie und begrub darin sein Gesicht. Dann ging der Mann zu Lena und legte ihr die Hand auf die Schulter, er spürte, wie das Mädchen zitterte, er spürte alle Angst und Erwartung aus ihr heraus, und er lächelte in unerwarteter Zuversicht, und beide gingen hinauf.
Die Barkasse hatte Verspätung. Sie trieb mitten im Strom mit gestopptem Motor, sie konnte nicht anlegen, denn der ganze Landungssteg war abgesperrt. Ein gewissenhaft errechnetes Geviert um den Landungssteg wurde von ausgewählten Polizisten freigehalten; die Polizisten waren blond und freundlich, sie waren gut gelaunt, sie trugen ausnahmslos neue Uniformen. Hinter ihnen stauten sich die Zeitgenossen, und manche fragten die Polizisten, was hier geschehen werde, und die freundlichen, blonden Polizisten gaben unermüdlich Auskunft und wiesen auf den roten Kokosläufer, der den Landungssteg bedeckte. Und sie deuteten auf die behagliche und saubere Regierungsbarkasse, die wohlvertäut am Landungssteg lag. Ihr stand es zu, hier festzumachen, sie war schneeweiß, sie war gewohnt, kostbare Fracht zu tragen; die andern Barkassen mußten sich ein Weilchen gedulden.
Der Mann erkannte seine Barkasse im Strom, er sah, daß sie sich treiben ließ und auf das Ablegen der Regierungsbarkasse wartete, er brauchte sich nicht zu beeilen. Er fühlte nach dem blauen Taucherbuch in der Joppentasche, es steckte noch im Briefumschlag, es steckte zusammen da mit dem Einstellungsbescheid und der Lohnsteuerkarte, dicht neben den Zigaretten. Und er dachte, während seine Finger auf dem alten Briefumschlag lagen, an den Augenblick, als er das Buch aus der Hand gegeben hatte, er dachte an das Mädchen im Kontor, an die freundliche Gleichgültigkeit, mit der sie die Daten aus dem Taucherbuch abgeschrieben hatte, sie hatte nicht einmal zurückgefragt, sich nicht einmal vergewissern müssen. Nachdem sie über das Geburtsdatum hinausgelangt war, hatte er versucht, ihr eine Zigarette anzubieten, aber sie hatte abgelehnt, mit freundlicher Gleichgültigkeit gedankt. Zum Schluß hatte sie ihm alles in die Hand gelegt, alle Papiere, die er brauchte, und auf seinen Gruß hatte sie sehr korrekt und sehr minimal genickt. Über ihrem Schreibtisch hing ein Schild, mit dem eine große Zeitung zu einer Freundschaftskampagne in der Stadt aufgerufen hatte: SEI GUT ZU DEINEM NÄCHSTEN, warb das Schild.
Der Mann stand mit den andern vor dem reservierten Geviert und wartete, immer mehr Zeitgenossen blieben stehen, immer mehr traten hinzu und beschlossen zu bleiben. Und dann wurden sie entschädigt für ihr Warten, wurden schön und angemessen belohnt: zuerst hielt ein kleineres Auto, und ihm entstieg der Protokollchef. Der Protokollchef war ein gutaussehender Mann, er war schlank, er trug einen taubenblauen Anzug, und sein Haar war grau über dem schmalen, jungen Gesicht. In seiner Begleitung befanden sich zwei ebenfalls gutgekleidete Herren, sie waren kräftiger als der Protokollchef, sie hatten einen anderen Gang als er, sie trugen ihre Sonntagsanzüge. Mit ihnen ging der Protokollchef zur Regierungsbarkasse hinab, hier traf er letzte Anordnung, gab letzte Weisung, und die Herren in den Sonntagsanzügen prüften noch einmal die Sicherheit der Laufplanke, prüften die Kissen auf den Bänken und die Lage der Bodenmatten, und plötzlich waren sie verschwunden.
Dann kam das große Auto mit dem ersten Bürgermeister. Auch der erste Bürgermeister war ein gutaussehender Mann, er war kleiner als sein Protokollchef, er war beleibt und älter, aber sein Gesicht war von einprägsamer Gesundheit, es war frisch, es war sonnengebräunt, es war weltoffen wie die Stadt, der er vorstand. Der erste Bürgermeister hatte kaum seinen Wagen verlassen, als eine Autokolonne mit Sirenengeheul anfuhr, alles war abgestimmt, alles war sorgsam berechnet in dieser Stadt – es hatte hier nie an fleißigen Rechnern gefehlt, an blonder Zuverlässigkeit. Die Kolonne hielt, und die freundlichen Polizisten stemmten sich gegen die Zeitgenossen, die herandrängten, die jetzt sehen, die entschädigt werden wollten für ihr Warten.
Der Protokollchef war schweigend empfangen worden, auch der Bürgermeister war schweigend empfangen worden, aber für den, der jetzt aus seinem Auto stieg, rührte sich leichter Beifall, ihm wurde gewinkt, ihm galten die sachlichen Willkommensrufe. Er stand klein und grazil vor seinem Auto, er war kein so gutaussehender Mann wie der Protokollchef, aber er war ein mächtiger Mann, ein reicher Mann, an dessen Name sich Ferne und Legende band. Er hatte ein faltiges, melancholisches Erdnußgesicht, seine Augen blickten schwermütig, die kleine Hand hielt einen kostbaren Stab, und in seinem wilden Ziegenbart schimmerte feines Öl unter der gemäßigten nordischen Sonne, einer Sonne, die er nicht kannte. Daheim, im fernen Bereich seiner Herrschaft, auf seinen glühenden afrikanischen Savannen war die Sonne Gegner und Widersacher, helle Würgerin, feurige Regentin, gnadenloser noch als er; hier war sie erträglich und lau, hier war sie nicht dazu angetan, Leidenschaft zu wecken, träumerische Dumpfheit hervorzurufen, Verfallenheit, hier nicht. Und er blickte einmal zu ihr hinauf, der kleine schwermütige Monarch, blickte mit flüchtiger Nachsicht in ihren nordisch-milchigen Kreis, dann dankte er mit leichter Verwunderung für den sittsamen Beifall und empfing den präparierten Gruß des ersten Bürgermeisters.
Der Bürgermeister sprach blauäugig und laut auf ihn ein, der Monarch lauschte ausdruckslos, lauschte ohne Bewegung, und nach der Rede drückte er dem Bürgermeister die Hand, und sie gingen über den roten Kokosläufer hinab zu der Regierungsbarkasse: die Hafenbesichtigung begann.
Auch dem kleinen, schwermütigen Monarchen sollte der Hafen gezeigt werden, er war der Stolz der großen Stadt, ihr Ruhm, ihre Schatzkammer seit altersher; mit dem Hafen war verbunden, was Tradition hatte in der Stadt, was hier galt und bedeutend war, und der Hafen war sehenswert, ohne Zweifel: das hatten schon frühere Staatsbesuche versichert. Ihn konnte man jederzeit vorweisen, er war ein rechtes Schaustück, ein bewegtes Panorama des Umsatzes, er war das Lieblingsgebiet der Stadt, er war ihre Geschichte, und er war auch ihr Geist.
Und sie bestiegen über die Laufplanke die Barkasse, die sie durch den Geist der Stadt bringen sollte, der Bürgermeister bestieg sie, der zarte Monarch und das ordentliche Gefolge. Sie nahmen Platz hinter schützender Wandung, suchten sich vor dem unablässigen Wind zu bergen, der kleine Herrscher hatte den besten Platz. Er saß verloren und regungslos da, sein Auge zeigte keine sonderliche Erwartung, kein Gefühl, kein Ermessen für das, was ihn umgab, er saß in einer Haltung verlorener Würde da, während die kräftigen Herren in den Sonntagsanzügen hervorkamen und die Regierungsbarkasse von den Leinen befreiten. Langsam drehte sie ab in den Strom, unter Winken und Wünschen der Zeitgenossen, sie drehte in schäumendem Bogen zur Mitte, leicht schlingernd mit ihrer noblen Fracht.
Die Zeitgenossen zerstreuten sich, die andern Barkassen, die im Strom hatten warten müssen, durften jetzt anlegen, sie kamen eilig heran. Der Mann entdeckte seine Barkasse am Firmenzeichen, auch sie kam heran, und er ging mit den andern den Landungssteg hinab. Er ging auf Planken, der rote Kokosläufer war nicht für ihn gedacht, seiner Schuhgröße nicht zugemessen, er drängte neben ihm vorbei, mit schweigendem Blick das Gewebe musternd, über das der sehr kleine Monarchenfuß spurlos geschritten war. Dann stand er auf dem Landungsponton, der unter ihm schwankte und schnalzte und gluckste, er spürte, wie sein Körper sich sanft hob, wie alles sich senkte, nicht tief, nicht bemerkenswert senkte, sondern lind und regelmäßig, weich wie Atemzüge. Und er spürte eine unverhoffte Müdigkeit, einen Zug in den Schultern, eine rieselnde Schwere des Körpers; er achtete nicht auf den gellenden Sturz der Möwen, er stand teilnahmslos da inmitten des sirenenzerrissenen Hafenmittags, mitten im Tuckern und Knattern, ein Fremder in all der geräuschvollen Herrlichkeit seebestimmter Arbeit. Da hörte er seinen Namen, hörte ihn heraufklingen aus einer schwarzen Barkasse. Ein Hüne mit kleinem Kopf und rosigem Kindergesicht rief ihn, und als der Mann hinabsah, vergewisserte sich der Barkassenführer: »Bist du Hinrichs?«
»Ja«, sagte der Mann.
»Dann steig ein.«
Und er sprang in die Barkasse hinab, keine Laufplanke erleichterte es ihm, an Bord zu kommen, aber er landete gut auf den Bodenbrettern, balancierte sich aus. Der Hüne begrüßte ihn nicht, er stand schon am Ruder, er wirbelte das Ruderrad herum, schätzte mit schnellem Blick den Abstand nach beiden Seiten und manövrierte die Barkasse hinaus.
Sie fuhren quer über den Strom, an der Werft vorbei und weiter durch eine Schleuse, und schließlich waren sie am Ziel. Es war ein entlegenes Hafenbecken, windstill und tot, und es roch hier anders als auf dem Strom; es war nicht das milde Salz der Meerluft, nicht der Geruch von Teer und Terpentin, von Ruß und Bretterzeug, hier lag ein anderer Geruch. Hier bemerkte er nur Fäulnis und Verfall, schlappende Leblosigkeit; das Wasser war zäh, das Wasser war schmierig und ölbedeckt, Kohlstrünke trieben darauf, Büchsen und Abfallholz, keine Möwe ließ sich hier nieder. Es war noch alles, wie es am Ende des Krieges gewesen war, die Kaimauern waren zerschmettert, die Giraffenhälse der fahrbaren Kräne amputiert, verdreht und zerrissen, Lokomotiven lagen rücklings neben den Schienen, und im Wasser, vertäut noch, gespenstisch befestigt an Poller und Dalben, ruhten die Schiffe. Sie waren auseinandergebrochen, sie hatten sich auf die Seite gelegt, einige waren friedlich und senkrecht auf Grund gegangen, nur ein kleiner Passagierdampfer, der über das Heck gesunken war, hob seinen Bug verzweifelt heraus aus dem Wasser, und es sah aus, als hätte er im letzten Augenblick, da die Bombe ihn traf, Kurs auf den Himmel nehmen wollen. Eine der Schuten war gekentert, sie hing kieloben in ihrer Vertäuung, sie lag schwarz und gewaltig und tot da, wie ein Wal, der in rätselhaftem Entschluß seichtes Wasser gesucht hat, Sterbewasser, Todesstrand.
Die Barkasse glitt langsam durch das Becken der toten Schiffe, ihre Bugwellen wanderten kaiwärts, zogen schwappend und murmelnd durch verrostete Aufbauten, brachen sich, verliefen. Der Hüne stoppte den Motor, die Barkasse fuhr aus und ging beim Taucherprahm längsseits, der in einer Ecke des Hafenbeckens vertäut lag; sie wurden schon erwartet.
Hinrichs begrüßte die Pumpenleute und den Signalmann, es war eine kurze Begrüßung, denn sie hatten einen Taucher runtergeschickt und verfolgten seine Arbeit auf dem Grund des toten, schwarzen Hafenbeckens. Und dann begrüßte er auch die anderen Männer auf dem Prahm, es waren ruhige, schweigsame Männer, alle jünger als er, alle stabiler. Sie gaben ihm die Hand, sie nickten ihm zu, sie zeigten auf die Anzahl der Wracks und ließen ihn stehen. Und der Hüne zeigte ihm sein Schapp, wo er seine Sachen loswerden konnte, sie hatten schon alles bereitgelegt für ihn und vorher zugepaßt, und er lächelte und sagte zu dem Hünen:
»Der Anzug hat nicht lange gelegen.«
»Nein«, sagte der Hüne.
»Ist mein Vorgänger weg?«
»Er hat nicht aufgepaßt. Er wurde bewußtlos nach einer Sprengung, und sein Kopf drückte das Helmventil auf. Er wollte die Sprengung unten abwarten, dabei ist es passiert. Er war zu alt.«
Hinrichs blickte auf den Taucheranzug, er hing glatt und grau an der Wand, er sah in dem schwachen Licht wie ein Mann aus, der sich erhängt hat. Hinrichs ging näher heran, er nahm den Taucheranzug vom Haken und trug ihn fast liebevoll ans Licht. Seine Hand fuhr prüfend über das derbe Gummi, fuhr hinauf bis zum Schulterstück, und der Hüne sah ihm nachdenklich zu. Und plötzlich sagte er:
»Wenn dein Vorgänger vor der Sprengung ausgetaucht wäre, hätte er den Anzug noch getragen. Er war der älteste Meister in der Firma, und du weißt, wie die Alten sind. Er hat sich zuviel zugetraut.«
»War das hier?«
»Es war drüben im Strom«, sagte der Hüne.
»Du sollst jetzt runter und nachschaun, was unten los ist mit dem Frachter, ob wir eine Trosse rumkriegen oder ob wir schneiden müssen.«
»Gut«, sagte Hinrichs. Und er zog seine alte Lederjoppe aus und die Stiefel und machte sich fertig, und der Hüne half ihm mit schweigender Selbstverständlichkeit. Sie hatten ein Modell des gesunkenen Dampfers angefertigt, sie gaben und erklärten es ihm, und er prägte sich alles ein und studierte das Modell wie einen Gegner. Und zum Schluß setzte ihm der Hüne den aus Kupfer getriebenen Helm auf, der Helm war herrlich und schwer und leuchtete in der Sonne; das Kopfstück wurde mit dem Schulterstück verschraubt, die Bolzen wurden angezogen und die Fenster eingesetzt, und jetzt war er allein und stimmlos und getrennt von der Welt. Sein Gesicht sah ernst und gespannt aus hinter der vergitterten Scheibe des Helms, er bewegte sich nicht, er beobachtete, wie der Hüne die Zusatzgewichte auf der Brust befestigte, und er dachte an die Zeit an der Ostküste, an den Taucherprahm, den er besessen hatte, und an die hundert Male, die er hinabgestiegen war. Er dachte auch einen Augenblick an den, der vor ihm den Taucheranzug getragen hatte, an den alten Meister, der in dieser Haut ertrunken war, und er empfand plötzlich Mitleid für ihn und einen sonderbaren Dank. Und als er jetzt schwer und schleppend zur Einstiegleiter ging, nahm er sich vor, nach dem Namen des alten Meisters zu fragen, wenn er wieder heraufkäme, er wollte wissen, wer er war und wie er ausgesehen hatte, der Mann, dessen Anzug er trug. Aber über allem, über den Gedanken an seinen Vorgänger und über der Schwere seines Schritts, empfand er eine wunderbare Genugtuung, ein ruhiges und wortloses Glück, das ihn die Müdigkeit vergessen ließ und alles, was ihn beim Einsteigen belastete: es war die Genugtuung der Arbeit.
Er kletterte auf die Einstiegleiter, der Hüne bückte sich zu ihm herab, er schob sein rosiges Kindergesicht an das Helmfenster und sagte:
»Es ist Schlick unten. Du mußt viel Luft im Anzug haben.« Und als Hinrichs nickte, lächelte er ihm zu, und dann wiederholte der neue Taucher die Signale, die Luft-, die Gefahren- und die Beruhigungssignale mit der Leine, und er erhielt den leichten, guten Schlag auf den Helm, den sie alle bekommen, wenn sie runtergehen.