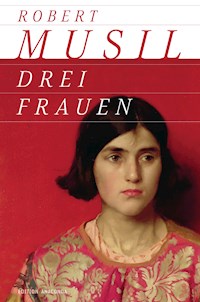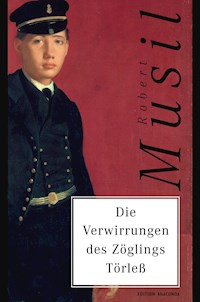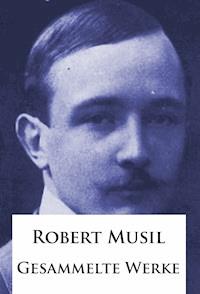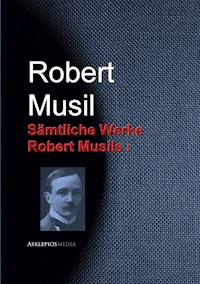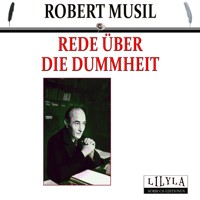0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
In diesem gewaltigen Meisterwerk, das viele auch mit Joyces "Ulysses" oder Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" vergleichen, passiert oberflächlich wenig. Die Protagonisten verlieren sich in ihren Gedanken und Emotionen. "Der Mann ohne Eigenschaften" ist ein ironischer, aber auch ein humanistisch-utopischer Roman. Über 2000 Seiten umfasste Musils letztlich unvollendet gebliebene Geschichte, nachdem sich der Berliner Rowohlt-Verlag weigerte, weitere Bände zu bezahlen. Daher liegen Teile des dritten und vierten Teils nur fragmentarisch vor - sie entstammen dem Nachlass. "Der Mann ohne Eigenschaften" ist eine sperrige Lektüre, die sich dem Leser nur schwer erschließt. Der titelgebende "Held" Ulrich, ein Mann mit allen Möglichkeiten aber ohne Heimat; gebildet, jung, gesund, aber nicht fähig, sich festzulegen, weder beruflich noch menschlich, er bleibt ein Mann ohne Konturen, eben ohne Eigenschaften. Robert Rudolf Matthias Edler von Musil wurde am 6. November 1880 in Klagenfurt, Österreich geboren und starb am 15. April 1942 in Genf. Er war ein österreichischer Schriftsteller und Theaterkritiker. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2758
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Robert Musil
Der Mann ohne Eigenschaften
Robert Musil
Der Mann ohne Eigenschaften
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Rowohlt, Berlin, 1930/33 3. Auflage, ISBN 978-3-954182-89-3
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Erstes Buch
Erster Teil -- Eine Art Einleitung
1 -- Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht
2 -- Haus und Wohnung des Mannes ohne Eigenschaften
3 -- Auch ein Mann ohne Eigenschaften hat einen Vater mit Eigenschaften
4 -- Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch Möglichkeitssinn geben
5 -- Ulrich
6 -- Leona oder eine perspektivische Verschiebung
7 -- In einem Zustand von Schwäche zieht sich Ulrich eine neue Geliebte zu
8 -- Kakanien
9 -- Erster von drei Versuchen, ein bedeutender Mann zu werden
10 -- Der zweite Versuch. Ansätze zu einer Moral des Mannes ohne Eigenschaften
11 -- Der wichtigste Versuch
12 -- Die Dame, deren Liebe Ulrich nach einem Gespräch über Sport und Mystik gewonnen hat
13 -- Ein geniales Rennpferd reift die Erkenntnis, ein Mann ohne Eigenschaften zu sein
14 -- Jugendfreunde
15 -- Geistiger Umsturz
16 -- Eine geheimnisvolle Zeitkrankheit
17 -- Wirkung eines Mannes ohne Eigenschaften auf einen Mann mit Eigenschaften
18 -- Moosbrugger
19 -- Briefliche Ermahnung und Gelegenheit, Eigenschaften zu erwerben. Konkurrenz zweier Thronbesteigungen
Zweiter Teil -- Seinesgleichen geschieht
20 -- Berührung der Wirklichkeit. Ungeachtet des Fehlens von Eigenschaften benimmt sich Ulrich tatkräftig und feurig
21 -- Die wahre Erfindung der Parallelaktion durch Graf Leinsdorf
22 -- Die Parallelaktion steht in Gestalt einer einflußreichen Dame von unbeschreiblicher geistiger Anmut bereit, Ulrich zu verschlingen
23 -- Erste Einmischung eines großen Mannes
24 -- Besitz und Bildung; Diotimas Freundschaft mit Graf Leinsdorf und das Amt, berühmte Gäste in Einheit mit der Seele zu bringen
25 -- Leiden einer verheirateten Seele
26 -- Die Vereinigung von Seele und Wirtschaft. Der Mann, der das kann, will den Barockzauber alter österreichischer Kultur genießen. Der Parallelaktion wird dadurch eine Idee geboren
27 -- Wesen und Inhalt einer großen Idee
28 -- Ein Kapitel, das jeder überschlagen kann, der von der Beschäftigung mit Gedanken keine besondere Meinung hat
29 -- Erklärung und Unterbrechungen eines normalen Bewußtseinszustandes
30 -- Ulrich hört Stimmen
31 -- Wem gibst du recht?
32 -- Die vergessene, überaus wichtige Geschichte mit der Gattin eines Majors
33 -- Bruch mit Bonadea
34 -- Ein heißer Strahl und erkaltete Wände
35 -- Direktor Leo Fischel und das Prinzip des unzureichenden Grundes
36 -- Dank des genannten Prinzips besteht die Parallelaktion greifbar, ehe man weiß, was sie ist
37 -- Ein Publizist bereitet Graf Leinsdorf durch die Erfindung »Österreichisches Jahr« große Unannehmlichkeiten; Se. Erlaucht verlangt heftig nach Ulrich
38 -- Clarisse und ihre Dämonen
39 -- Ein Mann ohne Eigenschaften besteht aus Eigenschaften ohne Mann
40 -- Ein Mann mit allen Eigenschaften, aber sie sind ihm gleichgültig. Ein Fürst des Geistes wird verhaftet, und die Parallelaktion erhält ihren Ehrensekretär
41 -- Rachel und Diotima
42 -- Die große Sitzung
43 -- Erste Begegnung Ulrichs mit dem großen Mann. In der Weltgeschichte geschieht nichts Unvernünftiges, aber Diotima stellt die Behauptung auf, das wahre Österreich sei die ganze Welt
44 -- Fortgang und Schluß der großen Sitzung. Ulrich findet an Rachel Wohlgefallen. Rachel an Soliman. Die Parallelaktion erhält eine feste Organisation
45 -- Schweigende Begegnung zweier Berggipfel
46 -- Ideale und Moral sind das beste Mittel, um das große Loch zu füllen, das man Seele nennt
47 -- Was alle getrennt sind, ist Arnheim in einer Person
48 -- Die drei Ursachen von Arnheims Berühmtheit und das Geheimnis des Ganzen
49 -- Beginnende Gegensätze zwischen alter und neuer Diplomatie
50 -- Weitere Entwicklung. Sektionschef Tuzzi beschließt, sich über die Person Arnheims Klarheit zu verschaffen
51 -- Das Haus Fischel
52 -- Sektionschef Tuzzi stellt eine Lücke im Betrieb seines Ministeriums fest
53 -- Man führt Moosbrugger in ein neues Gefängnis
54 -- Ulrich zeigt sich im Gespräch mit Walter und Clarisse reaktionär
55 -- Soliman und Arnheim
56 -- Lebhafte Arbeit in den Ausschüssen der Parallelaktion. Clarisse schreibt an Se. Erlaucht und schlägt ein Nietzsche-Jahr vor
57 -- Großer Aufschwung. Diotima macht sonderbare Erfahrungen mit dem Wesen großer Ideen
58 -- Die Parallelaktion erregt Bedenken. In der Geschichte der Menschheit gibt es aber kein freiwilliges Zurück
59 -- Moosbrugger denkt nach
60 -- Ausflug ins logisch-sittliche Reich
61 -- Das Ideal der drei Abhandlungen oder die Utopie des exakten Lebens
62 -- Auch die Erde, namentlich aber Ulrich, huldigt der Utopie des Essayismus
63 -- Bonadea hat eine Vision
64 -- General Stumm von Bordwehr besucht Diotima
65 -- Aus den Gesprächen Arnheims und Diotimas
66 -- Zwischen Ulrich und Arnheim ist einiges nicht in Ordnung
67 -- Diotima und Ulrich
68 -- Eine Abschweifung: Müssen Menschen mit ihrem Körper übereinstimmen?
69 -- Diotima und Ulrich. Fortsetzung
70 -- Clarisse besucht Ulrich, um ihm eine Geschichte zu erzählen
71 -- Der Ausschuß zur Fassung eines leitenden Beschlusses in bezug auf das Siebzigjährige Regierungsjubiläum Sr. Majestät beginnt zu tagen
72 -- Das In den Bart Lächeln der Wissenschaft oder Erste ausführliche Begegnung mit dem Bösen
73 -- Leo Fischels Tochter Gerda
74 -- Das 4. Jahrhundert v. Chr. gegen das Jahr 1797. Ulrich erhält abermals einen Brief seines Vaters
75 -- General Stumm von Bordwehr betrachtet Besuche bei Diotima als eine schöne Abwechslung in den dienstlichen Obliegenheiten
76 -- Graf Leinsdorf zeigt sich zurückhaltend
77 -- Arnheim als Freund der Journalisten
78 -- Verwandlungen Diotimas
79 -- Soliman liebt
80 -- Man lernt General Stumm kennen, der überraschend auf dem Konzil erscheint
81 -- Graf Leinsdorf äußert sich über Realpolitik. Ulrich gründet Vereine
82 -- Clarisse verlangt ein Ulrich-Jahr
83 -- Seinesgleichen geschieht oder warum erfindet man nicht Geschichte?
84 -- Behauptung, daß auch das gewöhnliche Leben von utopischer Natur ist
85 -- General Stumms Bemühung, Ordnung in den Zivilverstand zu bringen
86 -- Der Königskaufmann und die Interessenfusion Seele-Geschäft. Auch: Alle Wege zum Geist gehen von der Seele aus, aber keiner führt zurück
87 -- Moosbrugger tanzt
88 -- Die Verbindung mit großen Dingen
89 -- Man muß mit seiner Zeit gehn
90 -- Die Entthronung der Ideokratie
91 -- Spekulation in Geist à la baisse und à la hausse
92 -- Aus den Lebensregeln reicher Leute
93 -- Dem Zivilverstand ist auch auf dem Weg der Körperkultur schwer beizukommen
94 -- Diotimas Nächte
95 -- Der Großschriftsteller, Rückansicht
96 -- Der Großschriftsteller, Vorderansicht
97 -- Clarissens geheimnisvolle Kräfte und Aufgaben
98 -- Aus einem Staat, der an einem Sprachfehler zugrundegegangen ist
99 -- Von der Halbklugheit und ihrer fruchtbaren anderen Hälfte; von der Ähnlichkeit zweier Zeitalter, von dem liebenswerten Wesen Tante Janes und dem Unfug, den man neue Zeit nennt
100 -- General Stumm dringt in die Staatsbibliothek ein und sammelt Erfahrungen über Bibliothekare, Bibliotheksdiener und geistige Ordnung
101 -- Die feindlichen Verwandten
102 -- Kampf und Liebe im Hause Fischel
103 -- Die Versuchung
104 -- Rachel und Soliman auf dem Kriegspfad
105 -- Hohe Liebende haben nichts zu lachen
106 -- Glaubt der moderne Mensch an Gott oder an den Chef der Weltfirma? Arnheims Unentschlossenheit
107 -- Graf Leinsdorf erzielt einen unerwarteten politischen Erfolg
108 -- Die unerlösten Nationen und General Stamms Gedanken über die Wortgruppe Erlösen
109 -- Bonadea, Kakanien; Systeme des Glücks und Gleichgewichts
110 -- Moosbruggers Auflösung und Aufbewahrung
111 -- Es gibt für Juristen keine halbverrückten Menschen
112 -- Arnheim versetzt seinen Vater Samuel unter die Götter und faßt den Beschluß, sich Ulrichs zu bemächtigen. Soliman möchte über seinen königlichen Vater Näheres erfahren
113 -- Ulrich unterhält sich mit Hans Sepp und Gerda in der Mischsprache des Grenzgebiets zwischen Über- und Untervernunft
114 -- Die Verhältnisse spitzen sich zu. Arnheim ist sehr huldvoll zu General Stumm. Diotima trifft Anstalten, sich ins Grenzenlose zu begeben. Ulrich phantasiert von der Möglichkeit, so zu leben, wie man liest
115 -- Die Spitze deiner Brust ist wie ein Mohnblatt
116 -- Die beiden Bäume des Lebens und die Forderung eines Generalsekretariats der Genauigkeit und Seele
117 -- Rachels schwarzer Tag
118 -- So töte ihn doch!
119 -- Kontermine und Verführung
120 -- Die Parallelaktion erregt Aufruhr
121 -- Die Aussprache
122 -- Heimweg
123 -- Die Umkehrung
Zweites Buch
Dritter Teil -- Ins Tausendjährige Reich [Die Verbrecher]
1 -- Die vergessene Schwester
2 -- Vertrauen
3 -- Morgen in einem Trauerhaus
4 -- Ich hatt’ einen Kameraden
5 -- Sie tun Unrecht
6 -- Der alte Herr bekommt endlich Ruhe
7 -- Ein Brief von Clarisse trifft ein
8 -- Familie zu zweien
9 -- Agathe, wenn sie nicht mit Ulrich sprechen kann
10 -- Weiterer Verlauf des Ausflugs auf die Schwedenschanze. Die Moral des nächsten Schritts
11 -- Heilige Gespräche. Beginn
12 -- Heilige Gespräche. Wechselvoller Fortgang
13 -- Ulrich kehrt zurück und wird durch den General von allem unterrichtet, was er versäumt hat
14 -- Neues bei Walter und Clarisse. Ein Schausteller und seine Zuschauer
15 -- Das Testament
16 -- Wiedersehen mit Diotimas diplomatischem Gatten
17 -- Diotima hat ihre Lektüre gewechselt
18 -- Schwierigkeiten eines Moralisten beim Schreiben eines Briefs
19 -- Vorwärts zu Moosbrugger
20 -- Graf Leinsdorf zweifelt an Besitz und Bildung
21 -- Wirf alles, was du hast, ins Feuer, bis zu den Schuhen
22 -- Von der Koniatowski’schen Kritik des Danielli’schen Satzes zum Sündenfall. Vom Sündenfall zum Gefühlsrätsel der Schwester
23 -- Bonadea oder der Rückfall
24 -- Agathe ist wirklich da
25 -- Die Siamesischen Zwillinge
26 -- Frühling im Gemüsegarten
27 -- Agathe wird alsbald durch General Stumm für die Gesellschaft entdeckt
28 -- Zu viel Heiterkeit
29 -- Professor Hagauer greift zur Feder
30 -- Ulrich und Agathe suchen nachträglich einen Grund
31 -- Agathe möchte Selbstmord begehn und macht eine Herrenbekanntschaft
32 -- Der General bringt Ulrich und Clarisse inzwischen ins Irrenhaus
33 -- Die Irren begrüßen Clarisse
34 -- Ein großes Ereignis ist im Entstehen. Graf Leinsdorf und der Inn
35 -- Ein großes Ereignis ist im Entstehen. Regierungsrat Meseritscher
36 -- Ein großes Ereignis ist im Entstehen. Wobei man Bekannte trifft
37 -- Ein Vergleich
38 -- Ein großes Ereignis ist im Entstehen. Aber man hat es nicht gemerkt
Schluss des dritten Teils und vierter Teil
39 -- Nach der Begegnung
40 -- Der Tugut
41 -- Die Geschwister am nächsten Morgen
42 -- Auf der Himmelsleiter in eine fremde Wohnung
43 -- Der Tugut und der Tunichtgut. Aber auch Agathe
44 -- Eine gewaltige Aussprache
45 -- Beginn einer Reihe wundersamer Erlebnisse
46 -- Mondstrahlen bei Tage
47 -- Wandel unter Menschen
48 -- Eine auf das Bedeutende gerichtete Gesinnung und beginnendes Gespräch darüber
49 -- General von Stumm über die Genialität
50 -- Genialität als Frage
51 -- Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
52 -- Gespräche über Liebe
53 -- Schwierigkeiten, wo sie nicht gesucht werden
54 -- Es ist nicht einfach zu lieben
55 -- Atemzüge eines Sommertags
56 -- Das Sternbild der Geschwister oder Die Ungetrennten und Nichtvereinten
57 - 59
60 -- Nachdenken
61 -- Frühspaziergang
62 -- General von Stumm und Clarisse
63
64 -- Ein Blatt Papier. Ulrichs Tagebuch
65 -- Eine Eintragung. Entwurf zur Utopie des motivierten Lebens
66 -- Das Ende der Eintragung. Lebende Gedanken
67 -- General von Stumm läßt eine Bombe fallen Weltfriedenskongreß
68
69 -- Agathe findet Ulrichs Tagebuch
70 -- Große Veränderungen
71 -- Agathe stößt zu ihrem Mißvergnügen auf einen geschichtlichen Abriß der Gefühlspsychologie
72 -- Die Referate D und L
73 -- Naive Beschreibung, wie sich ein Gefühl bildet
74 -- Fühlen und Verhalten. Die Unsicherheit des Gefühls
75 -- Zurück zur Wirklichkeit. Oder Der Tugut singt
76 -- Die Wirklichkeit und die Ekstase
77 -- Ulrich und die zwei Welten des Gefühls
78 - 91
92 -- Moosbrugger im Irrenhaus. Eine Kartenpartie
93 -- Clarisse und Friedenthal
94 - 98
99 -- Werden eines Tatmenschen
100 -- Werden eines Tatmenschen. Fortsetzung
101 -- Ulrich hört Musik
102 -- Gerda
103 - 106
107 -- Clarisse bei Rachel
108 -- Moosbrugger und Rachel
109 -- Generaldirektor Fischel
110 -- Politisch unverläßlich. Was auch mitbedeutend sein soll
111 - 118
119 -- Generaldirektor Fischel. Begegnung im Zug
120 - 128
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Zum Buch
In diesem gewaltigen Meisterwerk, das viele auch mit Joyces »Ulysses« oder Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« vergleichen, passiert oberflächlich wenig. Die Protagonisten verlieren sich in ihren Gedanken und Emotionen.
»Der Mann ohne Eigenschaften‹ ist ein ironischer, aber auch ein humanistisch-utopischer Roman. Über 2000 Seiten umfasste Musils letztlich unvollendet gebliebene Geschichte, nachdem sich der Berliner Rowohlt-Verlag weigerte, weitere Bände zu bezahlen. Daher liegen Teile des dritten und vierten Teils nur fragmentarisch vor -- sie entstammen dem Nachlass.
»Der Mann ohne Eigenschaften‹ ist eine sperrige Lektüre, die sich dem Leser nur schwer erschließt.
Der titelgebende »Held« Ulrich, ein Mann mit allen Möglichkeiten aber ohne Heimat; gebildet, jung, gesund, aber nicht fähig, sich festzulegen, weder beruflich noch menschlich, er bleibt ein Mann ohne Konturen, eben ohne Eigenschaften.
Erstes Buch
Erster Teil -- Eine Art Einleitung
1 -- Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht
Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum; es wanderte ostwärts, einem über Rußland lagernden Maximum zu, und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren1 taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft, und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist: Es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913.
Autos schossen aus schmalen, tiefen Straßen in die Seichtigkeit heller Plätze. Fußgängerdunkelheit bildete wolkige Schnüre. Wo kräftigere Striche der Geschwindigkeit quer durch ihre lockere Eile fuhren, verdickten sie sich, rieselten nachher rascher und hatten nach wenigen Schwingungen wieder ihren gleichmäßigen Puls. Hunderte Töne waren zu einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden, aus dem einzelne Spitzen vorstanden, längs dessen schneidige Kanten liefen und sich wieder einebneten, von dem klare Töne absplitterten und verflogen. An diesem Geräusch, ohne daß sich seine Besonderheit beschreiben ließe, würde ein Mensch nach jahrelanger Abwesenheit mit geschlossenen Augen erkannt haben, daß er sich in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien befinde. Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen wie Menschen. Die Augen öffnend, würde er das gleiche an der Art bemerken, wie die Bewegung in den Straßen schwingt, bei weitem früher als er es durch irgendeine bezeichnende Einzelheit herausfände. Und wenn er sich, das zu können, nur einbilden sollte, schadet es auch nichts. Die Überschätzung der Frage, wo man sich befinde, stammt aus der Hordenzeit, wo man sich die Futterplätze merken mußte. Es wäre wichtig, zu wissen, warum man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit begnügt, sie sei rot, und nie danach fragt, welches besondere Rot sie habe, obgleich sich das durch die Wellenlänge auf Mikromillimeter genau ausdrücken ließe; wogegen man bei etwas so viel Verwickelterem, wie es eine Stadt ist, in der man sich aufhält, immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das sei. Es lenkt von Wichtigerem ab.
Es soll also auf den Namen der Stadt kein besonderer Wert gelegt werden. Wie alle großen Städte bestand sie aus Unregelmäßigkeit, Wechsel, Vorgleiten, Nichtschritthalten, Zusammenstößen von Dingen und Angelegenheiten, bodenlosen Punkten der Stille dazwischen, aus Bahnen und Ungebahntem, aus einem großen rhythmischen Schlag und der ewigen Verstimmung und Verschiebung aller Rhythmen gegeneinander, und glich im ganzen einer kochenden Blase, die in einem Gefäß ruht, das aus dem dauerhaften Stoff von Häusern, Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen besteht. Die beiden Menschen, die darin eine breite, belebte Straße hinaufgingen, hatten natürlich gar nicht diesen Eindruck. Sie gehörten ersichtlich einer bevorzugten Gesellschaftsschicht an, waren vornehm in Kleidung, Haltung und in der Art, wie sie miteinander sprachen, trugen die Anfangsbuchstaben ihrer Namen bedeutsam auf ihre Wäsche gestickt, und ebenso, das heißt nicht nach außen gekehrt, wohl aber in der feinen Unterwäsche ihres Bewußtseins, wußten sie, wer sie seien und daß sie sich in einer Haupt- und Residenzstadt auf ihrem Platze befanden. Angenommen, sie würden Arnheim und Ermelinda Tuzzi heißen, was aber nicht stimmt, denn Frau Tuzzi befand sich im August in Begleitung ihres Gatten in Bad Aussee und Dr. Arnheim noch in Konstantinopel, so steht man vor dem Rätsel, wer sie seien. Lebhafte Menschen empfinden solche Rätsel sehr oft in den Straßen. Sie lösen sich in bemerkenswerter Weise dadurch auf, daß man sie vergißt, falls man sich nicht während der nächsten fünfzig Schritte erinnern kann, wo man die beiden schon gesehen hat. Diese beiden hielten nun plötzlich ihren Schritt an, weil sie vor sich einen Auflauf bemerkten. Schon einen Augenblick vorher war etwas aus der Reihe gesprungen, eine quer schlagende Bewegung; etwas hatte sich gedreht, war seitwärts gerutscht, ein schwerer, jäh gebremster Lastwagen war es, wie sich jetzt zeigte, wo er, mit einem Rad auf der Bordschwelle, gestrandet dastand. Wie die Bienen um das Flugloch hatten sich im Nu Menschen um einen kleinen Fleck angesetzt, den sie in ihrer Mitte freiließen. Von seinem Wagen herabgekommen, stand der Lenker darin, grau wie Packpapier, und erklärte mit groben Gebärden den Unglücksfall. Die Blicke der Hinzukommenden richteten sich auf ihn und sanken dann vorsichtig in die Tiefe des Lochs, wo man einen Mann, der wie tot dalag, an die Schwelle des Gehsteigs gebettet hatte. Er war durch seine eigene Unachtsamkeit zu Schaden gekommen, wie allgemein zugegeben wurde. Abwechselnd knieten Leute bei ihm nieder, um etwas mit ihm anzufangen; man öffnete seinen Rock und schloß ihn wieder, man versuchte ihn aufzurichten oder im Gegenteil, ihn wieder hinzulegen; eigentlich wollte niemand etwas anderes damit, als die Zeit ausfüllen, bis mit der Rettungsgesellschaft sachkundige und befugte Hilfe käme.
Auch die Dame und ihr Begleiter waren herangetreten und hatten, über Köpfe und gebeugte Rücken hinweg, den Daliegenden betrachtet. Dann traten sie zurück und zögerten. Die Dame fühlte etwas Unangenehmes in der Herz-Magengrube, das sie berechtigt war für Mitleid zu halten; es war ein unentschlossenes, lähmendes Gefühl. Der Herr sagte nach einigem Schweigen zu ihr: »Diese schweren Kraftwagen, wie sie hier verwendet werden, haben einen zu langen Bremsweg.« Die Dame fühlte sich dadurch erleichtert und dankte mit einem aufmerksamen Blick. Sie hatte dieses Wort wohl schon manchmal gehört, aber sie wußte nicht, was ein Bremsweg sei, und wollte es auch nicht wissen; es genügte ihr, daß damit dieser gräßliche Vorfall in irgend eine Ordnung zu bringen war und zu einem technischen Problem wurde, das sie nicht mehr unmittelbar anging. Man hörte jetzt auch schon die Pfeife eines Rettungswagens schrillen, und die Schnelligkeit seines Eintreffens erfüllte alle Wartenden mit Genugtuung. Bewundernswert sind diese sozialen Einrichtungen. Man hob den Verunglückten auf eine Tragbahre und schob ihn mit dieser in den Wagen. Männer in einer Art Uniform waren um ihn bemüht, und das Innere des Fuhrwerks, das der Blick erhaschte, sah so sauber und regelmäßig wie ein Krankensaal aus. Man ging fast mit dem berechtigten Eindruck davon, daß sich ein gesetzliches und ordnungsmäßiges Ereignis vollzogen habe. »Nach den amerikanischen Statistiken«, so bemerkte der Herr, »werden dort jährlich durch Autos 190.000 Personen getötet und 450.000 verletzt.«
»Meinen Sie, daß er tot ist?« fragte seine Begleiterin und hatte noch immer das unberechtigte Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben.
»Ich hoffe, er lebt« erwiderte der Herr. »Als man ihn in den Wagen hob, sah es ganz so aus.«
Linien gleicher sommerlicher Maximaltemperatur <<<
2 -- Haus und Wohnung des Mannes ohne Eigenschaften
Die Straße, in der sich dieser kleine Unglücksfall ereignet hatte, war einer jener langen, gewundenen Verkehrsflüsse, die strahlenförmig am Kern der Stadt entspringen, die äußeren Bezirke durchziehn und in die Vorstädte münden. Sollte ihm das elegante Paar noch eine Weile weiter gefolgt sein, so würde es etwas gesehen haben, das ihm gewiß gefallen hätte. Das war ein teilweise noch erhalten gebliebener Garten aus dem achtzehnten oder gar aus dem siebzehnten Jahrhundert, und wenn man an seinem schmiedeeisernen Gitter vorbeikam, so erblickte man zwischen Bäumen, auf sorgfältig geschorenem Rasen etwas wie ein kurzflügeliges Schlößchen, ein Jagd- oder Liebesschlößchen vergangener Zeiten. Genau gesagt, seine Traggewölbe waren aus dem siebzehnten Jahrhundert, der Park und der Oberstock trugen das Ansehen des achtzehnten Jahrhunderts, die Fassade war im neunzehnten Jahrhundert erneuert und etwas verdorben worden, das Ganze hatte also einen etwas verwackelten Sinn, so wie übereinander photographierte Bilder; aber es war so, daß man unfehlbar stehen blieb und »Ah!« sagte. Und wenn das Weiße, Niedliche, Schöne seine Fenster geöffnet hatte, blickte man in die vornehme Stille der Bücherwände einer Gelehrtenwohnung.
Diese Wohnung und dieses Haus gehörten dem Mann ohne Eigenschaften.
Er stand hinter einem der Fenster, sah durch den zartgrünen Filter der Gartenluft auf die bräunliche Straße und zählte mit der Uhr seit zehn Minuten die Autos, die Wagen, die Trambahnen und die von der Entfernung ausgewaschenen Gesichter der Fußgänger, die das Netz des Blicks mit quirlender Eile füllten; er schätzte die Geschwindigkeiten, die Winkel, die lebendigen Kräfte vorüberbewegter Massen, die das Auge blitzschnell nach sich ziehen, festhalten, loslassen, die während einer Zeit, für die es kein Maß gibt, die Aufmerksamkeit zwingen, sich gegen sie zu stemmen, abzureißen, zum nächsten zu springen und sich diesem nachzuwerfen; kurz, er steckte, nachdem er eine Weile im Kopf gerechnet hatte, lachend die Uhr in die Tasche und stellte fest, daß er Unsinn getrieben habe. -- Könnte man die Sprünge der Aufmerksamkeit messen, die Leistungen der Augenmuskeln, die Pendelbewegungen der Seele und alle die Anstrengungen, die ein Mensch vollbringen muß, um sich im Fluß einer Straße aufrecht zu halten, es käme vermutlich -- so hatte er gedacht und spielend das Unmögliche zu berechnen versucht -- eine Größe heraus, mit der verglichen die Kraft, die Atlas braucht, um die Welt zu stemmen, gering ist, und man könnte ermessen, welche ungeheure Leistung heute schon ein Mensch vollbringt, der gar nichts tut.
Denn der Mann ohne Eigenschaften war augenblicklich ein solcher Mensch.
Und einer der tut?
»Man kann zwei Schlüsse daraus ziehen« sagte er sich.
Die Muskelleistung eines Bürgers, der ruhig einen Tag lang seines Weges geht, ist bedeutend größer als die eines Athleten, der einmal im Tag ein ungeheures Gewicht stemmt; das ist physiologisch nachgewiesen worden, und also setzen wohl auch die kleinen Alltagsleistungen in ihrer gesellschaftlichen Summe und durch ihre Eignung für diese Summierung viel mehr Energie in die Welt als die heroischen Taten; ja die heroische Leistung erscheint geradezu winzig, wie ein Sandkorn, das mit ungeheurer Illusion auf einen Berg gelegt wird. Dieser Gedanke gefiel ihm.
Aber es muß hinzugefügt werden, daß er ihm nicht etwa deshalb gefiel, weil er das bürgerliche Leben liebte; im Gegenteil, es beliebte ihm bloß, seinen Neigungen, die einstmals anders gewesen waren, Schwierigkeiten zu bereiten. Vielleicht ist es gerade der Spießbürger, der den Beginn eines ungeheuren neuen, kollektiven, ameisenhaften Heldentums vorausahnt? Man wird es rationalisiertes Heldentum nennen und sehr schön finden. Wer kann das heute schon wissen? Solcher unbeantworteter Fragen von größter Wichtigkeit gab es aber damals hunderte. Sie lagen in der Luft, sie brannten unter den Füßen. Die Zeit bewegte sich. Leute, die damals noch nicht gelebt haben, werden es nicht glauben wollen, aber schon damals bewegte sich die Zeit so schnell wie ein Reitkamel; und nicht erst heute. Man wußte bloß nicht, wohin. Man konnte auch nicht recht unterscheiden, was oben und unten war, was vor und zurück ging. »Man kann tun, was man will;« sagte sich der Mann ohne Eigenschaften achzelzuckend »es kommt in diesem Gefilz von Kräften nicht im geringsten darauf an!« Er wandte sich ab wie ein Mensch, der verzichten gelernt hat, ja fast wie ein kranker Mensch, der jede starke Berührung scheut, und als er, sein angrenzendes Ankleidezimmer durchschreitend, an einem Boxball, der dort hing, vorbeikam, gab er diesem einen so schnellen und heftigen Schlag, wie es in Stimmungen der Ergebenheit oder Zuständen der Schwäche nicht gerade üblich ist.
3 -- Auch ein Mann ohne Eigenschaften hat einen Vater mit Eigenschaften
Der Mann ohne Eigenschaften hatte, als er vor einiger Zeit aus dem Ausland zurückkehrte, eigentlich nur aus Übermut und weil er die gewöhnlichen Wohnungen verabscheute, dieses Schlößchen gemietet, das einst ein vor den Toren liegender Sommersitz gewesen war, der seine Bestimmung verlor, als die Großstadt über ihn wegwuchs, und zuletzt nicht mehr als ein brachliegendes, auf das Steigen der Bodenpreise wartendes Grundstück darstellte, das von niemand bewohnt wurde. Der Pachtzins war dementsprechend gering, aber unerwartet viel Geld hatte das Weitere gekostet, alles wieder in Stand setzen zu lassen und mit den Ansprüchen der Gegenwart zu verbinden; das war ein Abenteuer geworden, dessen Ausgang ihn zwang, sich an die Hilfe seines Vaters zu wenden, was ihm keineswegs angenehm war, denn er liebte seine Unabhängigkeit. Er war zweiunddreißig Jahre alt, und sein Vater neunundsechzig.
Der alte Herr war entsetzt. Nicht eigentlich wegen des Überfalls, wenngleich auch deswegen, denn er verabscheute die Unüberlegtheit; noch wegen der Kontribution, die er leisten mußte, denn im Grunde billigte er es, daß sein Sohn ein Bedürfnis nach Häuslichkeit und eigener Ordnung kundgegeben hatte. Aber die Aneignung eines Gebäudes, das man, und sei es auch nur im Diminutiv, nicht umhin konnte als ein Schloß zu bezeichnen, verletzte sein Gefühl und ängstigte es als eine unheilverheißende Anmaßung.
Er selbst hatte als Hauslehrer in hochgräflichen Häusern begonnen; als Student und fortfahrend noch als junger Rechtsanwaltsgehilfe und eigentlich ohne Not, denn schon sein Vater war ein wohlhabender Mann gewesen. -- Als er später Universitätsdozent und Professor wurde, fühlte er sich aber dafür belohnt, denn die sorgfältige Pflege dieser Beziehungen brachte es nun mit sich, daß er allmählich zum Rechtskonsulenten fast des gesamten Feudaladels seiner Heimat aufrückte, obgleich er eines Nebenberufs nun erst recht nicht mehr bedurfte. Ja, lange nachdem das Vermögen, welches er damit erwarb, schon den Vergleich mit der Morgengabe einer rheinischen Industriellenfamilie aushielt, die seines Sohnes frühverstorbene Mutter in die Ehe gebracht hatte, schliefen diese in der Jugend erworbenen und im Mannesalter befestigten Beziehungen nicht ein. Obgleich sich der zu Ehren gekommene Gelehrte nun vom eigentlichen Rechtsgeschäft zurückzog und nur gelegentlich noch eine hochbezahlte Gutachtertätigkeit ausübte, wurden doch noch alle Ereignisse, die den Kreis seiner ehemaligen Gönner angingen, in eigenen Aufzeichnungen sorgfältig gebucht, mit großer Genauigkeit von den Vätern auf die Söhne und Enkel übertragen, und es ging keine Auszeichnung, keine Hochzeit, kein Geburts- oder Namenstag ohne ein Schreiben vorüber, das den Empfänger in einer zarten Mischung von Ehrerbietung und gemeinsamen Erinnerungen beglückwünschte. Ebenso pünktlich liefen darauf auch jedesmal kurze Antwortschreiben ein, die dem lieben Freund und geschätzten Gelehrten dankten. So kannte sein Sohn dieses aristokratische Talent eines fast unbewußt, aber sicher wägenden Hochmuts von Jugend auf, welches das Maß einer Freundlichkeit gerade richtig bemißt, und die Unterwürfigkeit eines immerhin zum geistigen Adel gehörenden Menschen vor den Besitzern von Pferden, Äckern und Traditionen hatte ihn immer gereizt. Es war aber nicht Berechnung, was seinen Vater dagegen unempfindlich machte; ganz aus Naturtrieb legte er auf solche Weise eine große Laufbahn hinter sich, er wurde nicht nur Professor, Mitglied von Akademien und vielen wissenschaftlichen und staatlichen Ausschüssen, sondern auch Ritter, Komtur, ja sogar Großkreuz hoher Orden, Se. Majestät erhob ihn schließlich in den erblichen Adelsstand und hatte ihn schon vorher zum Mitglied des Herrenhauses ernannt. Dort hatte sich der Ausgezeichnete dem freisinnigen bürgerlichen Flügel angeschlossen, der zu dem hochadeligen manchmal im Gegensatz stand, aber bezeichnenderweise nahm es ihm keiner von seinen adeligen Gönnern übel oder wunderte sich auch nur darüber; man hatte niemals etwas anderes als den Geist des aufstrebenden Bürgertums in ihm gesehn. Der alte Herr nahm eifrig an den Facharbeiten der Gesetzgebung teil, und selbst wenn ihn eine Kampfabstimmung auf der bürgerlichen Seite sah, empfand man auf der anderen Seite keinen Groll darüber, sondern hatte eher das Gefühl, daß er nicht eingeladen worden sei. Er tat in der Politik nichts anderes, als was schon seinerzeit sein Amt gewesen war, ein überlegenes und zuweilen sanft verbesserndes Wissen mit dem Eindruck zu vereinen, daß man sich auf seine persönliche Ergebenheit trotzdem verlassen könne, und hatte es, wie sein Sohn behauptete, ohne wesentliche Veränderung vom Hauslehrer zum Herrenhauslehrer gebracht.
Als er die Geschichte mit dem Schloß erfuhr, erschien sie ihm als die Verletzung einer gesetzlich nicht umschriebenen, aber desto achtsamer zu respektierenden Grenze, und er machte seinem Sohne Vorwürfe, die noch bitterer waren als die vielen Vorwürfe, die er ihm im Lauf der Zeiten schon gemacht hatte, ja geradezu wie die Prophezeiung eines bösen Endes klangen, das nun begonnen habe. Das Grundgefühl seines Lebens war beleidigt. Wie bei vielen Männern, die etwas Bedeutendes erreichen, bestand es, fern von Eigennutz, aus einer tiefen Liebe für das sozusagen allgemein und überpersönlich Nützliche, mit anderen Worten aus einer ehrlichen Verehrung für das, worauf man seinen Vorteil baut, nicht weil man ihn baut, sondern in Harmonie und gleichzeitig damit und aus allgemeinen Gründen. Das ist von großer Wichtigkeit; schon ein edler Hund sucht seinen Platz unter dem Eßtisch, unbeirrt von Fußstößen, nicht etwa aus hündischer Niedrigkeit, sondern aus Anhänglichkeit und Treue, und gar die kalt berechnenden Menschen haben im Leben nicht halb soviel Erfolg wie die richtig gemischten Gemüter, die für Menschen und Verhältnisse, die ihnen Vorteil bringen, wirklich tief zu empfinden vermögen.
4 -- Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch Möglichkeitssinn geben
Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muß man die Tatsache achten, daß sie einen festen Rahmen haben: dieser Grundsatz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, daß er seine Daseinsberechtigung hat, dann muß es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann.
Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muß geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müßte geschehn; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Man sieht, daß die Folgen solcher schöpferischen Anlage bemerkenswert sein können, und bedauerlicherweise lassen sie nicht selten das, was die Menschen bewundern, falsch erscheinen und das, was sie verbieten, als erlaubt oder wohl auch beides als gleichgültig. Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven; Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten, Träumer, Schwächlinge und Besserwisser oder Krittler.
Wenn man sie loben will, nennt man diese Narren auch Idealisten, aber offenbar ist mit alledem nur ihre schwache Spielart erfaßt, welche die Wirklichkeit nicht begreifen kann oder ihr wehleidig ausweicht, wo also das Fehlen des Wirklichkeitssinns wirklich einen Mangel bedeutet. Das Mögliche umfaßt jedoch nicht nur die Träume nervenschwacher Personen, sondern auch die noch nicht erwachten Absichten Gottes. Ein mögliches Erlebnis oder eine mögliche Wahrheit sind nicht gleich wirklichem Erlebnis und wirklicher Wahrheit weniger dem Werte des Wirklichseins, sondern sie haben, wenigstens nach Ansicht ihrer Anhänger, etwas sehr Göttliches in sich, ein Feuer, einen Flug, einen Bauwillen und bewußten Utopismus, der die Wirklichkeit nicht scheut, wohl aber als Aufgabe und Erfindung behandelt. Schließlich ist die Erde gar nicht alt und war scheinbar noch nie so recht in gesegneten Umständen. Wenn man nun in bequemer Weise die Menschen des Wirklichkeits- und des Möglichkeitssinns voneinander unterscheiden will, so braucht man bloß an einen bestimmten Geldbetrag zu denken. Alles, was zum Beispiel tausend Mark an Möglichkeiten überhaupt enthalten, enthalten sie doch ohne Zweifel, ob man sie besitzt oder nicht; die Tatsache, daß Herr Ich oder Herr Du sie besitzen, fügt ihnen so wenig etwas hinzu wie einer Rose oder einer Frau. Aber ein Narr steckt sie in den Strumpf, sagen die Wirklichkeitsmenschen, und ein Tüchtiger schafft etwas mit ihnen; sogar der Schönheit einer Frau wird unleugbar von dem, der sie besitzt, etwas hinzugefügt oder genommen. Es ist die Wirklichkeit, welche die Möglichkeiten weckt, und nichts wäre so verkehrt, wie das zu leugnen. Trotzdem werden es in der Summe oder im Durchschnitt immer die gleichen Möglichkeiten bleiben, die sich wiederholen, so lange bis ein Mensch kommt, dem eine wirkliche Sache nicht mehr bedeutet als eine gedachte. Er ist es, der den neuen Möglichkeiten erst ihren Sinn und ihre Bestimmung gibt, und er erweckt sie.
Ein solcher Mann ist aber keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit. Da seine Ideen, soweit sie nicht müßige Hirngespinste bedeuten, nichts als noch nicht geborene Wirklichkeiten sind, hat natürlich auch er Wirklichkeitssinn; aber es ist ein Sinn für die mögliche Wirklichkeit und kommt viel langsamer ans Ziel als der den meisten Menschen eignende Sinn für ihre wirklichen Möglichkeiten. Er will gleichsam den Wald, und der andere die Bäume; und Wald, das ist etwas schwer Ausdrückbares, wogegen Bäume soundsoviel Festmeter bestimmter Qualität bedeuten. Oder vielleicht sagt man es anders besser, und der Mann mit gewöhnlichem Wirklichkeitssinn gleicht einem Fisch, der nach der Angel schnappt und die Schnur nicht sieht, während der Mann mit jenem Wirklichkeitssinn, den man auch Möglichkeitssinn nennen kann, eine Schnur durchs Wasser zieht und keine Ahnung hat, ob ein Köder daran sitzt. Einer außerordentlichen Gleichgültigkeit für das auf den Köder beißende Leben steht bei ihm die Gefahr gegenüber, völlig spleenige Dinge zu treiben. Ein unpraktischer Mann -- und so erscheint er nicht nur, sondern ist er auch -- bleibt unzuverlässig und unberechenbar im Verkehr mit Menschen. Er wird Handlungen begehen, die ihm etwas anderes bedeuten als anderen, aber beruhigt sich über alles, sobald es sich in einer außerordentlichen Idee zusammenfassen läßt. Und zudem ist er heute von Folgerichtigkeit noch weit entfernt. Es ist etwa sehr leicht möglich, daß ihm ein Verbrechen, bei dem ein anderer zu Schaden kommt, bloß als eine soziale Fehlleistung erscheint, an der nicht der Verbrecher die Schuld trägt, sondern die Einrichtung der Gesellschaft. Fraglich ist es dagegen, ob ihm eine Ohrfeige, die er selbst empfängt, als eine Schmach der Gesellschaft oder wenigstens so unpersönlich wie der Biß eines Hundes vorkommen werde; wahrscheinlich wird er da zuerst die Ohrfeige erwidern und danach die Auffassung haben, daß er das nicht hätte tun sollen. Und vollends, wenn man ihm eine Geliebte fortnimmt, wird er heute noch nicht ganz von der Wirklichkeit dieses Vorganges absehen und sich mit einem überraschenden, neuen Gefühl entschädigen können. Diese Entwicklung ist zurzeit noch im Fluß und bedeutet für den einzelnen Menschen sowohl eine Schwäche wie eine Kraft.
Und da der Besitz von Eigenschaften eine gewisse Freude an ihrer Wirklichkeit voraussetzt, erlaubt das den Ausblick darauf, wie es jemand, der auch sich selbst gegenüber keinen Wirklichkeitssinn aufbringt, unversehens widerfahren kann, daß er sich eines Tages als ein Mann ohne Eigenschaften vorkommt.
5 -- Ulrich
Seither waren sechzehn oder siebzehn Jahre vergangen, wie die Wolken am Himmel treiben. Ulrich bereute sie weder, noch war er auf sie stolz, er sah ihnen in seinem zweiunddreißigsten Lebensjahr einfach erstaunt nach. Er war inzwischen da und dort gewesen, manchmal auch kurze Zeit in der Heimat, und hatte überall Wertvolles und Nutzloses getrieben. Es ist schon angedeutet worden, daß er Mathematiker war, und mehr braucht davon noch nicht gesagt zu werden, denn in jedem Beruf, wenn man ihn nicht für Geld, sondern um der Liebe willen ausübt, kommt ein Augenblick, wo die ansteigenden Jahre ins Nichts zu führen scheinen. Nachdem dieser Augenblick längere Zeit angedauert hatte, erinnerte sich Ulrich, daß man der Heimat die geheimnisvolle Fähigkeit zuschreibe, das Sinnen wurzelständig und bodenecht zu machen, und er ließ sich in ihr mit dem Gefühl eines Wanderers nieder, der sich für die Ewigkeit auf eine Bank setzt, obgleich er ahnt, daß er sofort wieder aufstehen wird.
Als er dabei sein Haus bestellte, wie es die Bibel nennt, machte er eine Erfahrung, auf die er eigentlich nur gewartet hatte. Er hatte sich in die angenehme Lage versetzt, sein verwahrlostes kleines Besitztum nach Belieben vom Ei an neu herrichten zu müssen. Von der stilreinen Rekonstruktion bis zur vollkommenen Rücksichtslosigkeit standen ihm dafür alle Grundsätze zur Verfügung, und ebenso boten sich seinem Geist alle Stile, von den Assyrern bis zum Kubismus an. Was sollte er wählen? Der moderne Mensch wird in der Klinik geboren und stirbt in der Klinik: also soll er auch wie in einer Klinik wohnen! -- Diese Forderung hatte soeben ein führender Baukünstler aufgestellt, und ein anderer Reformer der Inneneinrichtung verlangte verschiebbare Wände der Wohnungen, mit der Begründung, daß der Mensch dem Menschen zusammenlebend vertrauen lernen müsse und nicht sich separatistisch abschließen dürfe. Es hatte damals gerade eine neue Zeit begonnen (denn das tut sie in jedem Augenblick), und eine neue Zeit braucht einen neuen Stil. Zu Ulrichs Glück besaß das Schloßhäuschen, so wie er es vorfand, bereits drei Stile übereinander, so daß man wirklich nicht alles damit vornehmen konnte, was verlangt wurde; dennoch fühlte er sich von der Verantwortung, sich ein Haus einrichten zu dürfen, gewaltig aufgerüttelt, und die Drohung »Sage mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist«, die er wiederholt in Kunstzeitschriften gelesen hatte, schwebte über seinem Haupt. Nach eingehender Beschäftigung mit diesen Zeitschriften kam er zu der Entscheidung, daß er den Ausbau seiner Persönlichkeit doch lieber selbst in die Hand nehmen wolle, und begann seine zukünftigen Möbel eigenhändig zu entwerfen. Aber wenn er sich soeben eine wuchtige Eindrucksform ausgedacht hatte, fiel ihm ein, daß man an ihre Stelle doch ebensogut eine technisch-schmalkräftige Zweckform setzen könnte, und wenn er eine von Kraft ausgezehrte Eisenbetonform entwarf, erinnerte er sich an die märzhaft mageren Formen eines dreizehnjährigen Mädchens und begann zu träumen, statt sich zu entschließen.
Es war das -- in einer Angelegenheit, die ihm im Ernst nicht besonders nahe ging -- die bekannte Zusammenhanglosigkeit der Einfälle und ihre Ausbreitung ohne Mittelpunkt, die für die Gegenwart kennzeichnend ist und deren merkwürdige Arithmetik ausmacht, die vom Hundertsten ins Tausendste kommt, ohne eine Einheit zu haben. Schließlich dachte er sich überhaupt nur noch unausführbare Zimmer aus, Drehzimmer, kaleidoskopische Einrichtungen, Umstellvorrichtungen für die Seele, und seine Einfälle wurden immer inhaltsloser. Da war er endlich auf dem Punkt, zu dem es ihn hinzog. Sein Vater würde es ungefähr so ausgedrückt haben: Wen man tun ließe, was er wolle, der könnte sich bald vor Verwirrung den Kopf einrennen. Oder auch so: Wer sich erfüllen kann, was er mag, weiß bald nicht mehr, was er wünschen soll. Ulrich wiederholte sich das mit großem Genuß. Diese Altvordernweisheit kam ihm als ein außerordentlich neuer Gedanke vor. Es muß der Mensch in seinen Möglichkeiten, Plänen und Gefühlen zuerst durch Vorurteile, Überlieferungen, Schwierigkeiten und Beschränkungen jeder Art eingeengt werden wie ein Narr in seiner Zwangsjacke, und erst dann hat, was er hervorzubringen vermag, vielleicht Wert, Gewachsenheit und Bestand; -- es ist in der Tat kaum abzusehen, was dieser Gedanke bedeutet! Nun, der Mann ohne Eigenschaften, der in seine Heimat zurückgekehrt war, tat auch den zweiten Schritt, um sich von außen, durch die Lebensumstände bilden zu lassen, er überließ an diesem Punkt seiner Überlegungen die Einrichtung seines Hauses einfach dem Genie seiner Lieferanten, in der sicheren Überzeugung, daß sie für Überlieferung, Vorurteile und Beschränktheit schon sorgen würden. Er selbst frischte nur die alten Linien auf, die von früher da waren, die dunklen Hirschgeweihe unter den weißen Wölbungen der kleinen Halle oder die steife Decke des Salons, und tat im übrigen alles hinzu, was ihm zweckhaft und bequem vorkam.
Als alles fertig war, durfte er den Kopf schütteln und sich fragen: dies ist also das Leben, das meines werden soll? -- Es war ein entzückendes kleines Palais, was er da besaß; fast mußte man es so nennen, denn es war ganz so, wie man sich seinesgleichen denkt, eine geschmackvolle Residenz für einen Residenten, wie ihn sich Möbel-, Teppich- und Installationsfirmen vorgestellt hatten, die auf ihrem Gebiete führen. Es fehlte nur, daß dieses reizende Uhrwerk nicht aufgezogen war; denn dann wären Equipagen mit hohen Würdenträgern und vornehmen Damen die Auffahrt emporgerollt, Lakaien wären von den Trittbrettern gesprungen und hätten Ulrich mißtrauisch gefragt: »Guter Mann, wo ist Euer Herr?«
Er war vom Mond zurückgekehrt und hatte sich sofort wieder wie am Mond eingerichtet.
6 -- Leona oder eine perspektivische Verschiebung
Wenn man sein Haus bestellt hat, soll man auch ein Weib freien. Ulrichs Freundin in jenen Tagen hieß Leontine und war Liedersängerin in einem kleinen Varieté; sie war groß, schlank und voll, aufreizend leblos, und er nannte sie Leona.
Sie war ihm aufgefallen durch das feuchte Dunkel ihrer Augen, durch einen schmerzlich leidenschaftlichen Ausdruck ihres regelmäßigen, schönen, langen Gesichts und durch die gefühlvollen Lieder, die sie an Stelle von unzüchtigen sang. Alle diese altmodischen kleinen Gesänge hatten Liebe, Leid, Treue, Verlassenheit, Waldesrauschen und Forellenblinken zum Inhalt. Leona stand groß und bis in die Knochen verlassen auf der kleinen Bühne und sang sie mit der Stimme einer Hausfrau geduldig ins Publikum, und wenn dazwischen doch kleine sittliche Gewagtheiten unterliefen, so wirkten sie um so gespenstischer, als dieses Mädchen die tragischen wie die neckischen Gefühle des Herzens mit den gleichen mühsam buchstabierten Gebärden unterstützte. Ulrich fühlte sich sofort an alte Photographien oder an schöne Frauen in verschollenen Jahrgängen deutscher Familienblätter erinnert, und während er sich in das Gesicht dieser Frau hineindachte, bemerkte er darin eine ganze Menge kleiner Züge, die gar nicht wirklich sein konnten und doch dieses Gesicht ausmachten. Es gibt natürlich zu allen Zeiten alle Arten von Antlitzen; aber je eine wird vom Zeitgeschmack emporgehoben und zu Glück und Schönheit gemacht, während alle anderen Gesichter sich dann diesem anzugleichen suchen; und selbst häßlichen gelingt das ungefähr, mit Hilfe von Frisur und Mode, und nur jenen zu seltsamen Erfolgen geborenen Gesichtern gelingt es niemals, in denen sich das königliche und vertriebene Schönheitsideal einer früheren Zeit ohne Zugeständnisse ausspricht. Solche Gesichter wandern wie Leichen früherer Gelüste in der großen Wesenlosigkeit des Liebesbetriebs, und den Männern, die in die weite Langweile von Leontinens Gesang gafften und nicht wußten, was ihnen geschah, bewegten ganz andre Gefühle die Nasenflügel als vor den kleinen frechen Chanteusen mit den Tangofrisuren. Da beschloß Ulrich, sie Leona zu nennen, und ihr Besitz erschien ihm begehrenswert wie der eines vom Kürschner ausgestopften großen Löwenfells.
Nachdem aber ihre Bekanntschaft begonnen hatte, entwickelte Leona noch eine unzeitgemäße Eigenschaft, sie war in ungeheurem Maße gefräßig, und das ist ein Laster, dessen große Ausbildung längst aus der Mode gekommen ist. Es war seinem Entstehen nach die endlich befreite Sehnsucht, die sie als armes Kind nach kostbaren Leckerbissen gelitten hatte; nun besaß es die Kraft eines Ideals, das endlich seinen Käfig zerbrochen und die Herrschaft an sich gerissen hat. Ihr Vater schien ein ehrbarer kleiner Bürger gewesen zu sein, der sie jedesmal schlug, wenn sie mit Verehrern ging; sie aber tat es aus keinem anderen Grund, als weil sie für ihr Leben gern in dem Vorgarten einer kleinen Konditorei saß und vornehm auf die Vorübergehenden blickend in ihrem Eis löffelte. Denn daß sie unsinnlich gewesen sei, hätte man zwar nicht behaupten können, aber sofern es erlaubt ist, wäre zu sagen, daß sie wie in allem so auch darin geradezu faul und arbeitsscheu war. In ihrem ausgedehnten Körper brauchte jeder Reiz wunderbar lange, bis er das Gehirn erreichte, und es geschah, daß mitten am Tag ihre Augen ohne Grund zu zergehen begannen, während sie in der Nacht unbeweglich auf einen Punkt der Zimmerdecke gerichtet waren, als ob sie dort eine Fliege beobachteten. Ebenso konnte sie manchmal mitten in voller Stille über einen Scherz zu lachen beginnen, der ihr da erst aufging, während sie ihn einige Tage zuvor ruhig angehört hatte, ohne ihn zu verstehen. Wenn sie keinen besonderen Grund zum Gegenteil hatte, war sie darum auch durchaus anständig. Auf welche Weise sie überhaupt zu ihrem Beruf gekommen war, war niemals aus ihr herauszubringen. Anscheinend wußte sie es selbst nicht mehr genau. Es zeigte sich bloß, daß sie die Tätigkeit einer Liedersängerin für einen notwendigen Teil des Lebens hielt und alles Große, was sie von Kunst und Künstlern je gehört hatte, damit verband, so daß es ihr durchaus richtig, erzieherisch und vornehm vorkam, allabendlich auf eine kleine, von Zigarrendunst umwölkte Bühne hinauszutreten und Lieder vorzutragen, deren ergreifende Geltung eine feststehende Sache war. Natürlich scheute sie dabei, wie es sein muß, um das Anständige zu beleben, auch keineswegs vor einer gelegentlich eingestreuten Unanständigkeit zurück, aber sie war fest überzeugt, daß die erste Sängerin der kaiserlichen Oper genau das gleiche tue wie sie.
Freilich, wenn man es durchaus Prostitution nennen will, wenn ein Mensch nicht, wie es üblich ist, seine ganze Person für Geld hergibt, sondern nur seinen Körper, so betrieb Leona gelegentlich Prostitution. Aber wenn man durch neun Jahre, wie sie seit ihrem sechzehnten Jahr, die Kleinheit der Taggelder kennt, die in den untersten Singhöllen gezahlt werden, die Preise der Toiletten und der Wäsche im Kopf hat, die Abzüge, den Geiz und die Willkür der Besitzer, die Perzente von Speis und Trank aufgemunterter Gäste und von der Zimmerrechnung des benachbarten Hotels, täglich damit zu tun hat, Zank darüber hat und kaufmännisch abrechnet, so wird das, was den Laien als Ausschweifung erfreut, zu einem Beruf, der voll Logik, Sachlichkeit und Standesgesetzen ist. Gerade Prostitution ist ja eine Angelegenheit, bei der es einen großen Unterschied macht, ob man sie von oben sieht oder von unten betrachtet.
Aber wenn Leona auch eine vollkommen sachliche Auffassung der sexuellen Frage besaß, so hatte sie doch auch ihre Romantik. Nur hatte sich bei ihr alles Überschwengliche, Eitle, Verschwenderische, hatten sich die Gefühle des Stolzes, des Neides, der Wollust, des Ehrgeizes, der Hingabe, kurz die Triebkräfte der Persönlichkeit und des gesellschaftlichen Aufstiegs durch ein Naturspiel nicht mit dem sogenannten Herzen verbunden, sondern mit dem tractus abdominalis, den Eßvorgängen, mit denen sie übrigens in früheren Zeiten regelmäßig in Verbindung gestanden sind, was man noch heute an Primitiven oder an breit prassenden Bauern beobachten kann, die Vornehmheit und allerhand anderes, was den Menschen auszeichnet, durch ein Festmahl auszudrücken vermögen, bei dem man sich feierlich und mit allen Begleiterscheinungen überißt. An den Tischen ihres Tingeltangels tat Leona ihre Pflicht; aber wovon sie träumte, war ein Kavalier, der sie durch ein Verhältnis auf Engagementsdauer dessen enthob und ihr gestattete, in vornehmer Haltung vor einer vornehmen Speisekarte in einem vornehmen Restaurant zu sitzen. Sie hätte dann am liebsten von allen vorhandenen Speisen auf einmal gegessen, und es bereitete ihr eine schmerzhaft widerspruchsvolle Genugtuung, gleichzeitig zeigen zu dürfen, daß sie wisse, wie man auswählen müsse und ein auserlesenes Menü zusammenstellt. Erst bei den kleinen Nachgerichten konnte sie ihre Phantasie gehen lassen, und gewöhnlich wurde in umgekehrter Reihenfolge ein ausgebreitetes zweites Abendbrot daraus. Leona stellte durch schwarzen Kaffee und anregende Mengen von Getränken ihre Aufnahmefähigkeit wieder her und reizte sich durch Überraschungen, bis ihre Leidenschaft gestillt war. Dann war ihr Leib so voll vornehmer Sachen, daß er kaum noch zusammenhielt. Sie blickte träg strahlend um sich, und obgleich sie niemals sehr gesprächig war, schloß sie in diesem Zustand gerne rückschauende Betrachtungen an die Kostbarkeiten an, die sie verspeist hatte. Wenn sie Polmone à la Torlogna oder Äpfel à la Melville sagte, streute sie es hin, wie ein anderer gesucht beiläufig erwähnt, daß er mit dem Fürsten oder dem Lord gleichen Namens gesprochen habe.
Weil das öffentliche Auftreten mit Leona nicht gerade nach Ulrichs Geschmack war, verlegte er ihre Fütterung gewöhnlich in sein Haus, wo sie den Hirschgeweihen und Stilmöbeln zuspeisen mochte. Sie aber sah sich dadurch um die gesellschaftliche Genugtuung gebracht, und wenn der Mann ohne Eigenschaften durch die unerhörtesten Gerichte, die ein Garkoch liefern kann, sie zu einsamer Unmäßigkeit reizte, empfand sie sich genau so mißbraucht wie eine Frau, die bemerkt, daß sie nicht um ihrer Seele willen geliebt wird. Sie war schön und eine Sängerin, sie brauchte sich nicht zu verstecken, und jeden Abend hingen an ihr die Begierden einiger Dutzend Männer, die ihr recht gegeben hätten. Dieser Mensch aber, obgleich er mit ihr allein sein wollte, brachte es nicht einmal fertig, ihr zu sagen: Jesus Maria, Leona, dein A… macht mich selig! und sich den Schnurrbart vor Appetit zu lecken, wenn er sie bloß ansah, wie sie es von ihren Kavalieren gewohnt war. Leona verachtete ihn ein bißchen, obgleich sie natürlich treu an ihm festhielt, und Ulrich wußte das. Er wußte übrigens wohl, was sich in Leonas Gesellschaft gehörte, aber die Zeit, wo er so etwas noch über die Lippen gebracht hätte und seine Lippen noch einen Schnurrbart trugen, lag zu weit zurück. Und wenn man etwas nicht mehr zuwege bringt, das man früher gekonnt hat, es mag noch so dumm gewesen sein, so ist das doch genau so, wie wenn der Schlagfluß in die Hand und in das Bein gefahren ist. Die Augäpfel schlotterten ihm, wenn er seine Freundin ansah, der Speise und Trank zu Kopf gestiegen waren. Man konnte ihre Schönheit vorsichtig von ihr abheben. Es war die Schönheit der Herzogin, die Scheffels Ekkehard über die Schwelle des Klosters getragen hat, die Schönheit der Ritterin mit dem Falken am Handschuh, die Schönheit der sagenumwobenen Kaiserin Elisabeth mit dem schweren Kranz von Haar, ein Entzücken für Leute, die alle schon tot waren. Und um es genau zu sagen, sie erinnerte auch an die göttliche Juno, aber nicht an die ewige und unvergängliche, sondern an das, was eine vergangene oder vergehende Zeit junonisch nannte. So war der Traum des Seins nur lose über die Materie gestülpt. Leona aber wußte, daß man für eine vornehme Einladung auch dann etwas schuldig ist, wenn sich der Gastgeber nichts wünscht, und daß man sich nicht bloß anglotzen lassen dürfe; so stand sie denn, sobald sie dessen wieder fähig war, auf und begann gelassen, aber mit lautem Vortrag zu singen. Ihrem Freund kamen solche Abende vor wie ein herausgerissenes Blatt, belebt von allerhand Einfällen und Gedanken, aber mumifiziert, wie es alles aus dem Zusammenhang Gerissene wird, und voll von jener Tyrannis des nun ewig so Stehenbleibenden, die den unheimlichen Reiz lebender Bilder ausmacht, als hätte das Leben plötzlich ein Schlafmittel erhalten, und nun steht es da, steif, voll Verbindung in sich, scharf begrenzt und doch ungeheuer sinnlos im Ganzen.
7 -- In einem Zustand von Schwäche zieht sich Ulrich eine neue Geliebte zu
Eines Morgens kam Ulrich nachhaus und war übel zugerichtet. Seine Kleider hingen zerrissen von ihm, er mußte feuchte Bauschen auf den zerschundenen Kopf legen, seine Uhr und seine Brieftasche fehlten. Er wußte nicht, ob die drei Männer, mit denen er in Streit geraten war, sie geraubt hatten oder ob sie ihm während der kurzen Zeit, wo er bewußtlos auf dem Pflaster lag, von einem stillen Menschenfreund gestohlen worden waren. Er legte sich zu Bett, und indes die matten Glieder sich wieder behutsam getragen und umhüllt fühlten, überlegte er noch einmal dieses Abenteuer.
Die drei Köpfe waren plötzlich vor ihm gestanden; er mochte in der spät-einsamen Straße einen der Männer gestreift haben, denn seine Gedanken waren zerstreut und mit etwas anderem beschäftigt gewesen, aber diese Gesichter waren schon vorbereitet auf Zorn und traten verzerrt in den Kreis der Laterne. Da hatte er einen Fehler begangen. Er hätte sofort zurückprallen müssen, als fürchte er sich, und dabei fest mit dem Rücken gegen den Kerl stoßen, der hinter ihn getreten war, oder mit dem Ellenbogen gegen seinen Magen, und noch im selben Augenblick trachten müssen, zu entwischen, denn gegen drei starke Männer gibt es kein Kämpfen. Statt dessen hatte er einen Augenblick gezögert. Das machte das Alter; seine zweiunddreißig Jahre; Feindseligkeit und Liebe brauchen da schon etwas mehr Zeit. Er wollte nicht glauben, daß die drei Antlitze, die ihn mit einemmal in der Nacht mit Zorn und Verachtung anblickten, es nur auf sein Geld abgesehen hatten, sondern gab sich dem Gefühl hin, daß da Haß gegen ihn zusammengeströmt und zu Gestalten geworden war; und während die Strolche ihn schon mit gemeinen Worten beschimpften, freute ihn der Gedanke, daß es vielleicht gar keine Strolche seien, sondern Bürger wie er, bloß etwas angetrunken und von Hemmungen befreit, die an seiner vorübergleitenden Erscheinung hängengeblieben waren und einen Haß auf ihn entluden, der für ihn und für jeden fremden Menschen stets vorbereitet ist wie das Gewitter in der Atmosphäre. Denn etwas Ähnliches fühlte auch er mitunter. Ungemein viele Menschen fühlen sich heute in bedauerlichem Gegensatz stehen zu ungemein viel anderen Menschen. Es ist ein Grundzug der Kultur, daß der Mensch dem außerhalb seines eigenen Kreises lebenden Menschen aufs tiefste mißtraut, also daß nicht nur ein Germane einen Juden, sondern auch ein Fußballspieler einen Klavierspieler für ein unbegreifliches und minderwertiges Wesen hält. Schließlich besteht ja das Ding nur durch seine Grenzen und damit durch einen gewissermaßen feindseligen Akt gegen seine Umgebung; ohne den Papst hätte es keinen Luther gegeben und ohne die Heiden keinen Papst, darum ist es nicht von der Hand zu weisen, daß die tiefste Anlehnung des Menschen an seinen Mitmenschen in dessen Ablehnung besteht. Das dachte er natürlich nicht so ausführlich; aber er kannte diesen Zustand einer ungewissen, atmosphärischen Feindseligkeit, von dem in unserem Menschenalter die Luft voll ist, und wenn sich das einmal plötzlich in drei unbekannten, nachher wieder auf ewig verschwindenden Männern zusammenzieht, um wie Donner und Blitz auszuschlagen, so ist das fast eine Erleichterung.
Immerhin schien er doch angesichts dreier Strolche etwas zu viel gedacht zu haben. Denn als ihn nun der erste ansprang, flog er zwar zurück, da ihm Ulrich mit einem Schlag aufs Kinn zuvorgekommen war, aber der zweite, der blitzschnell danach hätte erledigt werden müssen, wurde von der Faust nur noch gestreift, denn inzwischen hatte ein Hieb von hinten mit einem schweren Gegenstand Ulrichs Kopf beinahe zersprengt. Er brach ins Knie, wurde angefaßt, kam mit jenem fast unnatürlichen Klarwerden des Körpers, das gewöhnlich dem ersten Zusammenbruch folgt, noch einmal hoch, schlug in die Wirrnis fremder Körper und wurde von immer größer werdenden Fäusten niedergehämmert.
Da nun der Fehler festgestellt war, den er begangen hatte, und nur auf sportlichem Gebiet lag, eben so, wie es vorkommt, daß man einmal zu kurz springt, schlief Ulrich, der noch immer vorzügliche Nerven besaß, ruhig ein, genau mit dem gleichen Entzücken an den entschwebenden Spiralen des Bewußtseinsverfalls, das er im Hintergrunde schon während seiner Niederlage empfunden hatte.
Als er wieder erwachte, überzeugte er sich, daß seine Verletzungen nicht bedeutend waren, und dachte noch einmal über sein Erlebnis nach. Eine Schlägerei hinterläßt immer einen unangenehmen Nachgeschmack, sozusagen von voreiliger Vertraulichkeit, und unabhängig davon, daß er der Angegriffene war, hatte Ulrich das Gefühl, sich unpassend betragen zu haben. Aber unpassend wozu?! Dicht neben den Straßen, wo alle dreihundert Schritte ein Schutzmann den geringsten Verstoß gegen die Ordnung ahndet, liegen andere, die die gleiche Kraft und Gesinnung fordern wie ein Urwald. Die Menschheit erzeugt Bibeln und Gewehre, Tuberkulose und Tuberkulin. Sie ist demokratisch mit Königen und Adel; baut Kirchen und gegen die Kirchen wieder Universitäten; macht Klöster zu Kasernen, aber teilt den Kasernen Feldgeistliche zu. Natürlich liefert sie auch den Strolchen mit Blei gefüllte Gummischläuche in die Hand, um den Leib eines Mitmenschen damit krankzuschlagen, und stellt für den einsamen und mißhandelten Leib hinterdrein Daunenbetten bereit, wie es eines war, das in diesem Augenblick Ulrich umgab, als wäre es mit lauter Hochachtung und Rücksicht gefüllt. Es ist das die bekannte Sache mit den Widersprüchen, der Inkonsequenz und Unvollkommenheit des Lebens. Man lächelt oder seufzt dazu. Aber so war nun Ulrich gerade nicht. Er haßte diese Mischung aus Verzicht und Affenliebe im Verhalten zum Leben, die sich dessen Widersprüche und Halbheiten gefallen läßt wie eine eingejungferte Tante die Flegeleien eines jungen Neffen. Nur sprang er auch nicht gleich aus seinem Bett, wenn es sich zeigte, daß das Verweilen darin aus der Unordnung der Menschheitsangelegenheiten Vorteil zog, denn in mancherlei Sinn ist es ein voreiliger Ausgleich mit dem Gewissen auf Kosten der Sache, ein Kurzschluß, ein Ausweichen ins Private, wenn man für seine Person das Schlechte meidet und das Gute tut, statt sich um die Ordnung des Ganzen zu bemühen. Ja es kam Ulrich nach seiner unfreiwilligen Erfahrung sogar vor, daß es verzweifelt wenig Wert habe, wenn da die Gewehre, dort die Könige abgeschafft werden und irgendein kleiner oder großer Fortschritt die Dummheit und Schlechtigkeit vermindert; denn das Maß der Widerwärtigkeiten und Schlechtigkeiten wird augenblicklich wieder durch neue aufgefüllt, als glitte das eine Bein der Welt immer zurück, wenn sich das andere vorschiebt. Davon müßte man die Ursache und den Geheimmechanismus erkennen! Das wäre natürlich ungleich wichtiger, als nach veraltenden Grundsätzen ein guter Mensch zu sein, und so zog es Ulrich in der Moral mehr zum Generalstabsdienst als zum alltäglichen Heldentum des Guttuns.