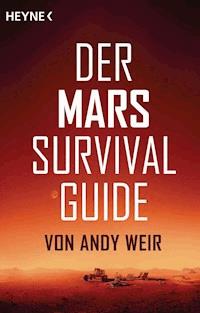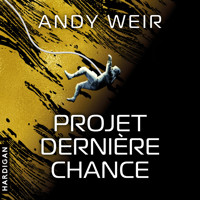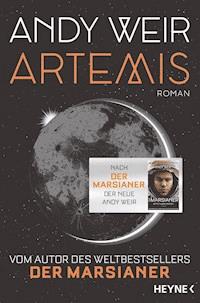9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gestrandet auf dem Mars
Der Astronaut Mark Watney war auf dem besten Weg, eine lebende Legende zu werden, schließlich war er der erste Mensch in der Geschichte der Raumfahrt, der je den Mars betreten hat. Nun, sechs Tage später, ist Mark auf dem besten Weg, der erste Mensch zu werden, der auf dem Mars sterben wird: Bei einer Expedition auf dem Roten Planeten gerät er in einen Sandsturm, und als er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, ist er allein. Auf dem Mars. Ohne Ausrüstung. Ohne Nahrung. Und ohne Crew, denn die ist bereits auf dem Weg zurück zur Erde. Es ist der Beginn eines spektakulären Überlebenskampfes ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Andy Weir
DER MARSIANER
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Jürgen Langowski
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
THE MARTIAN
Deutsche Erstausgabe 11/2014
Redaktion: Ralf Dürr
Copyright © 2011, 2014 by Andy Weir
Der Marsianer Film artwork © 2015 by
Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-14400-5
www.diezukunft.de
www.twitter.com/HeyneFantasySF
Für Mom, die mich »Pickle« nennt,
und für Dad, der mich »Dude« nennt.
1
Logbuch: Sol 6
Ich bin so was von im Arsch.
Das ist meine wohlüberlegte Meinung.
Im Arsch.
Sechs Tage nach Beginn der vermeintlich großartigsten zwei Monate meines Lebens setzte der Albtraum ein.
Ich weiß nicht, wer dies hier überhaupt lesen wird. Vermutlich wird es irgendwann einmal jemand finden. Vielleicht in hundert Jahren.
Für die Akten: Ich bin nicht an Sol 6 gestorben. Die anderen Crewmitglieder dachten dies sicherlich, und das kann ich ihnen nicht zum Vorwurf machen. Vielleicht gibt es einen nationalen Trauertag für mich, und auf meiner Wikipediaseite kann man es nachlesen: »Mark Watney ist der einzige Mensch, der je auf dem Mars gestorben ist.«
Wahrscheinlich wird das sogar zutreffen, denn ich sterbe ganz bestimmt hier – aber mein Todestag ist nicht Sol 6, wie alle anderen annehmen.
Mal sehen, wo fange ich an?
Das Ares-Programm. Die Menschen greifen nach dem Mars und schicken zum ersten Mal Astronauten auf einen anderen Planeten, um den Horizont der Menschheit unermesslich zu erweitern, blabla. Ares 1 hat seinen Beitrag geleistet, die Crewmitglieder sind als Helden zurückgekehrt. Ihnen zu Ehren gab es Aufmärsche, sie waren berühmt, die Herzen aller Menschen flogen ihnen zu.
Ares 2 tat das Gleiche an einem anderen Ort auf dem Mars. Bei ihrer Rückkehr bekamen sie einen kräftigen Händedruck und eine Tasse heißen Kaffee.
Ares 3, das war meine Mission. Na gut, nicht meine allein. Commander Lewis war meine Vorgesetzte. Ich war einfach nur ein Mitglied ihrer Crew. Genau genommen war ich sogar das Besatzungsmitglied mit dem niedrigsten Rang. Ich hätte nur dann das Kommando der Mission übernommen, wenn ich der einzige Überlebende auf dem Mars gewesen wäre.
Was soll ich sagen? Ich habe das Kommando.
Ich frage mich, ob dieses Logbuch entdeckt wird, ehe der Rest der Crew an Altersschwäche stirbt. Vermutlich sind sie gut nach Hause gekommen. Leute, wenn ihr das hier lest: Es war nicht eure Schuld. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Ich an eurer Stelle hätte genau das Gleiche getan. Ich mache euch keine Vorwürfe, und ich bin froh, dass ihr überlebt habt.
Für den Fall, dass ein Laie dies liest, sollte ich vielleicht erst einmal erklären, wie die Marsmissionen ablaufen. Zuerst steigen wir auf herkömmliche Weise in eine Erdumlaufbahn auf und erreichen mit einem gewöhnlichen Raumschiff die Hermes. Alle Ares-Missionen benutzen die Hermes, um zum Mars und wieder zurück zu gelangen. Es ist ein sehr großes Schiff, das eine Menge Geld gekostet hat. Daher hat die NASA nur ein einziges gebaut.
Nachdem wir die Hermes erreicht hatten, brachten uns vier weitere unbemannte Missionen den Treibstoff und die Vorräte, während wir uns auf die Reise vorbereiteten. Als schließlich alles klar war, starteten wir zum Mars. Aber nicht sehr schnell. Die Zeiten des starken Schubs mit chemischen Triebwerken bis in den Mars-Orbit sind vorbei.
Die Hermes hat Ionentriebwerke. Aus dem Heck des Schiffs schleudern sie mit hoher Geschwindigkeit Argon ins Weltall, um einen winzigen Schub zu erzeugen. Dazu braucht man keine große Reaktionsmasse, sodass ein wenig Argon (und dazu ein Atomreaktor, der die Energie liefert) ausreichen, um uns ständig leicht zu beschleunigen. Sie würden staunen, wie schnell Sie werden, wenn Sie beharrlich mit geringem Schub beschleunigen.
Ich könnte Ihnen jetzt in aller Ausführlichkeit schildern, wie vergnüglich unsere Schiffsreise war, aber das schenke ich mir, denn ich habe keine Lust, mir das noch einmal selbst vor Augen zu führen. Es soll reichen zu sagen, dass wir nach 124 Tagen den Mars erreichten, ohne uns gegenseitig die Gurgeln durchgeschnitten zu haben.
Von dort aus flogen wir mit dem MLM (Marslandemodul) zur Oberfläche hinunter. Das MLM ist im Grunde nur eine große Blechdose mit ein paar kleinen Steuertriebwerken und Fallschirmen. Seine einzige Aufgabe besteht darin, sechs Menschen aus der Umlaufbahn auf die Marsoberfläche zu befördern, ohne sie umzubringen.
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Clou der Marserkundung: Unser ganzes Zeug wurde im Voraus geliefert.
Insgesamt vierzehn unbemannte Missionen hatten alles, was wir für die Erforschung der Oberfläche brauchten, schon vorher dorthin gebracht. Die NASA hatte sich bemüht, alle Versorgungssonden in derselben Gegend zu landen, und es ziemlich gut hinbekommen. Die Vorräte sind nicht annähernd so empfindlich wie Menschen und können recht hart aufschlagen. Allerdings hüpfen sie dann ein wenig umher.
Natürlich haben sie uns erst zum Mars geschickt, als klar war, dass alle Vorräte die Oberfläche erreicht hatten und die Behälter nicht zerbrochen waren. Alles in allem dauert eine Marsmission etwa drei Jahre. Als die Crew von Ares 2 auf dem Heimweg war, flogen schon die ersten Vorräte für Ares 3 zum Mars.
Der wichtigste Bestandteil der vorab geschickten Güter war natürlich das MRM, das Marsrückkehrmodul. Damit sollten wir nach Abschluss der Bodenoperationen wieder zur Hermes hinauffliegen. Im Gegensatz zu den übrigen unsanft mit Ballons abgeworfenen Vorräten wurde das MRM sehr behutsam abgesetzt. Natürlich stand es jederzeit mit Houston in Funkverbindung, und falls es irgendein Problem damit gab, sollten wir am Mars vorbeifliegen und nach Hause zurückkehren, ohne überhaupt zu landen.
Das MRM ist ein ziemlich cooler Apparat. Dank einiger raffinierter chemischer Reaktionen mit der Marsatmosphäre kann man aus jedem Kilogramm Wasserstoff, das man mitbringt, dreizehn Kilogramm Treibstoff gewinnen. Allerdings ist das ein langwieriger Prozess. Es dauert vierundzwanzig Monate, den Tank zu füllen. Deshalb wird das MRM schon lange vor der Ankunft der Crew hergeschickt.
Sie werden verstehen, wie enttäuscht ich war, als ich entdeckte, dass das MRM verschwunden war.
Eine lächerliche Abfolge von Ereignissen führte dazu, dass ich fast gestorben wäre, und eine noch wahnwitzigere Serie von Ereignissen ließ mich überleben.
Die Mission ist darauf angelegt, Sandstürme bis zu einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern zu überstehen. Daher wurde Houston sehr nervös, als 175 Stundenkilometer schnelle Winde auf uns einprügelten. Wir zogen die Raumanzüge an und hockten uns mitten in die Wohnkuppel, um vor Druckverlust geschützt zu sein. Die Wohnkuppel war allerdings nicht das Problem.
Das MRM ist ein Raumschiff und hat viele empfindliche Teile. Bis zu einem gewissen Punkt kann es Stürme aushalten, aber eine Sandstrahlbehandlung übersteht es nicht ewig. Nach anderthalb Stunden unablässigem Wind gab die NASA den Befehl zum Abbruch. Niemand wollte eine mehrwöchige Mission schon nach sechs Tagen abbrechen, doch wenn das MRM zu stark beschädigt worden wäre, hätten wir alle auf dem Mars festgesessen.
Wir mussten in den Sturm hinaus und uns von der Wohnkuppel zum MRM durchschlagen. Das war gefährlich, aber was blieb uns anderes übrig?
Alle außer mir schafften es.
Die Hauptantennenschüssel, die unsere Signale von der Wohnkuppel zur Hermes übertrug, wirkte wie ein Fallschirm und wurde aus der Verankerung gerissen und weggefegt. Unterwegs krachte sie in die Empfangsantenne. Dann traf mich eine der langen Stabantennen wie ein Speer. Das Ding schlug durch meinen Raumanzug wie eine Gewehrkugel durch ein Stück Butter, und ich hatte die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, als es mich an der Seite verletzte. Ich kann mich noch erinnern, wie mir die Luft wegblieb (genau genommen wurde sie mir sogar entrissen) und wie meine Ohren schmerzten und knackten, als mein Raumanzug Druck verlor.
Das Letzte, was ich bewusst wahrnahm, war Johannsen, die hilflos die Arme zu mir ausstreckte.
Der Sauerstoffalarm meines Anzugs weckte mich. Es war ein stetiges, nervtötendes Piepsen, das mir die unendlich tiefe Sehnsucht austrieb, einfach zu sterben.
Der Sturm war abgeflaut, ich lag mit dem Gesicht voran am Boden und war fast vollständig vom Sand begraben. Als ich benommen die ersten klaren Gedanken fassen konnte, wunderte ich mich, warum ich nicht längst tot war.
Die Antenne hatte genug Wucht gehabt, um den Anzug und meine Haut zu durchbohren, war aber an meinem Beckenknochen aufgehalten worden. Daher gab es nur je ein einziges Loch im Anzug und in mir.
Der Aufprall hatte mich ein paar Meter weggeschleudert, und ich war einen steilen Abhang hinabgerollt und mit dem Gesicht voran gelandet. Die Antenne hatte sich dabei verbogen und übte eine Menge Druck auf das Loch im Anzug aus. So war eine schwache Versiegelung entstanden.
Außerdem strömte reichlich Blut aus meiner Wunde zum Loch. Sobald es die Öffnung erreichte, verdunstete im Wind und im niedrigen Luftdruck das Wasser aus dem Blut und hinterließ eine klebrige Masse. Das Blut, das danach herbeiströmte, gerann ebenfalls, bis das ganze Leck einigermaßen dicht war und eine Gefahr darstellte, mit der mein Anzug gerade noch umgehen konnte.
Der Anzug leistete eine bewundernswerte Arbeit. Er spürte den Druckabfall und lieferte zum Ausgleich ständig Stickstoff aus der Druckflasche nach. Sobald das Loch weit genug verschlossen war, musste er nur noch kleine Mengen einspeisen, um den Verlust auszugleichen.
Nach einer Weile waren allerdings die CO2-Tauscher im Anzug erschöpft. Dies ist der Faktor, der die Lebenserhaltung am stärksten einschränkt. Entscheidend ist nicht die Menge an Sauerstoff, die man mitführt, sondern die Menge an CO2, die man entfernen kann. In der Wohnkuppel gibt es einen Oxygenator, das ist ein großes Gerät, das CO2 zerlegt und den Sauerstoff zurückgewinnt. Ein Raumanzug muss jedoch beweglich sein, deshalb gibt es dort nur einen einfachen chemischen Abscheidungsprozess, der auf austauschbare Filter baut. Ich hatte so lange geschlafen, dass die Filter verbraucht waren.
Der Anzug hatte das Problem erkannt und in einen Notfallmodus umgeschaltet, den die Ingenieure als »Aderlass« bezeichnen. Da er das CO2 nicht mehr entfernen konnte, entließ der Anzug absichtlich etwas Luft in die Marsatmosphäre und glich den Mangel mit Stickstoff aus. Da auch durch das Loch ständig etwas Gas entwich, ging dem Anzug rasch der Stickstoff aus. Danach blieb ihm nur noch mein Sauerstoffbehälter.
Also tat er das Einzige, was er noch tun konnte, um mein Leben zu erhalten. Er füllte reinen Sauerstoff nach. Ich lief inzwischen Gefahr, an einer Sauerstoffvergiftung zu sterben. Der viel zu hohe Sauerstoffanteil in meiner Atemluft drohte mir das Nervensystem, die Lungen und die Augen zu verbrennen. Das ist ein absonderlicher Tod für jemanden, der in einem leckgeschlagenen Raumanzug steckt: zu viel Sauerstoff.
Jeder Schritt auf diesem Weg ging mit piepsenden Alarmsignalen, Meldungen und Warnungen einher. Der Alarm für die Sauerstoffüberversorgung hatte mich schließlich geweckt.
Das Training für eine Weltraummission ist erstaunlich umfangreich. Auf der Erde hatte ich wochenlang die entsprechenden Maßnahmen für alle möglichen Notfälle mit dem Raumanzug eingeübt. Daher wusste ich, was zu tun war.
Vorsichtig tastete ich an der Seite des Helms nach dem Flickzeug. Das ist nichts weiter als ein Trichter mit einem Ventil am schmalen und einem unglaublich klebrigen Harz am breiten Ende. Wenn man das Ventil öffnet, kann man das breite Ende über ein Loch stülpen. Die Luft entweicht durch das Ventil und stört nicht, während das Harz das Loch abdichtet. Dann schließt man das Ventil und hat das Leck versiegelt.
Das Problem war, die Antenne zu entfernen. Ich zog sie so schnell ich konnte heraus und zuckte zusammen, weil mir bei dem abrupten Druckabfall und dem grässlichen Schmerz schwindlig wurde.
Dann drückte ich das Flickzeug auf das Leck und verschloss es. Der Flicken hielt. Der Anzug ergänzte den fehlenden Luftdruck mit noch mehr Sauerstoff. Die Anzeige auf dem Arm verriet mir, dass ich inzwischen 85 Prozent Sauerstoff atmete. Der Anteil auf der Erde beträgt etwa 21 Prozent. Wenn ich nicht zu viel Zeit in dieser Atmosphäre verbrachte, würde mir nichts passieren.
Ich stolperte den Hügel hinauf zur Wohnkuppel. Auf der Anhöhe entdeckte ich zwei Dinge. Eines machte mich sehr glücklich, das andere sehr traurig. Die Wohnkuppel war in Ordnung (Juchhu!), das MRM war weg (Mist!).
In diesem Augenblick wusste ich, dass ich im Arsch war. Allerdings wollte ich nicht einfach da draußen auf der Oberfläche sterben. Ich humpelte zur Wohnkuppel zurück und tastete mich durch eine Luftschleuse. Sobald der Druck ausgeglichen war, legte ich den Helm ab.
In der Wohnkuppel zog ich auch den Anzug aus und nahm mir etwas Zeit, die Verletzung eingehend zu untersuchen. Ich musste sie nähen. Glücklicherweise hatten wir alle eine medizinische Grundausbildung bekommen, und in der Wohnkuppel gab es eine ausgezeichnete medizinische Ausrüstung. Rasch eine Spritze für die örtliche Betäubung setzen, die Wunde spülen, neun Stiche, und die Sache war erledigt. Zwei Wochen lang musste ich noch Antibiotika nehmen, aber davon abgesehen war alles in Ordnung.
Obwohl ich wusste, dass es hoffnungslos war, schaltete ich die Kommunikationsanlage ein. Natürlich empfing ich kein Signal. Die Hauptantennenschüssel war ja weggebrochen und hatte die Empfangsantenne gleich mitgenommen. Die Wohnkuppel besaß zwar Reservesysteme, doch die waren nur dazu gedacht, die Verbindung zum MRM zu halten, dessen stärkere Sender als Relaisstation für die restliche Strecke bis zur Hermes dienten. Das funktioniert natürlich nur, solange das MRM noch da ist.
Also konnte ich die Hermes nicht erreichen. Mit genügend Zeit konnte ich die Schüssel auf der Oberfläche finden, aber es hätte Wochen gedauert, alles zu reparieren, und dann wäre es zu spät gewesen. Bei einem Missionsabbruch verließ die Hermes die Umlaufbahn binnen vierundzwanzig Stunden. Die Dynamik der Umlaufbahnen sorgte dafür, dass die Rückreise umso schneller und sicherer verlief, je eher man sie antrat. Warum also warten?
Die Überprüfung meines Raumanzugs ergab, dass die Stabantenne meinen Biomonitor zerstört hatte. Bei EVAs – so nennen wir die Außenbordeinsätze – auf der Oberfläche sind die Raumanzüge der Crewmitglieder vernetzt, sodass wir gegenseitig über unseren Status informiert sind. Die anderen Crewmitglieder hatten verfolgt, wie der Druck in meinem Anzug bis fast auf null gesunken war, und dann hatten meine Biosignale ausgesetzt. Außerdem hatten sie beobachtet, wie ich in einem Sandsturm mit einem Speer in der Hüfte den Abhang hinuntergepurzelt war … alles klar. Sie hielten mich für tot. Was sonst hätten sie denken sollen?
Vielleicht hatten sie sogar kurz darüber diskutiert, meine Leiche zu bergen, aber die Vorschriften sind eindeutig. Falls auf dem Mars jemand stirbt, bleibt er auf dem Mars. Wenn sein Körper dort bleibt, muss das MRM weniger Gewicht tragen, also hat man mehr Treibstoff zur Verfügung, und die Fehlertoleranz wird größer. So einen Vorteil opfert man nicht aus sentimentalen Gründen.
So sieht die Situation also aus. Ich bin auf dem Mars gestrandet und kann weder mit der Hermes noch mit der Erde Verbindung aufnehmen. Alle halten mich für tot. Ich sitze in einer Wohnkuppel, die einunddreißig Tage stabil bleiben soll.
Wenn der Oxygenator versagt, ersticke ich. Wenn der Wasseraufbereiter versagt, verdurste ich. Wenn die Wohnkuppel nicht hält, explodiere ich einfach. Wenn das alles nicht passiert, geht mir irgendwann der Proviant aus, und ich verhungere.
Also bin ich wohl im Arsch.
2
Logbuch: Sol 7
Na gut, ich bin jetzt ausgeschlafen, und die Sache ist nicht mehr ganz so hoffnungslos wie gestern.
Heute habe ich die Vorräte überprüft und eine rasche EVA durchgeführt, um die draußen gelagerte Ausrüstung zu inspizieren. Die Lage sieht folgendermaßen aus:
Die Mission auf der Oberfläche sollte einunddreißig Tage dauern. Aus Sicherheitsgründen haben die Voraussonden genügend Lebensmittel für sechsundfünfzig Tage geliefert. Wären eine oder sogar zwei Sendungen nicht angekommen, dann hätten wir immer noch genügend Lebensmittel gehabt, um die Mission zu beenden.
Nach sechs Tagen ist die Hölle losgebrochen, also ist noch genügend Proviant für sechs Menschen und fünfzig Tage vorhanden. Ich bin allein, daher komme ich dreihundert Tage aus, sofern ich nicht streng rationiere. Ich habe also noch eine Weile Zeit.
Außerdem habe ich reichlich EVA-Anzüge. Jedes Crewmitglied erhielt zwei Raumanzüge: einen für den Raumflug, den wir während des Landeanflugs und beim Rückflug tragen sollten, und die klobigeren und robusteren EVA-Anzüge für die Außeneinsätze auf der Oberfläche. Mein Raumanzug hat ein Loch, und die Crewmitglieder trugen beim Rückflug zur Hermes natürlich ihre eigenen Anzüge. Alle sechs EVA-Anzüge sind aber noch vorhanden und in ausgezeichnetem Zustand.
Die Wohnkuppel hat den Sturm gut überstanden. Draußen sieht es nicht ganz so rosig aus. Die Satellitenschüssel kann ich nirgends finden. Wahrscheinlich wurde sie kilometerweit fortgeweht.
Das MRM ist natürlich weg, denn meine Kameraden sind damit zur Hermes geflogen. Die untere Hälfte (die Landestufe) ist noch da. Es gibt keinen Grund, so ein Ding mitzuschleppen, wenn jedes Gramm Gewicht ein Feind ist. Zu dem Unterteil gehören die Landestützen, die Treibstofferzeugung und alles andere, was die NASA auf dem Rückflug in die Umlaufbahn für entbehrlich hielt.
Das MLM liegt auf der Seite, die Hülle hat einen Riss. Anscheinend hat der Sturm die Verkleidung des Reservefallschirms zerfetzt, den wir für die Landung nicht gebraucht haben. Sobald der Fallschirm freigelegt war, zerrte er die Landekapsel umher und schmetterte sie gegen jeden Felsblock in der Umgebung. Nicht, dass mir das MLM viel nützen würde. Die Düsen können nicht einmal sein eigenes Gewicht heben. Allerdings hätte es möglicherweise wertvolle Ersatzteile enthalten.
Beide Rover liegen halb verschüttet im Sand, davon abgesehen sind sie aber in einem guten Zustand. Die Dichtungen sind intakt, was nicht anders zu erwarten war. Unser Operationsverfahren sah vor, bei einem aufziehenden Sturm einfach anzuhalten und das Ende abzuwarten. Die Rover sind so konstruiert, dass sie widrigen Bedingungen standhalten. Vermutlich kostet es mich etwa einen Tag Arbeit, sie auszugraben.
Die Verbindung zu den Wetterstationen, die in einem Kilometer Abstand rings um die Wohnkuppel verteilt sind, ist unterbrochen. Vielleicht sind sie sogar noch in Ordnung. Die Funksignale der Wohnkuppel reichen jetzt nicht einmal mehr einen Kilometer weit.
Die Solarzellen waren mit Sand bedeckt und nutzlos. Sie brauchen Sonnenlicht, um Strom zu erzeugen. Seit ich sie freigelegt habe, arbeiten sie wieder mit voller Leistung. Was ich auch tun will, an Strom wird es mir nicht mangeln. Zweihundert Quadratmeter Solarzellen und Wasserstoff-Brennstoffzellen, um die Energie zu speichern. Ich muss nur alle paar Tage die Solarzellen abwischen.
Da die Wohnkuppel stabil gebaut ist, sieht es drinnen sehr gut aus.
Ich habe das volle Diagnoseprogramm des Oxygenators ablaufen lassen. Zweimal. Er ist in perfektem Zustand. Wenn damit etwas passiert, gibt es noch ein Ersatzgerät mit kürzerer Laufzeit, das jedoch nur als Behelf dient, während das Hauptgerät repariert wird. Das Reservegerät zerlegt nicht das CO2 und setzt den Sauerstoff wieder frei, sondern absorbiert lediglich CO2, wie es auch die Raumanzüge tun. Es soll fünf Tage arbeiten, ehe die Filter gesättigt sind. Für mich wären das dreißig Tage, weil nur ein Mensch anstelle von sechs Crewmitgliedern atmet. Also habe ich einen gewissen Spielraum.
Auch der Wasseraufbereiter funktioniert einwandfrei. Dafür gibt es leider kein Ersatzgerät. Wenn er versagt, muss ich Wasser aus der Reserve entnehmen, während ich eine primitive Destille baue, um meine Pisse zu kochen. Außerdem verliere ich pro Tag einen halben Liter Wasser durch die Atmung, bis die Luftfeuchtigkeit in der Wohnkuppel den maximalen Wert erreicht und das Wasser an allen Oberflächen kondensiert. Dann kann ich die Wände abschlecken. Lecker. Wie auch immer, vorläufig macht der Wasseraufbereiter keinen Ärger.
Also gut – Essen, Wasser und Quartier sind abgehakt. Ich beginne sofort, das Essen zu rationieren. Die Mahlzeiten sind sowieso schon auf ein Minimum beschränkt, aber ich kann pro Mahlzeit nur drei Viertel einer Ration essen und trotzdem gesund bleiben. Damit strecke ich die dreihundert auf vierhundert Tage. Im medizinischen Lager habe ich die Flasche mit den Multivitamintabletten gefunden. Sie dürften mehrere Jahre reichen. Also werde ich nicht an Mangelerscheinungen leiden. Wenn mir das Essen ausgeht, werde ich natürlich trotzdem verhungern, ganz egal, wie viele Vitamine ich zu mir nehme.
In der medizinischen Abteilung gibt es Morphium für Notfälle. Der Vorrat reicht für eine tödliche Dosis. Eins kann ich Ihnen versprechen, ich werde nicht langsam verhungern. Wenn es so weit ist, wähle ich den einfacheren Ausweg.
Jeder Teilnehmer der Mission hatte zwei Spezialgebiete. Ich bin Botaniker und Mechaniker. Im Grunde bin ich der Reparaturtrupp, der außerdem gut Blumen gießen kann. Falls etwas kaputt geht, rettet mir die Bastelei möglicherweise das Leben.
Die ganze Zeit habe ich darüber nachgedacht, wie ich die Sache überleben kann. Ganz hoffnungslos ist es nicht. In etwa vier Jahren, wenn Ares 4 eintrifft, werden wieder Menschen auf dem Mars sein, falls sie nicht aufgrund meines vermeintlichen Todes das ganze Programm einstellen.
Ares 4 wird im Schiaparelli-Krater landen, der etwa 3200 Kilometer von meinem jetzigen Standort in Acidalia Planitia entfernt ist. Aus eigener Kraft kann ich nicht dorthin gelangen. Aber wenn ich kommunizieren kann, dann schicken sie mir vielleicht Hilfe. Ich bin nicht sicher, wie sie das mit den verfügbaren Ressourcen tun wollen, aber bei der NASA gibt es eine Menge clevere Leute.
Damit ist meine jetzige Mission umrissen. Einen Weg finden, um mit der Erde zu kommunizieren. Falls mir das nicht gelingt, muss ich die Hermes erreichen, während sie in vier Jahren die Crew von Ares 4 zum Mars bringt.
Natürlich habe ich nicht die Absicht, mit Vorräten für ein Jahr vier Jahre zu überleben. Aber eins nach dem anderen. Vorläufig habe ich genug zu essen und ein Ziel: Ich muss die verdammte Funkanlage reparieren.
Logbuch: Sol 10
Inzwischen habe ich drei EVAs absolviert und keine Spur der Antennenschüssel gefunden.
Einen der Rover habe ich ausgegraben und bin damit herumgefahren, aber nachdem ich mehrere Tage gesucht habe, muss ich es wohl aufgeben. Der Sturm hat die Schüssel weit weggeweht und dann alle Hinweise und Spuren verdeckt. Wahrscheinlich hat er sie völlig verschüttet.
Den heutigen Tag über habe ich mich um die Überreste der Funkanlage gekümmert. Es ist ein trauriger Anblick. Ich könnte auch gleich die Erde anbrüllen und hoffen, dass mich jemand hört.
Aus dem Metall, das ich im Stützpunkt finde, könnte ich möglicherweise eine primitive Schüssel formen, aber ich arbeite hier nicht mit einem kleinen Sprechfunkgerät. Die Kommunikation zwischen Erde und Mars ist schwierig und erfordert äußerst spezialisierte Geräte. Aus Alufolie und Kaugummi kann ich mir jedenfalls nichts basteln.
Meine EVAs muss ich ebenso rationieren wie das Essen. Die CO2-Filter kann man nicht reinigen. Sobald sie gesättigt sind, sind sie Schrott. Die Mission ging von einem vierstündigen Außeneinsatz pro Crewmitglied und Tag aus. Glücklicherweise sind CO2-Filter leicht und klein, und die NASA hat sich den Luxus erlaubt, mehr mitzuschicken, als benötigt wurden. Alles in allem stehen mir 1500 Stunden Außeneinsatz in Form von CO2-Filtern zur Verfügung. Danach kann ich mich nur noch draußen bewegen, wenn ich die verbrauchte Luft per Aderlass abstoße.
Tausendfünfhundert Stunden, das klingt nach einer ganzen Menge. Allerdings muss ich mindestens vier Jahre hierbleiben, ehe ich auf Rettung hoffen kann, und ich muss mindestens einmal pro Woche mehrere Stunden lang die Sonnenkollektoren abwischen. Wie auch immer, keine sinnlosen EVAs mehr.
Allmählich schält sich eine Idee heraus, wie ich meine Nahrungsmittelversorgung sicherstellen kann. Anscheinend zahlt sich meine botanische Ausbildung doch noch aus.
Warum haben sie überhaupt einen Botaniker zum Mars geschickt? Der Planet ist doch bekannt dafür, dass nichts auf ihm wächst. Nun ja, sie wollten herausfinden, wie gut die Pflanzen in der niedrigen Marsschwerkraft gedeihen und was wir, wenn überhaupt, mit dem marsianischen Erdreich anfangen können. Die kurze Antwort lautet: eigentlich eine ganze Menge. Beinahe. Die marsianische Krume hat alle Grundbausteine, die wachsende Pflanzen benötigen, aber auf der Erde passieren im Ackerboden viele Dinge, die es auf dem Mars nicht gibt, und es wird auch nicht besser, wenn man marsianisches Erdreich in irdischer Atmosphäre aufbewahrt und reichlich wässert. Dies betrifft vor allem Bakterien und gewisse Nährstoffe, die durch tierisches Leben erzeugt werden und so weiter. Nichts dergleichen existiert auf dem Mars. Eine meiner Aufgaben während der Mission bestand darin herauszufinden, wie die Pflanzen hier wachsen, wenn man irdische und marsianische Krume und die Atmosphären beider Planeten vermischt.
Deshalb habe ich eine kleine Menge Erdreich von der Erde und einige Samen mitgenommen.
Leider ist das kein Grund, in Begeisterungsschreie auszubrechen. Das Erdreich entspricht der Menge, die für einen Blumenkasten reicht, und die einzigen Samen, die ich habe, sind ein paar Gräser und Farne. Die NASA hat die widerstandsfähigsten und am leichtesten zu ziehenden Pflanzen der Erde als Testobjekte ausgewählt.
Also habe ich zwei Probleme: nicht genügend Erdreich und nichts Essbares, um es darin anzubauen.
Aber verdammt noch mal, ich bin Botaniker. Ich sollte doch fähig sein, einen Ausweg zu finden. Wenn mir das nicht gelingt, bin ich in etwa einem Jahr ein ziemlich hungriger Botaniker.
Logbuch: Sol 11
Ich frage mich, wie sich die Chicago Cubs schlagen.
Logbuch: Sol 14
Mein Diplom habe ich an der University of Chicago erworben. Die Hälfte der Leute, die Botanik studierten, waren Hippies, die dachten, sie könnten zu einem natürlichen Wirtschaftssystem zurückkehren und irgendwie sieben Milliarden Menschen versorgen, indem sie alles Mögliche sammelten. Die meiste Zeit versuchten sie aber nur, bessere Methoden für den Hanfanbau zu entwickeln. Ich mochte sie nicht. Mir ging es immer nur um die Wissenschaft und nicht um irgendeine blöde Weltverbesserung.
Als sie Komposthaufen anlegten und jedes bisschen lebende Materie einsammelten, lachte ich sie aus. »Seht euch nur die albernen Hippies an! Diese lächerlichen Versuche, ein komplexes globales Ökosystem im Hinterhof zu simulieren!«
Genau das mache ich jetzt selbst. Ich hebe jedes Fitzelchen organische Materie auf, das ich finden kann. Wenn ich eine Mahlzeit beende, kommen die Reste in den Komposteimer. Was das andere biologisch aktive Material angeht …
Die Wohnkuppel hat hochmoderne Toiletten. Der Kot wird gewöhnlich vakuumgetrocknet und in versiegelten Beuteln gesammelt, die auf der Oberfläche weggeworfen werden.
Damit ist jetzt Schluss!
Ich habe sogar einen Ausflug unternommen, um die alten Kotbeutel einzusammeln, die vor dem Rückflug der Crew draußen gelandet sind. Diese vollständig ausgedörrten Haufen enthalten natürlich keine Bakterien mehr, aber immer noch komplexe Proteine, die einen nützlichen Dung ergeben. Wenn ich Wasser und aktive Bakterien hinzufüge, kann ich sie schnell befruchten und die Bewohner ersetzen, die im Todesklo umgekommen sind.
Den getrockneten Kot und etwas Wasser habe ich in einen großen Behälter gekippt. Regelmäßig kommt nun auch mein eigener Stuhl hinzu. Je schlimmer es riecht, desto besser läuft es. Die Bakterien sind an der Arbeit!
Sobald ich etwas marsianische Erde hereingeschafft habe, kann ich den Dung untermischen und verteilen. Dann streue ich die irdische Erde oben darauf. Man sollte meinen, dies sei vielleicht nicht so wichtig, aber das trifft nicht zu. In der heimischen Krume leben Dutzende Bakterienarten, die für das Wachstum der Pflanzen entscheidend sind. Sie breiten sich aus und vermehren sich wie … nun ja, wie eine Bakterieninfektion.
Die Menschen benutzen schon seit Jahrhunderten ihre Exkremente als Dünger, und in England gab es sogar den Begriff »Nachterde« dafür. Normalerweise ist das kein idealer Dünger, weil sich über den Kot Krankheiten verbreiten. Menschliche Exkremente bergen Erreger, die – Sie ahnen es – Menschen infizieren können. Das ist für mich allerdings kein Problem. Die einzigen Erreger in diesem Mist sind diejenigen, die ich sowieso schon habe.
Binnen einer Woche ist die marsianische Erde so weit, dass in ihr Pflanzen keimen können. Aber ich werde noch nichts anpflanzen. Ich hole vielmehr noch mehr leblose Erde von draußen herein und decke die belebte Erde darüber. So wird die tote Erde infiziert, und ich bekomme die doppelte Menge heraus. Nach einer weiteren Woche folgt die nächste Verdopplung, und so geht es weiter. Die ganze Zeit füge ich meinen frischen Dung hinzu.
Mein Arsch trägt ebenso zu meinem Überleben bei wie mein Kopf.
Ich habe das nicht selbst erfunden. Schon vor Jahrzehnten haben die Leute darüber spekuliert, wie man aus dem marsianischen Staub fruchtbaren Ackerboden machen kann. Ich führe lediglich den ersten Praxistest durch.
Bei der Untersuchung der Lebensmittelvorräte fand ich alle möglichen Dinge, die ich anbauen kann. Erbsen zum Beispiel, dazu reichlich Bohnen. Außerdem mehrere Kartoffeln. Wenn auch nur eine von ihnen nach dem entbehrungsreichen Flug noch keimt, wäre es schön. Dank des fast unendlichen Vorrats an Vitaminen brauche ich nur noch Kalorien irgendeiner Art, um zu überleben.
Insgesamt hat die Wohnkuppel eine Grundfläche von 92 Quadratmetern. Ich will die ganze Fläche für meinen Ackerbau nutzen. Es macht mir nichts aus, auf nackter Erde zu laufen. Es ist eine Menge Arbeit, aber ich muss den ganzen Boden zehn Zentimeter hoch mit Erde bedecken. Das heißt, dass ich 9,2 Kubikmeter Marsstaub in die Wohnkuppel schaffen muss. Bei jedem Durchgang bekomme ich schätzungsweise ein Zehntel Kubikmeter durch die Luftschleuse, und es ist eine ziemliche Anstrengung, die Erde zu sammeln. Aber wenn schließlich alles gut verläuft, habe ich 92 Quadratmeter urbare Erde.
Teufel, ja, ich bin Botaniker! Fürchtet meine botanischen Kräfte!
Logbuch: Sol 15
Bäh! Ich schufte mich dumm und dämlich.
Heute habe ich zwölf Stunden draußen verbracht, um Erde in die Wohnkuppel zu schaffen. Trotzdem konnte ich nur eine kleine Ecke des Stützpunkts füllen. Es sind höchstens fünf Quadratmeter. Bei diesem Tempo brauche ich Wochen, um die ganze Erde zu beschaffen. Aber was soll’s, Zeit habe ich ja genug.
Die ersten paar Ausflüge waren recht ineffizient. Ich füllte kleine Behälter und brachte sie durch die Luftschleuse wieder hinein. Dann wurde ich schlauer und stellte einen großen Kasten auf, in dem ich die kleineren Behälter verstaute. Auf diese Weise konnte ich viel schneller arbeiten, weil ein Gang durch die Luftschleuse zehn Minuten dauert.
Mir tun alle Knochen weh. Die Schaufeln, die ich habe, sind für das Entnehmen von Proben gedacht, aber nicht für schwere Wühlarbeit. Mein Rücken bringt mich um. In der medizinischen Abteilung habe ich etwas Vicodin gefunden, das ich vor zehn Minuten genommen habe. Die Wirkung müsste bald einsetzen.
Jedenfalls ist es nett, Fortschritte zu sehen. Höchste Zeit, dass ich die Bakterien auf die Mineralstoffe loslasse. Nach dem Mittagessen ist es so weit. Heute gibt es keine Dreiviertelration. Ich habe mir eine vollständige Mahlzeit verdient.
Logbuch: Sol 16
Ein Problem habe ich nicht bedacht: das Wasser.
Nach ein paar Millionen Jahren auf der Marsoberfläche enthält der Staub keinerlei Feuchtigkeit mehr. Dank meines Abschlusses in Botanik bin ich ziemlich sicher, dass Pflanzen zum Wachsen feuchte Erde brauchen. Ganz zu schweigen von den Bakterien, die schon vorher in der Erde leben müssen.
Glücklicherweise habe ich Wasser, aber nicht so viel wie nötig. Fruchtbare Erde muss vierzig Liter Wasser pro Kubikmeter enthalten. Ich will hier 9,2 Kubikmeter Erde einsetzen, also brauche ich 368 Liter Wasser.
Die Wohnkuppel hat einen ausgezeichneten Wasseraufbereiter. Es ist das Beste, was man überhaupt auf der Erde bekommen kann. Also dachte sich die NASA: »Warum sollen wir einen Haufen Wasser da hinaufschicken? Wir geben ihnen gerade so viel, dass es im Notfall ausreicht.« Ein Mensch braucht rund zwei Liter Wasser am Tag, um sich gut zu fühlen. Sie haben uns fünfzig Liter pro Kopf mitgegeben, daher befinden sich 300 Liter Wasser in der Wohnkuppel.
Ich bin bereit, alles bis auf einen Notvorrat von 50 Litern für die Pflanzen zu verwenden. Das bedeutet, dass ich 62,5 Quadratmeter bis zu einer Tiefe von zehn Zentimetern wässern kann, also ungefähr zwei Drittel der verfügbaren Fläche in der Wohnkuppel. Das muss reichen. So sieht der langfristige Plan aus. Erst einmal richte ich weitere fünf Quadratmeter ein.
Zusammengerollte Decken und die Uniformen meiner abgereisten Kameraden habe ich verwendet, um die Ränder einer Art Pflanzkiste festzulegen, die gegenüber von den gekrümmten Wänden der Wohnkuppel selbst begrenzt wird. Die fünf Quadratmeter habe ich so gut abgemessen, wie es eben ging. Dann habe ich zehn Zentimeter hoch Sand eingefüllt und 20 Liter meines kostbaren Wassers den Staubgöttern geopfert.
Danach wurde es widerlich. Ich habe meinen großen Kotbehälter auf die Erde entleert und hätte mich bei dem Gestank fast übergeben. Mit einer Schaufel habe ich Erde und Kot vermischt und gleichmäßig verteilt. Dann habe ich die irdische Krume darauf gestreut. Nun macht euch an die Arbeit, ihr Bakterien. Ich verlasse mich auf euch. Der Geruch wird sich wohl eine Weile halten. Leider kann ich kein Fenster öffnen und lüften. Nun ja, man gewöhnt sich daran.
Übrigens ist heute Thanksgiving. Wie gewohnt wird sich meine Familie in Chicago in meinem Elternhaus versammeln und feiern. Wahrscheinlich kommt dabei keine große Freude auf, weil ich vor zehn Tagen gestorben bin. Teufel auch, vielleicht haben sie gerade die Beerdigung hinter sich.
Ich frage mich, ob sie jemals erfahren werden, was wirklich geschehen ist. Ich war so sehr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, dass ich gar nicht daran gedacht habe, wie es für meine Eltern gewesen sein muss. Im Augenblick sind sie bestimmt unendlich traurig. Ich würde alles geben, um sie wissen zu lassen, dass ich gar nicht tot bin.
Diesen Kummer will ich ihnen eines Tages nehmen. Ich muss einfach überleben.
Logbuch: Sol 22
Hey, so langsam tut sich was.
Ich habe den ganzen benötigten Sand hereingeschafft und kann loslegen. Zwei Drittel des Stützpunkts sind mit Erde bedeckt. Heute habe ich zum ersten Mal den Ackerboden verdoppelt. Eine Woche ist vergangen, und der ehemalige marsianische Staub ist schöner, fruchtbarer Ackerboden. Noch zwei Verdopplungen, und ich habe das ganze Feld bedeckt.
Die Arbeit war gut für meine Moral. Ich hatte etwas zu tun. Aber sobald es etwas ruhiger wurde, setzte ich mich zum Essen hin und hörte mir Johannsens Beatles-Sammlung an. Dabei bekam ich wieder Depressionen.
Ich kann rechnen, solange ich will, ich werde verhungern.
Aus Kartoffeln kann ich die meisten Kalorien herausholen. Sie wachsen wie wild und haben einen relativ hohen Gehalt, etwa 770 Kalorien pro Kilogramm. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Exemplare keimen werden. Das Problem ist nur, dass ich nicht genug davon anbauen kann. Auf 62 Quadratmetern könnte ich in 400 Tagen (das ist die Zeitspanne, ehe mir die Vorräte ausgehen) etwa 150 Kilogramm Kartoffeln erzeugen. Das macht insgesamt 115.500 Kalorien, was 288 Kalorien pro Tag entspricht. Bei meiner Körpergröße und meinem Gewicht – und wenn ich bereit bin, ein wenig zu hungern – brauche ich 1500 Kalorien pro Tag.
Die Produktion deckt nicht einmal annähernd meinen täglichen Bedarf.
Also kann ich mich nicht ewig von meinem Ackerboden ernähren. Aber ich kann mein Leben verlängern. Die Kartoffeln schenken mir 76 Tage.
Kartoffeln wachsen ständig nach, also kann ich in den 76 Tagen noch einmal 22.000 Kalorien in Form von Kartoffeln erzeugen, was mir weitere 15 Tage einbringt. Danach ist es mehr oder weniger sinnlos, die Arbeit fortzusetzen. Alles in allem komme ich auf zusätzliche 90 Tage.
Also werde ich nun an Sol 490 statt an Sol 400 zu verhungern beginnen. Das ist ein Fortschritt, aber wenn ich überleben will, muss ich es bis Sol 1412 schaffen, wenn Ares 4 landet.
Mir fehlt die Nahrung für rund eintausend Tage, und ich habe keine Ahnung, wie ich sie beschaffen kann.
Verdammt.
3
Logbuch: Sol 25
Erinnern Sie sich an Ihre alten Mathematikaufgaben? Das Wasser fließt mit einer bestimmten Geschwindigkeit in einen Behälter hinein und am anderen Ende wieder heraus. Sie müssen berechnen, wann der Behälter leer ist. Diese Rechenaufgabe ist jetzt entscheidend für mein Projekt »Mark Watney darf nicht sterben«.
Ich muss Kalorien erzeugen, und zwar genug, um 1387 Marstage zu überleben, bis Ares 4 landet. Wenn mich Ares 4 nicht rettet, bin ich sowieso tot. Ein Sol ist 39 Minuten länger als ein irdischer Tag, also läuft es auf Nahrung für 1425 Erdentage hinaus. Das ist mein Ziel: Nahrung für 1425 Tage.
Ich habe reichlich Vitamine, mehr als doppelt so viele, wie ich brauche. Jedes Proviantpaket enthält den fünffachen Tagesbedarf an Protein, bei vorsichtiger Rationierung ist meine Proteinversorgung demnach für mindestens vier Jahre gesichert. Die Grundlagen der Ernährung sind vorhanden, jetzt brauche ich nur noch Kalorien.
Ich verbrenne jeden Tag 1500 Kalorien. Als Startkapital habe ich Vorräte für 400 Tage. Wie viele Kalorien muss ich durchgängig pro Tag erzeugen, um insgesamt 1425 Tage zu überleben?
Die Berechnungen schenke ich mir hier. Die Antwort lautet: Es sind etwa 1100 Kalorien. Ich muss mit meinem Ackerbauprojekt pro Tag 1100 Kalorien neu erzeugen, wenn ich überleben will, bis Ares 4 eintrifft. Genau genommen sogar etwas mehr, weil wir jetzt schon Sol 25 schreiben und ich bisher noch nichts angebaut habe.
Mit meinen 62 Quadratmetern Ackerfläche erzeuge ich etwa 288 Kalorien am Tag. Folglich muss ich, wenn ich überleben will, meine gegenwärtige Produktion um fast das Vierfache steigern.
Das bedeutet, dass ich mehr Fläche für den Ackerbau und obendrein mehr Wasser brauche, um die Pflanzen zu versorgen. Aber eins nach dem anderen.
Wie viel Ackerland kann ich tatsächlich bereitstellen?
Die Wohnkuppel hat eine Grundfläche von 92 Quadratmetern. Nehmen wir an, ich kann die volle Fläche nutzen.
Außerdem gibt es fünf unbenutzte Kojen. Wenn ich auch sie mit Erde fülle, bekomme ich jeweils 2 Quadratmeter heraus, also insgesamt noch einmal 10 Quadratmeter. Macht zusammen 102 Quadratmeter.
In der Wohnkuppel stehen drei Labortische, die ebenfalls jeweils 2 Quadratmeter groß sind. Einen will ich selbst benutzen, zwei verwandle ich in Anbaufläche. Das macht noch einmal 4 Quadratmeter, insgesamt 106.
Ich habe zwei Marsrover. Sie sind luftdicht, damit die Insassen bei längeren Ausflügen ohne Raumanzüge fahren können. Die Innenräume sind zu beengt, um dort etwas anzupflanzen, und ich brauche sie außerdem, wenn ich mich bewegen will. Aber die beiden Rover besitzen Wurfzelte für Notfälle.
Aufblasbare Zelte als Ackerland zu benutzen bringt eine Menge Schwierigkeiten mit sich, aber immerhin haben sie jeweils zehn Quadratmeter Grundfläche. Sofern ich die Probleme überwinden kann, geben sie mir weitere 20 Quadratmeter, sodass ich insgesamt 126 Quadratmeter Ackerland bewirtschaften kann.
Hundertsechsundzwanzig Quadratmeter urbares Land, das ist doch mal was. Ich habe nicht genug Wasser, um die ganze Krume zu bestellen, aber wie gesagt, eins nach dem anderen.
Als Nächstes muss ich mir überlegen, wie effizient mein Kartoffelanbau verläuft. Meinen Ertrag habe ich an der Kartoffelproduktion auf der Erde orientiert, aber die Kartoffelbauern kämpfen nicht verzweifelt ums Überleben wie ich. Kann ich höhere Erträge erzielen?
Zuerst einmal kann ich mich individuell um jede einzelne Pflanze kümmern. Ich kann die Triebe zurückschneiden und dafür sorgen, dass sie gesund bleiben und sich nicht gegenseitig stören. Außerdem kann ich sie tiefer setzen, sobald sie durch die Erde brechen, und über ihnen jüngere Exemplare einpflanzen. Normale Kartoffelbauern tun das nicht, weil es die Mühe nicht wert ist, wenn sie es mit Millionen von Pflanzen zu tun haben.
Obendrein laugt man mit einem derart intensiven Anbau den Boden aus. Wer so etwas tut, verwandelt sein Land binnen zwölf Jahren in eine Staubwüste. Die Erde kann sich nicht erholen. Aber wen kümmert das? Ich muss ja lediglich vier Jahre überleben.
Mit dieser Taktik lässt sich der Ertrag schätzungsweise um 50 Prozent erhöhen. Und dank der 126 Quadratmeter (ich habe die ursprünglichen 62 Quadratmeter etwas mehr als verdoppelt) komme ich auf etwas mehr als 850 Kalorien pro Tag.
Das ist ein echter Fortschritt. Ich bin immer noch dem Verhungern nahe, aber ich komme allmählich in den Bereich, in dem ich überleben kann. Vielleicht schaffe ich es fast verhungert, aber eben noch nicht tot. Ich könnte den Kalorienbedarf verringern, indem ich mich möglichst wenig bewege. Ich könnte die Temperatur der Wohnkuppel erhöhen und muss dadurch weniger Energie aufwenden, um meinen Körper warm zu halten. Ich könnte mir einen Arm abhacken und aufessen, was mir einerseits wertvolle Kalorien verschafft und andererseits meinen Bedarf senkt.
Nein, nicht wirklich.
Nehmen wir mal an, ich kann tatsächlich so viel Ackerland bereitstellen. Jedenfalls scheint das machbar. Woher bekomme ich das Wasser? Der Sprung von 62 bis zu 126 Quadratmetern bei zehn Zentimetern Höhe erfordert weitere 6,4 Kubikmeter Erde (schon wieder schaufeln, wie schön!) und außerdem mehr als 250 Liter Wasser.
Die 50 Liter, die ich noch habe, sind für mich gedacht, falls der Wasseraufbereiter versagt. Von den 250 Litern, die ich brauche, fehlen mir genau 250 Liter.
Mist. Ich gehe jetzt ins Bett.
Logbuch: Sol 26
Es war ein furchtbar anstrengender, aber auch ein sehr produktiver Tag.
Ich hatte keine Lust mehr zum Nachdenken und habe mir nicht überlegt, woher ich 250 Liter Wasser bekomme, sondern eine Menge neue Erde in die Wohnkuppel gebracht, auch wenn sie derzeit noch trocken und nutzlos ist.
Einen Kubikmeter habe ich geschafft, ehe ich zu erschöpft war und aufhören musste.
Dann hat mich eine Stunde lang ein kleiner Staubsturm behelligt und eine Menge Dreck auf den Sonnenkollektoren hinterlassen. Deshalb musste ich mich abermals anziehen und schon wieder hinausgehen. Ich war die ganze Zeit ziemlich sauer. Es ist ausgesprochen langweilig und körperlich anstrengend, eine große Zahl von Sonnenkollektoren abzuwischen. Sobald ich fertig war, kehrte ich in meine kleine Farm zurück.
Es war Zeit für die nächste Ackerverdopplung, und ich dachte mir, ich könnte es auch gleich erledigen. Es dauerte eine Stunde. Noch eine weitere Verdopplung, und die nutzbare Erde ist einsatzbereit.
Außerdem dachte ich, es sei an der Zeit, ein paar Pflanzen auszusäen. Ich hatte genügend Erde verdoppelt, um eine kleine Ecke auszusparen, und besaß zwölf Kartoffeln, mit denen ich arbeiten konnte.
Es ist ein unglaublicher Glücksfall, dass sie nicht gefriergetrocknet oder gemulcht sind. Warum hat die NASA zwölf ganze Kartoffeln gekühlt, aber nicht tiefgefroren mitgeschickt? Und warum wurden die Kartoffeln unter normalen Druckverhältnissen zusammen mit uns verladen statt mit den übrigen Vorräten für die Wohnkuppel in einer Kiste? Weil Thanksgiving in die Zeit unserer Bodenoperationen fiel und die Eierköpfe bei der NASA dachten, es sei doch eine schöne Sache, wenn wir zusammen kochten. Wir sollten nicht nur zusammen essen, sondern das Mahl gemeinsam zubereiten. Irgendwo gibt es dahinter bestimmt eine gewisse Logik, aber wen kümmert’s?
Ich schnitt jede Kartoffel in vier Teile und achtete darauf, dass jedes Stück mindestens zwei Augen hatte. Die Augen sind die Stellen, aus denen die Pflanzen keimen. Ich ließ sie ein paar Stunden liegen, damit sie etwas hart wurden, und pflanzte sie in der Ecke in ausreichendem Abstand ein. Alles Gute, ihr kleinen Erdäpfel. Mein Leben hängt von euch ab.
Normalerweise dauert es mindestens 90 Tage, bis Kartoffeln zu normaler Größe heranwachsen, aber so lange kann ich nicht warten. Ich muss die Kartoffeln aus dieser Ernte erneut zerschneiden, um das ganze Feld zu besetzen.
Wenn ich die Temperatur in der Wohnkuppel auf 25,5 Grad einstelle, wachsen die Pflanzen schneller. Außerdem liefert die interne Beleuchtung genügend künstliches Sonnenlicht, und ich sorge dafür, dass es immer feucht genug ist (sobald ich mir ausgedacht habe, woher ich das Wasser bekomme). Es gibt hier kein schlechtes Wetter und keine Parasiten, die den Pflanzen zusetzen, auch kein Unkraut, das mit ihnen um Erde und Nährstoffe konkurriert. Da es für sie so gut läuft, sollte ich binnen 40 Tagen gesunde, keimfähige Kartoffeln erhalten.
Schließlich war ich der Ansicht, dass der Bauer Mark für einen Tag genug geleistet hatte.
Zum Abendessen gab es eine volle Mahlzeit. Ich hatte sie mir redlich verdient. Außerdem hatte ich eine Menge Kalorien verbrannt, die ich zurückhaben wollte.
Ich durchwühlte Commander Lewis’ Sachen, bis ich ihren persönlichen Datenstick fand. Jeder durfte digitale Unterhaltungsmedien nach seinem Geschmack mitbringen, und ich hatte genug von Johannsens Beatles-Platten. Es war Zeit zu sehen, was Lewis hatte.
Kitschige Fernsehserien. Ja, genau. Komplette Staffeln uralter Fernsehserien.
Na ja. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also gibt es jetzt Herzbube mit zwei Damen.
Logbuch: Sol 29
In den letzten paar Tagen habe ich so viel Erde hereingeholt, wie ich brauche. Ich habe die Tische und Kojen abgestützt, damit sie das Gewicht tragen, und sogar schon die Erde darauf verteilt. Das Wasser, das sie fruchtbar macht, habe ich immer noch nicht, aber ich habe einige Ideen. Wirklich schlechte Ideen, aber immerhin, es sind Ideen.
Heute bestand meine größte Leistung darin, die Wurfzelte aufzustellen.
Das Problem der Zelte ist, dass sie nicht für den ständigen Gebrauch gedacht sind.
Sie dienen nur einem einzigen Zweck: Man baut sie auf, klettert hinein und wartet auf Rettung. Die Luftschleuse besteht lediglich aus Düsen und zwei Türen. Man stellt den Druckausgleich her, steigt hinein, stellt noch einmal den Druckausgleich her und ist draußen. Bei jeder Benutzung verliert man eine gewisse Menge Atemluft, und ich muss mindestens einmal am Tag hinein. Das Volumen der Zelte ist klein, daher kann ich mir den Luftverlust eigentlich nicht erlauben.
Mehrere Stunden verbrachte ich damit, mir zu überlegen, wie man die Luftschleuse eines Zelts mit einer Luftschleuse der Wohnkuppel verbinden kann. Die Wohnkuppel hat drei Luftschleusen, und ich hätte gern zwei davon für die aufblasbaren Zelte geopfert. Das wäre die ideale Lösung gewesen.
Die frustrierende Erkenntnis war, dass man die Luftschleusen der Zelte tatsächlich mit anderen Luftschleusen koppeln kann. Möglicherweise liegen Verletzte in den Zelten, oder es gibt nicht genügend Raumanzüge. Also muss man die Leute herausholen können, ohne sie der Marsatmosphäre auszusetzen.
Die Wurfzelte sind allerdings für Rettungseinsätze mit dem Rover gedacht. Die Luftschleusen der Wohnkuppel sind viel größer und völlig anders konstruiert als die der Rover. Wenn man richtig darüber nachdenkt, gibt es auch keinerlei Grund, die Notzelte mit der Wohnkuppel zu verbinden.
Es sei denn, man strandet auf dem Mars, alle halten einen für tot, und man führt einen verzweifelten Kampf gegen die Elemente, um am Leben zu bleiben. Aber abgesehen von diesem Sonderfall gibt es wirklich keinen Grund dafür.
Also entschloss ich mich letzten Endes, die Nachteile in Kauf zu nehmen. Dann werde ich eben beim Betreten oder Verlassen eines Wurfzelts jedes Mal etwas Druck verlieren. Zum Glück besitzen die Zelte Einspeiseventile für Luft, die man von außen erreichen kann. Es sind ja Notunterkünfte, und die Insassen brauchen möglicherweise Luft, die man aus dem Rover mithilfe eines Schlauchs einleiten kann. Die simple Vorrichtung stellt einen Druckausgleich zwischen dem Rover und dem Wurfzelt her.
Die Wohnkuppel und die Rover benutzen die gleichen Ventile und Schläuche, sodass ich die Aufblaszelte direkt mit der Wohnkuppel verbinden kann. Auf diese Weise fülle ich die Luft nach, die ich jedes Mal beim Betreten und Verlassen der Zelte verliere (die NASA-Leute reden in solchen Fällen von Einstieg und Ausstieg).
Die NASA hat bei den Notzelten gewiss nicht gepfuscht. Kaum dass ich im Rover auf den Panikknopf drückte, entfaltete sich das Wurfzelt mit einem Zischen, bei dem mir die Ohren knackten, und hing vor der Luftschleuse des Rovers. Es dauerte höchstens zwei Sekunden.
Ich schloss die Luftschleuse des Rovers und hatte nun ein schönes, isoliertes Aufblaszelt. Den Ausgleichsschlauch anzubringen war einfach, weil ich ausnahmsweise einmal die Ausrüstung für den Zweck verwendete, dem sie dienen sollte. Nach ein paar Durchgängen durch die Schleuse (wobei die Wohnkuppel automatisch den Druckverlust ausglich) hatte ich die Erde hineingeschafft.
Ich wiederholte den Vorgang mit dem zweiten Zelt. Alles verlief reibungslos.
Aber … das Wasser.
Auf der Highschool habe ich oft »Dungeons and Dragons« gespielt. Wahrscheinlich hätten Sie nicht vermutet, dass ein Botaniker und Mechaniker wie ich auf der Schule ein kleiner Nerd war, aber genau das war ich. In dem Spiel habe ich einen Kleriker gemimt, und einer der Sprüche, die ich wirken konnte, war »erschaffe Wasser«. Das hatte ich immer für einen ausgesprochen dummen Zauberspruch gehalten und ihn nie benutzt. Mann, was hätte ich jetzt hergegeben, um im richtigen Leben dazu fähig zu sein.
Wie auch immer, dies ist ein Problem, das ich morgen lösen werde.
Heute Abend ist wieder Herzbube mit zwei Damen dran. Gestern Abend habe ich mitten in der Folge abgebrochen, nachdem Mr. Roper etwas beobachtet und in einen falschen Kontext gestellt hatte.
Logbuch: Sol 30
Ich habe einen ebenso idiotischen wie gefährlichen Plan für die Beschaffung des Wassers entwickelt. O Mann, ich meine, er ist wirklich gefährlich. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe keine anderen Ideen mehr, und in ein paar Tagen muss ich das nächste Mal das Erdreich verdoppeln. Bei der letzten Verdopplung werde ich all die neue Erde einbeziehen, die ich hereingebracht habe. Wenn ich sie nicht vorher anfeuchte, stirbt der Boden ab.
Auf dem Mars gibt es nicht viel Wasser. Auf den Polkappen existiert Eis, aber sie sind zu weit weg. Wenn ich Wasser haben will, muss ich es selbst herstellen. Glücklicherweise kenne ich das Rezept: Man mische Wasserstoff und Sauerstoff und zünde das Ganze an.
Eins nach dem anderen. Ich beginne mit dem Sauerstoff.
Ich verfüge über einige Sauerstoffreserven, aber nicht genug, um 250 Liter Wasser herzustellen. Zwei Hochdrucktanks am Ende der Wohnkuppel bergen meinen gesamten Vorrat (natürlich abgesehen von der freien Luft in der Kapsel). In jedem Behälter befinden sich 25 Liter Flüssigsauerstoff. Die Wohnkuppel darf nur im Notfall auf sie zurückgreifen, denn sie besitzt einen Oxygenator, um die Atmosphäre zu erhalten. Die Sauerstofftanks dienen vor allem der Versorgung der Raumanzüge und der Rover.
Wie auch immer, diese Reserven reichen nur aus, um 100 Liter Wasser herzustellen (50 Liter O2 ergeben 100 Liter Moleküle, die jeweils nur ein Sauerstoffatom haben). Wenn ich den Vorrat benutze, kann ich keine EVAs mehr durchführen und habe keine Reserven für Notfälle. Außerdem bekomme ich damit weniger als die Hälfte des Wassers, das ich brauche. Dieser Weg scheidet also aus.
Sauerstoff ist auf dem Mars jedoch einfacher zu finden, als man glaubt. Die Atmosphäre besteht zu 95 Prozent aus CO2, und ich besitze zufällig eine Maschine, deren einziger Zweck darin besteht, den Sauerstoff aus CO2 zu gewinnen. Genau, der Oxygenator!
Das Problem dabei: Die Atmosphäre ist sehr dünn. Der Luftdruck beträgt weniger als ein Prozent des irdischen Werts. Das Gas ist daher schwer einzusammeln. Der ganze Zweck der Wohnkuppel besteht ja darin, die Bewohner von der Marsatmosphäre zu isolieren. Die lächerlich kleine Menge an marsianischer Atmosphäre, die beim Benutzen der Luftschleuse eindringt, kann man vernachlässigen.
An dieser Stelle kommt die Treibstoffproduktion des MRM ins Spiel.
Meine Crew ist vor ein paar Wochen mit dem MRM weggeflogen. Die untere Hälfte ist aber noch da. Die NASA sieht keinen Sinn darin, unnötigen Ballast in die Umlaufbahn zu bringen. Die Landestützen, die Rampe für den Einstieg und die Treibstofferzeugung sind noch vorhanden. Das MRM hat seinen Treibstoff aus der Marsatmosphäre selbst gewonnen. Der erste Schritt des Prozesses besteht darin, CO2 aufzufangen und unter hohem Druck in einem Behälter zu speichern. Sobald ich die Treibstoffproduktion mit der Energieversorgung der Wohnkuppel verbunden habe, bekomme ich beliebig lange pro Stunde einen halben Liter CO2. Nach zehn Marstagen sind es 125 Liter CO2, aus denen der Oxygenator 125 Liter O2 herstellen kann.
ENDE DER LESEPROBE