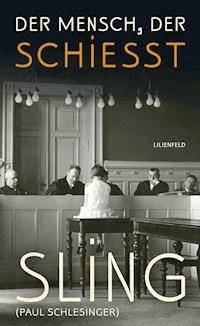
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lilienfeld Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum hat die Gräfin Bothmer all diese kleinen Diebstähle begangen? Ist der Archivdieb Dr. Hauck ein Dokumentenfetischist? Hat Sanitätsrat Boehme alle seine Ehefrauen umgebracht? Und durfte Frau Huhn Frau Knill eine Ohrfeige geben wegen der Behauptung, sie habe etwas mit ihrem Gatten Herrn Knill? Von der Verleumdungsklage unter Nachbarn, dem Erbschaftsstreit im Hochadel, über Glücksspielbetrug, Meineidsverfahren, aufgedeckte Korruption sowie geniale Fälschungen bis hin zum Verdacht auf Gattinnenmord, zu erschossenen Söhnen, tödlichen Eifersuchtsdramen und müden Richtern: Die Gerichtsreportagen von Sling führen mitten hinein in das Leben, wie es sich vor den Schranken der Gerichte sammelt, mitten hinein in die Welt der zwanziger Jahre. Das Kürzel "Sling" stand dabei für eine neuartige Berichterstattung, die geprägt war von einem menschenfreundlichen Humor und ihren Urheber zu einem der berühmtesten Journalisten der Weimarer Republik und zum Vorbild für viele nach ihm machte. Hans Holzhaider, als Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung ein "Nachfahre" Slings, trägt das Nachwort bei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SLING
(Paul Schlesinger)
DER MENSCH,DER SCHIESST
Berichte aus dem Gerichtssaal
Mit einem Nachwortvon HANS HOLZHAIDERherausgegebenvon AXEL VON ERNST
INHALT
Vorbemerkung
DER HERR SLING
Der Mensch, der schießt
Die Atmosphäre von Moabit
Wie ich Gerichts-Berichterstatter wurde
GEWALTSAMER TOD
Hackbusch
Amtsgerichtsrat Josephsen
Angerstein
Dr. Bruno Schreiber
Sanitätsrat Böhme
Bilder vom Flessa-Prozeß
Der Fall Strasser
Der Fall Heydebrand
Mensch und Hund
Mordprozeß Krantz
Die große Wut des kleinen Mannes
DIE KUNST DES BETRUGS
Die alte Geschichte
Der Vater keiner Kinder
Der Spezialist im Betrogenwerden
Tragödie mit Lichtblick
Heinrich Sklarz
Mittelalter
Herr von Lehn
Wer ist verantwortlich?
Das Buch des falschen Prinzen
Der schwarze Harry und der eiserne Willy
Die Eierkiste
FREMDER BESITZ
Der Räuber aus Reklamesucht
Die sachverständige Lebedame
Die Kette
Die Banderolendiebe
Der ehrliche Dieb und der schwindelnde Ehrenmann
Der Einbruch
Statt fünf Jahre Zuchthaus ein Jahr Gefängnis
Der letzte Fall im alten Jahr
Wald
BELEIDIGUNGEN
Der Kavalier
Der Schattenriß an der Wand
Intermezzo
Mit Fischen in der Halle …
Berlinisches Satyrspiel
Der Schüler als Lehrer
Der beleidigende Schupomann
Hausfriedensbruch auf der Polizeiwache
Der Hosentrompeter
KLEINE SÜNDEN
Der nackte Mann auf der Wiese
Der Jurist und die Bajadere
Regierungsräte in Moabit
50 Prozent
Um 20 Mark zehn Jahre Zuchthaus – und freigesprochen
Einer, der nicht mehr hören will …
Das Doppelkinn der Frau T.
Die Liebe auf Kündigung
Männliches Urteil
Wenn ich Verteidiger wär …
Das Bothmer-Urteil
Verspielt
Kawruleit
Ein ungetreuer Postschaffner
LIEBE UND GEMEINHEIT
Der rüstige Witwer und das Fräulein vom Amt
Der Mann von 40 Jahren
Erdgeist
Widuwilt
Intermezzo amoroso
Einbruch und Liebe
Berlinische Tragödie
Der heilsame Schuß
Das Hähnchen im Korbe oder Die verführte Verführerin
Eine Dame von der Liebe
Liebe und Gemeinheit
Die Schönheit
Der Segen der Liebe
Der böse Mann und die böse Frau
Märchenhaftes
Die Kleine vom Großherzog
DIE WELT DER KUNST UND DES GEISTES
Die Schriftstellerinnen
Der Phantasist
Dr. Hauck
Kunst, Kitsch oder sonstwas
Das Leben ein Film
Rembrandt und die Zirkulationsfurche
Der unverständliche Brandstifter
Der Betriebsunfall des Dichters
Entführer, Tanzgirl, Hungerkünstler
Der Pelz der Tschechowa
Das Bild
REIGEN
Der neue „Reigen“-Prozeß
Das Gericht vor dem „Reigen“
„Reigen“ vor Gericht
„Reigen“ vor GerichtDie Gutachten der Sachverständigen
Freispruch im „Reigen“-Prozeß
RECHTS UND LINKS
Meineid für nichts und wieder nichts
Das Schießen im Walde
Die Gesinnung der ReichswehrEin Nachklang aus der Zeit des Rathenau-Mordes
Was kann das kosten?
Nachts vor der Wahl
Der Bolschewistenhasser
Unverschworene Verschwörer
Besuch bei Max HölzEin Brief an den preußischen Justizminister
Slang
Der verurteilte Slang
DER MENSCHHEIT KRÜMEL
Wanderer auf Erden
Das Verbrechen, wenn man dabeisitzt
Die Glückspilze
Der Schattenfürst
Der Frechdachs
Das Untier
Der Bauchladen
Das WC vor dem Kompetenzgerichtshof
Phryne ohne
Graphologie vor Gericht
Die Voliere
Kinderaussagen
Ein Leutnant ging vorüber
Der Menschheit Krümel
Die böse und grausame Mutter
Ein Unschuldiger hingerichtet?
DIE EIDESSEUCHE
Die Familie und der Staat
Wie man so schwört
Die er kennt, sagt er du
Die Meineidskönigin
Die spacke WaschwanneEin Beitrag zur Meineidsstatistik
Psychologie im Gerichtssaal
Blind, halbblind, sehend
DIE HERREN RICHTER
Richterporträts aus Moabit
Der gute RichterTräumereien aus dem Schöffengericht
Der erschöpfte Richter
Die Gerichtsstube im Polizeipräsidium
Der Fall Eggert
Der Sachverständige
Triumph der Wissenschaft
Justiz und BerichterstattungDie Folgen des Prozesses Krantz
NACHWORT
von Hans Holzhaider
VORBEMERKUNG
Paul Schlesinger (1878 – 1928), einer der prominentesten Journalisten der zwanziger Jahre, schrieb seit Februar 1921 unter dem Pseudonym „Sling“. Bereits zu seinen Lebzeiten erschien eine Auswahl seiner beliebten Texte aus dem Feuilleton („Das Sling-Buch“, Berlin 1924), aber besonderen Ruhm und Nachruhm erntete er für seine Gerichtsberichterstattung, die bis heute stilprägend ist.
Schon im Jahr nach seinem frühen Tod erschien eine Sammlung aus diesen Berichten („Richter und Gerichtete“, Berlin 1929), die 1969 mit erweiterten Kommentaren erneut aufgelegt wurde. Herausgeber ist der Jurist Robert M. W. Kempner, der u. a. auch stellvertretender Hauptankläger für die USA bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen war. Die Texte Slings zu den großen Mordprozessen sind von Robert Kempner aus mehreren Artikeln zusammengestellt worden und werden auch hier in dieser Fassung abgedruckt.
Zuletzt sind Slingsche Gerichtsberichte 1989 in Ost-Berlin unter dem Titel „Der Fassadenkletterer vom ‚Kaiserhof‘“ erschienen. Die Datierungen im vorliegenden Buch sind der Herausgeberin dieses Bandes, Ruth Greuner, zu verdanken. Die undatierten Texte entstammen dagegen der Sammlung „Richter und Gerichtete“ von 1929.
Alle hier abgedruckten Berichte aus den Gerichtssälen standen zwischen 1921 und 1928 in der „Vossischen Zeitung“ und stellen die bisher breiteste Auswahl aus der viel größeren Fülle Slingscher Texte dar. Einfügungen und Passagen, die nicht von Sling stammen, sind kursiv und in Klammern gesetzt.
Franz Ullstein, Vorstand des Ullstein Verlages, in dem die „Vossische Zeitung“ erschien, soll auf den Redaktionsnachlaß Slings weisend zu Robert Kempner gesagt haben: „Kempner, das da darf nicht verschwinden!“
Wird es nicht.
Der Herausgeber
DER HERR SLING
DER MENSCH, DER SCHIESST
Der Mensch, der schießt, ist ebenso unschuldig wie der Kessel, der explodiert, die Eisenbahnschiene, die sich verbiegt, der Blitz, der einschlägt, die Lawine, die verschüttet. Alles tötet den Menschen, auch der Mensch tötet den Menschen.
Wann der Mensch tötet, ist so wenig vorauszusehen wie der Zeitpunkt, wann der Blitz einschlägt. Aber die Bedingungen, unter denen die Natur gegen die Menschen wütet, sind nachträglich oft leichter zu erklären als der gewaltsame Ausbruch des Stückes Natur, das sich Mensch nennt. Um die Missetaten der Natur zu erklären, hat man allerhand Hilfsmittel ersonnen, zum Beispiel Instrumente. Zur Erklärung der Explosion eines Menschen benutzt man die Psychologie.
Die Menschheit sucht sich gegen die Gewalt und die Willkür der Natur durch allerhand Erfindungen zu schützen, zum Beispiel den Blitzableiter oder den Rettungsring. Um sich gegen den Menschen zu schützen, erfand der Mensch das Strafgesetz.
Von der Natur glaubt der Mensch, er werde sie beherrschen, wenn er ihre Geheimnisse erspürt. Aber der Mensch, zur Gesellschaft zusammengeschlossen, schützt sich gegen den gefährlichen Menschen, indem er ihn bestraft.
In der rauhen Jugend des Menschengeschlechts wehrte er sich gegen seine Schädlinge durch die Begriffe Vergeltung und Sühne. Wir wissen, daß die rauhe Jugend des Menschengeschlechts noch nicht abgeschlossen ist, obgleich sich in seinem Haar bereits einige Silberfäden zeigen. Es war eine großartige Sache, als man zu der Überzeugung gelangte, der Mensch könnte sich bessern, man könne ihn erziehen. Einige Geister glaubten, die Abschreckung sei ein solches Erziehungsmittel, und seitdem straft man nicht nur, um die primitive Vergeltung zu üben, sondern um zu erziehen.
Den Kaffeekessel, der explodiert, schickt man zum Klempner, den Menschen ins Gefängnis.
Eine Weile hat man sich vorgestellt, der Mensch könne die Gelegenheit benutzen, sich im Gefängnis zu bessern. Man hat aber die Erfahrung gemacht, daß von dieser Gelegenheit höchst selten Gebrauch gemacht wird, daß der Mensch vielmehr in den meisten Fällen völlig verdorben zur Menschheit zurückkehrt. Man erzielte, auf den Kaffeekessel angewendet, die Wirkung, als ob man ihn nicht zum Klempner geschickt, sondern nun erst recht mit den Füßen zertrampelt und auf den Kehricht geworfen hätte.
Die Erkenntnis von der Nutzlosigkeit der Strafe stellte sich etwa zu derselben Zeit ein wie die andere Erkenntnis von der Unschuld des explodierenden Menschen. Ob Vererbung, Milieu, Not, Schicksalsstellung, eine zu warme Nacht oder ein Glas Kognak zuviel zu der Explosion des Menschen Veranlassung gaben oder mangelhafter Verschluß oder Dünnwandigkeit des Nervenkessels: wir haben für alles unsere Erklärungen durch die nie rastende Arbeit unserer Psychologen und Psychiater bezogen. Nutzlosigkeit der Strafe (im Sinne der Besserung) und die Unschuld des Menschen gäben uns ja eigentlich Veranlassung, dies Strafgesetzbuch zu zerreißen; aber wir tun es nicht, denn noch blieb ein Strafzweck übrig: die Abschreckung.
Seitdem strafen wir Unschuldige, um andere Unschuldige von der Explosion abzuschrecken. Wir (andern) leben nicht gern in der Nähe von explodierenden Unschuldigen, also lassen wir die Unschuldigen für uns sterben oder für uns in den Gefängnissen verkommen.
Wir anderen haben überaus glückliche Konstitutionen, die es uns ermöglichen, das Für-uns-Sterben mit schönem Gleichmut hinzunehmen. Hebt uns jemand ein Taschentuch auf, so lächeln wir artig und sagen „Danke schön“. Demjenigen, der für uns stirbt, sagen wir durchaus nicht „Danke schön“, noch lächeln wir. Im Gegenteil, wir machen ein sehr böses Gesicht und schneiden gerne nach der Elle noch ein Stückchen Ehre ab – fünf Jahre, zehn Jahre. Es ist auch noch nicht vorgekommen, daß wer zu einem, der für uns stirbt, gesagt hätte: Bitte, bemühen Sie sich nicht, ich sterbe selber.
Aber zuweilen kommt uns was in die unrechte Kehle. Wir kriegen Mitleid, und das ist sehr unangenehm. Es gibt Fälle, in denen uns das Mitleid nicht ganz ruhig schlafen läßt, und das fühlt sich beinahe so an wie schlechtes Gewissen – natürlich, ohne es zu sein.
Mitleid ist eine Krankheit. Staatsanwälte verwenden gegen dieses Leiden vielfach mit Erfolg Monokel. Und da so viele Staatsanwälte Monokel tragen, ist anzunehmen, daß das Mitleid eine bei den Staatsanwälten vielfach verbreitete Krankheit ist.
Aber was tun wir übrigen Menschen, die wir uns zu einer solchen Radikalkur nicht entschließen können? Wir sind übel daran.
Glücklicherweise geht das Übel auch so vorüber. Denn Gott gab uns, damit die Welt sich nicht in Tränen auflöst, als höchstes Gut ein miserables Gedächtnis.
Ist jemand für uns gestorben, haben wir eine schlaflose Nacht verbracht – am Morgen singen die Vögel, die Sonne liegt auf Wiesen und Feldern, die Eisenbahnen gehen, und uns gegenüber im Coupé sitzt vielleicht eine junge Dame und sendet uns einen süßen Blick aus blauen Augen. Wie gern wären wir bereit, den Blick zu erwidern. Doch ach, wie, wenn sie explodierte – unschuldig, wie sie ist –, früher oder später. Aber nein, sie hat das Auge wieder auf die Zeitung gesenkt. Sie liest den Bericht über den Flessa-Prozeß. Sie schreckt sich gerade ab. Stören wir sie – um Gottes willen – nicht dabei.
25. 8. 1926
DIE ATMOSPHÄRE VON MOABIT
Skandal.
Das Wort steht in den Zeitungen. Aber die Hallen und Wandelgänge des Justizpalastes liegen nur noch um einige Nuancen stiller und verlassener.
Lautlosigkeit ist eine der unheimlichen Komponenten der Moabiter Atmosphäre. Der prunkvolle Treppenbau mit seinem öden und ungefühlten Schmuck von sandsteinernen Allegorien ist fast immer menschenleer. Zuweilen zieht ein Trüppchen Zeugen die Stufen empor, staut sich vor einer Saaltür. Ein paar Anwälte huschen in ihren Talaren über die Korridore, oder ein Staatsanwalt wird aus seinem Amtszimmer, wohin er sich während der Beratung des Gerichts zurückgezogen hat, geholt. Mal tönt die Stimme eines Wachtmeisters, der eine Sache, einen Zeugen aufruft. Ganz selten, und um so erschreckender, der Schrei eines Nervenkranken, das anhaltende Stöhnen eines Epileptikers, der Wutausbruch eines Verurteilten, das Trompetengezänk von Parteien, die ihren Streit auch außerhalb des Gerichtssaals fortsetzen.
Sonst aber Schweigen, garantiert durch das Vorhandensein von zwei inneren Treppensystemen, deren Existenz eigentlich erst im Gerichtssaal selbst in Erscheinung tritt. Das eine System führt die Zuschauer von der Straße her, das andere die inhaftierten Angeklagten auf verschwiegenen Wegen vom Untersuchungsgefängnis direkt in den Gerichtssaal. Wird im Saal mal eine sofortige Verhaftung verfügt: eine Tür öffnet sich, eine Gestalt ist verschluckt.
Und merkwürdig, wie wenig man in den Hallen vom Geschäftsbetrieb der Gerichte merkt. Da sind die beiden riesigen Gebäude, das alte und das neue, verbunden durch einen langen gewundenen Gang, der wiederum nur den Eingeweihten bekannt ist. Gewiß, man begegnet mal einem Wachtmeister, der Akten schleppt oder auf Karren vor sich herschiebt. Ein paar Türen weiter ist er verschwunden, hat seine Ware abgeliefert.
Der äußeren Nüchternheit, Ereignislosigkeit, der trockenen Sachlichkeit der Amtszimmer widerspricht ein inneres Leben von lebendigster Leidenschaftlichkeit. Da spricht nicht nur die Tatsache, daß das Delikt, das einen Menschen auf die Anklagebank führt, zumeist einem starken, übermäßigen Impulse entsprungen ist: Gier nach Besitz, Geltung, Wollust, Rache. Es ist noch ein anderes. Der geistigen und moralischen Unterwelt, die vor die Schranken gezerrt wird, entspricht eine Oberwelt, eine lichtere reine, geistigere.
Menschen hüben und drüben. Der Mann im Schatten zuweilen ein Gestürzter der Oberwelt. Der Mann im Lichte zuweilen einer, der durch Arbeit und Tugend emporgekommen. Der Mann oben hilft nicht, streckt keine Hand entgegen, darf nicht. Der Mann unten kämpft, schreit wie ein Ertrinkender, beschwört seine Unschuld; man glaubt ihm nicht. Ein Stoß wirft ihn hinab. Oder man glaubt ihm – aber auch dann keine helfende Hand, nur eine Geste im Abwenden: bring dich ins trockene.
Zwischen den beiden Welten einige Mittler: Beamte, Inspektoren, Wachtmeister, Gefängniswärter, Schreiber, Sekretäre – einige Schichten dieser gestuften Welt, dem Angeklagten oft sozial näher als dem Richter. Dann aber der berufenste Mittler: der Verteidiger. Dem Richter sozial ganz nahe, sogar identisch – aber erfüllt von den Geheimnissen des Sünders, entweder sein Vertrauter oder doch ihn durchschauend und trotzdem helfend, nachfühlend, nachdichtend seine Seele, auch wenn sie böse ist. Er beschwichtigt, er beschönigt, er holt seine Argumente aus allen Winkeln der Rechtswissenschaft und ihrer Hilfswissenschaften: Psychologie, Soziologie, Graphologie. Und was da noch ist …
Aber mit den paar Worten ist die Gefahrenstellung nicht umschrieben, in der sich der Verteidiger befindet. Zweifellos gibt es unter den Anwälten eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die das Recht haben, das Wort Gefahrenstellung für die Art und Weise, wie sie ihren Beruf auffassen und wie sie ihn ausüben, abzulehnen. Aber es gibt viele andere, die bei aller Makellosigkeit ihrer Intentionen, bei ausgeprägtem Standesbewußtsein und peinlichster Korrektheit doch sehr genau wissen, wie nahe sie der Gefahr dauernd sind.
Denn der Anwalt spricht nicht nur für den Sünder, er spricht auch für sich, er wirbt für sich. Er übt freien Beruf, er ist kein festbezahlter Beamter, hat als Freiwerbender die Pflicht, als Familienvater und als Staatsbürger für die Mehrung seines Einkommens zu sorgen. Und er, der berufen ist, der Wahrheit zu dienen wie Staatsanwalt und Richter – er bezieht seine Einnahmen aus der Hand des Angeklagten, der eben doch in den meisten Fällen ein Rechtsbrecher ist. Der Rechtsbrecher, sozial, geistig, moralisch oft tief unter ihm, ist sein Arbeitgeber. Ein solcher Arbeitgeber kann unendlich arm sein, er kann den Anwalt mit den Früchten seiner Verbrechen bezahlen, er kann hochgestellt und reich sein – und ist er das wirklich, so ist er der große Kunde, nach dem sich der Anwalt sehnt. Gewiß stellt so ein Kunde den Anwalt oft auch vor die Aufgaben, die ihn rein beruflich, geistig am meisten interessieren. Zu beweisen, daß ein Großkaufmann, durch das Heer von Paragraphen der Nachkriegszeit zu Fall gebracht, dennoch ein anständiger Mensch ist, daß er schon aus rein juristischen Gründen freizusprechen ist – das lohnt sich. Und es ist gewiß herrlich, mit Witz und Gefühl dafür einzutreten, daß eine Tat der Leidenschaft oder der Verzweiflung ihre tiefsten Ursachen in einer Veranlagung des Täters hatte, die den Rechtsbruch mit zwingender Notwendigkeit zur Folge hat. – Aber so einfach liegen die Dinge in den seltensten Fällen, namentlich dann nicht, wenn der Angeklagte wirklich ein reicher Mann ist. Das Geld in seiner Tasche übt Verführung nach allen Seiten. Gewiß nicht nach der Seite des Richters – zuweilen ist es die soziale Stellung eines Angeklagten, die am Richtertisch Milde und Verständnis wachruft. Das Geld aber wirkt in die Breite und in die Tiefe. Es kann nicht anders, es muß versuchen, Vergünstigungen, Linderungen, Annehmlichkeiten zu verschaffen. Am Urteil kann es nichts ändern, also übt es seine Verführung an den Vollstreckern des Urteils. Wieder und wieder sieht man Opfer des Geldes auf der Anklagebank: Wachtmeister, Gefängniswärter und zuweilen auch Justizsekretäre, von denen der jetzige Skandal wieder ein paar der tüchtigsten getroffen hat.
Und nun auch einen Anwalt. Ist er, den wir alle als einen bescheidenen, arbeitsamen, gutherzigen Menschen kannten, ein so sehr schuldiger Mensch? Gegen welche Paragraphen er gesündigt hat, wird das Gericht feststellen. Wir aber wissen: Er ist ein Opfer der Atmosphäre von Moabit. Er ist die lebendige Illustration zu der Frage: Wie kommt der Strafverteidiger zu seiner Praxis? Hätte so ein junger Rechtsanwalt familiäre und freundschaftliche Beziehungen zur Welt der Banken und Großindustrie gehabt, er wäre nie Strafverteidiger geworden. Und das Glück im Unglück, schwere Verbrecher im nächsten Verwandten- und Bekanntenkreise, hat er auch nur selten. Dazu treibt ihn vielleicht Neigung und spezifisches Talent zur Kriminaljustiz. Wie kommt er aber wirklich zur Kundschaft?
In glücklichen Fällen bilden sich Spezialitäten heraus, Syndikate für bestimmte Erwerbsgruppen, die beruflich den Gefahren des Strafgesetzes ausgeliefert sind. Einer erhascht die Klientel der Polizisten, der andere die der Straßenbahner, der Automobilisten. Eine geistige Kapazität schreibt über Wucherverordnungen, und ihm fällt die ganze Kundschaft der Bank- und Handelswelt zu, die unter außerordentlichen Zeitumständen in ungeahnte Situationen gekommen ist. Der versteht sich auf Steuern, jener auf Konkurse.
Schon sind die Möglichkeiten verteilt. Aber hinter den Gefängnismauern hocken genug Angeklagte. Welcher Name dringt zu ihnen? Früher war’s einfacher; da nannte die Zeitung den Namen jedes Verteidigers, der irgendwo auftrat. Aber die Zeitungen sind vorsichtiger geworden, aus guten Gründen. Wie sich bemerkbar machen dem Vertreter des letzten „großen Falles“, der eben eingeliefert wurde?
Hat man nicht sowieso dies und das im Untersuchungsgefängnis zu tun? Spricht man nicht mit Wärtern und Wachtmeistern? Und war der Kerkermeister, selbst ein Mann im tiefsten Schatten, nicht immer, seitdem es Kerker gibt, ein Mann mit viel Durst und wenig Butter auf dem Brot? Ein Zettel wird zugesteckt. In der Schale des Angeklagten häufen sich die Visitenkarten – und es ist ein neues System entstanden, ähnlich den Treppen im Gerichtsgebäude. Heimliche Leitungen gehen hin – sie gehen auch her. Recht verschwistert sich mit dem Unrecht, verknäult sich unlösbar.
Die Wachtmeister fallen zu Dutzenden. Alle paar Wochen sieht man sie, arm und kläglich vor dem strengen Richter, der das Unkraut ausrotten will. Heimlicheres verhandelt man vor der Anwaltskammer, die spürt und tastet. Und einmal wächst das Gemurmel zum Skandal. Einen trifft’s. Ist er der Schuldigste?
Andere, viele andere, verschmähten die Mittel und Mittelchen und kamen doch zum Ziel.
Andere, noch mehr andere, sind auch im Anfang bedenkliche Wege gegangen und haben heute das Glück, sich nicht mehr zu erinnern.
Den kleinen armen Anwalt fraß es auf, das gefräßige Verbrechertum. Spielte erst mit ihm, ließ ihn alle Ängste durchkosten, bis es ihn verschluckte.
Opfer der Moabiter Atmosphäre, einer Atmosphäre unausgeglichener Widersprüche, unbeschwichtigter Leidenschaften. Menschentum, verschlossen hinter dem Harnisch der Korrektheit, versteinert wie die blöden allegorischen Gestalten im Treppenhaus – neben dem lebendigsten Strom des Leides und Mitleidens.
Ehre denen, die mit reinem Herzen und reiner Hand hier hindurchschreiten. Aber eine stets wachsende Last der Verantwortung, der Sorgen und des Mitgefühls für den, der es mit offenen Augen tut.
24. 12. 1926
WIE ICH GERICHTS-BERICHTERSTATTER WURDE
Den Grund meiner juristischen Kenntnisse legte ich als Lehrling einer sehr alten, sehr ehrenwerten Firma der Textilbranche. Wir fabrizierten Damenkleiderstoffe, Schals und Tücher. Da keiner der Söhne und Schwiegersöhne des Chefs Rechtsanwalt geworden war, führte die Firma prinzipiell keine Prozesse. Infolgedessen ließ er die unbefriedigte Streitlust in den Geschäftsräumen des Hauses aus, besonders an mir. Er war gewöhnlich anderer Ansicht wie ich. Dennoch hat er mich höchstens dreimal einen Esel genannt.
In dieser trüben Lehrzeit gab es einen Lichtblick. Alle zwei, drei Monate passierte es, daß der jeweilige Lehrling mit dem Hausdiener Justav auf dem Packhof zu tun hatte. Nun war es eine geheiligte Tradition der Firma, daß jede Erledigung auf dem Packhof fünf Stunden dauerte. In Wirklichkeit brauchte man zwei Stunden zu dem Geschäft. Justav und der Lehrling gingen zunächst in eine Destille frühstücken, sodann zogen sie in gehobener Stimmung in das nahe gelegene Kriminalgericht, um ein paar Verbrecher aburteilen zu sehen. So kam ich nach Moabit. In Moabit rollten Justavs und meine Filme.
Ich habe das Wollwarenhandwerk nie gelernt. Aber von Moabit blieb was in mir hängen. Ich habe inzwischen alles mögliche getrieben (außer Jurisprudenz). Musik, Literatur, ja Schauspielerei. Ich habe Stücke geschrieben, wurde Journalist, zog in Deutschland hin und her. Ging ins Ausland. Nach 25 Wanderjahren kam ich heim. Nun bin ich wieder in Moabit. Ich kann jetzt alle Tage nach Moabit gehen. Nur Justav ist nicht mehr dabei. Er ist längst tot. Er fehlt mir sehr.
Die Frage, ob ich auf all diesen Umwegen wenigstens das Handwerk eines Gerichtsberichterstatters erlernt habe, ist nicht von mir zu beantworten. Aber ich verdanke dieser Tätigkeit ein Erleben, das zu hübsch ist, um verschwiegen zu werden. Es war vor etwa einem Jahre in einer Strafkammersitzung in Moabit. Das Gericht hatte gerade eine kleine Pause eintreten lassen, als der Herr Staatsanwalt seinen Platz verließ, auf mich zukam und mich fragte, ob ich der Herr Sling sei.
„Nun denn, wenn Sie Herr Sling sind, habe ich den Auftrag, Ihnen zu sagen, daß der Gerichtshof Ihnen seinen Dank aussprechen läßt für manche vergnügte Viertelstunde, die den Herren Ihre netten, boshaften Artikel bereitet haben. Nur hat der Gerichtshof eine Bitte: Falls Sie über die heutige Verhandlung schreiben, gehen Sie einigermaßen glimpflich mit uns um.“ Ich lächelte unbeschreiblich geschmeichelt, dankte dem Gerichtshof für sein freundliches Interesse, versprach, mein möglichstes zu tun, und bat nur, falls ich mal auf der Anklagebank sitzen sollte, mögen die Herren auch mit mir glimpflich umgehen.
Dennoch weiß ich, daß nicht alle Juristen derselben freundlichen Ansicht sind. Es sind (sogar wohlmeinende) Stimmen laut geworden, die mir Mangel an Objektivität vorwerfen. Ja, nichtjuristische Freunde haben mir gelegentlich Komplimente gemacht: Es gehöre doch eine große Phantasie dazu, die nüchternen Vorgänge so auszuschmücken.
Ich habe darauf zu erwidern, daß ich mich selbst für einen durchaus phantasielosen Menschen halte. (Es ist mir trotz vielfachen Versuchs niemals gelungen, eine brauchbare Filmidee zu erfinden!) Ich habe kein ernsteres Bestreben, als die Dinge so zu zeichnen, wie ich sie sehe.
Freilich – das sage ich auch. Auf mein seelisches Erleben kommt es an. Eine Objektivität gibt es nicht. Weder in der Wissenschaft noch am Richtertisch. Selbst das fotografische Objektiv ist nicht objektiv. Helmholtz hat gesagt, daß er das menschliche Auge dem Optiker zurückschicken würde, wenn er es bei ihm bestellt hätte – so fehlerhaft sei es konstruiert. Wir leben alle von Konventionen: optischen, akustischen, gefühlsmäßigen. Selbst die stenographische Berichterstattung, die ja schon aus praktischen, zeitungstechnischen Gründen unmöglich sei, wäre weder garantiert fehlerlos, noch gäbe sie ein vollkommenes Bild. Denn die Tonfarbe, die Geste würde fehlen. Man hat sich vielfach mit einer quasi-stenographischen Wiedergabe in ganz großen Prozessen geholfen. Gerade die Richter wissen, welche ungeheuren Fehlersummen sich in diesen Berichten zu häufen pflegen.
Ich suche im Gerichtssaal die seelischen Beweggründe der auftretenden Personen, der Angeklagten, der Zeugen. Ich kann es auch nicht unversucht lassen, in die Herzen des Staatsanwalts und des Richters zu blicken. Das aufgenommene Bild erzeugt in mir Trauer, Empörung, Furcht, Mitleid, Verachtung, Heiterkeit, Spottlust, Liebe und Haß. Dann versuche ich, mein Gefühl nachzuschaffen, es dem Leser kenntlich zu machen.
Ich bin gewiß imstande, ich habe es gelernt, den Bericht zu schreiben, den man im Grunde deshalb objektiv nennt, weil er die Ansicht des Richters ausspricht oder ihr wenigstens nahezukommen versucht. Aber „richtig“ ist dieser richteroffiziöse Bericht schon deshalb nicht, weil im Gericht ebensowenig was richtig ist wie sonst im Leben. Wie oft möchte man sich einmischen, nur weil der Angeklagte nicht die Sprache des Richters, der nicht die Sprache des Angeklagten versteht. Das soll durchaus kein Vorwurf sein. Die verantwortlich handelnde Person ist immer befangener, durch Formalien, Gesetzesfassungen, dann aber auch durch menschliche Hemmungen, als die unbeteiligt zuschauende Person.
Indem ich mich zum verantwortungsbewußten subjektiven Schaffen bekenne, sage ich auch, daß die suggestive Mitteilung eines eigenen seelischen Erlebnisses in der gedrängten Form eines Zeitungsberichtes nur durch die Anwendung künstlerischer Mittel möglich sei. Das schließt weder den intellektuellen Irrtum noch die ungeschickte Handhabung, noch die Unzulänglichkeit dieser Mittel aus.
Selbstverständlich: Der Kritiker untersteht der Kritik.
Sling
GEWALTSAMER TOD
HACKBUSCH
Unter den vielen sonderbaren Verbrechen, die unsere Zeit, will sagen, unsere Not, hervorgebracht hat, wird das des Kaufmanns Paul Hackbusch als eines der merkwürdigsten im Gedächtnis haftenbleiben. Man möchte sogar glauben, daß die Tat dieses Vaters, der seinen Sohn Rolf, sein einziges Kind, auf dem Finanzamt Neukölln durch einen Kopfschuß tötete, so sinnlos sie gewesen ist, nicht ganz unfruchtbar bleiben kann. Das von Georg Hermann gezeichnete Gespenst des „Staatsangeklagten“1, das so oft in unseren Tagen neben dem eigentlich handelnden Täter auf der Anklagebank Platz nimmt, saß wieder einmal zum Greifen deutlich vor unseren Augen.
Der fast 50jährige Kaufmann Paul Hackbusch darf mit Bezug auf seine innere Struktur nicht auf eine Stufe gestellt werden mit jenem armen Minderwertigen, der sich erst vor wenigen Tagen wegen Tötung eines Direktors der Elektrizitätswerke zu verantworten hatte. Hackbusch ist auch nicht zu vergleichen mit den verzweifelten Eisenbahnattentätern von Leiferde. Ein Mann von zähem Willen, von Unternehmungsgeist und einer Arbeitskraft, die man unerschöpflich nennen könnte – wenn sie nicht eben doch offenbar eines Tages zur Neige gegangen wäre. Ein stämmiger Mecklenburger, der mit jungen Jahren nach Rußland und Sibirien auswanderte, um sich dort eine Existenz zu schaffen, der im Begriff war, ein wohlhabender Mann zu werden, als der Krieg ausbrach und man ihn internierte. Nach seiner Entlassung erneute Versuche, im fernen Osten wieder emporzukommen, schließlich gezwungen, mit einer kleinen Barschaft in die Heimat zurückzukehren. Ein als Beamter in Berlin lebender Bruder, der nebenbei eine kleine Fabrik betreibt, nimmt ihn liebevoll auf und gibt ihm die Möglichkeit, sich in der Fabrik zu betätigen. Paul Hackbusch arbeitet dort technisch und kaufmännisch von morgens bis in die Nacht, freilich ohne Glück.
Das junge Unternehmen frißt Geld und bringt nichts ein. Aber die Steuer ist gleichwohl hinterher, aus dem Verlustbetriebe wenigstens für den Staat Gewinne herauszuwirtschaften, und der Kampf gegen die Steuer ist es, in dem der noch ungebeugte Mann schließlich zu seiner Wahnsinnstat getrieben wird; wohlgemerkt: Es handelt sich nicht um Paul Hackbuschs persönliche Steuerleistung, sondern um die seines Bruders, für die Paul kämpft und fällt. Ein persönlicher Steuerkonflikt, auf einem anderen Finanzamt, lag bereits einige Monate zurück. Er, der von Zuwendungen seiner Verwandten und seiner Freunde leben mußte, war unter Zugrundelegung seines Verbrauchs zur Steuer herangezogen worden. Auf seine Reklamation hin hatte man ihm sogar zuviel gezahlte Steuern zurückzahlen wollen.
Aber der zurückzuzahlende Betrag sollte verwendet werden für eine Kirchensteuer, die ihrerseits nach der ersten zu hoch bemessenen Einkommenschätzung berechnet war. Vergeblich hatte er klarzumachen versucht, daß die Kirchensteuer sich doch nach der eben rektifizierten Schätzung richten müsse; aber man verwies ihn auf den Weg der Reklamation. Das hatte dem Mann den ersten Knacks gegeben. In der Steuersache seines Bruders sollte er am Ende auch recht behalten. Schon hatte man die Aufhebung der angedrohten Pfändung beschlossen. Aber der Weg von den beschließenden zu den ausführenden Organen eines Beamtenkörpers ist lang – inzwischen war die Tat schon geschehen. Nachträglich hat man sogar die völlige Streichung der ursprünglich geforderten Steuersumme beschlossen.
Bereits Wochen vor der Tat hatte Paul Hackbusch den Beschluß gefaßt, aus dem Leben zu scheiden und seinen elfjährigen Sohn, als Teil seines Selbst, mit hinüberzunehmen. Er fühlte sich dem Leben nicht mehr gewachsen. Einige Tage vor der Tat verdüsterte sich sein Gemütszustand immer mehr. Er kaufte einen Revolver, er schrieb Abschiedsbriefe und darunter einen besonders merkwürdigen an das Finanzamt Neukölln. Er suchte seine Tat zu erklären aus der Verzweiflung über den Zustand seines Vaterlandes, über die Ohnmacht des Staates, seinen Bürgern die Möglichkeit der Existenz zu gewähren. Der Brief, auf Zitate Schillers und Goethes fundiert, ist nicht nur eine Kritik an dem nachrevolutionären Deutschland; Hackbusch sieht auch in der Wilhelminischen Epoche nur den Beweis für die Behauptung von der Unmöglichkeit einer deutschen Nation. Die Tat aber sollte seinem Willen nach ein warnendes Zeichen für die Machthaber des heutigen Deutschland sein.
Welche Tat war geplant? Die Absichten schwankten tagelang hin und her. Er hatte sich ein merkwürdiges Duell mit dem Steuersekretär Hesse ausgedacht, der die Sache Hackbusch zu bearbeiten hatte. Eine Art Gottesurteil – er wollte zu Hesse gehen; war er in seinem Zimmer anwesend, so wollte er erst den Sohn, dann Hesse und schließlich sich selbst erschießen. War Hesse nicht anwesend, so sollte der frei ausgehen, dann sollte nur der Doppelselbstmord ausgeübt werden.
Er trat mit seinem Sohn in das Amtszimmer. Hesse war anwesend. Aber der Entschluß wurde wieder wankend. Eine kurze Unterhaltung zwischen ihm und Hesse, der sich ablehnend verhielt. Noch einmal ging Hackbusch hinaus, um das Zimmer ein zweites Mal zu betreten. Wieder ein kurzes Gespräch, wieder ein Hinausgehen. Und zum dritten Male trat er ein. Hesse saß an seinem Schreibtisch und arbeitete. Hörte plötzlich einen Knall, kroch unter den Schreibtisch. Der Schuß hatte den Sohn in den Kopf getroffen. Leute eilten hinzu. Hackbusch versuchte die Waffe gegen sich selbst zu richten, sie versagte. Er wurde festgenommen, der Knabe erlag seinen Verletzungen.
Die Anklage lautet auf Tötungsversuch des Steuerbeamten. Hackbusch will selbst einen zweiten Schuß gehört haben. Aber weder eine Kugel noch eine Patronenhülse ist gefunden worden. Hesse erinnert sich nicht, einen zweiten Schuß gehört zu haben.
Fälle dieser Art werden bekanntlich auf die Frage hin geprüft, ob sie etwa infolge einer krankhaften Störung der Geistesfähigkeit, die die freie Willensbestimmung ausschließt, verübt worden sind. Und wie gewöhnlich hört man von den Sachverständigen verschiedene Urteile; hier sagte der eine, daß der Angeklagte sich in einer so tiefen Gemütsdepression befunden habe, daß man an einer Klarheit seines Willens zweifeln könne. Der andere glaubte aus gewissen Erinnerungen, die der Angeklagte an Einzelheiten der Tat bekundete, schließen zu müssen, daß sein Verstand durchaus normal funktionierte, daß aber freilich die schwere Depression, in der er sich befunden hat, ihm Anspruch auf alle Milderungen gäbe.
Aber merkwürdig, so gewiß in einem solchen Fall der Psychiater das entscheidende Wort zu sprechen hat, diesmal stand es nicht im eigentlichen Brennpunkt des Interesses. Nicht wie sonst fragt man nach dem Grade der geistigen oder moralischen Krankheit eines Verbrechers, sondern man fragt: Wie schmerzlich belastend muß ein behördlicher Apparat wirken, um einen geistig gesunden, ja sogar besonders widerstandsfähigen Staatsbürger zu einer Wahnsinnstat zu treiben? Wobei man zugunsten der Staatsmaschine nur zu berücksichtigen hätte, wieweit ein solcher Täter noch durch andere Umstände – hier durch die Erfolglosigkeit seines kaufmännischen Strebens und durch geistige Erschöpfung – für ein derartiges Verbrechen besonders vorbereitet sein mochte. Dabei braucht man gar nicht oder nur nebenbei die Frage zu erörtern, wieweit etwa ein einzelner Beamter – er muß ja nicht immer bei der Steuer sitzen – sich besonders schikanös gezeigt habe.
Es ist in den meisten Fällen der Geist gewisser Gesetze oder Verordnungen, der in seiner Starrheit den Menschen viel mehr zur Raserei treibt als der einzelne Beamte, der vielleicht einmal eine grobe Antwort gibt oder der für die besonderen Verhältnisse eines Falles nicht das richtige Verständnis aufbringt. Eine Steuerbehörde, die – um nur ein Beispiel zu erwähnen – ohne Rücksicht auf die Geld- und Diskontverhältnisse sich jede Steuerschuld mit zehn Prozent verzinsen läßt, ohne andererseits sich selbst verpflichtet zu fühlen, irgendwelche Zinsen für zuviel eingezogene Steuern zu zahlen, gibt damit eine gewisse Richtung für die Stellung, in die der Steuerzahler gedrängt ist und die – wie man hier sah – auch den Vernünftigen zur sinnlosen Raserei treiben kann.
Der Antrag des Staatsanwalts lautete unter Berücksichtigung aller mildernden Umstände auf zehn Monate Gefängnis und Bewährungsfrist.
1(Georg Hermann, Vorschläge eines Schriftstellers, 9. Der Staatsangeklagte, Baden-Baden 1923)
AMTSGERICHTSRAT JOSEPHSEN
(Im Mai 1924 schoß in Breslau die 30jährige Olga Rodestock mehrmals in deren Wohnung auf die Bardame Martha Hesse, die dabei aber nicht gefährlich verletzt wurde. Olga Rodestock gab an, aus Liebe zum Amtsgerichtsrat Josephsen und aus Eifersucht gehandelt zu haben. Auch habe ihr der Amtsgerichtsrat 50 Mark für den Kauf eines Revolvers gegeben und sie zur Tat angestiftet.)
Josephsen ist als Sohn eines Kaufmanns und Gutsbesitzers in Neutomischel 1876 geboren, studierte anfangs Nationalökonomie und Philosophie, machte später die Nachprüfung in Latein und Griechisch, um Jura zu studieren. Er bestand seine Examina gut und wurde nach vielfacher Verwendung 1910 Amts- und Landrichter in Brieg. Den Krieg machte er als Freiwilliger mit und brachte es bald zum Offizier. Er schildert sich als nervös. Seine Eltern sind Cousin und Cousine. Er hatte beschlossen, nicht zu heiraten, hatte aber das starke Bedürfnis nach einer Frau, die ihn versorgte. Als er 1910 nach Brieg versetzt wurde, fiel ihm Fräulein Rodestock, Angestellte eines Anwalts auf, weil sie ihm offenbar nachstellte.
Die Rodestock schickte ihm einen anonymen Brief, der auch zur Verlesung kommt. Darin fordert sie ihn zu einem Stelldichein auf. Der Brief ist vom 21. Juli 1914, nachdem die Rodestock vier Jahre hinter ihm hergelaufen war. Josephsen war zu Kriegsbeginn in England, wurde aber nach einigen Wochen nach Deutschland entlassen. Er antwortete auf den Brief erst im September 1914. Sie trafen sich zu einem Spaziergang, bei dem Fräulein Rodestock plötzlich sehr verliebte Anwandlungen bekam, denen schließlich auch der Angeklagte nachgab. Zu einer Wiederholung kam es nicht, da Josephsen einberufen wurde, er verließ Brieg ohne Abschied von ihr. Aus einem weiteren Brief von ihr geht die schwärmerische Liebe des Mädchens zu Josephsen hervor. Sie fühlt sich von ihm „verstanden“. Er aber fand an ihr eigentlich nichts Besonderes zu „verstehen“, außer ihrer besonders starken Sinnlichkeit.
Nach vierjähriger Pause war Josephsen im Jahre 1918 als Rekonvaleszent im Lazarett in Berlin und erhielt hier zum ersten Male wieder den Besuch der Rodestock. Er wollte sie abends um 9 Uhr mit Gewalt zum Zimmer hinausführen, sie blieb jedoch bei ihm. In der Folgezeit versuchte Josephsen mehrfach, sich von ihr zu befreien. Aber das gelang nicht. Als sie sich schwanger fühlte, verlangte sie von ihm – es war in der Inflationszeit – Geld, um im Auslande das Kind zur Welt bringen zu können. Später wollte sie dann eine Fehlgeburt herbeiführen. Hiergegen will Josephsen lebhaften Widerspruch geäußert und ihr gesagt haben, das sei nur möglich, wenn ein Arzt wegen ihres Nervenleidens die Unterbrechung der Schwangerschaft für statthaft erkläre.
Jeder Mensch ist irgendwo …
Jeder Mensch ist irgendwo ein armer Teufel. Und diesen armen Teufel muß man auch Herrn Josephsen konzedieren. Ach, wieviel lieber wandelte er am Arm einer sehr sanften, sehr blonden Gattin in der Sonne der Gunst von Vorgesetzten, Kollegen und Mitmenschen. Intelligenz und vielfache Kenntnisse hätten ihn zu einer Laufbahn berechtigt, die über dem Durchschnittsniveau liegt. Ein unglückliches Liebesabenteuer machte ihn als Studenten für sein Leben krank, und ein Zuckerleiden trat hinzu, um sein Gemütsleben recht eigentlich zu umdüstern. Das Schicksal traf den Unschuldigen so schwer, bis er aufhörte, unschuldig zu sein. Er gibt an, wegen seiner Krankheit nicht geheiratet zu haben, ja lange Zeit im Punkte Liebe sich abstinent verhalten zu haben. Ob er hierüber immer die Wahrheit sagt, weiß man nicht. Später war sein Liebesleben ebenso heftig wie vielseitig und wahllos.
Richter und Geschworene werden entscheiden, ob er sich im Sinne der Anklage zur Anstiftung zum Mordversuch schuldig gemacht hat. Nach dem bisherigen Stande der Beweisaufnahme ist seine Verurteilung nicht wahrscheinlich. Daneben läuft das Disziplinarverfahren. Verurteilt ihn das Schwurgericht, ist der Richter Josephsen bestimmt erledigt, aber, wenn die Geschworenen seine Schuld verneinen – Josephsen ist übel dran. Freilich – die Disziplinarrichter der zweiten Instanz werden, wenn sie ihn verurteilen, ebenso wie die in der ersten Instanz, sich an gewisse äußere Dinge halten müssen, um zu einem vernichtenden Spruche zu kommen. Man hat im Laufe des Verfahrens herausbekommen, daß ein Auftritt mit Martha Hesse zu einer Straßenprügelei führte. Es kann dem Bravsten passieren, von einer hysterischen Dame verprügelt zu werden. Ihr Gewicht bekommen diese Dinge erst durch die Begleitumstände. Den Verkehr mit Olga Rodestock wird man ihm um so weniger zum Vorwurf machen können, als Olga zweifellos der aggressive Teil war. Daß er an ihrer Abtreibungsgeschichte ratend beteiligt war, wird man – Olga Rodestocks Zeugnis kann kaum je bestimmend verwertet werden – nicht als erwiesen ansehen.
Schlimmer steht der Fall Hesse. Soweit Martha Hesse angibt, von Josephsen in Geldsachen geschädigt zu sein, wird man ihr nicht glauben. Selbst wenn er ihr mal einen Betrag schuldig geblieben sein sollte – es handelt sich um zwei geringe Summen, so daß sie entscheidend kaum in Betracht kommen. Viel peinlicher ist es, einen Richter in einem dauernden, nicht nur sexuellen, sondern menschlichen Freundschaftsverhältnis mit einer Martha Hesse zu sehen. Daß sie in ihrer Jugend einige Jahre unter Kontrolle stand, mag er nicht gewußt haben. Daß er diese Frau, die unter dem Titel „Servierfräulein“ ihr Gewerbe fortsetzte, immer für eine Dame hielt – wie er behauptet –, ist ganz unwahrscheinlich. Sie ist nicht dumm, nicht ohne Witz. Man kann sich schon denken, daß sie als Kleinstadt-Hetäre in Kneipen und Bars jüngeren und älteren Juristen die Zeit verkürzte. Man kann sich auch vorstellen, daß der im Grunde unglückliche Josephsen geschlechtlich von ihr immer abhängiger wurde. Daß er aber diesen Verkehr jahrelang unterhielt, ohne sich je erkenntlich zu zeigen, daß er in der Liebe der Nehmende, materiell nie der Gebende war, auch das macht das Verhältnis anrüchig. Er hat bei einem Halbweltmädchen genassauert.
Und auch im Falle Rodestock: Niemals hielt er sich zur Sorge verpflichtet. Das ist der Punkt, der die Erscheinung dieses Mannes so peinlich macht – aber man wird zugeben müssen, daß dieser Punkt allein ihn niemals um sein Richteramt gebracht hätte. Schofle Gesinnung ist nicht strafbar. Auch ein Richter kann ein schofler Kerl sein; wir werden das nie ändern können, bevor wir eine Methode gefunden haben, in das Herz der Menschen zu leuchten. Das Licht, das uns über Josephsen Klarheit gibt, ging erst auf, als sich die Dinge dramatisch zuspitzten, als Olga Rodestock – völlig von Sinnen – den Revolver auf Martha Hesse richtete. Ein trübes Bild, wie es sich nach den ersten fünf Verhandlungstagen ergibt. Sonderbar bewegend in Details, generell wenig besagend oder gar nichts – mag das Urteil so oder so ausfallen.
Die Bacchantin
Olga Rodestock, seit Jahr und Tag Insassin einer Irrenanstalt, ist verurteilt, in diesem Prozeß als nicht zu vereidigende Zeugin aufzutreten. Ein seltener Fall, der vielleicht juristisch, kaum aber menschlich zu rechtfertigen ist. Jahrelang hatte ihre Umgebung Anlaß, an ihrer Vollsinnigkeit zu zweifeln. Die Anwälte, bei denen sie angestellt war, lobten sie weg, und sie selbst sagt: „War das nicht Betrug, daß sie mir gute Zeugnisse ausstellten, nachdem sie mich wegen Unfähigkeit entlassen hatten?“ Sie weiß Bescheid mit sich, sie spricht von Gedächtnishemmungen, die ihr lange Zeit zu schaffen machten, und bei ihrer Vernehmung bedient sie sich sehr umfangreicher Aufzeichnungen, die sie immer wieder vorzulesen versucht.
Der Vorsitzende läßt es nicht zu. Spricht sie frei, so verwirren sich ihre Gedanken sehr rasch. Man hat das Gefühl, daß das meiste, was sie spricht, irgendwie wahr ist. Aber die logische und juristische Abfolge vermag sie nicht innezuhalten. Man fühlt aber auch: ein begabtes Menschenkind, mit starken seelischen Trieben. In dem stattlichen jungen Richter sieht sie als 17jährige ihr Ideal. Jahrelang trägt sie in der Kleinstadt Brieg die Neigung mit sich herum, bis sie ihn stellt, von ihm Besitz nimmt. „Wenn ein Mensch einen andern geistig liebt, dann wird es auch körperlich – da ist doch nichts dabei –, das kann auch ein Landgerichtsdirektor oder ein Staatsanwalt tun, ohne sich strafbar zu machen“, so sagt sie. Furchtbares erlebt sie. Ob es wahr ist, daß sie sich das Kind, das sie von Josephsen erwartet, auf dessen Wunsch abtreiben läßt? Jedenfalls tut sie es auf eigene Kosten mit dem Gelde, das ihr ein verliebter alter Rechtsanwalt als Buße zahlen mußte. Jahre überspringt sie – oder wirft sie in tollem Wirbel durcheinander. Selbstmordversuch. Jammervolle Tage in Berlin, wo sie auf Treppen, in Bahnhofswartesälen übernachtet. Ein Testament, das sie in seiner Gegenwart macht: die Kindergeige, ihr einziges Erbstück. Sie will dem Geliebten nicht wehe tun, sie schluchzt auf. Er war der, dem sie „die einzigen schönen Lebensstunden“ verdankt. Aber sie ist auch ruhig, wie sie sagt, „abgestumpft“. Und sie ist es jetzt, weil sie ihr Kind hat. Sie empfing es in der letzten Zeit, die sie in Freiheit zubrachte. „Als ich mich ganz verlor“ – den Vater bezeichnet sie als einen Grafen. Das Kind lebt.
Der Vorsitzende versucht, Ordnung in die Erzählung zu bringen – meist vergebens. Aber, so wirr die Bruchstücke daliegen, es ist kein einziges darunter, das uns erzählt von der Güte, der Fürsorge des Geliebten, der dunkel und feindselig auf der Anklagebank sitzt, immer bereit, jeden anderen Menschen preiszugeben, wenn er sich nur selbst schützen kann. Diese Frau nennt er „Bacchantin“ – als reiche die entfesselte Sinnlichkeit nicht an das Menschentum.
In der sechsten Stunde ihrer Vernehmung kommt Olga Rodestock zu dem Tage vor ihrer Tat. Sie ist sehr ermüdet, aber mit augenscheinlicher Energie schildert sie die seelischen Zustände: Sie selbst verzweifelt über ihre trostlose Lage – Josephsen unter dem Druck der Erpressungen von seiten der Hesse häufig weinend. Einmal sagt er: „Wenn ich keine Stellung zu verlieren hätte wie du, so würde ich sie kaltblütig töten.“ Sie bittet um das Geld für den Revolver. Er hat keins. Sie sucht – vergebens – es sich anderweit zu verschaffen. Am nächsten Tage trifft sie ihn wieder. Jetzt hat er 50 Mark in der Tasche, die ihm der Bruder geschickt hat. Sie fordert 40 Mark. Er sagt, der Revolver koste doch nur 30. Dann gibt er das Geld. Sie fragt, wie sie die Hesse am besten träfe. Er sagt: Wenn sie am Schreibtisch sitze. Olga bekommt es mit der Angst. Er tröstet: „Du drückst ihr den Revolver in die Hand und verschwindest.“ Er kauft Maiglöckchen, die sie der Hesse mitbringen soll, um sie freundlich zu stimmen. Dann aber meint er: „Ich komme vom Regen in die Traufe –“
Und dieser Satz wird den Prozeß entscheiden. Nach Josephsens Äußerung will er gesagt haben: „Das hat ja keinen Zweck, ich käme ja vom Regen in die Traufe!“ Olga Rodestock selbst sagt: „Ich war meiner Sinne kaum mächtig.“ War sie noch imstande, das Gespräch richtig aufzufassen, ist sie heute imstande, es richtig wiederzugeben?
Dann erzählt sie von der Tat: „Ich empfinde keine Reue. Mir ist, als ob die Tat ein anderer getan hätte.“ Olga Rodestock verliert sich in psychologischen Spekulationen. Ihr war, als hätte die Hesse etwas geahnt. „Merkwürdig, wie sich die Gedanken von einem Menschen zum anderen übertragen.“ Dann kommt sie zur Tat zurück, die sie eine ungeheure Überwindung kostet.
Immer wieder stört sie, daß die Hesse es offenbar geahnt hat. Aber sie denkt sich: Was würde Josephsen sagen, wenn ich es nicht tue? – Er würde sagen, ich sei zu nichts nutze! Da drückt sie los. Sie bricht in Tränen aus. „Ich habe kein Anrecht auf das Leben der Hesse. Ich habe sie hier im Saale gegrüßt – und sie hat mir gedankt. Ich war eben ein Werkzeug in der Hand Josephsens, der meine Krankheit ausnutzte.“ – „Haben Sie die Absicht gehabt, sich dann das Leben zu nehmen?“ – „Nein, das brauchte ich nicht – als ich geschossen hatte, war ich erleichtert. Durch diesen Schuß hatte meine Krankheit die Krise überwunden. Ich war erleichtert, ich erkannte die Schlechtigkeit Josephsens, der mich mißbraucht hatte, und ich war erlöst – aber Josephsens Tat muß man auch milde ansehen. Er stand unter dem Druck der Hesse, er war sehr gereizt, er ist schwer krank. Er wird in seinem Gewissen die Sühne finden.“ Als der Vorsitzende ihr vorhält, daß der Angeklagte es anders darstellt, sagt sie: „Es ist peinlich für ihn, aber ich kann nicht anders.“
So sprach die Bacchantin.
Das Urteil
Das Urteil des Breslauer Schwurgerichts trägt mit der Freisprechung des Angeklagten im großen und ganzen den Eindrücken Rechnung, die man als Zuhörer des Prozesses gewann. Mit der Bemerkung, daß dem Angeklagten diese Tat zuzutrauen gewesen sei, geht es allerdings zum Schaden des Angeklagten weiter, als notwendig gewesen wäre. Selbst wenn der Angeklagte in einem Augenblick völliger Nervenzerrüttung, der zweifellos vorlag, zur Rodestock geäußert haben sollte: man müßte die Hesse totschießen, so wäre mit einer verzweifelten Redensart immer noch nicht die Anstiftung zum Mordversuch erwiesen. Vor allem aber weiß niemand, was die Rodestock in ihrem völlig desolaten Zustand mit den Worten Josephsens gemacht hat. Auch heute, nach einem monatelangen Aufenthalt in der Irrenanstalt, ist diese schwer hysterische Frau geistig noch völlig ungeordnet. Für ihre Glaubwürdigkeit nimmt die Tatsache ein, daß sie mit außerordentlich gespanntem Interesse der Verhandlung folgte, daß in den Bruchstücken ihrer Aussage vielerlei plausibel klang. Aber wir haben von zu viel Zeugen gehört, daß diese Frau unter dem zerstörenden Einfluß ihres Leidens unerhört viel gelogen hat. Die Zeugen, die mit der Tat nichts zu tun hatten, die lediglich beruflich mit Fräulein Rodestock zu tun hatten, erklärten, man habe ihr kein Wort glauben können – und das zu einer Zeit, die jahrelang vor dem Attentat lag.
Die Feststellung, daß man dem Angeklagten die Tat zutrauen könne, war um so überflüssiger, als auch sonst genügend Anhaltspunkte vorlagen, ihn moralisch zu disqualifizieren. Die Tatsache, daß ein deutscher Richter ein solches Privatleben führen konnte – oder vielmehr innerhalb seines Privatlebens sich so weit gegen die Grundbegriffe des Anstandes vergehen konnte, bleibt peinlich. Am peinlichsten ist wohl die Erinnerung an die skandalösen Auftritte, die die Rodestock ihm in seinem Amtszimmer machte, als er eben im Begriff war, sich in einen Gerichtssaal zu begeben, um als Vorsitzender Strafrichter zu fungieren.
Das Beste und das einzig Versöhnliche, was Josephsen heute noch tun könnte, wäre seine Bitte um Abschied unter Verzicht auf Pension. Ob dieser Schritt im Augenblick noch möglich ist – das Disziplinargericht erster Instanz hat ja schon die Entlassung ausgesprochen –, wissen wir nicht. Er sollte jedenfalls das möglichste tun, um dem Spruch der zweiten Instanz zuvorzukommen. Im Breslauer Prozeß durfte er um sein Recht kämpfen, den weiteren Kampf um sein Richteramt möge er unterlassen.
ANGERSTEIN
(Im Dezember 1924 schrieb die „Vossische Zeitung“: „Das Städtchen Haiger im Regierungsbezirk Wiesbaden ist der Schauplatz eines furchtbaren Verbrechens geworden. Als der Direktor Angerstein von der Kalksteingrube Haiger in seine Villa zurückkehrte, hörte er einen wüsten Tumult und Hilferufe. Er lief, wie er angab, rasch nach dem Haustor, wurde aber dort von zwei Männern gestellt, die ihm mit einem Dolch einen tiefen Stich in die Brust beibrachten. Er wurde später bewußtlos in seinem Garten aufgefunden. Was sich in der Villa selbst abgespielt hat, läßt sich nur aus Indizien rekonstruieren; denn alle in der Villa anwesenden Personen sind ermordet worden: Frau Angerstein, deren Mutter und Schwester, ein Hausmädchen, zwei Angestellte, ein Gärtner und ein fünfjähriges Kind.“ Bereits einen Tag später stellte sich heraus, daß der schwerverletzt im Krankenhaus von Haiger liegende Direktor Angerstein selbst der Mörder war. Er gestand, die acht Personen mit einer Baumaxt getötet zu haben.)
Am 13. Juli 1925 um 7 Uhr verkündete der Vorsitzende des Schwurgerichts in Limburg das Urteil über Angerstein. Es lautete: „Angerstein wird wegen Mordes in acht Fällen achtmal zum Tode verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf Lebenszeit aberkannt.“
Nachdem das Urteil verkündet war, erhob sich Angerstein und sagte: „Ich nehme das Urteil an.“
Vorsitzender Roth: „Ich weise Sie darauf hin, daß es hier kein Zurück mehr gibt, daß Sie damit auf die Rechtsmittel verzichten. Ich mache Sie ferner darauf aufmerksam, daß, nachdem Sie achtmal zum Tode verurteilt wurden, Sie auf eine Begnadigung nicht zu rechnen haben.“
Darauf sagte Angerstein: „Ich nehme die Strafe an; meine Tat kann nur durch Blut gesühnt werden.“
Der Vorsitzende erklärte zum Gerichtsschreiber: „Um 7.02 Uhr: Das Urteil wird vom Angeklagten anerkannt. Ich schließe die Sitzung.“
Das Urteil kann einen Menschen voll befriedigen: den Verurteilten selbst, dem die Bürde eines fortan untragbaren Lebens abgenommen wird. Aus der furchtbaren Region mörderischen Tuns führt keine Brücke in die Welt zurück, deren Bevölkerung von der beglückenden Idee lebt, sie könne auf irdischen Wegen ihre Schuld abtragen.
Wir aber, die so gern geneigt sind, den Verbrecher mit Abscheu und Verachtung zu betrachten, wollen uns darauf besinnen, daß kein Verbrecher der letzten Jahre sichtbarer für die Menschheit auf dem Schafott verblutet als dieser Angerstein. Man unterscheidet wohl: Angerstein ist gewiß alles andere denn der Träger einer göttlichen Idee, er war nicht einmal ein irgendwie beachtenswerter Mensch, und wir alle wären an diesem Kleinbürger vorbeigegangen, ohne ihn zu bemerken. Aber das, was man einen unsympathischen Menschen nennt, ist er kaum gewesen. Die hervorstechende Häßlichkeit hat sich vielleicht erst nach der Tat eingezeichnet. Er hinterläßt wenig persönliche Feinde; Väter und Geschwister der Ermordeten, die haßzitternd ihr Zeugnis ablegten, schildern einen anscheinend harmlosen Menschen, einen ausgezeichneten, treu besorgten Gatten, der keinem andern je etwas zuleide getan hat. Die Fälschungen und Unterschlagungen sind nicht abzuleugnende Tatsachen – aber sie gehören zu jener Sorte von Gelegenheitsverbrechen, nach deren Sühne es für unsere Begriffe wohl eine Rückkehr in die menschliche Gemeinschaft gibt.
Nur der achtfache Mord steht isoliert da, ein ungeheures, unzugängliches Gebirge der Tat, in dessen von düsterem Gestrüpp verdeckten Anstieg nur der Psychiater Jahrmärker ein Licht geworfen hat – freilich eines, das nicht nur den seelischen Tatbestand Angersteins erhellte; er ließ uns die Schuld dieses Mörders für lange, erschütternde Augenblicke vergessen, da es furchtbare und nicht geahnte Bezirke unseres eigenen Herzens beleuchtete.
Solange man der These des Staatsanwalts folgt, kann man Angerstein für ein verbrecherisches Individuum halten, das aus der Welt zu stoßen ist; und da wir das weitere Leben dieses Menschen, aus seinen inneren Bedingungen heraus, für untragbar halten, wollen wir nicht mit dem Urteil hadern, das diesem Leben ein Ziel setzt. Aber wir Zuschauer müssen erkennen: Wenn Jahrmärker recht hat, dann sind die Bedingungen zu einer solchen Tat in jedem von uns gegeben – und gerade in denjenigen von uns, die unverschuldetes häusliches Elend mit Geduld, Sorge und nie ermüdender Liebe tragen. Die schwer hysterische Frau, den hingebend zärtlichen Mann stellt Jahrmärker in Vordergrund und Gegensatz. Und diese schuldig-unschuldige, harmlos-mörderische Frau sog mit ihrer pathologischen Klagesucht alles aus der Seele des Mannes, was an Güte, Wohlwollen, Mitleiden in dieser gar nicht armen Seele war. Hatte die Frau sich sattgetrunken, gewann er wohl für gewöhnlich Zeit, die guten Säfte zu regenerieren. Aber sie trieb das Spiel fort, bis die guten Säfte völlig erschöpft waren und sich andere Reservoirs öffneten, aus denen das Böse mit lebensvernichtender Kraft plötzlich hervorströmte. Und die Frau hatte von der Existenz des Bösen gewußt. Nur sie war von den Ahnungen ihres frühen Todes gewarnt, nur sie hatte in der Atmosphäre der sorgenden Gattenliebe die stets lauernde Gefahr gewittert.
Was Jahrmärker da aufdeckte, ist nicht Angersteins Rätsel; der Forscher gibt aus der Erfahrung mit den Mitteln des allgemein Menschlichen die Lösung für das allgemein Menschliche. Er sagt von uns etwas, das für Angerstein gilt. Und das bedeutet: Angersteins Verbrechen ist das unsrige. Selten offenbart sich das Böse mit solcher Vehemenz wie bei Angerstein. Aber wer kennt nicht von sich oder Personen der nächsten Umgebung die plötzlichen Ausbrüche, die – oft bei geringfügigen Anlässen – einen guten Ehemann als unleidlichen Tyrannen, einen liebenden Vater als Wüterich erscheinen lassen? Wie weit ist noch der Weg zum Verbrechen? Der Fall des Tierarztes, der nach Jahren treuer Pflichterfüllung den Weg des Mörders gehen wollte – der Arbeitslose, der in einem plötzlichen Erlahmen der Geduld den Säugling an die Wand schleudert, der hingebende Liebhaber, der zum Lustmörder wird – sie gehören alle hierher in dieses allzu menschliche Kapitel.
So ist Angersteins Tat eine Warnung an alle: das Mißtrauen gegen sich selbst nie völlig einschlafen zu lassen – aber auch die, den gutmütigen, aber erregbaren Nebenmenschen keiner zu schweren Belastungsprobe auszusetzen. Hat Jahrmärkers aussichtsvolle Theorie auf das Urteil keinen Einfluß geübt, wird das Gesetz in aller Schwere zur Anwendung gebracht – die beste Lösung für Angerstein.
Wir aber dürfen diesem Menschen, der vom Schicksal getrieben wurde, uns allen innewohnende Kräfte zur furchtbaren Tat zu steigern, trotz allem unser Mitgefühl nicht versagen.
DR. BRUNO SCHREIBER
Das Schwurgericht III Berlin verurteilte den früheren Studienreferendar Dr. Schreiber wegen Totschlags, begangen an seiner Ehefrau, unter Zubilligung mildernder Umstände zu dreieinhalb Jahren Gefängnis unter Anrechnung von sechs Monaten Untersuchungshaft. Als ehrlos hat das Gericht die Tat nicht angesehen und deshalb von der Verhängung einer Ehrenstrafe abgesehen.
Dr. Bruno Schreiber, einst ein angehender Gymnasiallehrer, dann ein Redakteur des „Tegeler Anzeigers“, schließlich Klavierspieler in Kneipen, tötete seine Frau. Einige Tage lang behielt er die Leiche, mit Immortellen geschmückt, im Bett. Dann wickelte er sie in eine Zeltbahn, trug sie auf den nahen Boden und begrub sie gewissermaßen unter einem Berge von Zeitungspapier. Die Dünste der Druckerschwärze absorbierten jeglichen Verwesungsgeruch und bewirkten eine völlige Mumifizierung der Leiche. Da Schreiber seinen Angehörigen gesagt hatte, seine Frau sei verreist, schöpfte man erst spät Verdacht und fand die Leiche erst nach Monaten. In seiner Verteidigung hat Schreiber im Laufe des Verfahrens die Taktik geändert. Zuerst ließ er glauben, er habe die Tat im Streit begangen. Später (und auch vor Gericht) suchte er darzutun, seine Frau habe ihn – nicht zum ersten Male – mit dem Revolver bedroht. Da habe er in der Notwehr zugeschlagen. Daß er in der Stunde der Tat bis zur Willenlosigkeit betrunken gewesen sei, behauptet er nicht.
Überhaupt – der kleine, etwa 35jährige Mann mit dem glattrasierten, zierlich geschnittenen Gesicht, den klugen, dunklen Augen, beschönigt eigentlich sehr wenig. Gewisse Züge lassen es verstehen, daß Kriminalkommissar Trettin, mit dem er von der Schule her befreundet war, ihn immer für einen durchaus anständigen Menschen hielt. – Trettin schildert in eigener Erschütterung, wie er den Freund als Gattenmörder selbst verhaften mußte.
Auch Bruno Schreibers Vater ist ein Berliner Vorstadtredakteur; der Sohn sollte Gymnasiallehrer werden; es trieb ihn zur Journalistik, über Tegel hinaus ist er nicht gekommen. Die lebhafte Intelligenz sieht man ihm an, zugleich aber ein ständiges Schwanken seines Gemütszustandes. Er kann über die Tat – ohne jeglichen Zynismus – mit einer erstaunlichen Sachlichkeit reden, zuweilen spielt ganz leicht Theaterei mit hinein. Dann wieder gerät er in offenbar echte Erregung der Reue, um eine Sekunde später, gewandt, ja geschäftlich zu sprechen. So wenig ist er in der Rolle seines Ichs, daß er mehr als einmal einen Zeugen als Angeklagten anspricht.
Eine starke Neigung zum schriftlichen Ausdruck muß er haben; nach einem Selbstmordversuch im Gefängnis, zu dem er etwa 50 Aspirintabletten schluckte, schildert er ausführlichst in einem langen Manuskript seine körperlichen Zustände.
Eine eigentliche Erklärung der Tat wird nicht gegeben. Hausnachbarn sagen aus, er habe die Frau mehrfach mißhandelt, einmal habe sie sogar die Polizei gerufen. Eine andere Zeugin weiß aus dem Munde der Getöteten, daß diese schon früher mit dem Revolver auf ihren Mann losgegangen sei. Da der Revolver versagte, habe die Frau den Mann mit der Waffe blutig geschlagen. Trettin, der sie flüchtig kannte, bezeichnet sie als Mannweib. Der Vater des Angeklagten schildert sie als eine reizbare und auch zanksüchtige Person, die sehr unter dem seit dem Kriege häufigen Alkoholgenuß ihres Mannes litt. Überhaupt habe sie gesucht, den Mann zu beherrschen, und nicht geduldet, daß er die ihm noch offene Stellung an dem „Tegeler Anzeiger“ wieder annahm.
Aus der Zeugenvernehmung ergibt sich, daß die Familie der Frau – und damit wohl auch die Frau selbst – weit unter dem Bildungsgrade des Mannes stand.
Er aber wehrt sich gegen die Annahme, daß seine Ehe zerrüttet war. Zuweilen habe es Krach gegeben, die Versöhnung sei um so schöner gewesen. Die Hausbewohner hätten ihre Zärtlichkeit belächelt. „Ich ging mit ihr ins Theater, ins Kino, zu Regatten und zu Boxabenden. So führten wir ein gutes Leben wie jede andere ordentliche Familie.“
Trettin gibt auf die Frage, ob er dem Angeklagten die Tat zumute, keine Antwort. Eine kleine Unehrlichkeit, von der er kurz vor der Verhaftung gehört hatte, habe ihn sehr eigentümlich berührt. Die Wahrheit ist wohl die: lebendige Intelligenz gepaart mit Entmutigkeit. Aber keine Begabung, kein eigener seelischer Stoff, der zur Verarbeitung gekommen wäre. Kino, Theater, Regatten, Boxen – dies der wesentliche Inhalt der Ehe; dann gutes Essen und ein starker Trunk.
Fast unvermittelt ragt in das behagliche Schlemmerleben des kleinen Mannes die furchtbare Tat: die einzige seines Lebens.
20. 10. 1925
SANITÄTSRAT BÖHME
(Im September 1916 wurde die dritte Frau des Sanitätsrats Dr. Robert Justus Böhme aus Großröhrsdorf auf der Jagd durch einen Schrotschuß aus dem Gewehr ihres Mannes tödlich verletzt. Dr. Böhme erklärte, er sei versehentlich auf seine geöffneten Schnürsenkel getreten und gestolpert, wobei dann das Gewehr losgegangen sei. Zehn Jahre nach der Tat stand Dr. Böhme vor dem Schwurgericht Dresden unter Mordanklage.)
Dresden, 8. Oktober 1926.
Vorläufig, da sein Mördertum noch nicht erwiesen ist, muß er es sich gefallen lassen, daß man ihn für komisch hält. Der kräftige Sechziger ist eine mehr bäuerliche als akademische Erscheinung. Er hat vermutlich in seinem Leben nie was Rechtes getan und war im wesentlichen damit beschäftigt, wohlhabende Frauen zu heiraten. Die Tatsache, daß ihm das ursprünglich in so geringem Maße gelang, macht ihn komisch. Der eigentliche durchziehende Handlungsstoff seines Lebens ist die großväterliche Erbschaft seiner Tochter aus erster Ehe, die vielleicht vom Vormundschaftsgericht in größerer Höhe festgesetzt wurde, als zulässig war. Wie er mit den 20 000 Mark manipulierte, wie sie bald in einer Hypothek verschwinden, bald zur Rückzahlung einer anderen Hypothek verwendet werden – wie er sie sich von seiner zweiten Frau schenken läßt, um seine Verpflichtung der Tochter gegenüber zu erfüllen – wie aber schließlich die Tochter das Geld doch nicht kriegt – das ist alles sein Hauptgeschäftsgeheimnis, in das man nicht dringen wird, weil es ja nicht Gegenstand dieses Prozesses ist.
Um so deutlicher wird sein Hang zur Heuchelei, der fortwährende Trieb, mit Gemütswerten zu operieren – es wäre nur abstoßend, wenn es nicht durch seine vollendet sächsische Aussprache wunderbar gemildert würde. Dieser Mann, der die Gewohnheit hat, sich am ersten Tag der Bekanntschaft zu verloben – „Ich verließ mich auf meinen Scharfblick“ –, ist irgendwo naiv. Er hat sich seinen Kinderglauben an das Wunderbare bewahrt. Ihm ist natürlich genau bekannt, was der Vorsitzende ihm vorhalten wird – und er hofft immer wieder, der Richter werde irgend etwas Wesentliches vergessen. Aber ach, der Richter vergißt nichts.
Ein Beispiel: Nach der Scheidung von der zweiten Frau sah er sich nach der dritten sehr energisch um und befreundete sich mit einer Hamburger Dame, die ihn durch ihr „seelenvolles Gemüt“ entzückt hatte. Der Vorsitzende verliest einen sehr freundschaftlichen Brief an die Dame und fragt: „Waren Sie, als Sie diesen Brief schrieben, schon in dritter Ehe verheiratet?“
Böhme (mit Entrüstung): „Aber nein!“
Vorsitzender: „Und doch haben Sie nach der Eheschließung mit der dritten Frau an die Hamburger Dame noch andere Briefe geschrieben, in denen Sie auf eine Verehelichung mit ihr hofften.“
Angeklagter: „Das war aber doch eine Notlüge – ich wollte ihr doch nicht sagen, daß ich inzwischen geheiratet hatte.“
Die Höhe des Vermögens der dritten Frau, die er ermordet haben soll, will er vor ihrem Tode nicht gekannt haben. Aus den Akten des Zivilprozesses geht das Gegenteil hervor.
Aber – wie bekam er seine dritte Frau? Sie hatte ihm anfangs ihre Hand verweigert. Da war er mit einem Riesenkranz am Grabe ihres ersten Gatten erschienen und hatte sie so gerührt, daß sie ihr Ja-Wort gab. Auch das will er bestreiten – gibt aber dann den Sachverhalt zu, weil er alles das selbst in einem höchst sentimentalen Briefe an die Frau geschrieben hat. Der Brief ist vom 24. März 1915. Am 25. hat er sie geheiratet.
Nun schildert Böhme die Katastrophe: „Meine Frau hatte Lust, sich an der Jagd zu beteiligen. Sie wollte sogar schießen lernen. Sie war sieben- bis achtmal mit mir auf der Hühnerjagd.“
Vorsitzender: „Früher sagten Sie, es war das zweite Mal.“
Angeklagter: „Das muß ein Irrtum sein.“
Vorsitzender: „Kennen Sie den Rahmenstein?“
Angeklagter: „Nein.“
Vorsitzender: „Das ist aber ein ganz bekannter Punkt.“
Angeklagter: „Weiß ich nicht.“
Vorsitzender: „Ihre Frau soll dort mal runtergefallen sein?“
Angeklagter: „Aber nein.“
Vorsitzender: „Aber Ihre Frau hat davon erzählt. Sie sollen Ihre Frau gebeten haben, Ihnen den Schuhsenkel zu binden. Als Ihre Frau sich bückte, sollen Sie ihr einen Stoß gegeben haben, so daß sie beinahe hinuntergestürzt ist.“
Angeklagter: „Davon ist gar keine Rede. Wir sind einmal auf dem glatten Moose, als wir eine Schlange sahen, ausgerutscht. Da hat meine Frau so gelacht und gesagt: Denk mal, wenn wir den Hang hinuntergefallen wären. Nachher hat sie es auch anderen gesagt, und ich habe ihr gesagt: Laß doch die dummen Redereien.“
Vorsitzender: „Merkwürdig. Bisher haben Sie ja auch schon von der Schlange gesprochen. Aber alles andere ist heute neu, obwohl Sie wiederholt danach gefragt wurden.“
Angeklagter: „Das ist mir erst wieder eingefallen.“
Er schildert dann den Hergang am Tage der Katastrophe: „Wir saßen zuerst im Gasthause. Meine Frau war sehr zärtlich zu mir. Wir suchten dann die Kartoffelfelder nach Hühnern ab. Förster Winter ging rechts, ich etwa 25 Meter hinter ihm, meine Frau war an meiner linken Seite, mal näher, mal weiter. Ich kam an eine Stelle, wo Hühner eingefallen waren. Plötzlich fühlte ich eine Hemmung, ich stolperte, ich falle nach rechts über, stürze, der Schuß geht los. Der Senkel vom rechten Schuh war auf, darüber war ich gestolpert.“
Vorsitzender: „Sie gingen doch langsam, und wenn man langsam geht, stolpert man doch nicht so, daß man stürzt.“
Böhme macht zur Illustration einige verzweifelte Sprünge im Gerichtssaal.
Vorsitzender: „Wann sahen Sie nun, daß Ihrer Frau etwas passiert war?“
Angeklagter: „Ich sah meine Frau sinken, aber ich nahm zuerst gar keinen Zusammenhang wahr. Alles andere weiß ich nicht mehr. Ich war so erschüttert, ich hatte mich mit den Händen in den Boden eingekrallt, so verzweifelt war ich.“
Epilog





























