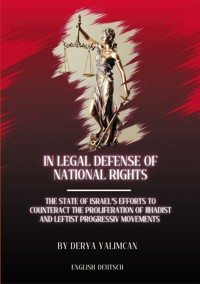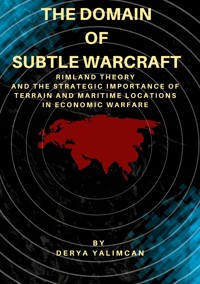Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Guten Tag, Monsieur Le Bon. Auch Ihnen einen guten Tag, Monsieur Joly. Wie lange liegt der Patient bereits im Wachkoma? Ich glaube seit Mitte der Achtzigerjahre. Und der Patient lebt noch? Ja, Maurice, das Gehirn ist noch völlig intakt und die Organe ebenfalls. Aber Gustave, warum wacht der Patient dann nicht auf? Es scheint, dass der Patient alles mitbekommt, was um ihn herum passiert, er es aber aus irgendeinem Grund vorzieht, vor der Realität zu flüchten. Ich verstehe, Gustave, das ist tragisch, sehr tragisch; aber auch nicht schlecht, denn dann können wir offen reden, während wir spielen. Gut, Maurice, holen wir den Patienten an den Tisch und lassen ihn bei unserem Spiel zuschauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dem Patienten gewidmet
Guten Tag, Monsieur Le Bon.
Auch Ihnen einen guten Tag, Monsieur Joly.
Wie lange liegt der Patient bereits im Wachkoma?
Ich glaube seit Mitte der Achtzigerjahre.
Und der Patient lebt noch?
Ja, Maurice, das Gehirn ist noch völlig intakt und die Organe ebenfalls.
Aber Gustave, warum wacht der Patient dann nicht auf?
Es scheint, dass der Patient alles mitbekommt, was um ihn herum passiert, er es aber aus irgendeinem
Grund vorzieht, vor der Realität zu flüchten.
Ich verstehe, Gustave, das ist tragisch, sehr tragisch ‒ aber auch nicht schlecht, denn dann können wir offen reden, während wir spielen.
Gut, Maurice, holen wir den Patienten an den Tisch und lassen ihn bei unserem Spiel zuschauen.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Theurgie
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Heilige Geometrie
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Mythologie
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Dogma
Astrologie
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Mutter Monster
Alchemie
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Epilog
Prolog
Rasputin’s Book Circle lag in der Store Street, einer Seitenstraße im Stadtteil Fitzrovia und befand sich in einem jener für London typischen dreistöckigen Häuserblöcke, die im Untergeschoss aneinandergereihte, von mächtigen weißen Halbpfeilern getrennte Ladengeschäfte beherbergen und die oberhalb des durchgehenden, weiß getünchten Abschlusssimses in einer zwischen gedämpftem Dunkelrot, angeschmutztem Schwarz und verwaschenem Grau changierenden Klinkerfassade auslaufen. Das auf einem grau gestrichenen, kassettierten Sockel ruhende Schaufenster und die graugerahmte gläserne Eingangstür gaben den Blick in einen von überbordenden Bücherregalen gesäumten, mit Stelltischen, Vitrinen und geöffneten Pappkartons vollgestopften, sich schlauchartig nach hinten verengenden Raum frei.
Auf die graue Markise, die den Eingangsbereich der Hausnummer 33 überspannte, trommelte stakkatoartig der Platzregen und stürzte in reißenden Bächen klatschend auf die orange-grauen Gehwegplatten. „Gerade noch geschafft“, seufzte Kimberly erleichtert, nachdem sie die letzten Bücher vom großen Ausstellungstisch, der als Blickfang für die Laufkundschaft vor dem Schaufenster platziert war, trocken ins Ladeninnere gerettet hatte. Erschöpft ließ sie sich in das abgewetzte Samtpolster des neobarocken Kanapees fallen, das die schräg gegenüber dem Verkaufstresen befindliche Nische ausfüllte, die sie als ihr Refugium ansah, in das sie sich, wenn sie allein im Geschäft war, zurückziehen konnte, um durchzuatmen oder sich in die Lektüre eines der unzähligen Bücher zu versenken, von denen sie den ganzen Tag umgeben war.
Kimberly war eine jener rothaarigen, blassen, blauäugigen, sommersprossigen, typisch keltisch wirkenden Frauen, die trefflich den aus der Überlieferung bezeugten Idealtypus einer Hexe charakterisierten. Immer wenn sie in einem der Bücher über Teufelsglauben und Hexenwahn blätterte, stellte sie sich mit einer Mischung aus Grausen und Wohlsein vor, dass sie allein ihres Äußeren wegen im Mittelalter mit Sicherheit auf dem Scheiterhaufen gelandet wäre. Auch wenn sie als Spezialistin der mittelalterlichen Geschichte und Mythologie bekannt war und sich als Expertin auf dem Gebiet der Ketzerinquisition und der Hexenprozesse einen Namen erworben hatte, so hielt sie dennoch Abstand zu jener Bewegung des Neuhexentums, deren Vertreterinnen sich regelmäßig zu Lesungen und Sessions in ihrer Buchhandlung zusammenfanden. Sie hegte durchaus Gefühle der Bewunderung für das Selbstbewusstsein der Frauen, die sich als junge urbane Hexen bezeichneten und die ohne jeden Vorbehalt satanische Rituale praktizierten, um darüber in ihren Texten voller Emotionen zu berichten, doch bevorzugte sie, die Mittvierzigerin, den distanzierten Blick der Wissenschaftlerin auf das Phänomen Hexenwesen. Auch wenn sie manchmal von der kühlen Analyse abwich und sich im Spiel ihrer Phantasie verwirrenden Träumereien von der eigenen Hexennatur hingab, so tat sie das doch stets nur im Verborgenen und für sich allein, und ihre Grenzüberschreitungen unternahm sie für die Außenwelt unbemerkt.
Kimberly ließ die mit Pentagrammen durchwirkte Wolldecke von ihren Schultern gleiten und spielte mit dem Gedanken, einen Tee aufzubrühen, als die Ladenglocke hektisch zu läuten begann und sie aus ihrer wohligen Ruhepause schreckte. Der junge Mann, der rückwärts polternd durch die Eingangstür brach, wuchtete einen großen, an vielen Stellen bereits durchnässten Pappkarton herein. ,Er wird einen Unterschlupf vor dem Regen suchen‘, dachte sie und stellte sich abwartend hinter den Tresen. Sie beobachtete, wie sich der Junge, trotz seines Exoskeletts unter der Last schwankend, auf sie zubewegte und dabei nur knapp Zusammenstöße mit den Aufstelltischen vermied. Seine übermäßig mit Haarwachs frisierte Rockabilly-Frisur saß perfekt, der Regen hatte der Tolle und dem nach hinten gekämmtem Haar nichts anhaben können. Er trug ein Lonsdale-T-Shirt, das nass im Gürtel hing und 501-Jeans über Poncho-Stiefeln, die bis zu den Knöcheln reichten. Es waren Stiefel, deren Spitzen aussahen wie abgehackt. Kimberlys feine Nase nahm den Geruch schalen Biers wahr, der sich verstärkte, je näher der Junge auf sie zukam. Als er den Karton auf den Tresen knallte, wehte seine Alkoholfahne ihr direkt ins Gesicht.
„Guten Morgen“, raunzte er mit starkem Cockney-Akzent, „ich habe hier wirklich alte Bücher, die sich mit allerlei Hokuspokus beschäftigen.“ Er trug offensichtlich Display-Kontaktlinsen für Halbblinde, die in den letzten Jahren zunehmend die Smartbrillen ersetzt hatten und die seinem Blick eine Note grotesker Verzerrung beigaben. Kimberly glaubte, in diesen Augen Wollust zu erkennen, und zuckte instinktiv ein wenig zurück. ,Komm mir bloß nicht zu nahe, du Giftzwerg‘, dachte sie mit einem leichten Anflug von Ekel.
„Der RFID-Chip und das Augenlidinterface können nicht konnektieren, weshalb ich diese Bücher ohne das Exoskelett schleppen musste“, erklärte der junge Mann leutselig und wies auf den umgeschnallten Powerloader, der gewöhnlich von Leuten benutzt wurde, die in der Umzugsbranche beschäftigt waren.
„Guten Morgen“, entgegnete Kimberly, „wir kaufen normalerweise keine gebrauchten Bücher, wir vermitteln diese nur, wenn überhaupt.“ Sie zuckte mit dem Kinn in Richtung des Kartons und fuhr fort: „Und auch nur dann, wenn sie nicht vom Regen durchnässt sind.“ Sie hielt kurz inne und ließ dann lässig ihre blasse Hand einen Halbkreis andeuten: „Schauen Sie sich unser Sortiment an. Wir führen ausschließlich qualitativ hochwertige Bücher aus dem Bereich Okkultismus.“
Der junge Mann blickte sich um und trat an eines der Regale. „Scarlet Imprint - ist das eine Marke oder Serie?“ fragte er. Kimberly rümpfte unmerklich die Nase. Sie war sich sicher, dass der Mann, da er seinen RFID-Chip nicht mit der Linse konnektieren konnte, kaum in der Lage war, die Buchtitel zu entziffern. „Das ist ein Verlag von besonderer Qualität“, antwortete sie, „dessen Bücher sehr individuell gestaltet und aufwendig gearbeitet sind.“
Der junge Mann zog einen der Bände aus dem Regal und begutachtete ihn fasziniert.
„Ich lese ja keine Bücher“, bemerkte er und schob das Buch zurück an seinen Platz. „Die Erlebnisse anderer sind nicht so interessant für mich, ich erlebe gerne selbst und sammle meine eigenen Erfahrungen. Ich bin Gildenführer in Holoworld“, trumpfte er stolz auf. „Holoworld, die multimassive Online-Existenz?“ fragte Kimberly interessiert.
„Ich arbeite halbtags bei einem Umzugsunternehmen und den Rest des Tages bin ich Waffenschmied in Holoworld“, erwiderte der junge Mann. „Aber ich überlege, meinen Umzugsjob aufzugeben, da ich in Holoworld mehr verdiene. Ich bin nun der Waffenschmied der Gilde und kann davon gut leben. Die Waffen, die ich für das Spiel produziere, verkaufe ich mit großem Gewinn an meine Gilde und als Gildenführer halte ich eine hohe Position im Spiel.“ Er grinste. „Das gibt viele Kryptos für die Portokasse“, fügte er schelmisch hinzu.
Kimberly ließ ihn reden. Sie war sich sicher, dass der Rockabilly sein Geld in Spielautomaten verprasste, das würde seinem Profil entsprechen. Die exakte Verfolgbarkeit der Kryptowährungen über die private Blockchain-IP durch die Suchmaschinenalgorithmen wird ihn sicherlich immer wieder zu Spielautomaten leiten. ,Dort knöpft man dir wieder alles ab, du Loser‘, dachte sie spöttisch.
„Holoworld hat mittlerweile fünfhundert Millionen Spieler und keinen einzigen Konkurrenten. Somit ist mein Einkommen gesichert. Ich zahle sogar in die Holoworld-Rentenversicherung ein“, redete der Junge weiter. „Es ist sinnlos, sich mit Büchern zu beschäftigen, diese haben keinen Mehrwert. Wie heißt es so schön? Es gibt keine andere Welt, komm zu Holoworld.“
Kimberly lächelte: „Ich muss Sie enttäuschen. Leider müssen Sie Ihre Bücher wieder mitnehmen. Wir kaufen, wie gesagt, für gewöhnlich keine gebrauchten Ausgaben. Versuchen Sie es auf dem Flohmarkt.“
„Nachdem ich den Kartoninhalt durch die Display-Kontaktlinse analysiert habe, hat mich die Suchmaschine zu Ihnen geführt“, ließ der junge Mann nicht locker.
„Tatsächlich?“ fragte Kimberly verwundert und zum ersten Mal klang ihre Stimme ein wenig interessiert. „Wo haben Sie den Karton Bücher her?“
Das Läuten der Eingangsglocke unterbrach ihr Gespräch. Ein großgewachsener Kunde mit langen, geflochtenen, größtenteils grauen Haaren und einem Scheitellappeninterface, der sich auf einen Knotenstock aus Ebenholz stützte, schüttelte die Regentropfen vom gummierten schwarzen Baumwollstoff seines Kleppermantels und trat ein. Als der Rockabilly den Kunden sah, wich er instinktiv einige Schritte zurück. „Transhumanist-Cyborg“, murmelte er halb ängstlich, halb bewundernd. Der Kunde übersah den sichtlich Kürzeren bewusst und ging direkt auf Kimberly zu.
Der Rockabilly sagte salopp: „Ich komme heute Abend
erneut vorbei, und wenn Sie die Bücher kaufen wollen, machen wir ein Geschäft, wenn nicht, nehme ich sie
wieder mit“ und wankte zum Ausgang, noch ehe
Kimberly irgendetwas erwidern konnte. Das Areal um den Tresen roch nach Bier. ,Na toll‘, dachte Kimberly, ,nun habe ich eine Kiste Flohmarkt-Bücher auf dem Hals.‘ Zu gerne hätte sie dem sonderbaren Jüngling den Karton gleich wieder mitgegeben.
„Herr Doktor, guten Morgen“, wandte sie sich an den neuen Kunden. Eigentlich wirkte der Herr Doktor eher wie ein Junkie, aber alle, die ihn kannten, nannten ihn Herr Doktor, da er sehr gerne und fundiert über sämtliche Aspekte des Keltentums dozierte.
Der Kunde trat an das Terminal, das sich in der Ecke hinter dem Tresen befand, und konnektierte sein Scheitellappeninterface mit der Datenbank, um in den Kataloglisten nach einem Buch zu suchen. Kimberly hantierte derweil mit sichtlicher Mühe den Karton an die rechte Ecke des Tresens, und ihrer Miene war die Verärgerung über diesen Stress deutlich anzusehen.
Der Doktor drehte sich zur Verkäuferin und stieß seinen Knotenstock zweimal auf den Boden. Kimberly schreckte hoch und sah ihn fragend an. „Ich suche ein altes Werk in deutscher Sprache, eine Enzyklopädie in zwölf Bänden mit dem Titel Das Kloster von Johann Scheible“, dröhnte sein Bass. „Im Netz habe ich nichts gefunden. Haben Sie eine Idee, woher wir dieses Werk beziehen könnten, Mrs. Morrigain?“
„In der antiquarischen Datenbank haben Sie auch nichts gefunden?“
„Nein“, antwortete der Bass.
„Ich suche für Sie, Herr Doktor. Haben Sie die Suchwörter?“
„Gehen Sie vom Titel aus, Mrs. Morrigain, Das Kloster. Weltlich und geistlich und suchen Sie darüber hinaus nach den Stichworten Faustscher Pakt und Faustsche Magie. Sie sprechen doch Deutsch.“
Kimberly konnektierte ihren RFID-Chip mit dem Augenlidinterface und sah im Hologramm der Datenbank nach. „Laut dem deutschen Datenbanksystem ist es ein Werk, das Johann Scheible 1845 bis 1849 im Eigenverlag in einer sehr geringen Stückzahl herausgegeben hat, nur eine Auflage“, erklärte sie. „Faustsche Magie und faustscher Pakt mit Mephistopheles. Die Geschichte von Faust in Reimen, nach dem einzigen bekannten Exemplar von 1587 in der Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen.“
Während sie weiter nach dem Werk in der Datenbank fahndete, sah sich der große Mann im Laden um und bemerkte den halb geöffneten Pappkarton am Ende des Tresens. „Darf ich mir mal die Bücher in der Kiste ansehen, Mrs. Morrigain?“ fragte er interessiert. „Ja, natürlich“, nuschelte Kimberly geistesabwesend, ohne ihre Suche zu unterbrechen.
Der Doktor öffnete den Karton. Sofort sprang ihm ein in Schlangenleder gebundenes, elegant gestaltetes, voluminöses Buch in die Augen. Er las den Titel The Game of Saturn und stöberte weiter. Dann nahm er ein weiteres Buch heraus und las den Namen des Autors: Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.
„Ihr gesuchtes Buch enthält Sigillen“, ließ sich Kimberly erneut vernehmen, „und den Schlüssel zum Pakt. Jedenfalls zwei der Bände der Enzyklopädie sind im Hinblick auf Faust relevant.“ Sie sah zum Doktor, zuckte entschuldigend mit den Schultern und fügte hinzu: „Die Bibliotheksversion in der Preußischen Staatsbibliothek ist nur registrierten Wissenschaftlern zugängig.“
Es schien, als habe der Doktor nur halb zugehört. „Was sind das für Bücher hier, Mrs. Morrigain?“ fiel er ihr ins Wort. „Ich würde gerne einige Bände aus diesem Karton erwerben wollen.“
Kimberly sah verunsichert auf und sagte: „Das sind Flohmarkt-Bücher.“ „Was wollen Sie für den gesamten Karton haben?“ dröhnte fragend der Bass des Doktors. Irritiert schob Kimberly ihre Brille in die Stirn und sagte: „Die Bücher sind vorerst nicht verkäuflich. Die gehören uns nicht.“
„Schauen Sie mal, was ich in dem Karton gefunden habe, Mrs. Morrigain“, sprach der Doktor und starrte Kimberly mit seltsamem Blick an. „Das Kloster.“
Kimberly nahm ihm das Buch aus der Hand und las langsam und mit Unterbrechungen den in altdeutscher Fraktur gestanzten Titel: „Johann Scheible, Doktor Johann Faust ... I. Faust und seine Vorgänger.“ Ihre Mundwinkel zuckten. „III. Faust’s Höllenzwang. Jesuitarum libellus, oder der gewaltige Meergeist. Miracul-,Kunst- und Wunderbuch. Schlüssel zum Höllenzwang.“ Sie holte kurz Luft und übersetzte. Dann sah sie erwartungsvoll zum Doktor und sagte: „Sie selbst, Herr Doktor, sind ja auch im Deutschen recht bewandert.“ Sie schlug das Buch zu, blies etwas Staub von den Schnittkanten und fügte mit leichter Verwunderung in der Stimme an: „Und dies ist das Buch, das Sie suchen.“ Kimberly begann nun, den Inhalt des Kartons genauer zu begutachten. „Diese Bücher sind ein Vermögen wert. Nicht einmal mehr antiquarisch erhältlich“, bemerkte sie verblüfft. Sie kramten beide im Karton.
„Hier dieses Buch, schauen Sie es sich an, Herr Doktor, es ist handgeschrieben auf Pergament. Die Schrift sieht aus wie aramäisch.“
„Nein, Mrs. Morrigain“, widersprach der Mann trocken, „es ist chaldäisch und dieses hier ist …“, der Doktor stutzte und setzte erstaunt fort: „Das hier ist eine Kopie der griechischen Zauberpapyri in Altgriechisch, Koptisch und Demotisch.“
Die beiden bibliophilen Schatzsucher beförderten alle Bände auf den Tresen und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Der Doktor schnaufte vor Aufregung und legte seinen Mantel ab. Kimberly knetete selbstvergessen die Hände, in ihr blasses Gesicht malten sich rote Flecke.
„Wie gehen wir nun vor, Mrs. Morrigain?“ fragte der Doktor.
„Wir müssen den Besitzer kontaktieren. Den jungen
Mann mit dem Exoskelett von vorhin.“
„Wo hat er denn die Bücher her?“
„Ich habe ihn nicht gefragt“, entschuldigte sich Kimberly.
„Nun denn“, hob der Doktor an, „er ist nicht da, doch wir sollten eine Lösung finden. Ich gebe Ihnen 2000 Pfund für das Scheible-Buch, Mrs. Morrigain.“
„Ich kann Ihnen diesen Band nicht überlassen“, wehrte Kimberly ab. „Die Bücher habe ich noch nicht erworben. Kommen Sie morgen wieder.“
„Sie glauben doch wohl nicht, dass ich auf diesen Schatz verzichte und ohne einen einzigen Band nach Hause gehe“, erregte sich der Doktor. „Ich gebe Ihnen 3000, nein 5000 Pfund Anzahlung dafür, Mrs. Morrigain, und Sie werden mit dem Jungen handelseinig.“
„Sie wissen, dass es nicht rechtens ist, wenn ich Ihnen etwas überlasse, bevor ich dem Jungen die Bücher abgekauft habe.“
„5000 Pfund sofort!“ bellte der Doktor und verzog sein Gesicht zu einer bösen Grimasse. „Whatspay Transfer!“ kommandierte er weiter und aktivierte sein Bezahlsystem. „Morgen schließen wir das Geschäft ab“, fügte er besänftigend hinzu, hüllte sich in seinen Mantel und griff nach dem voluminösen Band des Klosters: „Den nehme ich heute schon mal mit.“
„Überredet“, seufzte Kimberly und zog ihre Hand vom Einband, „heute Abend werde ich mich mit dem Jungen einigen.“ Sie schaute ihr Gegenüber fragend an. „5000 Pfund?“ Der Doktor nickte bestätigend und schloss den Bezahlvorgang über sein Interface ab. Dann klemmte er sich den Folianten unter den Arm, deutete eine knappe Verbeugung an und klopfte zum
Abschied dreimal mit dem Knotenstock auf den Boden. Nachdem die Glastür mit Geläut ins Schloss gefallen
war, betrachtete Kimberly die auf dem Tresen aufgereihten Bücher und Manuskriptbündel. Liebevoll strich sie über die Patina der Einbände und sog den
Duft der jahrhundertealten Gelehrsamkeit ein. Unter dem Tisch zog sie einen unbeschädigten Karton hervor und begann wehmütig die Bücher einzupacken. ,Die Drucke sind zum Glück trocken geblieben‘, dachte sie, ,nur die Handschriften haben Feuchtigkeit abbekommen.‘ Sorgfältig schichtete sie die Bände übereinander. Obendrauf legte sie die Manuskripte und ließ den Deckel offen, damit die feuchten Seiten Luft bekamen. Ein Bündel gewellten, ungebleichten Papiers, das an mehreren Stellen durchnässt war, behielt sie in der Hand, um es vorübergehend an einem trockenen Platz auszulegen. Vorsichtig löste sie die zusammengeklebten vorderen Blätter voneinander und schlug die erste Seite, von der ein größeres Stück abgerissen war, um. Die strenge, regelmäßige Handschrift beanspruchte sofort ihre Aufmerksamkeit. „Florentiner Bastarda“, murmelte sie und betrachtete die Seite genauer. Das Regenwasser hatte die schwarze Tinte zusammenlaufen lassen und einen Teil der Schrift unleserlich gemacht. ,Das ist ja Englisch‘, staunte sie beim Entziffern der lesbaren Fragmente, ,modernes Englisch!‘ Sie blätterte aufgeregt weitere Seiten um und schüttelte mehrfach ungläubig den Kopf. ,Wer verwendet denn heutzutage eine mittelalterliche Kanzleischrift zur Abfassung eines Tagebuchs?‘ fragte sie sich. Ein Tagebuch schien es wohl zu sein oder ein Bericht oder etwas in der Art, leider, wie sie feststellte, vielfach unvollständig. Einige Seiten fehlten, auf anderen war die Schrift kaum zu entziffern.
Es war Freitag, und Kimberly freute sich, dass an diesem verregneten Tag kaum mehr Kunden zu erwarten waren und sie bis zum Eintreffen des jungen Mannes genug Zeit zum ungestörten Schmökern besaß. Sie legte das Manuskript ab und begab sich zum Teekessel. Endlich fand sie Gelegenheit, ihren geliebten nepalesischen Hochlandtee zuzubereiten, eine Zeremonie, die sie voller Vorfreude auf den zu erwartenden Genuss vollzog. Bedächtig ließ sie die dunkelgrünen, goldgelb durchwirkten Blätter des First Flush in das feine Porzellankännchen rieseln und nahm mit einem stillen Lächeln das einzelne, auf die Tischplatte gefallene Blättchen mit der angefeuchteten Fingerspitze auf, um es zwischen den Zähnen lustvoll zu zermahlen. Diesen wundervoll aromatischen Jahrgang von einer versteckten Plantage am Südhang des Kantschindschanga im Distrikt Ilam, einen Geheimtipp für Genießer, hatte ihr eine der jungen Hexen von einer Pilgerfahrt zu den Devi-Tempeln des Himalajas mitgebracht. Als das Wasser kochte, zählte sie bis dreißig, und erst danach goss sie es ein, denn sie war der Überzeugung, dass der Tee am besten gelingt, wenn der Siedepunkt ein wenig unterschritten wird. Auf einem Tablett balancierte sie das Teegeschirr in ihr Nischenrefugium und sank in die samtigen Polster des Kanapees. Aus dem Kännchen ließ sie den Tee in einem sanften Bogen in die Tasse fließen, zog die Knie an sich und schlürfte genussvoll den dampfenden Sud. Dann schlug sie das Manuskript auf und begann auf der vielfach gerissenen ersten Seite zu lesen.
Ave Sorores, un Fra...
Hier folgt nunmehr mein Bericht für das Zikkurat, den ich dem Egregor zur Verfü… Es ist eine weitere Bestätigung der Vorhersehung des Orakels über …. die wir zu erwarten haben. Um den Ablauf der Wahrscheinlichkeiten zu verändern, müssen wir explizit punktu... Der Grund ist, dass das in meiner Erzählung erwähnte Fehlerdelta nicht vom Or… berechnet werden kann. Das Orakel muss die Variablen dahingehend anpassen ... Und dieses Fehlerdelta wird einen Quantensprungeffekt auslösen, der den Mechanismus und unsere Berufung ins Obsolete führen wird. Noch ist genug Zeit, … Fehlerdelta zu neutralisieren, um unseren Plan für den Homo sapiens in die adäquate Bahn zu lenk... Meine Erzählung der Vorkommnisse habe ich genau in der Form beschrieben, wie ich sie …. die Übermittlung des Orakels als Erkenntnisgewinn erfahren …
Der Rest des Textes fehlte. Auch die nächsten Seiten waren nicht mehr vorhanden. Kimberly nahm erneut einen Schluck Nepaltee, platzierte ein dickes Kissen auf der mit einem schwarzen Löwenkopf verzierten Seitenlehne des Sofas und nahm eine bequeme Liegeposition ein. Sie las weiter.
1
…nte mich erinnern, dass ich in Warschau gewesen bin. Kiew hatte ich verlassen und war weiter auf dem Landweg nach Polen gereist. Ich weiß, dass ich in Kiew ein Konzert der Heavy Metal Band Warlock besuchte und dort das Lied All we are hörte. Das Konzertposter, auf dem ein Alligator abgebildet war, habe ich noch gut in Erinnerung.
Auf dem Kiewer Busbahnhof habe ich eine Flasche Wasser gekauft. Wie ich in den Bus gelangt bin und was auf der Fahrt geschehen ist, weiß ich nicht mehr. Das letzte, woran ich mich entsinne, ist, dass ich in Warschau in einem extrem psychedelischen Zustand auf die beiden Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes zugewankt bin.
Danach bin ich in einem Krankenhaus aufgewacht, am Bett fixiert. Ich lag in einem engen Sechsbettzimmer. Von den anderen Patienten waren einige ebenfalls fixiert, jedoch nicht alle. Einer redete unaufhörlich in einem Idiom, das sich wie eine Mischung verschiedener osteuropäischer Sprachen anhörte. Ich verstand nicht, wovon der Mann sprach, aber sein endloser Monolog war aus mindestens sechs verschiedenen Sprachen zusammengesetzt. Die anderen Patienten schienen unter sehr starker Medikation zu stehen, da sie, mit offenen Mündern vor sich hin sabbernd, lethargisch ins Leere starrten. Es war ein unheimlicher Ort. Drei der Insassen schienen mir keine Einheimischen zu sein, sie erinnerten mich an Westeuropäer.
Einer von ihnen kam mit wirrem Blick auf mich zu und sprach mich mit gehetzter Stimme auf Englisch an. „Willkommen im Fegefeuer! Ich erinnere mich nur, dass ich in Wien einen Devils-Own-Cocktail getrunken habe“, schrie er und fügte zusammenzuckend hinzu: „Und dann bin ich hier aufgewacht. Irgendwann. Wann, weiß ich nicht mehr, Wochen, Monate!“ Er heulte auf und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. „Wir kommen hier nie mehr raus“, brüllte er.
„Wo sind wir hier?“ fragte ich.
„Es scheint Polen zu sein. Ich habe einmal die Krankenschwestern polnisch tuscheln gehört“, antwortete er mit krampfartigem Zucken im Gesicht. „Aber wo, weiß ich nicht. Es gibt hier keine Möglichkeit der Kommunikation mit der Außenwelt. Sie mischen etwas in unser Trinkwasser, nur wenn du drei Tage nichts trinkst, wirst du wieder klar im Kopf, dann wirken allein die Medikamente. ... Die zapfen unsere Gehirne an. ... Keiner der Männer und Frauen ist wirklich krank. Etwa zwanzig Personen sind hier. Sie sagen uns nichts, sondern stellen uns ruhig, damit sie mit uns Versuche machen können. Zwei der Ärzte sprechen Englisch mit leichtem osteuropäischem Akzent und einer ein perfektes Englisch.“
„Was erzählt die penetrante Stimme unseres Zimmergenossen unaufhörlich?“ fragte ich.
„Ich weiß es auch nicht“, entgegnete der Mann, der vom Bettrand auf mich herabblickte. „Es gibt hier zwei Ärzte, Dr. Lomer, den Chefarzt“, er zuckte zusammen, als er den Namen erwähnte, „und seine Assistentin Dr. Ilse Anschütz. Sie tragen deutsche Namen, sind aber keine Deutschen.“ Er rollte seine Augen und sein Geifer tropfte auf meine Brust. Mit hochrotem Gesicht fuhr er krächzend fort: „Der echte Dr. Lomer war ein deutscher Okkultist, ein Ariosoph.“ Mit einem Mal ermattet, fügte er hinzu: „Dr. Anschütz zeichnet ständig alles auf, wie eine Reporterin, als ob sie alles, was gefilmt wird, protokolliert und kommentiert.“
Ich dachte daran, dass dieser Ort, an den es mich verschlagen hat, in einem Bezug zu meinen Erlebnissen in der Ukraine stehen musste. Und dass hier ein Okkultist und Ariosoph das Kommando führte, ließ in mir eine Vorahnung auf die Entwicklung der Ereignisse aufsteigen.
Als ein Hüne von Pfleger ins Zimmer trat, flüchtete der englischsprachige Patient sofort so weit wie möglich in die Ecke, um Abstand zu bekommen. Meine Fesseln wurden gelöst. Der Pfleger forderte mich mit Handzeichen auf, das Bett zu verlassen und ihm zu folgen. Ich erhaschte einen Blick aus dem vergitterten Fenster. Die Umgebung wirkte wie ein Urwald. Wenn es Polen sein sollte, müsste es irgendwo im Osten des Landes sein. Die letzten Urwälder Europas, grübelte ich.
Draußen im Flur waren Patienten, die lethargisch herumstanden. Das war ein Gefängnis, ging es mir durch den Kopf. Wir liefen einen halbdunklen, mit kaltem Neonlicht notdürftig beleuchteten Korridor entlang. Die dunkelgrünen Wände drückten depressiv auf die Stimmung. Eine Frauenstimme gellte aus einem der Zimmer, und mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Es schien, als schrie sich jemand die Stimmbänder aus dem Hals. Auf der Tür war ein nach oben weisender Pfeil gezeichnet. Nein, es war kein Pfeil, es war eine Rune, und zwar die Tyr-Rune, die im älteren Futhark, der germanischen ersten Runenreihe, für die Justiz steht. Auch alle anderen Türen, die auf den Flur hinausgingen, waren mit Runen gekennzeichnet. Der Pfleger forderte mich auf, vor der Tür mit der Rune der Justiz zu warten. Eine Mischung aus Schmerzensschreien und Musik drang nach draußen. Ich konnte den voluminösen Sopran der Maria Callas heraushören. In überdrehter Lautstärke endete eine Arie aus der Zauberflöte und setzte erneut ein.
Der Pfleger öffnete die Tür und warf einen Blick in das Innere des Zimmers. Auch mir war es möglich, hineinzusehen. Arhythmische, extrem helle Lichtblitze durchzuckten den Raum. Eine Frau war an einem Sessel gefesselt und ihr Kopf fixiert. Von der Decke tropfte aus cirka drei Metern Höhe Wasser auf den halb ausrasierten Kopf der Frau. Durch einen Schlauch, der in ihrem Mund steckte, wurde ihr zwangsweise Wasser eingeführt. Ich konnte erkennen, dass sie sich eingenässt hatte. Nach einigen Sekunden schloss der Pfleger die Tür wieder und setzte einen roten Strich in eine am Türrahmen angeheftete Tabelle, den sechsten, wie ich zählte und ich vermutete, dass es sich hierbei um Tage handelte. Der Pfleger forderte mich auf, voranzugehen.
2
An einer Tür am Ende des Korridors sah ich die Rune Hagalaz, die Rune der Zerstörung. Ich überlegte, wo ich sein konnte, denn das, was ich sah, passte nicht recht zusammen. Aus welchem Grund werden in einem Krankenhaus oder einer Gefängnisanstalt in Polen alte nordische Runensymbole genutzt und Menschen psychisch und physisch gefoltert? Es wirkte surreal. Überall waren Kameras angebracht, die den gesamten Krankenhausflügel überwachten.
Der Pfleger öffnete die Tür. Der Raum war sehr schlicht. An einem Schreibtisch saß ein Mann in den Sechzigern mit einem Schnurrbart und blickte mich über den goldenen Rand seiner Brille an. Seine Erscheinung wirkte autoritär. Das Schild aus geriebenem Messing am Tischrand wies ihn als Dr. Georg Lomer aus. Neben ihm stand eine Frau. Auf dem Namensschild an ihrem Arztkittel las ich Dr. Ilse Anschütz. In einer Ecke befand sich ein Terrarium mit kleinen schwarzen Skorpionen. Im Hintergrund spielte leise Schostakowitschs Walzer Nr. 2. Dr. Anschütz zog ein Diktiergerät aus der Tasche und schaltete es ein. Der Pfleger drückte mich auf einen am Boden festgeschraubten Stuhl und fixierte mich mit Fuß- und Handschellen. Den linken Arm ließ er frei. Dann entfernte er sich. An der Wand hing ein gerahmtes Gedicht von Ernst Moritz Arndt aus der Zeit der napoleonischen Kriege und mir fiel das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ein, das ich besucht hatte.
„Hat Er jemals solch eine Harmonie erlebt wie bei Schostakowitsch?“ wandte sich der Arzt in perfektem Bostoner Akzent an mich und schwang seine rechte
Hand im Takt des Walzers. „Wie die Ruhe im Auge des Hurrikans und draußen wütet der Behemoth, der alles verschlingt.“ Eine neue Melodie setzte ein. „Der Schneesturm, ein Walzer von Georgi Swiridow“, merkte Dr. Lomer an. Ich schüttelte den Kopf, da mir diese Komposition nicht bekannt war.
Ich begann, ohne hinzusehen, aus dem Gedicht an der Wand zu zitieren: Das ist des Deutschen Vaterland / wo Eide schwört der Druck der Hand / wo Treue tief vom Auge blitzt / und Liebe fest im Herzen sitzt / das soll es sein! / dass, wackrer Deutscher, nenne dein! / das nenne dein!
„Wie viele Sprachen spricht Er?“ fragte Dr. Lomer.
„Einige fließend und einige halbwegs“, sprach ich in die Kamera hinein, die hinter dem Arzt an der Wand befestigt war. Auf dem Rücken eines der auf dem Schreibtisch gestapelten Bücher las ich den Titel Die Genealogie der Moral und merkte an: „Viele haben sich in Nietzsche verlaufen.“ Der Doktor hob fragend die Augenbraue.
„Nietzsches Übermensch ist per definitionem nicht rassisch bestimmt, sondern transzendental. Transhuman, nicht suprahuman“, erklärte ich. „Nicht nur sein Moralverständnis bestätigt dies, auch aus seiner Schrift Nietzsche contra Wagner lässt sich das herauslesen.“
Dr. Lomer wischte mit einem feinen Tüchlein seine Brillengläser und schwieg. Er blickte, scheinbar geistesabwesend, auf die grüne Schreibtischunterlage, schob bedächtig mit spitzen Fingern sein
Brillengestell zurück auf die Nase und sah mich unvermittelt an. Die wie unter einem Brennglas vervielfachte Strahlkraft seiner blassen, stechenden Augen traf mich jählings und ließ mich zusammenfahren.
„Er ist ein Reisender in den Dimensionen der Psyche, und Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten“, sprach er mit einer kalten, schneidenden Stimme, die mich frösteln ließ. „Er will mir beweisen, dass Er ein Mensch sei und denken könne? Ich höre nur eine Zitate stammelnde Endloskassette. Solche Methoden des Selbstschutzes kommen bei mir nicht an, denn ich bin Ihm intellektuell, mental und fachlich überlegen.“ Er formte den Mund zu etwas, das wie ein süffisantes Lächeln wirken sollte, und fügte hinzu: „Ich werde Ihn foltern. Es wird nicht davonkommen. Aber ich gebe Ihm die Möglichkeit, der Folter zu entgehen, wenn Er den Komponisten des folgenden Musikstücks errät.“
Die Musik setzte ein, doch mir war die Komposition nicht bekannt. „Und?“ wollte der Arzt wissen. „Ich weiß es nicht“, antwortete ich.
„Mir war natürlich klar, dass Er nur eine obszöne, banale Kreatur ist und es nicht wissen kann“, lachte Lomer verächtlich. „So ist das mit verblendeten, selbstverliebten und halbgebildeten kosmopolitischen Subjekten wie Ihm, deren Kulturverständnis selektiv ist und sich in partiellen Details verliert, elendig kulturlos, bar jeder Loyalität und niemandem zugehörig außer dem eigenen Syndikat, dem eigenen Rudel.“ Während er sich ereiferte, spritzte ihm der Speichel in feinen Bläschen von den Lippen. Sein Blick blieb unbeweglich auf mich gerichtet, dann entspannte er sich. „Aram Chatschaturjan, der Maskerade-Walzer“, rief er beinahe fröhlich und schwang seine Rechte erneut im Takt der Melodie. „Einer der schönsten Walzer, der jemals komponiert worden ist.“
Ich ließ mich, angesichts der Aussichtslosigkeit meiner Lage, von den Klängen treiben. Während der Doktor vor mir seinen imaginierten Taktstock schwang, unternahm ich keinen Versuch meine verbliebene innere Widerstandsfähigkeit zu mobilisieren. Ich gab mich in diesem Augenblick auf. „Dieses Angebot mache ich nur einmal“, peitschten mich Dr. Lomers Worte aus meiner Selbstvergessenheit, „Er soll alles erzählen, und da Er nicht weiß, was ich wissen will, wird Er mir jedes Detail berichten.“ Ich schlug die Augen auf und starrte auf den graumelierten Kopf des Arztes, der sich zu mir herunterbeugte. Seine Lippen sonderten Geifer ab, der mein Gesicht mit einem feinen Feuchtigkeitsfilm überzog. „Ansonsten wird Er in die Abgründe der elf Dimensionen reisen, und ich werde Ihm keine Fragen mehr stellen, sondern alles aus Seinem in den Wahnsinn geflüchteten Gehirn extrahieren!“ fügte er drohend hinzu, setzte sich an seinen Schreibtisch und gab Dr. Anschütz ein Zeichen. Diese legte das Diktiergerät auf den Tisch. „Ich bereite derweil den Wassertank vor“, sagte sie und wandte sich zum Gehen. Sie trat an mich heran und mir fiel das T-Shirt auf, das sie unter dem Kittel trug. Ich nahm die Aufschrift Save the Dolphinswahr und begegnete ihrem Blick. Ich konnte die Grausamkeit in ihren kalten Augen wahrnehmen. Sie sah eher wie jemand aus, der Tiere quälte, als jemand der Delphine rettete.
Ich drehte den Kopf wieder zum Arzt und fragte: „Wo soll ich beginnen?“, und ich bemerkte, dass Dr. Lomer kaum oder fast gar nicht blinzelte.
„Das ist die einzige Entscheidung, die Er hier selbst treffen darf“, antwortete Dr. Lomer.
3
Seine Augen waren verbunden. Dennoch konnte er in der völligen Dunkelheit des Gewölbes die Anwesenheit von Menschen spüren. Er atmete tief ein und aus. Die von schweren Aromen getränkte Luft versetzte ihn in leichten Taumel. Das unstete Knistern brennender Kerzen und Fackeln war das einzig wahrnehmbare Geräusch. Seine Nacktheit störte ihn nicht.
Ein wohltemperierter Bariton durchbrach die Stille:
Das Bestreben, die eigene Glückseligkeit In Verzückung zu erreichen, Im Herzen die Treue, als göttlicher Funke versiegelt, Dem Einen zu folgen, Der den nicht-seinigen das Joch der Verdammnis bringt Auf dem rechten Pfad.
Der Mann vernahm hinter sich einen Gongschlag und drehte seine verbundenen Augen intuitiv in südöstliche Richtung.
Ein jener, der mit Prometheus‘ Feuer den Menschen Zum Golde transmutiert, Der den nicht-seinigen den Glorienschein der Verdammnis bringt, Um dem Einen zu folgen und im Herzen durch Treue Seinen göttlichen Funken versiegelt In dem Bestreben, die eigene Glückseligkeit In Verzückung zu erreichen Auf dem linken Pfad.
Ein zweiter Gongschlag ertönte aus nordwestlicher Richtung. Wieder riss der Mann reflexhaft seinen Kopf herum.
Opus Magnum – Magnum Opus
Als die letzten Worte verhallten und die Stille sich erneut durch das rastlose Knistern unzähliger kleiner Feuer manifestierte, befiel den nackten Mann ein plötzlicher Schauder. Ihn fror und er spürte kalten Schweiß den Rücken herunterrinnen. Quälend lange Augenblicke fühlte er sich in völliger Verlorenheit.
„We shall begin.“ Eine Männerstimme mit deutlich britischer Akzentuierung entriss ihn mit einem Male seiner Erstarrung.
4
„Vergiss das niemals, es ist unser Geheimnis. Hast du das verstanden?“ Der Junge war ungefähr zwölf Jahre alt und seine Schwester mochte vielleicht zwei Jahre jünger sein. „Du musst gut auf deine kleine Schwester aufpassen, ein Leben lang, und deine Schwester wird auf dich aufpassen.“ Der kleine Junge blickte hoch und nickte stumm. Der Mann sah in seine hellen blauen Augen und dachte sich: „Sie sind soweit, gute Charaktere.“
Er hatte ihn und Elise schließlich von klein auf gepflegt, erzogen und unterrichtet. „Trage deinen neuen Namen mit Stolz, denn dieser Name wird dich dein Leben lang begleiten … und sprich deine Schwester von nun an nur noch mit Elise an.“ Er verzichtete bewusst auf den Gebrauch des Afrikaans, der Muttersprache der Kinder, sondern sprach Deutsch, denn er wusste, dass die beiden sich diese fremde Sprache bereits vollständig angeeignet hatten. Dann stiegen sie in das Auto und fuhren los.
Vor dem Tor des katholischen Franz-von-Assisi-Fürsorgeheims brachte der Mann den Wagen zum Stehen. Rachmaninows Klaviersonate Nummer 1 brach mit dem Ziehen des Zündschlüssels abrupt ab. Der Mann drehte sich zu den Kindern auf der Rückbank: „Wir sind am Ziel.“ Auf der Fahrt von München zu diesem Heim für schwer erziehbare und verhaltensgestörte Kinder, das dem Dekanat von Fürstenfeldbruck unterstellt war und von ordinierten Nonnen geführt wurde, hatte niemand ein Wort gesprochen, nur der Musik gelauscht und den eigenen Gedanken nachgehangen.
Als sie an diesem leicht bewölkten dreizehnten Oktober des Jahres 1988 den Garten des Fürsorgeheims betraten, wartete in etwa fünfzig Metern Entfernung an der Außentür der Empfangshalle bereits eine Nonne auf sie. Schwester Gabriele war die Oberin des Heims. Beide Kinder blickten den Mann an und liefen hinüber zur Ordensschwester. Der Mann drehte sich um und ging, ohne sich noch einmal umzusehen. Sein schulterlanges, zu einem Zopf zusammengebundenes Haar, das an einigen Stellen bereits ergraut war, wippte zum Abschied auf und nieder.
5
„Das Fürsorgeheim ist in eine ruhige und abgeschiedene Waldkolonie eingebettet“, sprach Schwester Gabriele zu den beiden Neulingen. Die zehn pavillonähnlichen Gebäude, die sich ihren Blicken darboten, waren von großzügig angelegten und umzäunten Gärten umschlossen, die an den Wald grenzten. Etwa 150 Kinder lebten hier, behütet von zwanzig Ordensschwestern.
Elise sah die dürre alte Frau, die sich Schwester Gabriele nannte, an und versuchte, ihr Alter abzuschätzen. Sie bemerkte einen Ring an ihrem Ringfinger. ,Mit wem war die hagere Nonne denn verheiratet?‘ Sie würde sie danach fragen, irgendwann später.
Im Hause angekommen, nahmen die beiden Kinder im Gemeinschaftszimmer Platz, während die Oberschwester den Gang hinunter ging, um ihnen ihre Stuben herzurichten. Schwester Christel, die mit flinken Bewegungen Staub wischte, mochte in ihren Fünfzigern sein. Sie sah sehr streng aus. Nicht, dass das den Kindern etwas ausgemacht hätte. Ein Fürsorgeheim war für die beiden wie ein Ferienlager. In einer Ecke des großen Zimmers stand auf einem Wandvorsprung ein Käfig, in dem ein kleiner gelbgrüner Vogel auf einer Stange hockte. Voller Neugierde trat der Junge an den Vogelkäfig heran, Elise folgte ihm. Der kleine Vogel begrüßte sie mit einem hellen Trillern.
Ein dicklicher Junge und eine fröhliche Ordensschwester traten auf sie zu. Die Schwester neigte sich mit dem Kopf leicht zu den Kindern hin und sagte mit angenehmer Stimme: „Das ist Hansi. Der Name des Wellensittichs ist Hansi. Ihr dürft ihn füttern, aber erst später.“ Lächelnd sah sie die beiden Kinder an. „Und mein Name ist Hildegard, ich bin Novizin, das heißt, ich bin noch nicht ordiniert. Und wie heißt ihr?“ Ihr ausgeprägt bayrischer Akzent schwang noch einen Augenblick in der Luft nach.
„Gu… gu… ten Tag, Schwe...ster Hildegard“, bemühte sich das Mädchen zu antworten, doch wie immer, wenn Elise aufgeregt war, geriet sie ins Stottern, „a...aangenehm Ihre Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Elise.“ Die Novizin reichte dem Mädchen die Hand und nickte aufmunternd.
„Und wer bist du, junger Mann?“ Der Junge lächelte flüchtig und sagte seinen Namen, den Namen, den der Mann mit dem grauen Haarschopf ihm erst vor etwa zwei Stunden genannt hatte. „Mein Name ist Beo“, wiederholte er. „Hallo“, sagte der dickliche Junge, „ich bin Mario“, und grinste hinterhältig. „Hallo“, gaben die beiden Neuankömmlinge zur Antwort.
„Kommt, ich zeige euch das Haus. Die anderen Kinder kommen bald aus der Schule. Die Schule ist nicht weit von hier, sie befindet sich auf dem Gelände.“ Elise schaute den Jungen an, der nun ihr Bruder war. Sie kannte ihn von früher, nicht gut zwar, aber sie kannte ihn zumindest.
Ein Trupp Kinder stürmte laut gestikulierend das Haus. Ein Mädchen von vielleicht neun oder zehn Jahren, kam auf die beiden Geschwister zu und gab ein lautes „Ouh“ von sich. Dann trat es einige Meter zurück. Dort lief es hektisch hin und her und betrachtete die zwei Neuen aus sicherer Entfernung. Seine Fingernägel waren alle angeknabbert. Schwester Hildegard legte dem Mädchen die Hand auf die Schulter und sagte: „Monika, alles ist gut. Die beiden Geschwister sind neu aufgenommen worden. Sie werden hier mit uns leben.“ Die Kinderschar umringte die beiden. „Wie heißt ich?“ fragte in falschem Deutsch einer der Jungen kess und zupfte sich am rechten Ohr. Elise und ihr Bruder sahen einander kurz in die Augen. Sie hatten realisiert, wo sie ab jetzt zu Hause waren.
6
Mittagszeit. Im Gemeinschaftszimmer forderte Schwester Christel die Kinder auf, an ihren Tischen Platz zu nehmen. „Jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend vor dem Essen spricht einer von euch das Tischgebet für uns alle“, sprach Schwester Christel. „Lieber Gott, segne das, was du uns bescheret hast. Und wir alle sagen dann, Amen“, fügte sie, an die Geschwister gewandt, hinzu. „Jeden Donnerstagabend und jeden Sonntag gehen wir zur Messe. Ihr beiden dürft gerne mitkommen, ihr müsst aber nicht. Jedoch möchten wir euch herzlich zu unserer Katechese einladen.“ Die beiden Geschwister nickten der Oberschwester zu.
7
Am nächsten Donnerstag, nach der Messe in der Kapelle, kamen Schwester Hildegard und eine weitere Ordensschwester auf Elise und ihren Bruder zu. „Hallo!“ begrüßte Schwester Hildegard die beiden und fragte fröhlich: „Wie hat euch die Messe gefallen?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: „Das ist Ordensschwester Dorothy. Sie wollte euch Neuankömmlinge kennenlernen. Schwester Dorothy ist Amerikanerin, von unserer Diözese in Austin. Das ist eine Stadt im Bundesstaat Texas. Wir nennen sie alle Schwester Dorothea. Sie wird einige Jahre hier bei uns bleiben. Schwester Dorothea ist unsere Bibelexpertin und spricht viele alte Sprachen, sogar Koptisch und Amharisch.“ Etwas schüchtern nickte der Junge den Nonnen zu: „Angenehm Ihre Bekanntschaft zu machen, liebe Schwester.“
„Lasst uns ein wenig spazieren gehen“, sagte Schwester Dorothea zu Beo und Elise. Die Novizin Hildegard verließ die beiden und ging zurück in die Kapelle.
„Junger Mann, erzähle mir von dir und deiner Schwester.“ Schwester Dorothea schaute den Jungen mit einem erstarrten Lächeln an. „Da gibt es nichts zu erzählen“, gab Beo mit leiser Stimme zur Antwort.
Die drei liefen über eine weite, fein säuberlich gemähte Wiesenfläche in Richtung des Basketballplatzes. Roter Tartar, so nannten die Kinder das Sportfeld, doch weshalb, wusste niemand mehr, keiner konnte sich erinnern, wie der Platz zu seinem Namen kam. Die letzten warmen Strahlen der Abendsonne liebkosten sanft die bloßen Unterarme der Kinder. Es war friedlich hier. Der Junge bemerkte, dass die Ordensschwester auf eine Antwort wartete.
Er räusperte sich und begann zu erzählen: „Die Tortur des Zusammenseins mit einem Vater, der uns psychisch wie physisch folterte, war nicht nur uns, sondern auch dem Jugendamt zu viel. So hat das Jugendamt uns hergebracht.“
Schwester Dorotheas Blick wurde streng und sie verfiel leicht erregt in ihre Muttersprache: „What rubbish is this, the torture of …?“ Dann wechselte sie zurück ins Deutsche: „Kein Kind spricht so. Im Deutschen heißt das: Unser Vater hat uns misshandelt.“ Ihre Stimme wurde wieder weicher. An den Jungen gewandt, fragte sie: „Was willst du werden, wenn du groß bist?“
„Ich würde gerne Koch werden wollen“, sagte der Junge. Elise machte es ihrem Bruder nach und fügte hinzu: „Oh, ich wü...wü...rde gerne Ballerina werden.“ Sie dachte sich, dass die Ordensschwester etwas in dieser Art hören wollte.
„Macht euch keine Sorgen, ihr beiden“, sprach die Schwester, „es wird euch hier gut gehen. Und eines Tages werdet ihr adoptiert werden und ein neues Zuhause bekommen, oder aber ihr bleibt hier, bis ihr achtzehn seid und beginnt dann ein Leben da draußen. Aber bis dahin ist das hier euer Zuhause und wir sind eure Familie. Wie gut kennt ihr die Bibel? Kennt ihr sie überhaupt?“ Die Kinder schüttelten den Kopf.
„Welche Religion kennt ihr denn?“ Der Junge antwortete: „Wir kennen keine Religion, wir sind laizistisch und säkular aufgewachsen.“
„Schon wieder solche Wörter, laizistisch und säkular! Kinder sprechen doch nicht so“, fuhr ihm Schwester Dorothea grantig ins Wort. „Hast du Deutsch aus dem Wörterbuch gelernt? Ist Deutsch nicht deine Muttersprache?“ fragte sie bohrend. Als sie keine Antwort bekam, hob sie erneut an: „Es heißt: Wir sind nicht religiös erzogen worden!“ „Okay“, sagte der Junge. „Boy, do you speak English?“ Beo blieb völlig ruhig und schaute die Ordensschwester an, ohne etwas zu sagen. Elise blickte der Nonne tief in die Augen. „Never look atme that way again, child!“ wies Schwester Dorothea das Mädchen scharf zurecht. Dann fragte sie etwas in Afrikaans. Langsam wandte Elise ihren Blick zur Seite. Sie schaute an der Ordensfrau vorbei und fixierte einen Punkt am Abendhimmel.
„Schwester, Sie sind komisch. Sie reden mit uns in Sprachen, die wir nicht verstehen. Mir ist langweilig. Wir gehen spielen.“ Die Stimme des Jungen klang unwirsch. „Komm Elise, wir gehen.“
„Woher weißt du denn, dass es verschiedene Sprachen waren?“ fragte Schwester Dorothea in durchdringendem Ton. Ohne sich umzublicken, setzten die Kinder ihren Weg zum Spielplatz fort. Sie waren kaum einige Meter gegangen, als die Ordensfrau in herrischem Ton befahl: „Junge, bleib stehen! Elise, du auch!“ „Bei Gott, bleibt stehen, sage ich euch, sonst werde ich euch bestrafen!!!“ schrie Schwester Dorothea noch einmal mit lauter Stimme. Indes, die Kinder hörten nicht.
Dann sprach die Schwester mit ruhiger, aber deutlich akzentuierter Betonung ein einziges Wort: „Minutemen.“ Die Kinder blieben abrupt stehen und drehten sich blitzschnell zur Ordensschwester um. Sie sahen sie ruhig an und warteten, dass sie erneut das Wort ergriff. Nach einigen Sekunden der Stille sprach die Nonne: „Ihr wisst, dass wir für euch da sind – und das für immer.“ Beide Kinder nickten kurz, aber sehr unauffällig. „Das hier ist und war unsere einzige unverschlüsselte Unterhaltung“, fügte sie bestimmt hinzu. Die Kinder sahen sie ruhig an und warteten, dass die Ordensfrau ihre Ansprache fortsetzte. Die Nonne schwieg einige weitere Augenblicke und fuhr fort: „Von morgen an meldet ihr euch freiwillig zur Bibelstunde bei Schwester Hildegard. Und das täglich. Bereits Sir Francis Bacon sagte, dass Wissen Macht ist. Merkt euch das sehr gut. Sehr, sehr gut. Und zwar euer Leben lang.“ Beide Kinder bestätigten mit einem kurzen Nicken und warteten. Mit einem knappen „Go!“ beendete Schwester Dorothea die Unterweisung. Die Kinder nickten der Ordensfrau nochmals zu. Dann reichte sie den beiden altes Schwarzbrot und sprach: „Geht und füttert damit die Vögel.“ Die Geschwister entfernten sich eilig und eilten zum Rande der Rasenfläche. Niemand hatte ihre Unterhaltung bemerkt.
8
Als Elise das Brot zerteilte, um mit den Krumen die Vögel zu füttern, entdeckte sie unter der Kruste einen zusammengerollten Zettel. Sie zog ihn heraus, faltete ihn glatt und überflog die eng geschriebenen Zeilen. Dann nahm ihn der Junge an sich und las. Seine Lippen bewegten sich dabei lautlos.
Mission objectives:
Die Zusammenarbeit von euch beiden ist erwünscht.
Wer von euch die Schlüssel des Pfarrers für die Kapelle zuerst bekommt, hat gewonnen.
Das ist unsere erste und einzige unverschlüsselte Unterredung.
Korrespondenz ausschließlich in Form von Akrostichon oder Telestichon in deutscher Sprache, so wie es der alte Mann euch beigebracht hat.
Fortnight, nach der Messe von heute an.
Wenn das Ziel nicht erreicht wird, kann euer Auftrag nicht erfüllt werden, ihr müsst die Schlüssel unbedingt bekommen, koste es, was es wolle.
Das kleine Mädchen nahm das Papier wieder an sich und aß es auf.
9
Vinka war ein Mädchen ohne Freunde. Aufgrund ihres Aussehens und ihrer roten Augen hielten sich die anderen Kinder von ihr fern. Die meisten fürchteten sich vor Vinkas Blicken. Sie war schulisch unterdurchschnittlich begabt und die anderen Kinder lachten sie deswegen aus. Vinka zog sich in solchen Momenten immer zurück auf den Roten Tartar, den Basketballplatz, dessen Boden von einem roten Kunstbelag überzogen war, der sich bis zur Rasenfläche streckte. Zu ihrem engeren Zufluchtsort hatte sie die kleine Tribüne erwählt, die sie immer dann aufsuchte, wenn sie ihre Tränen nicht mehr zurückzuhalten vermochte. Wie auch heute. Die Einzige, die sie als eine Freundin bezeichnen konnte, war ein französisches Mädchen, das viel zu dick für sein Alter war, obwohl es immer versuchte, so wenig wie möglich zu essen, und das von den anderen Kindern als Babyelefant verspottet wurde. Ihre Leidensgenossin hieß Eugenie. Ihr linkes Auge war blau und das rechte smaragdgrün.
Beide befanden sich bereits in der Pubertät, und einige Monate zuvor waren sie über die Veränderungen, die in ihren Körpern vor sich gingen, von einer der Nonnen rudimentär aufgeklärt worden. Das Gesicht der dicklichen Französin war von Pickeln übersät, weswegen sie sich nicht mehr in die Schule traute. Damit Eugenie lernte, ihren Körper, wie Schwester Christel es ausdrückte, so zu akzeptieren, wie Gott ihn geschaffen habe und ihr zu helfen, neues Selbstbewusstsein aufzubauen, wurde von der Schwesternschaft nach einigem Hin und Her beschlossen, sie zur Abhärtung in den Supermarkt zu schicken. So sollte sie den Willen Gottes akzeptieren und an dieser Erkenntnis wachsen. Eugenie war das völlig egal, sie war schon einsam genug und litt darunter, dass die Kinder sie immer intensiver wegen ihres Aussehens hänselten.
Am Einkaufstag folgte sie lustlos Schwester Brunhild in den nahegelegenen Supermarkt. Während die Nonne einige Dinge für das Büro des Heimes zusammensuchte, erspähte Eugenie die Auslage mit den Presseerzeugnissen. Mehrere Reihen bunter Umschläge weckten ihre Neugier und sie trat an das Regal mit den Musikzeitschriften. Hier traf sie auf eine Welt, die ihr völlig unbekannt war, denn diese Art von Musik galt als unrein und durfte im Fürsorgeheim weder gespielt, noch gehört werden.
Auf einem Cover sah sie ihn plötzlich. Sie beugte sich vor und las: „Human Apocalypse“. Die Band hieß Human Apocalypse und am Mikrofon stand ein Mann in einer braunen Wildlederhose, die an beiden Seiten von oben bis unten komplett geschnürt war. Sein muskulöser Oberkörper war nackt und seine langen Haare wirbelten um das Mikrofon. Ihm zur Seite standen zwei wunderschöne Frauen in Bikinis, die ihn mit aufreizenden Blicken taxierten. Eugenie überlegte, ob sie sich jemals erlauben könnte, in einem Bikini herumzulaufen, ohne sich ihres Aussehens schämen zu müssen. Auf dem Cover stand Sledge.
„Sledge“, sprach sie laut und versank für einen Augenblick fasziniert in das Bild des Mannes am Mikrofon. Ohne nachzudenken, griff sie nach der Zeitschrift und schob sie blitzschnell unter ihren Pullover. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals und ein Schwindel erfasste sie, als ihr bewusst wurde, dass sie gerade etwas gestohlen hatte. „Eugenie, was machst du da?“ Schwester Brunhilds Stimme hinter ihr ließ sie zusammenfahren. Sie drehte sich voller Panik um und sah sprachlos in die strengen Augen der Nonne. „Das ist nichts für dich, geh da weg und komm her!“ Eugenie brachte kein Wort heraus und nickte nur. ,Anscheinend hat Schwester Brunhild nicht bemerkt, dass ich die Zeitschrift gestohlen habe‘, atmete sie erleichtert auf. Als die Ordensfrau ihr den Rücken zudrehte, ließ Eugenie das Magazin in ihren Hosenbund rutschen und trat zu ihr.
,Was habe ich getan?!‘ Sie konnte es nicht fassen. Sie hatte gestohlen! ,Human Apocalypse‘, ging es ihr durch den Kopf. Sie konnte an nichts anderes denken. „Sledge“, murmelte sie vor sich hin und fragte sich, was für ein Mensch das wohl war. Auf dem Rückweg malte sie sich aus, wie sie Sledge und die Band Human Apocalypse kennenlernte.
Es war bereits später Nachmittag und die Zeit für das Abendessen rückte heran. Aber ihr blieb noch eine halbe Stunde. Sie war zum Roten Tartar gerannt, hatte sich auf die Tribüne gesetzt und blätterte nun aufgeregt in der Zeitschrift. Endlich konnte sie sich den Artikel über Sledge und Human Apocalypse vornehmen.
Sie blickte kurz auf und sah zu Vivi, einem Mulatten aus Litauen, dessen Namen sich niemand merken konnte. Er hieß eigentlich Vytautas Varagas. Er spielte wie immer allein Basketball. Sie wusste, dass Vivi, der über einen Meter neunzig groß war, auch ohne Freunde war. Er spielte immer allein Basketball. Vytautas hätte Freunde haben können, weil er der Stärkste unter den Heimkindern war. Aber er war immer allein und hielt sich fern von den anderen. Ein wahrer Einzelgänger. ,Human Apocalypse‘, zuckte es Eugenie durch den Kopf. Neugierig betrachtete sie die Bilder der Band. ,Wie schön doch dieser Sledge ist‘, dachte sie, ,so schöne reine Haut, nicht so wie meine.‘ Eugenie nahm ein Gefühl wahr, das sie nicht kannte und nicht beschreiben konnte, und in ihrer Magengegend verspürte sie vor Aufregung ein seltsames Flimmern.
Sie hatte nicht bemerkt, dass der Hausmeister an die Tribüne getreten war. Der Pedell trug wie üblich einen grauen Overall und karrte einen Mob und einen roten Eimer vor sich her. Als Eugenie aufblickte, sah sie in das gütige Lächeln des alten Mannes. „Na, wie geht es dir?“ fragte er mit sanfter Stimme. „Ich wollte dich nicht stören, ich habe nur vor, die Tribüne zu reinigen.“ Dankbar registrierte sie, dass der Hausmeister die Zeitschrift dezent übersah, obwohl ihm natürlich bekannt war, dass solch Besitz auf dem Gelände des Fürsorgeheims verboten war.
Eugenie und Vinka mochten den alten Herrn, der immer ein freundliches Wort für sie übrig hatte. Einst wollte er Mönch werden, doch letzten Endes hat er sich gegen die Ordination entschieden, da er fühlte, den Herausforderungen des Klosterlebens nicht gewachsen zu sein. Stattdessen war er Hausmeister im Fürsorgeheim geworden. Die beiden Mädchen unterhielten sich öfter auf dem Roten Tartar mit dem alten Mann, der ihnen so manche Lebensweisheit ethischer Natur mit auf den Weg gab. Er sah auf die
Zeitschrift, die Eugenie in den Händen hielt, und sagte:
„Weißt du, Kleines, auch wenn du es mir nicht glauben magst, diese Hochglanzbilder sind nicht das wahre Leben. Das Leben besteht nicht nur aus Festen. Und auch diese Sternchen in den Zeitschriften weinen manchmal heimlich. Auch sie haben ihre Ängste und Probleme.“ Eugenie lächelte, weil sie erkannte, dass der betagte Schuldiener sie aufzubauen versuchte und erwiderte: „Diese Menschen sind so schön und werden von allen geliebt.“ Auf dem faltigen, stoppelbärtigen Gesicht des Hausmeisters erschien erneut sein stilles, liebevolles Lächeln. „Auch du wirst eines Tages jemanden kennenlernen, der dich lieben wird und den du lieben wirst“, sprach er mit sanfter Stimme.
Eugenie jedoch hasste ihre Mitmenschen dafür, dass sie sie ausgestoßen hatten, und dafür, dass sie in einem Fürsorgeheim leben musste, verlassen von den Eltern und ausgegrenzt von den anderen Kindern. Um aus dieser bedrückenden Realität auszubrechen, zog sie sich, so viel sie konnte, in die Welt der Bücher zurück und formte anhand des Schicksals ihrer literarischen Helden ihr Bild von der Welt.
Victor Hugos Glöckner von Notre Dame, ein Buch, das sie sich in der Bibliothek des Heimes ausgeliehen und in einem Zug verschlungen hatte, war eines der Werke, von dem sie besonders beeindruckt war. Quasimodo, diese armselige Gestalt, mit der sie voller Mitgefühl war, litt nur deshalb so sehr, weil sie beide das gleiche Schicksal zu erleiden hatten und weil er von Esmeralda genauso schlecht behandelt wurde, wie sie von den Kindern im Heim. Sie verabscheute Esmeralda und alle, die wie sie von schönem Äußeren waren.
Später entdeckte sie die Bücher von Emile Zola. Sie liebte diesen Autor, weil sie der Überzeugung war, dass seine Schilderungen das wahre Leben widerspiegelten, etwas, wovor diese naiven Nonnen sie zu schützen versuchten. Nach der Lektüre des Totschlägers und Nanas vermochte sie nächtelang keinen Schlaf finden, denn sie musste unablässig daran denken, wie das Leben der Nana in Armut und Krankheit verronnen war. Und voller Entsetzen vergegenwärtigte sie sich immer wieder, wie ihre Heldin, unter einer Treppe im Sterben liegend, auch noch ausgeraubt wurde. Das also war das Leben. Eugenie wollte nicht lieben, niemals in ihrem Leben würde sie einen Menschen lieben wollen. Dieses Versprechen hatte sie sich gegeben.
Eugenie sah auf und ihr Blick wanderte über den Tribünenrand und sie erkannte in dem Schemen, der auf den Basketballplatz zuhielt, den kleinwüchsigen Neuling und seine dickliche Schwester, die kaum einen Satz zustande brachte, ohne zwanzigmal zu stottern, und die ihn um einen Kopf überragte, obwohl sie einige Jahre jünger war. Beo und Elise gesellten sich zu Eugenie und Vinka. Da war sie wieder zusammen, die lose Vierergruppe der Außenseiter, die wegen ihres jeweiligen Handicaps von der Mehrheit geschnitten wurden. ,Irgendwie sind wir wohl Freunde‘, dachte Eugenie.
Das klackende Geräusch des Basketballes erstarb und Vytautas kam auf die anderen Kinder zu. „Grüß Gott, alter Mann“, wandte er sich an den Hausmeister. Der nickte freundlich und sprach: „Bald ist Essenszeit, nicht, dass du über deinem Basketball das Abendbrot versäumst.“
Vivi schaute in die Runde und bemerkte beiläufig: „Stimmt, ich habe Hunger.“ Dann entfernte er sich, den Basketball dribbelnd vor sich führend, in Richtung der Bungalows. „Auch für euch ist nun Zeit fürs Abendbrot“, rief der Hausmeister den anderen vier Kindern zu.
Sie verließen den Roten Tartar, passierten das Verwaltungsgebäude und die Kapelle, als ein Trupp Kinder rechts vom Schulhof auf die Vierergruppe zukam. Ihr Anführer war Kilian. Er war bekannt dafür, dass er Tiere quälte. „Was für ein Glück, alle Mutanten beisammen“, johlte er und rammte ohne Vorwarnung Beo seine Faust in den Magen. Sein Kumpel Mario griff nach einem Stein so groß wie eine Orange und warf ihn auf Eugenie, die sich reflexhaft zur Seite drehte und an der linken Schulter getroffen wurde. Beo japste nach Luft, während Eugenie vor Schmerz aufheulte. Mario packte Elise an den Haaren und klatschte ihr eine Ohrfeige. „Du fette, hässliche Sau“, grölte er. In dem Moment stürmte Vinka nach vorn und fauchte wie eine Katze. „Ich sauge euch euer Blut aus“, schrie sie mit weit aufgerissenen, roten Augen. Kilian, Mario und die anderen Kinder blieben für einen Moment erschrocken stehen und starrten Vinka an. „Oh Mann, du bist so was von geliefert“, brüllte, nachdem er seine Fassung wiedererlangte, Kilian auf, versetzte dem am Boden liegenden Beo einen Fußtritt und preschte auf Vinka los. Gerade als er ausholte, um ihr in den Unterleib zu treten, fuhr Vivi wie ein plötzlich hereinbrechender Blitz dazwischen, packte ihn am Kragen und schleuderte ihn in einem Schwung ins Gebüsch. Im selben Augenblick trat er dem verdutzten Mario brutal in die Seite, der ächzend zusammenklappte. Nachdem er mit den beiden fertig war, klatschte er den anderen, die noch nicht in Panik davongestoben waren, Ohrfeigen und jagte sie mit Tritten von dannen. „Wir kriegen euch, wenn ihr alleine seid!“ kreischte mit wutverzerrter Stimme Mario aus sicherer Entfernung und lief weg. Vivi sammelte die vier Kinder auf und sagte: „Kommt mit zum Essen, aber erzählt es niemandem.“ Die gesamte Szene wurde von Schwester Dorothea aus einem Fenster im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes beobachtet.
Die nächsten Tage lief die Vierergruppe bei jeder Gelegenheit hinter Vivi her. Die Kinder folgten ihm in fünf bis sechs Metern Abstand, und wenn er allein Basketball spielte, saßen sie alle auf der Tribüne und sahen ihm zu. Er scheuchte sie mehrmals fort, aber sie entfernten sich dann nur einige Meter und hielten sich weiter in seiner Nähe auf.
Einige Wochen später kam Schwester Dorothea auf den Roten Tartar. Sie sah sich mehrfach um, und als sie sicher war, dass sie nicht beobachtet wurde, betrat sie die Tribüne, drehte sich zum Spielfeld und rief auch Vytautas zu sich. Erwartungsvoll hefteten sich fünf Augenpaare auf sie. „Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr so stark werden könnt wie Vivi, und noch viel stärker“, sprach sie in die kleine Runde, „einen Weg, auf dem ihr alles im Leben erreichen könnt, eine Chance euch alle eure Wünsche zu erfüllen.“