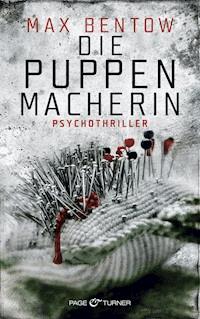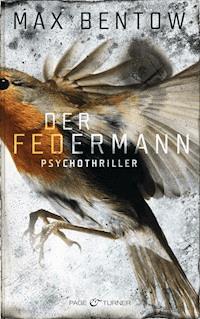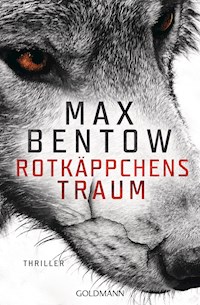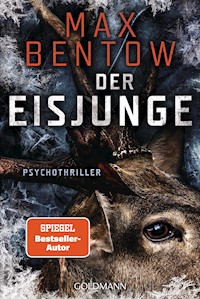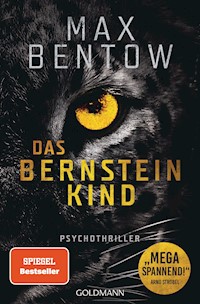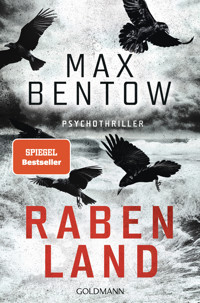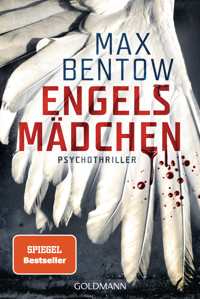9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Nils Trojan
- Sprache: Deutsch
Lilienblüten auf dem Boden, Kerzen brennen und erhellen die Umrisse einer toten Frau, geschminkt und frisiert. Das Einzige, was die perfekte Inszenierung stört, sind die vielen Schnecken, die leise über das morbide Stillleben gleiten. Dies ist das Bild, das sich Kommissar Nils Trojan und seinem Team bietet, als sie in einer Berliner Wohnung eintreffen. Wenig später wird ein zweites Opfer im Wald aufgefunden, und wieder ist der Tatort inszeniert wie ein Andachtsraum. Trojan stürzt sich in die Ermittlungen und merkt zu spät, dass sein Gegner ein Spiel mit ihm spielt – ein Spiel, das so sanft wie eine Klaviersonate beginnt und mit dem sicheren Tod endet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Lilienblüten auf dem Boden, Kerzen brennen und erhellen die Umrisse einer toten Frau, geschminkt und frisiert. Das Einzige, was die perfekte Inszenierung stört, sind die vielen Schnecken, die leise über das morbide Stillleben gleiten. Dies ist das Bild, das sich Kommissar Nils Trojan und seinem Team bietet, als sie in einer Berliner Wohnung eintreffen. Wenig später wird ein zweites Opfer im Wald aufgefunden, und wieder ist der Tatort inszeniert wie ein Andachtsraum. Trojan stürzt sich in die Ermittlungen und merkt zu spät, dass sein Gegner ein Spiel mit ihm spielt – ein Spiel, das so sanft wie eine Klaviersonate beginnt und mit dem sicheren Tod endet …
Weitere Informationen zu Max Bentow sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
MAX BENTOW
DERMONDSCHEIN-MANN
PSYCHOTHRILLER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe August 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Covergestaltung: Uno Werbeagentur, München
Covermotiv: © plainpicture/Philippe Lesprit und FinePic®, München
CN · Herstellung: ikSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-25837-5V003
www.goldmann-verlag.de
Für Christina
ERSTER TEIL
Der Junge saß auf der Rückbank des Wagens. Das Fenster war einen Spalt geöffnet, und die Nachtluft kühlte seine Stirn. Im Nacken seiner Mutter glänzte Schweiß. Ihr Haar war zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden.
Sie fuhr schnell, hoch konzentriert, behielt die Landstraße im Blick. Lichtreflexe zuckten über ihre Wange. Sie hatte gesagt, sie müssten sich beeilen. In dem kleinen Rucksack neben ihm war bloß ein Schlafanzug, einmal Wäsche zum Wechseln und seine Zahnbürste.
»Wohin fahren wir?«, fragte er zum wiederholten Mal, doch sie gab keine Antwort.
Stattdessen drückte sie auf den Zigarettenanzünder. Mit einem Ploppen sprang er heraus, und sie steckte sich die nächste Kippe an. Der Junge mochte es, wenn die Spitze kurz aufflammte und Tabakfunken durchs offene Fenster hinaussegelten. Er verfolgte die Lichtspur, wie sie im Wind verglühte.
»Machen wir Urlaub?«
»Lass dich überraschen.« Auch ihre Stimme mochte er. Sie war rau und ziemlich dunkel.
Er hatte Vertrauen. Sie war eine gute Autofahrerin. Sie würden sicher an ihr Ziel kommen, wo immer das war.
Irgendwann döste er ein. Das Brummen des Motors mischte sich in seinen Traum. Einmal tauchte ein riesiger Schatten vor ihm auf. Da waren Hände, die ihn packten, Fäuste, die ihn schlugen. Der Junge wimmerte im Schlaf.
Der Wagen hielt, und prompt war er wach.
»Komm«, sagte seine Mutter.
Sie öffnete ihm die Tür, und er stieg aus. Dichter Wald umgab sie, Finsternis. Am Himmel stand ein blasser Mond.
»Wo sind wir?«
»Spielt keine Rolle.«
Sie nahm ihn an der Hand und ging mit ihm einen schmalen Pfad entlang. Er stolperte über Wurzeln. Dornige Zweige zerkratzten seine nackten Waden in den Shorts. Sie ließ seine Hand nicht los, und das beruhigte ihn. Ihre Schritte waren energisch. Sie schien den Weg zu kennen.
Schließlich erkannte er die Umrisse einer Hütte. Sie traten näher, und seine Mutter machte sich am Türschloss zu schaffen. Im Mondschein beobachtete er ihre gebückte Gestalt. Sie fluchte leise, während sie mit einem Werkzeug aus dem Wagen auf das Schloss einhämmerte.
»Dürfen wir das überhaupt?«
»Sei still.«
Endlich sprang die Tür auf. Sie zog ihn ins Innere und schaltete das Licht ein. Eine funzlige Glühbirne, die von der Decke hing. Die Hütte war winzig. Auf den wenigen Möbeln lag Staub. Es roch muffig.
Sie beugte sich zu ihm herab. »Du versprichst mir jetzt etwas. Von nun an stellst du keine Fragen mehr, okay?«
Warum nicht?, wollte er erwidern, aber da das eine Frage war, nickte er stumm.
Sie öffnete eine weitere Tür. Dahinter stand ein Bett.
»Wasch dich, und dann wird geschlafen.«
Wo ist das Bad?, wollte er fragen, doch das durfte er nicht.
Im größeren der beiden Räume befand sich ein Spültisch. Das Wasser aus dem Hahn war kalt und roch metallisch. Der Junge wusch sich notdürftig das Gesicht. Es gab kein Handtuch, also rieb er sich mit dem Ärmel trocken.
Als er neben seiner Mutter im Bett lag, war ihm wohler. Das Bettzeug war klamm, also behielten sie all ihre Sachen an.
Sie rauchte noch eine Zigarette, dann schaltete sie die Nachttischlampe aus. Durchs Fenster schien der Mond herein und erhellte matt das Zimmer.
»Könntest du …?«
»Keine Fragen«, unterbrach sie ihn.
»Ist auch mehr ein Wunsch. Würdest du …?«
Sie seufzte. Er erkannte die Furche auf ihrer Stirn, die sich immer dann bildete, wenn sie ungehalten war. Schließlich aber wandte sie den Kopf zu ihm, und auf ihren Lippen war ein Lächeln, was ihn erleichterte.
»Also gut.«
»Kannst du mir eine Geschichte erzählen?«
»Bist du nicht zu alt dafür?«
»Bitte.«
Ihr Lächeln wurde breiter. »Welche denn?«
»Die du mir immer vorm Einschlafen erzählst.«
»Aber die ist unheimlich.«
»Ich weiß.«
Schon beim Gedanken an die Geschichte fröstelte ihn. Sie war zum Fürchten, abgründig, voller Horror. Sie brachte ihn zum Zittern und trieb ihm den Angstschweiß auf die Stirn.
Doch sie nahm ein gutes Ende. Der Junge liebte Geschichten mit glücklichem Ausgang, egal wie gruselig sie waren.
»Macht nichts, wenn sie unheimlich ist«, flüsterte er.
»Na schön. Du hast es so gewollt.«
Sie zupfte an der Bettdecke. Der Junge wusste, was nun kam. Ein angenehmer Schauer lief über seinen Rücken. Sie hob die Decke an und zog sie über ihre Köpfe. Nun waren sie darunter verborgen wie in einem Zelt.
Er spürte ihre Wärme, ihren Atem. Er war ihr so nah.
Es war dunkel, und die Luft wurde knapp.
Sie senkte ihre Stimme zu einem Wispern.
Und sie begann.
Sie erzählte ihm von den Tieren, die auf dem Boden krochen. Diesen Tieren, die Schleim absonderten und lange Fühler hatten. Sie waren träge und zäh.
Sie schilderte ihm den Wald, in dem sie hausten. Normalerweise waren diese Tiere recht klein. Aber in dem speziellen Wald schwollen ihre weichen Körper zu erstaunlicher Größe an. Es waren riesige Viecher, die auf dem Boden herumwuselten und sich an den Baumstämmen entlangwanden.
Seine Mutter erzählte, und er lauschte ihr gebannt.
Es war eine böse Geschichte, aber sie endete gut.
Und so schlief der Junge selig ein.
Ein Poltern riss ihn aus dem Schlaf. Die schützende Decke war fort. Er fror, wusste zeitweilig nicht, wo oben und unten war. Schließlich bemerkte er, dass er auf dem Boden lag. Er war wohl aus dem Bett gefallen.
Seine Schulter schmerzte, in seinem Kopf war ein Dröhnen.
Er hörte Schreie.
Es waren die Schreie seiner Mutter.
Ein Stiefel tauchte neben seinem Kopf auf, dann noch einer. Zwei grobe Männerstiefel.
Ängstlich richtete sich der Junge auf.
Was er sah, ließ ihn erstarren.
Blut auf dem Bett. Die geweiteten Augen seiner Mutter. Ein Mann war über sie gebeugt.
Hilflos streckte der Junge die Hände nach ihr aus. Sie rief ihm etwas zu. Er verstand sie zunächst nicht.
Er war wie gelähmt.
Schließlich aber begriff er, dass es um sein Leben ging.
»Lauf!«, schrie die Mutter. »Lauf weg!«
Schon war er an der Tür. Er riss sie auf. Er stürmte ins Freie hinaus.
Im Wald war es finster.
Der Junge rannte.
EINS
DIENSTAG, 11. JUNI, WEIT NACH MITTERNACHT
Ihre Lippen näherten sich dem Mikrofon. Sie sprach leise, leicht verhaucht. Sie wusste, ihre Stimme hatte so ein angenehmes Raspeln, das an den Genuss von filterlosen Zigaretten und reichlich gutem Single Malt Whisky erinnerte. Dabei trank sie wenig Alkohol und war überzeugte Nichtraucherin. Ihre Hörer liebten diese Stimme, und Nora Sand gab ihnen, was sie von ihr erwarteten, wochentags von null bis zwei Uhr früh. Das war ihr Job, und den machte sie gut.
Ihre Gesprächssendung empfing man im Internet, sie hatte den unverblümten Titel Schlaflos mit Nora. Auch zu dieser nächtlichen Stunde war sie mit ihrem Aufnahmeleiter im Studio, spielte Smooth Jazz ein und gab ihren Anrufern gut gemeinte Ratschläge für alle Lebenslagen. Ihre Hauptaufgabe aber bestand darin, einfach zuzuhören, denn das schienen die meisten Menschen verlernt zu haben.
Es war erstaunlich, wie viele einsame Seelen es in dieser Stadt gab. Sie lagen nachts wach, lauschten ihrer Sendung, griffen irgendwann zum Telefon, wählten die Hotline und erzählten ihr von ihren intimsten Problemen. Nora Sand wusste, dass sie der Ersatz für wahre menschliche Beziehungen war. Die Mehrzahl der Hörer sah in ihr eine Art beste Freundin, die es in Wahrheit nicht gab. Für Wildfremde schlüpfte sie in diese Rolle und war selbst überrascht von den guten Einschaltquoten.
Nora bildete sich wenig darauf ein, sie war bloß eine junge Frau mit einem abgebrochenen Psychologiestudium, die mehr oder minder durch Zufall über eine frühere Mitbewohnerin zum Internetradio gefunden hatte.
»Hi, ihr da draußen«, raunte sie ins Mikro, »es ist ein Uhr zweiunddreißig, und ein Blick aus dem Studiofenster verrät mir, dass es noch immer in Strömen regnet. Werdet ihr auch so melancholisch wie ich in einer Juninacht wie dieser? Für die Jahreszeit zu kühl, der Regen trommelt aufs Fensterbrett und verwischt das Licht der Straßenlaternen. Habt ihr es wenigstens schön warm, wo immer ihr gerade seid? Eingekuschelt unter eurer Lieblingsdecke auf dem Sofa? Seid ihr schon im Bett, habt die Nachttischlampe ausgeknipst, aber lauscht noch diesem Programm? Oder seid ihr draußen unterwegs und empfangt mich auf dem Smartphone, die Ohrhörer eingestöpselt? Vielleicht wartet ihr auf die letzte U-Bahn, seid im Nachtbus oder im Auto. Wo auch immer, ruft mich an, wenn euch irgendetwas auf dem Herzen liegt. Was raubt euch zurzeit den Schlaf? Habt ihr Stress in der Arbeit? Plagt euch Liebeskummer? Gibt es Ärger in eurer Beziehung, oder sind es Probleme mit Drogen? Sorgt ihr euch um eure Gesundheit? Denkt ihr an jemanden, der erst kürzlich verstorben ist? Braucht ihr Trost? Ganz egal, worum es geht, das ist die Sendung für alle, die in dieser Nacht bedrückt sind. Aber auch für diejenigen unter euch, denen es gut geht, die mir einfach mal sagen wollen, was sie heute gefreut hat. Ihr erreicht mich unter 015339966, vom Festnetz oder übers Handy. Ich bin Nora Sand, und hier kommt Till Brönner mit ›Nightfall‹. Ich liebe diesen Track.«
Freddy, ihr Aufnahmeleiter, nickte ihr hinter der Trennscheibe im Studio zu, bediente die Regler und spielte das Stück ein. Nora vernahm über Kopfhörer die sanften Klänge der Jazztrompete, ein Hauch von Schwermut, dunkel, verträumt, begleitet vom Kontrabass.
Sie wiegte sich leicht im Takt der Musik und schloss die Augen. Sie ahnte, dass Freddy sie dabei beobachtete. Er hatte sie in letzter Zeit insgesamt dreimal gefragt, ob sie nach der Sendung mit ihm was trinken gehen wollte, und da sie jedes Mal Müdigkeit vorgeschützt hatte, war er nun offenbar beleidigt.
Er verhielt sich ihr gegenüber zwar professionell freundlich, doch gelegentlich fing sie hinter der Glasscheibe einen verstohlenen Blick von ihm auf, der sie frösteln ließ. Sein Lächeln war in diesen Momenten schmal und irgendwie auch unheimlich, als habe sie ihn in tiefster Seele verletzt.
Sie öffnete die Augen. Vor ihr am Pult leuchtete ein grünes Lämpchen auf. Das hieß, sie hatte einen Anrufer in der Leitung. Nora wartete ab, bis die Jazznummer beendet war, und schon war das Mikro wieder offen.
»Hi, ihr hört Schlaflos mit Nora, und mich ruft gerade jemand an. Wie ist dein Name?«
»Tom.«
»Hi, Tom.«
»Hallo, Nora.«
»Was hast du auf dem Herzen?«
»Zuerst mal möchte ich sagen, dass ich deine Sendung echt klasse finde.«
Sie lächelte. »Das freut mich aufrichtig. Ich danke dir.«
»Ja, und dann rufe ich an, weil … Na ja, ich bin seit Wochen ziemlich durcheinander.«
»Was bedrückt dich denn?«
»Es geht um meine Freundin. Genauer um meine Ex. Sie hat plötzlich Schluss gemacht.«
»Was war der Grund dafür?«
Der Hörer, junge Stimme, vielleicht Mitte, Ende zwanzig, kam unumwunden zur Sache. »Es ging um Sex. Das Problem war Sex. Anfangs hat sie gemacht, was mir gefällt, dann sagte sie mir, dass sie es abstoßend findet.«
Nora war um einen sachlichen Tonfall bemüht. Sie war nicht prüde, aber unter den männlichen Anrufern, die mit ihr sexuelle Themen besprechen wollten, gab es so einige, denen sie insgeheim einen gewissen verbalen Exhibitionismus unterstellte. Dieser Tom gehörte eindeutig dazu. Er hatte schon öfter bei ihr angerufen. Offenbar lauerte er nur darauf, dass sie nachhakte: »Kannst du das ein bisschen näher erläutern?«
Sie bemerkte Freddys Grinsen hinter der Scheibe.
»Ich hab sie gern gefesselt. Auch aufs Knebeln stehe ich irgendwie. Dominanz und Demut, das volle Programm.«
»Deutlich voneinander abgesetzte Rollen also. Hast du das mit deiner Freundin vorher auch besprochen?«
»Ja. Sie hat gesagt, wir probieren es mal aus.«
»Aber dann hat es ihr nicht gefallen, oder?«
»Schätze schon. Ich gebe dir mal ein Beispiel …«
Tom setzte zu einer ausführlichen Schilderung seiner Fesselspiele an.
Nora unterbrach ihn: »Entschuldige, wenn ich hier nachfragen muss. Ganz ehrlich, Tom, bist du eigentlich bereit, auch auf die Wünsche deiner Partnerin einzugehen?«
Seine Erwiderung war mürrisch. »Dafür ist es ja jetzt zu spät.«
»Na ja, aber wenn du mal an die Zukunft denkst. Bei einer anderen Partnerin, meine ich.«
Er atmete in den Hörer. Dieser Einwand schien ihm nicht zu gefallen.
Freddy lächelte breit, als der Typ zu weiteren intimen Beichten ansetzte.
Nora konnte ihn nur mühsam bremsen. Schließlich empfahl sie ihm spezielle Internetforen für S/M-Anhänger. Ob sich Tom nicht dort einmal umtun wolle? Er blieb hartnäckig. Ungeniert ließ er die nächsten deftigen Details seiner Vorlieben einfließen. Sie fiel ihm freundlich ins Wort und versuchte es mit einem möglichst eleganten Schlusssatz.
Endlich nahm Freddy den Anrufer aus der Leitung, und sie konnte den folgenden Titel ansagen. »Where Can I Go Without You« von Keith Jarrett und Charlie Haden. Kaum lief das Stück, atmete sie durch.
Sie vermied Blickkontakt mit Freddy, spürte Zorn in sich aufwallen. Wie oft hatte sie ihm gesagt, er solle die Anrufer vorher besser checken. Der hier zählte zur untersten Kategorie. Sein einziges Ziel war, sich Geltung zu verschaffen und die Moderatorin bloßzustellen.
Zum Glück näherte sich die Sendung ihrem Ende. Doch dann gab es noch eine Anruferin namens Britta, die sich mit ihr über ihre Waschzwänge unterhalten wollte. Auch zwanghaftes Putzen gehörte dazu.
»Selbst nachts stehe ich manchmal auf, um staubzusaugen.«
»Geht es vielleicht um den Wunsch, in deinem Leben mehr Kontrolle zu haben?«
»Ich weiß nicht. Es kommt mir alles immer so schmutzig vor.«
Die Frau war den Tränen nahe. Sie hatte eine brüchige Stimme, Nora schätzte sie auf Ende dreißig.
Freddy tippte ungeduldig auf eine imaginäre Uhr an seinem Handgelenk. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als die Anruferin möglichst behutsam mit einem freundlichen Ratschlag zu vertrösten.
»Denk doch mal darüber nach, ob du dich von etwas ablenken willst, wenn du putzt. Den Staub kannst du beherrschen, das erscheint dir eventuell leichter, als sich dem eigentlichen Problem zu stellen. Etwas, das an dir nagt. Was du womöglich verdrängt hast.«
Die Hörerin wirkte verblüfft. »Klingt ziemlich einleuchtend, Nora. Von dieser Seite habe ich das noch nie betrachtet.«
»Bleib einfach in der Leitung. Mein Kollege hat eine Liste mit Telefonnummern parat. Nur für den Fall, dass du dir weitere Hilfe suchen willst.«
»Okay, vielen Dank.«
»Nicht dafür, Britta.«
Es war kurz vor zwei. Sie leitete zum nächsten Titel über, dem letzten für heute. »Naima«, ein Klassiker von John Coltrane, ein Saxofonsolo voller Melancholie und Sehnsucht, passend zu einer verregneten Sommernacht, eingebettet in ein Pianospiel, schwebend und zart.
Als der letzte Akkord verklungen war, verabschiedete sich Nora von ihren sorgenvollen Zuhörern.
Mehr konnte sie derzeit nicht tun. Sie war bloß ein Trostpflaster für die Nacht.
Freddy trat im Vorraum dicht auf sie zu, nach ihrem Ermessen einen halben Meter zu nah. »Gute Sendung, Nora.«
»Findest du?«
»Ja, war doch in Ordnung.«
»Ich weiß nicht, ich war mit der letzten halben Stunde nicht so zufrieden.«
»Wieso, was war denn los?«
»Ganz im Gegensatz zu dem Typen mit den Fesselspielen hätte ich mich mit der Frau, die unter ihren Zwängen leidet, gerne länger unterhalten.«
»Dann hätte sie früher anrufen müssen.«
»Mir wäre es lieber«, sie holte tief Luft, »wenn du Kerle wie diesen gar nicht erst zu mir durchstellst. Hast du ihn gecheckt?«
»Hab ich.«
»Ihn gefragt, worum es geht?«
»Klar.«
»Der wollte sich an dem Thema doch nur hochziehen.«
Freddy setzte ein Grinsen auf, das ihr überhaupt nicht gefiel. »Komm schon, Nora. Sexgeschichten hören sich die Leute nun mal lieber an als das Gejammer einer einsamen Frau, die zu viel putzt.«
Für einen Augenblick war sie sprachlos. »Das ist ziemlich respektlos von dir, Freddy. Hast du ihr wenigstens die Telefonnummern gegeben?«
»Na klar.«
Verärgert ruckte sie mit dem Kopf. »Schön, dann bis morgen.«
»Gute Nacht.«
Sie wandte sich von ihm ab, zog ihre Jacke an, nahm ihre Handtasche und ging. Ganz ruhig bleiben, dachte sie, während sie draußen im Flur auf den Aufzug wartete.
Schnarrend öffneten sich die Schiebetüren. Sie trat ein, drückte auf die Taste fürs Erdgeschoss, und die Türen schlossen sich. Im Nu hatte sie dieses flaue Gefühl im Magen, das sie stets in Fahrstühlen überkam. Die Kabine rauschte mit ihr in die Tiefe, fünfzehn Stockwerke, etliche Herzschläge lang. Sie betrachtete es als Übung, gerade nicht die Treppen zu benutzen, um ihre Lift-Phobie zu überwinden. Versuchte, weder an das dünne Stahlseil zu denken, an dem die zerbrechliche Kabine hing, noch an ihren Wortwechsel mit Freddy. Doch beides gelang ihr nicht, und ihr Puls schoss weiter in die Höhe.
Was bildete sich der Kerl nur ein? Sexgeschichten gegen Putzneurosen? Das war doch bloß seine heimliche Rache dafür, dass sie seine Einladungen ausgeschlagen hatte.
Erst als sie das Bürogebäude verlassen hatte und ihr der Juniregen ins Gesicht sprühte, fühlte sie sich besser. Sie ging eilig zu ihrem Wagen, schloss auf und stieg ein. Da stockte ihr der Atem.
Was war das vor ihr auf der Windschutzscheibe?
Was bewegte sich da, langsam und kriechend?
Mit einem leisen Aufschrei öffnete sie die Tür und stieg wieder aus.
Ihre Augen weiteten sich.
Schnecken krochen glibberig über die regennasse Scheibe. Große Weinbergschnecken, wulstig ihre Leiber, die Fühler tastend ausgestreckt. Die gesamte Front war verklebt von ihrem Schleim.
Wie viele waren das? Nora zählte an die zwanzig, dreißig Stück. Wo kamen die alle her? Es gab ja nicht mal Bäume in dieser Straße.
Zögernd streckte sie die Hand nach den feucht wabernden Weichtieren aus, die sich aneinander vorbei und übereinander hinweg die Scheibe entlangwanden, doch sie wagte es nicht, auch nur eines von ihnen zu berühren. Nicht einmal mit den Schneckengehäusen wollte sie in Kontakt geraten.
Welke Blütenblätter klebten an der Windschutzscheibe. Genüsslich und träge machten sich die Schnecken darüber her. Nora konnte die winzigen Fressspuren an den Blättern erkennen.
Es schüttelte sie.
Rasch stieg sie ein, warf die Tür zu und schaltete erst den Motor, dann die Scheinwerfer und schließlich die Scheibenwischer ein. Tierquälerei, dachte sie, aber das war ihr im Moment egal. Mit einem hässlich schurrenden Geräusch wurden die Schnecken über die Scheibe geschleudert. Es knackte, als die Wischer manche der Gehäuse zerbrachen. Schmatzend fuhren die Gummilippen durch den zähen Schneckenschleim.
Nora scherte aus der Parklücke aus und gab Gas.
Sie zwang sich, nur auf die Straße zu achten. Nicht auf das, was sich am unteren Ende der Scheibe angesammelt hatte und von den Wischern weiterhin zerquetscht wurde. Sie war bemüht, ruhiger zu atmen und weniger hektisch durch die Gänge zu schalten, um das Getriebe zu schonen.
Doch als sie in die Alexanderstraße einbog, nahm sie die Kurve so scharf, dass die Reifen quietschten. Erst als sie die Holzmarktstraße erreicht hatte, beruhigte sie sich ein wenig. Die Windschutzscheibe war jetzt halbwegs frei. Sie betätigte den Regler für das Sprühwasser, und die letzten Spuren wurden mit Seifenlauge beseitigt.
Auf der Schillingbrücke wanderte ihr Blick über die nächtliche Spree. Lichter spiegelten sich auf dem Fluss, der Regen ließ nach.
Sie versuchte, die Sache mit den Schnecken als dummen Streich eines Passanten abzutun, der die Tiere auf ihrem Auto ausgesetzt hatte. Oder es gab irgendeine andere Erklärung dafür. Zum Beispiel könnte der Wind die Blüten herangeweht haben, und das wiederum hatte die Schnecken angelockt. Vielleicht gab es ja eine Plage, möglicherweise hatte es mit dem verregneten Sommer zu tun, in dem sich die Viecher ungewöhnlich schnell vermehrten.
Aber waren Weinbergschnecken nicht eigentlich vom Aussterben bedroht?
In diesem Sommer wohl eher nicht.
Gedankenverloren schüttelte sie leicht den Kopf. Es wäre dumm von ihr, sich noch länger darüber aufzuregen.
Sie fuhr den Engeldamm entlang und bog in die Melchiorstraße ein. Sie fand einen Parkplatz in der Nähe ihrer Haustür, hielt an und schaltete den Motor und die Scheinwerfer aus. Sie verließ den Wagen und verriegelte ihn. Mit energischen Schritten steuerte sie auf das Wohnhaus zu, nahm den Schlüssel aus ihrer Handtasche und schloss den Eingang auf.
Wieder nahm sie den Aufzug, um ihre Ängste zu besiegen. Im fünften Stockwerk angekommen, wandte sich Nora dem Eingang ihrer Dachgeschosswohnung zu.
Und da sah sie etwas.
Es bewegte sich auf dem Türknauf.
Es war schleimig und dick.
Direkt vor ihr. An ihrer Wohnungstür.
Noch eine Schnecke.
Eine fettleibige Weinbergschnecke.
Das konnte doch kein Zufall sein.
Nora schnappte nach Luft. Da vernahm sie ein Geräusch auf der Treppe. Schritte näherten sich. Das Geräusch wurde stärker. Ein Summen, Surren.
Gerade als sie sich umwenden wollte, packte sie jemand im Nacken und presste ihr etwas Gummiartiges auf Mund und Nase.
Dämpfe stiegen daraus hervor.
Eine Stimme raunte ihr von hinten ins Ohr: »Tief einatmen. Das wird dich entspannen.«
Nora wollte sich gegen den Angreifer wehren, doch die Dämpfe betäubten sie. Ihr wurde schwummrig.
Die Schnecke auf dem Türknauf bewegte sich. Träge, wie in Zeitlupe. Dann verschwamm sie vor ihren Augen. Das Gerät vor ihrem Gesicht surrte.
»Tiefer atmen«, flüsterte die Gestalt hinter ihr. »Tiefer und tiefer. Lass dich einfach fallen.«
Sie wollte schreien, doch alles um sie herum war mit einem Mal so wabernd weich wie Schneckenfleisch.
Die Wohnungsschlüssel wurden ihr aus der Hand genommen, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Die Tür wurde aufgesperrt. Die Gestalt in ihrem Rücken schob sie ins Innere der Wohnung hinein. Leise schloss sich die Tür hinter ihr.
Nora schwankte. Die Gestalt hielt sie fest. »Ruhig, Nora. Atmen, einfach nur atmen.«
Aus dem gummiartigen Gebilde in ihrem Gesicht drangen die Dämpfe. Es surrte, summte dicht an ihrem Kinn.
Ihre Glieder wurden schwer.
Dann schwanden ihr die Sinne.
ZWEI
DIENSTAG, 11. JUNI, FRÜHMORGENS
Mit eiligen Schritten näherte sich Nils Trojan dem Büro seines Chefs im Kommissariat. Vor der Tür blieb er stehen, straffte die Schultern, atmete ein paarmal tief durch, dann klopfte er an und trat ein.
Landsberg blickte von seinen Papieren auf. »Morgen, Nils.«
»Morgen.«
»Setz dich doch.«
Trojan nahm gegenüber vom Schreibtisch Platz. Er sah Landsberg fest in die Augen. Nun war er schon seit Stunden wach, hatte das Gespräch wieder und wieder im Kopf durchgespielt. Diesmal würde er sich nicht abwimmeln lassen.
Landsbergs Lächeln wirkte gequält. »Worum geht es?«
»Das weißt du genau.«
»Dieses Sabbatical?«
»Richtig. Ich hab dich wegen der Angelegenheit mehrfach angerufen und dich immer wieder darauf angesprochen, wenn wir uns im Flur begegnet sind. Und du hast stets nur gelächelt und gesagt, es sei im Moment gerade ungünstig.«
»Ja, und deswegen nehme ich mir jetzt Zeit für dich.«
»Vielen Dank«, entgegnete Trojan kühl.
Landsberg verschränkte die Arme vor der Brust. »Dann schieß mal los.«
»Okay, Hilmar. Auch wenn du mein Anliegen vielleicht für leere Worte hältst, es ist mir wirklich ernst. Ich hab mich seit Jahren in diesem Kommissariat abgerackert. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, da ich dringend eine Auszeit brauche. Ich werde mich für ein Jahr verabschieden. Für ein ganzes Jahr, Hilmar. Du musst auf mich verzichten, auch wenn ich weiß, dass die Personalsituation angespannt ist. Um es kurz zu sagen: Ich bin dann mal weg.«
»So einfach, wie du dir das vorstellst, ist es aber nicht.«
»Dann lass uns gemeinsam einen Weg finden.«
Landsberg beugte sich vor: »Wir beide, Nils, können dabei wenig ausrichten. Uns sind die Hände gebunden.«
»Wie meinst du das?«
»Es gibt eine Anweisung von ganz oben, dass bei der Berliner Polizei derzeit jeder Antrag auf ein Sabbatical abgelehnt werden muss.«
»Das glaub ich nicht.«
»Es ist aber so. Personalnot. Zu wenig Leute. Wir sind unterbesetzt. Beklag dich beim Senat, aber nicht bei mir. Es werden in Berlin schlichtweg zu wenig Kriminalbeamte eingestellt. Darunter leidet jeder hier in der Mordkommission. Du bist bei Weitem nicht der Einzige, der völlig überlastet ist. Du kannst den Antrag gerne bei mir abgeben. Aber ich sage dir gleich, der Polizeipräsident wird ihn nicht bewilligen.«
»Du könntest ein gutes Wort für mich einlegen.«
»Könnte ich, ja. Doch das wird nichts nutzen.«
»Wie wäre es, wenn du auf meine besonderen Verdienste hinweist? Wir haben eine sehr hohe Aufklärungsrate. Und ich denke, ich habe einiges dazu beigetragen.«
»Hast du auch, Nils. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wer dich ein Jahr lang ersetzen sollte. Doch mal von diesem Bewilligungsstopp abgesehen, lässt sich ein Sabbatical nicht von heute auf morgen durchziehen. Du müsstest zunächst einmal sechs Monate lang für halbe Bezüge arbeiten, um dann während deiner Auszeit mit der anderen Hälfte bezahlt werden zu können.«
»Das Geld ist mir egal.«
»Wovon willst du denn leben?«
»Einerlei. Ich will nur raus. Ich bin völlig ausgebrannt, Hilmar.«
Stille. Landsberg lehnte sich in seinem Stuhl zurück und musterte ihn. »Ist es so schlimm?«
»Ziemlich.«
»Hast du gesundheitliche Probleme?«
Nils blickte ihn schweigend an. Sollte er ihm die Wahrheit sagen? Ihm anvertrauen, dass er seit Jahren unter heftigen Panikattacken litt? Von seinen Ängsten erzählen, von dem Gefühl, in diesem Job allmählich vor die Hunde zu gehen? Darüber hatte er sich nicht nur in der vergangenen Nacht den Kopf zerbrochen. Wie viel durfte er verraten? Würde es ihm helfen, reinen Tisch zu machen?
Oder war es unklug? Würde er seinen Ruf verlieren? Landsberg schien ja große Stücke auf ihn zu halten. Warum also alles preisgeben?
»Es ist der Stress«, murmelte er knapp.
»Klar. Unter dem leiden wir alle.«
»Massiver Stress.«
»Meine Frau besucht gerade einen Meditationskurs.«
»Schön für sie.«
»Bei ihr hilft’s. Versuch es doch auch mal.«
»Ein Jahr Pause, Hilmar. Meinetwegen ohne Bezahlung. Danach hast du mich wieder. Mit aufgeladenen Batterien und neuer Kraft. Selbst Fußballtrainer nehmen sich heutzutage mal eine Auszeit.«
»Das kriegen wir unmöglich durch.«
»Dann lasse ich mich eben krankschreiben. Ich gehe zum Arzt, sage, ich kann nicht mehr. Der Doc verordnet mir eine längere Pause, ich werde weiter bezahlt, und du musst sehen, wie du ohne mich auskommst.« Er hob die Stimme. »Wäre dir das lieber, Chef? So machen es doch die meisten Leute im öffentlichen Dienst.«
»Nur bist du dafür viel zu gewissenhaft, Nils.«
»Ja, das bin ich.«
»Du drückst dich nicht. Du stehst deinen Mann. Und dafür schätze ich dich.«
»Deshalb lass uns eine bessere Lösung finden.«
»Ein Jahr ist zu viel. Ich brauche dich hier. Du bist mein bester Ermittler. Hast du nicht noch Resturlaub?«
»Nein.«
»Scheiße, was soll ich denn machen?«
»Gib mir Sonderurlaub. Drei Monate.«
Landsberg stieß die Luft aus.
»Zwei Monate wenigstens. Acht Wochen. Ich muss hier mal raus.«
»Ich denke darüber nach.«
»Tu das bitte.«
»Okay.«
»Schieb es nicht auf die lange Bank. Gib mir in ein paar Tagen Bescheid.«
»In Ordnung.«
Sie schwiegen eine Weile. Trojan hielt dem prüfenden Blick seines Chefs stand, danach erhob er sich und wandte sich zur Tür.
»Nils?«
Er drehte sich zu ihm um. »Ja?«
»Da ist leider noch etwas.«
»Was?«
»Mir ist ein Gerücht zu Ohren gekommen.«
Sein Puls beschleunigte sich. »Ach ja?«
»Es geht um Stefanie Dachs.«
Trojan verzog keine Miene.
»Ist es wahr, dass du mit ihr eine Affäre hast?«
Verdammt, dachte er, sie hatten sich so sehr bemüht, es geheim zu halten.
»Das geht dich nichts an.«
»Du irrst.«
»Reine Privatangelegenheit.«
»Du kennst die Vorschriften.«
Er verkniff den Mund.
»Sollte an dem Gerücht was dran sein, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ihr beendet die Geschichte, oder aber einer von euch beiden muss die Dienststelle wechseln. Und in dem Fall würde es Stefanie treffen. Denn dich will ich unbedingt behalten.« Nach einer Pause fuhr er leise fort: »Weißt du, Nils, wie ich Steffie einschätze, wird ihr das nicht recht sein. Niemand kann ihr garantieren, dass sie zu einer anderen Mordkommission versetzt wird. Wäre durchaus möglich, dass sie in Zukunft Einbrüche bearbeiten muss. Ich denke, bei ihrem Ehrgeiz wäre das eine Katastrophe für sie.«
»Soll das etwa eine Drohung sein?«
»Es sind Tatsachen, mehr nicht.«
»Wir haben keine Affäre.«
Er verließ Landsbergs Büro und schlug die Tür hinter sich zu.
Die Attacke erwischte ihn im Flur. Kalt stand ihm der Schweiß auf der Stirn. Sein Herz raste. Das Atmen fiel ihm schwer.
Trojan eilte in den Waschraum. So durfte er von den Kollegen nicht gesehen werden.
Er stützte sich aufs Becken, drehte den Hahn auf und warf sich kaltes Wasser ins Gesicht.
Seine Beine waren zittrig. Das Gespräch war gänzlich schiefgelaufen.
Acht Wochen statt eines Jahres. Und selbst das würde ihm Landsberg vermutlich ausreden. Zu allem Überfluss war nun auch die Sache mit Steffie ans Licht gekommen.
Wie lange würde er noch durchhalten?
Er rang nach Luft. Er konnte einfach nicht mehr.
Ich kündige, durchfuhr es ihn. Ich schmeiße alles hin.
Er drehte das Wasser ab, nahm ein Papiertuch aus dem Spender und trocknete sich die Stirn.
Kurze Zeit später stürmte er aus dem Kommissariat, sprang in seinen Wagen und rauschte davon.
DREI
Mario Gutland war ungehalten. Dass sich Nora verspätete, hielt er für ein schlechtes Zeichen. Wie viel bedeutete er ihr eigentlich noch? Seit ihrem Streit am Wochenende war er in heilloser Aufregung. Heute war der Tag, an dem er sich mit ihr versöhnen wollte.
Und nun kam sie einfach nicht.
Ungeduldig saß er an dem Tisch im hinteren Teil des Restaurants, den er zum Lunch für sie beide reserviert hatte. Er beobachtete das hektische Treiben der Geschäftsleute, die sich hier zu einem kurzen Mittagessen trafen, und ließ die Eingangstür nicht aus den Augen.
Sie war schon zwanzig Minuten zu spät. Wo steckte sie nur?
Wenn er nicht rechtzeitig zurück im Büro war, bekam er Ärger. Am Nachmittag stand ein wichtiges Meeting an, und dafür war noch einiges vorzubereiten. Viel lieber hätte er sich abends mit Nora verabredet, doch das war schwierig. Nach acht war sie für gewöhnlich im Studio, um ihre nächtliche Sendung vorzubereiten.
Er musste wachsam sein. Nora traf sich mit einem anderen. Anfangs war es ein vager Verdacht gewesen, später kränkende Gewissheit. Schließlich hatte Nora alles zugegeben. Sie sprach von Trennung, doch das wollte er nicht wahrhaben.
Mario war ein Kämpfer. So leicht gab er nicht auf.
Am Wochenende war ihm der Kragen geplatzt. Er hatte sie angeschrien. Und das tat ihm leid. Am Telefon hatte er sich bei ihr entschuldigt und diese Verabredung vorgeschlagen. Sie hatte eingewilligt, und das war nun seine Chance, alles wiedergutzumachen.
Heute galt es, die Nerven zu behalten. Sein Jähzorn verschreckte sie, das hatte sie ihm selbst gesagt. Darum bloß nicht abermals einen Streit anzetteln. Wenn sie zur Tür hereinkommt, lächeln. Immerzu lächeln. Sie freundlich begrüßen und ihr Komplimente machen.
Er blickte zur Uhr. Und wenn sie ihn nun versetzte?
Oder ließ sie ihn absichtlich zappeln?
War das ein Machtspiel?
Zu viel Adrenalin im Blut. Er war ein Heißsporn, das wusste er. Darum ruhig bleiben, tief durchatmen.
Er schwitzte, das Jackett über seinem blütenweißen Hemd verbarg die unangenehmen Flecken unter den Achseln. Warum tat sie ihm das an?
Schon dreimal hatte er es auf ihrem Handy versucht, doch immer nur die Mailbox erreicht.
Erneut blickte er auf seine Armbanduhr. Nun war es schon fast halb zwei. Der Kellner hatte ihn mehrmals gefragt, ob er nicht endlich das Essen bestellen wolle, der Tisch werde benötigt. Doch Mario blieb hartnäckig.
Er beschloss, noch drei Minuten zu warten. Und wenn sie bis dahin nicht erschien? Würde das ein endgültiges Aus ihrer Beziehung bedeuten?
Nein, das durfte nicht sein. Möglicherweise hatte sie ja verschlafen. Als Nachtarbeiterin hatte Nora einen ganz anderen Rhythmus als er. Meistens blieb sie bis mittags im Bett.
Alles wegen dieser verdammten Radiosendung. Jeder Trottel durfte bei ihr anrufen und ihr von seinen Problemen erzählen. Wie er das hasste. Sie hatte so eine kumpelhafte Art drauf, die die Leute dazu brachte, ihr geheime Dinge anzuvertrauen. Was sollte das?
Mario war nicht bereit, sie mit anderen zu teilen, nicht mit den Fans ihrer Sendung und schon gar nicht mit einem anderen Liebhaber.
Was bildete sie sich nur ein, wie konnte sie ihn so lange warten lassen? Der Zorn ließ noch mehr Hitze in ihm aufwallen. Sein Hemd klebte am Rücken.
Wieder griff er zum Handy und tippte auf den ersten Eintrag in seiner Favoritenliste. Sie war seine Nummer eins. Wusste sie denn nicht, wie viel sie ihm bedeutete? Wie konnte er ihr bloß begreiflich machen, dass ihre Liebe etwas ganz Besonderes war?
Auch diesmal schaltete sich die Mailbox ein.
Ihre vertraute Stimme, rau und verlockend an seinem Ohr: »Hallo, hier ist Nora Sand, bitte hinterlasst mir eine Nachricht.«
Er unterbrach die Verbindung, trank seinen Kaffee aus, winkte dem Kellner und zahlte.
Es war dreizehn Uhr vierundzwanzig. Mario Gutland verließ das Restaurant.
Er schlug den Weg zurück zu seinem Büro ein, als er plötzlich innehielt. Nein, dachte er. Er würde jetzt nicht klein beigeben. Immerhin besaß er einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Zwar hatte sie ihn erst neulich von ihm zurückgefordert und ihn damit zutiefst gedemütigt. Doch er war so clever gewesen, ihn schließlich herauszurücken. Allerdings ahnte Nora nicht, dass er sich zuvor ein zweites Exemplar davon hatte anfertigen lassen.
So konnte er in ihrer Wohnung ein und aus gehen, wann immer sie nicht da war. Das verlieh ihm Macht und Kontrolle. Und es war ja nur zu ihrem Besten. Nora war dabei, einen schrecklichen Fehler zu begehen, und davor musste er sie bewahren. Er war der Mann, der sie beschützen würde. Auf immer und ewig.
Sie war so hübsch und begehrenswert. Sie faszinierte ihn. Und es war aufregend, wenn sie mit ihrer raspelnden Stimme zu ihm sprach. Sie beide hatten eine gute Zeit zusammen gehabt, und sie würden ihre Krise gemeinsam überwinden. Nora sollte endlich einsehen, dass ihre Liebe einzigartig war. Dafür musste er Sorge tragen.
Ihre Wohnung lag nicht weit entfernt, zu Fuß nur etwa eine Viertelstunde. Er würde sich bei seinem Chef für die verlängerte Mittagspause entschuldigen müssen, aber das war ihm egal. Nora Sand war das Wichtigste in seinem Leben. Und dafür lohnte es sich zu kämpfen.
Für einen Moment schnürte es ihm bei dem Gedanken, sie mit dem anderen Mann im Bett zu erwischen, die Kehle zu. Der Kerl war Anwalt, ein arroganter Schnösel. Mario hatte seine Facebook-Seite gecheckt. Auch auf Twitter und Instagram war der Typ aktiv. So manches Mal hatte er sich vorgestellt, ihm irgendwo an einer dunklen Straßenecke aufzulauern und zur Rede zu stellen.
Ruhig Blut, dachte er. Nora hat ganz sicher verschlafen. Sie wird froh sein, dass ich an ihre Tür klopfe, um sie zu wecken. Sie lässt mich herein, wir versöhnen uns. Sie sieht ein, dass sie einen Fehler gemacht hat, gibt dem anderen Kerl den Laufpass, und alles wird gut.
Wenn er doch nicht so übermäßig schwitzen würde. Sein Herz schlug viel zu schnell, und in seinem Magen rumorte es. Irgendeine dunkle Vorahnung brodelte in ihm, als wäre heute der Tag, an dem ihm sämtliche Sicherungen durchbrennen würden.
Er musste sich zügeln. Durfte Nora auf keinen Fall wieder anschreien.
Schwer atmend überquerte er den Engeldamm an der Fußgängerampel und bog kurz darauf in die Melchiorstraße ein. Vor ihrer Haustür angekommen, drückte er sogleich auf die Klingel an ihrem Namensschild. Er wartete ein paar Sekunden, läutete erneut, und als niemand öffnete, holte er den Schlüssel hervor und schloss auf.
Er verzichtete auf den Fahrstuhl und eilte die Treppen hinauf. Im fünften Stockwerk betätigte er ihre Türklingel, klopfte ein paarmal an, erst verhalten, dann lauter.
Nichts rührte sich.
Also schloss Mario auf und trat ein.
Leise rief er ihren Namen. Er erhielt keine Antwort.
Er durchquerte den Flur, sah im Wohnzimmer nach. Niemand.
Die Tür zum Schlafzimmer war geschlossen. Leise drückte er die Klinke.
Sein Blick fiel aufs Bett. Es war leer. Ordentlich, wie unbenutzt, die Überdecke glatt gestrichen.
Er trat näher.
Etwas an den Bettpfosten irritierte ihn. Da waren zwei weiße Tücher verknotet, eines links, eines rechts. Und in der Mitte des Bettes lag ein weiteres Tuch, zusammengewirkt, wie zu einem Knebel.
Was hatte das zu bedeuten? Seit wann stand Nora auf Fesselspiele?
Hatte etwa dieser Anwalt abartige Dinge von ihr verlangt?
Entsetzt verließ er das Zimmer.
»Nora?«
In der Küche war sie nicht.
Er ging zurück ins Wohnzimmer und näherte sich der Glastür zur Dachterrasse. Auch draußen war niemand.
Blieb nur noch das Badezimmer.
Hier war die Tür ebenfalls geschlossen. Mario klopfte zaghaft an.
Keine Antwort.
Er trat ein und registrierte das flackernde Kerzenlicht. Überall im Bad waren brennende Kerzen aufgestellt.
»Nora?«, fragte er erneut.
Über die Vorhangstange an der Badewanne war ein großes weißes Tuch gehängt.
Mario tastete nach dem Schalter und knipste das Deckenlicht an.
Augenblicklich wich er zurück.
Auf den Fliesen bewegte sich etwas. Langsam, behäbig.
»Um Himmels willen, Nora, was ist hier los?«
Stille.
Fassungslos betrachtete er die gespenstische Szenerie in dem Raum. Erst als er sich wieder halbwegs im Griff hatte, näherte er sich zögernd der Badewanne.
Er holte einmal tief Luft. Dann zog er das Tuch weg.
Er vergaß zu atmen.
Schwankte.
Mario Gutland stieß einen winselnden Laut aus.
VIER
Trojan fuhr vom Kommissariat in Tiergarten direkt nach Lankwitz in die Malteserstraße. Er stieg aus, ging in eine Bäckerei und kaufte zwei Becher Kaffee zum Mitnehmen.
Von dort aus waren es nur noch ein paar Schritte bis zum Friedhofsgelände. Als er das Tor passiert hatte, umgab ihn tröstende Stille. Der Verkehrslärm war wie verschluckt. Langsam ging er die Grabreihen entlang. Irgendwo rief ein Vogel. Ein lauer Wind in den Bäumen, der Geruch von feuchter Erde. In den letzten Tagen hatte es viel geregnet.
Als er den Grabstein mit dem Namen »TROJAN« erreicht hatte, stellte er einen der Pappbecher darauf.
»Hier, Pa«, sagte er, »für dich. Schwarz, ohne Zucker, so wie du ihn magst.«
Es tat gut, endlich »Pa« zu ihm zu sagen. Eigentlich hatte er sich das schon immer gewünscht, jedoch nie fertiggebracht. Früher hatte er Richard Trojan stets mit »Vater« angeredet. Förmlich, kühl, distanziert, so wie ihr Umgang eben war.
Seit seinem Tod hatte sich das geändert. War es verrückt von ihm, dass er öfter hierherkam, nur um mit ihm zu sprechen? Und zudem vertraulicher als vor seinem Ableben? Mit einem großen Bedauern, aber zugleich liebevoller als jemals zuvor? Hier hatte er einen Vater, der ihm nicht mehr widersprach. Der ihm keine Geringschätzung entgegenbrachte und auch keine Angst einflößte.
Er richtete das Wort an ein Grabmal. An ein Viereck voller Erde, ordentlich geharkt, mit Primeln und Koniferen bepflanzt. Und doch hatte er das Gefühl, dass sein Vater ihm zuhörte, ja mehr noch, als würde er Verständnis für ihn und seine Sorgen aufbringen.
An seiner letzten Ruhestätte war Richard Trojan der Pa, den er sich immer gewünscht hatte: ein geduldiger Zuhörer, mitfühlend, sanftmütig, aufrichtig.
Er vermutete, dass Gertrud Korn, die Lebensgefährtin seines Vaters, noch weitaus öfter als er herkam, um das Unkraut zu zupfen und die Pflanzen zu gießen. Ob sie dabei auch mit ihm sprach? Er wusste es nicht. Er hatte wenig Kontakt zu dieser Frau.
Bislang hatte ihn die Atmosphäre auf Friedhöfen bedrückt. Nun nicht mehr. Er genoss die Stille. Und dieses eigenartige Gespräch, das letztlich bloß ein Monolog war, den er vor sich hin murmelte.
»Bin froh, dass du noch die Kreuzfahrt unternehmen konntest. Hat dir gefallen draußen auf See, hmm? Ich sehe es direkt vor mir, wie du an der Reling stehst, aufs Meer hinausschaust und dir die frische Brise um die Nase wehen lässt.«
Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee.
»Du hast es von Anfang an geplant, nicht wahr? Du wusstest, dass es deine letzte Reise sein wird. Unser Gespräch damals, das war unser Abschied. Ich weiß noch jedes Wort, das du zu mir gesagt hast. Du hast alles zugegeben. Du hast mir einen Mord gestanden, Pa. Alle Achtung, hätte nie gedacht, dass du mal so ehrlich zu mir sein würdest. Gut, dass wir uns noch mal umarmen konnten. Ein Mal wenigstens.«
Trojan blinzelte eine Träne weg.
»Ja«, sagte er leise, »jedes Detail war geplant. Dein Brief, unser Gespräch, die Reise, die Heimkehr und dann dein Tod. Du bist friedlich entschlafen, hat mir Gertrud gesagt. Aber es waren die Tabletten, oder? Schlaftabletten. Ich hab die leeren Packungen unter deinem Bett gefunden. Auch ein Mittel gegen Erbrechen war dabei. Du hast einfach an alles gedacht. Du wünschst deiner Lebensgefährtin eine gute Nacht, und das war’s dann.« Er holte tief Luft. »Ich hab dafür gesorgt, dass niemand Verdacht schöpft. Vor allem Gertrud nicht. Natürliche Todesursache. Herzversagen. Der Arzt hat den Totenschein kommentarlos unterschrieben. War dir doch recht so, oder? Und doch muss dir klar gewesen sein, dass ich deine Absichten durchschauen und deinen Tod als Suizid einschätzen würde.« Er schluckte. »Ziemlich gut gespielt, Pa. So hast du mir wenigstens erspart, dich wegen des Mordes an Susanna Halm festnehmen zu müssen. Der eigene Sohn überführt seinen Vater. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Vielleicht hätte das Gericht die Sache als Totschlag eingeschätzt. Totschlag verjährt, Mord nicht. Wer weiß, vielleicht wärst du noch mal davongekommen. Aber darum ging es dir nicht. Du wolltest vielmehr, dass die Angelegenheit niemals an die Öffentlichkeit gerät. Ich denke, es war dir wichtig, deine Lebensgefährtin damit zu verschonen. Nur vor deinem Sohn hast du deine Schuld eingestanden. Ein einziges Mal. Zumindest das rechne ich dir hoch an, Pa.«
Schweigend stand Trojan da und hing seinen Erinnerungen nach. Seit seiner Kindheit hatte ihn die Frage beschäftigt, wie es zu dem gewaltsamen Tod von Susanna Halm, der Nachbarin in ihrer Siedlung, gekommen war und welche Rolle sein Vater dabei gespielt hatte. Wahrscheinlich war das sogar der Grund, warum er Kriminalbeamter geworden war. Jana Michels, seine Ex-Freundin und Ex-Therapeutin hatte mal zu ihm gesagt, jede seiner Mordermittlungen sei letztlich unbewusst eine Ermittlung gegen seinen Vater.
Vermutlich lag sie richtig mit dieser Einschätzung.
Und nun hatte er endlich Gewissheit.
Es war wie die Lösung eines äußerst schwierigen Falls. Aber gleichzeitig war es auch ein Fluch, der auf ihm lastete. Zwar konnte er jetzt entspannter mit seinem Vater reden, aber der war ja auch tot und konnte ihm nicht mehr widersprechen.
Und außerdem gab es diese Schuldgefühle, die pausenlos an ihm nagten.
Nacht für Nacht träumte er von seinem Vater. Und in diesen Albträumen war er noch ganz der Alte. Ein zornerfüllter, verbitterter Richard Trojan. Er wütete, überschüttete seinen Sohn mit Vorwürfen. Er gab ihm die Schuld an seinem Selbstmord.
Nun lag die Schuld also bei ihm. Er hatte ihn ins Grab gebracht. Er, Nils, war dafür verantwortlich, dass sein Vater sich das Leben genommen hatte. Seine bohrenden Fragen, wer Susanna Halm damals vor vielen Jahren mit einem gusseisernen Kerzenständer den Schädel eingeschlagen hatte, seine Hartnäckigkeit, Gewissenhaftigkeit, seine Pflichten als Polizist hatten Richard Trojan in den Selbstmord getrieben.
»Kannst du mir verzeihen, Pa?«, fragte er den Stein mit dem Pappbecher darauf.
Keine Antwort.
Natürlich nicht.
Wo auch immer Richard Trojan nun war, mit dieser Frage ließ er seinen Sohn allein zurück.
»Du hast die Schuld an mich weitergegeben. Dein letzter Schachzug, Vater. Ist dir gelungen.«
Er trank seinen Kaffee aus und stellte den Becher zu dem anderen.
»Ich komme wieder. Vielleicht hab ich ja von nun an mehr Zeit. Muss mir die Sache gründlich durch den Kopf gehen lassen. Landsberg mauert, was mein Sabbatical betrifft. Ich denke ernsthaft darüber nach, ob ich ihm die Kündigung auf den Tisch knalle.«
Wovon willst du denn leben?
Er zuckte zusammen. Die Stimme war so deutlich zu vernehmen, als käme sie direkt aus dem Grab.
Nur ganz allmählich beruhigte sich sein Herzschlag.
»Scheiße, hast du mich erschreckt. Ich bin wohl ziemlich durcheinander.«
Du bist der Nächste, den es erwischt.
Er fuhr herum. Diesmal kam die Stimme von hinten. Eine Gestalt im Parka, runzliges Gesicht, stechende Augen, tauchte zwischen den Gräbern auf und grinste ihn an.
»Was haben Sie gesagt?«
»Gut, dass es keinen Regen mehr gibt.«
Trojan atmete durch. »Wer sind Sie?«
Der alte Mann lächelte. »Ich arbeite hier. Kümmere mich um die Gräber.«
»Entschuldigung. Ich war ganz in Gedanken.«
Trojan wandte sich zum Gehen.
»Einen schönen Tag noch«, rief der Alte ihm nach.
Du bist der Nächste, den es erwischt. Da schien er sich wohl verhört zu haben. Hoffentlich.
»Nur ein Gärtner«, murmelte er vor sich hin. »Nicht der Tod persönlich.«
Er eilte auf den Ausgang zu.
Zurück in seinem Wagen, schaltete er das Handy ein.
Auf dem Display wurden ihm dreizehn Sprachnachrichten in Abwesenheit angezeigt.
Die letzte hörte er ab.
Es war Landsberg. Er klang genervt: »Nils, verdammt, wo steckst du? Wir haben hier einen Mordfall. Melchiorstraße 17 in Berlin-Mitte. Beeil dich.«
Trojan startete den Motor und scherte aus der Parklücke aus.
Es ging wieder los.
FÜNF
Landsberg nahm Trojan im Flur der Tatortwohnung zur Seite. »Wo warst du nur so lange?«
»Eine private Angelegenheit, tut mir leid.«
»Privat? Du bist im Dienst.«
»Es geht um meinen Vater.«
»Aber das ist jetzt nicht …«