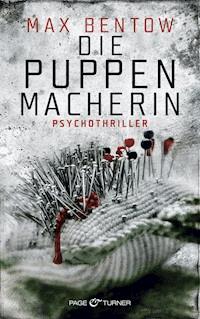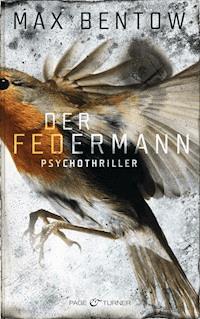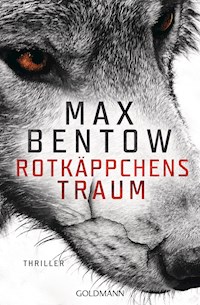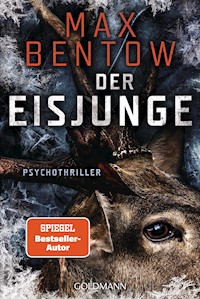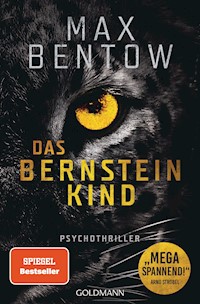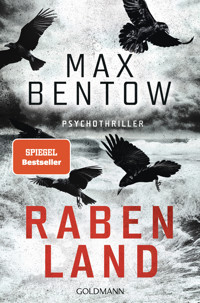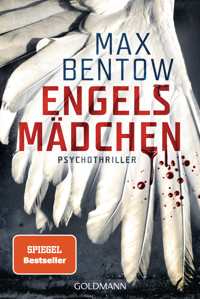10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Carlotta Weiss und Nils Trojan
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, ermordet in einem Baumhaus. Ein männliches Opfer, getötet in seinem Auto. Eine Schauspielerin, tot aufgefunden in ihrer Badewanne. Profilerin Carlotta Weiss und Kommissar Nils Trojan tappen im Dunklen: was ist die Beziehung zwischen diesen Menschen, die einem scheinbar wahllos wütenden Mörder zum Opfer gefallen sind? Einen ersten Hinweis erhalten sie, als auch noch der Maler Robert Lumen gewaltsam ums Leben kommt: auf dem Speicher seines Hauses ist das Bildnis einer mysteriösen jungen Frau mit einer Eule versteckt. Ist sie das Bindeglied zwischen den Opfern? Als Carlotta sich wie die Porträtierte kleidet und ein zwielichtiges Etablissement aufsucht, das Lumen und die Frau möglicherweise verbunden hat, kommt sie dem Täter gefährlich nahe. Aber in welch tödlicher Gefahr sie wirklich schwebt, begreift sie erst im letzten Moment ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text zum Buch
Eine Frau, ermordet in einem Baumhaus. Ein männliches Opfer, getötet in seinem Auto. Eine Schauspielerin, tot aufgefunden in ihrer Badewanne. Profilerin Carlotta Weiss und Kommissar Nils Trojan tappen im Dunklen: Was ist die Beziehung zwischen diesen Menschen, die einem scheinbar wahllos wütenden Mörder zum Opfer gefallen sind? Einen ersten Hinweis erhalten sie, als auch noch der Maler Robert Lumen gewaltsam ums Leben kommt: Auf dem Speicher seines Hauses ist das Bildnis einer mysteriösen jungen Frau mit einer Eule versteckt. Ist sie das Bindeglied zwischen den Opfern? Als Carlotta sich wie die Porträtierte kleidet und ein zwielichtiges Etablissement aufsucht, das Lumen und die Frau möglicherweise verbunden hat, kommt sie dem Täter gefährlich nahe. Aber in welch tödlicher Gefahr sie wirklich schwebt, begreift sie erst im letzten Moment …
Weitere Informationen zu Max Bentow sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
MAX BENTOW
EULENSCHREI
PSYCHOTHRILLER
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe Juli 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt
durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Ilona Wellmann / Trevillion Images; FinePic®, München
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30924-4V002
www.goldmann-verlag.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
ZWEITER TEIL
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DRITTER TEIL
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERTER TEIL
VIERUNDVIERZIG
FÜNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
SIEBENUNDVIERZIG
ACHTUNDVIERZIG
NEUNUNDVIERZIG
FÜNFZIG
EINUNDFÜNFZIG
ZWEIUNDFÜNFZIG
DREIUNDFÜNFZIG
VIERUNDFÜNFZIG
FÜNFUNDFÜNFZIG
SECHSUNDFÜNFZIG
SIEBENUNDFÜNFZIG
ACHTUNDFÜNFZIG
NEUNUNDFÜNFZIG
SECHZIG
EINUNDSECHZIG
ZWEIUNDSECHZIG
DREIUNDSECHZIG
VIERUNDSECHZIG
FÜNFUNDSECHZIG
SECHSUNDSECHZIG
EPILOG
Max Bentow
Sie wollen gleich weiterlesen? Unsere Empfehlungen für Sie…
Newsletter-Anmeldung
ERSTER TEIL
Das Unheil begann mit einer Reise, die mehr eine Flucht war. Mutter hatte unsere wenigen Sachen eingepackt, weckte mich mitten in der Nacht und trieb mich zur Eile an. Wir fuhren los, und ich wusste nicht, wohin.
Ich versuchte, auf der Rückbank des Wagens weiterzuschlafen, doch ihre Angst hielt mich wach. Sie umklammerte das Lenkrad, überschritt die Höchstgeschwindigkeit. Von da an ließ ich sie nicht mehr aus den Augen, ständig war ich in Sorge um sie.
Ich wollte sie trösten, ihr etwas Aufmunterndes sagen, doch mir fiel nichts Passendes ein. Sie hatte blaue Flecken im Gesicht, und wo ihre Augenbraue aufgeplatzt war, klebte schief ein Pflaster. Ansonsten war sie schön wie immer. Ihr rotbraunes Haar, die vollen Lippen. Wenn sie endlich wieder lächeln konnte, würde ihre winzige Zahnlücke aufblitzen, die mochte ich besonders an ihr.
Ich erinnere mich an Landstraßen und Autobahnen, Parkplätze im frühen Morgenlicht. Wenn wir kurz anhielten, um eine Pause zu machen, warfen ihr Fernfahrer begehrliche Blicke zu, bis sie ihre Blutergüsse sahen, dann wandten sie sich ab. Mutter nahm es achselzuckend hin, schon fuhren wir weiter.
Ich drückte meine Nase an die Fensterscheibe. Landschaften und Städte flogen an mir vorüber.
»Wohin wollen wir?«, fragte ich sie einmal, doch sie schwieg. Bald brach die nächste Nacht über uns herein. Das Brummen des Motors war mein Schlaflied.
In letzter Zeit waren wir so oft umgezogen, dass ich die Hoffnung aufgegeben hatte, jemals irgendwo anzukommen. Und so wusch ich morgens mein Gesicht unterm Wasserhahn in einer schmutzigen Raststätte.
Mutter öffnete mit besorgtem Blick ihr Portemonnaie. Eigentlich waren wir fast pleite, dennoch durfte ich mir einen Schokoriegel und einen Milchshake kaufen, während sie zum Frühstück bloß einen Kaugummi hatte.
Unsere Fahrt ging weiter. Irgendwo am Horizont schien eine bleiche Sonne, und bald darauf war es wieder Nacht.
»Du musst schlafen«, sagte ich zu ihr, und endlich fand sie eine Stelle, wo sie uns halbwegs sicher glaubte, verriegelte die Türen und ließ den Sitz herunter. Sie schlief unruhig, ihre Augenlider zitterten. Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, sie zu bewachen, doch irgendwann übermannte auch mich der Schlaf.
Kaum war es hell, startete sie den Motor, und wir waren zurück auf der Straße. Ich beobachtete ängstlich den Zeiger für den Tankfüllstand, wir näherten uns dem roten Bereich.
»Hast du Geld für Benzin?«, fragte ich.
»Wird knapp.«
Kilometer um Kilometer rannen dahin.
Später tankte sie für dreißig Euro. Hinterm nächsten Autobahnabzweig fuhr sie langsamer, um Sprit zu sparen.
Mir wurde klar, dass wir uns im Zickzack durch das Land bewegten. Mutter hatte kein Ziel, und ich fürchtete, den Rest meiner Kindheit mit ihr im Auto verbringen zu müssen.
Einmal hielt sie an, um zu telefonieren. Ich wartete im Wagen auf sie. Als sie zurückkam, hatte sich ihre Stimmung gebessert. Sie wendete, und es ging zügig weiter.
Ihr Griff um das Lenkrad lockerte sich. »Wir fangen woanders neu an.«
Wie oft sie das schon zu mir gesagt hatte. Wie viele Träume geplatzt waren. Aber ich wusste, ich musste ihr Mut machen.
»Das schaffen wir«, sagte ich.
Auf einmal begann sie zu lächeln. Ihre Zahnlücke blitzte auf. Ich fand sie wunderschön.
Ich zählte erst die blauen Hinweisschilder, dann die gelben, nur um mich abzulenken.
Schließlich erreichten wir eine Stadt. Sie war größer als alle anderen, die ich jemals gesehen hatte. Hier war das Licht anders, die Straßen breiter, ein Strom von Menschen auf den Gehwegen. Staunend sah ich aus dem Fenster, während Mutter uns durch den dichten Verkehr kurvte.
»Bleiben wir hier?«, fragte ich.
Sie nickte. »Wir können eine Weile in der Wohnung einer Bekannten unterkommen. Sie ist zurzeit im Ausland.«
»Wohnen wir zur Untermiete?«
»Ja.«
»Ist es teuer?«
»Wir kommen klar.«
»Müssen wir danach wieder weg?«
Sie hob die Schultern. »Ich hoffe nicht.«
Und wieder versicherte ich ihr, dass wir es schaffen würden, nur um mir selbst Mut zu machen.
Ich sah ihr an, dass eine Last von ihr abfiel. Vielleicht waren wir in dieser Stadt endlich einmal in Sicherheit. Immer war Mutter an die falschen Männer geraten. Oft hatte sie zu viel getrunken. Wenn sie feiern ging, wie sie es nannte, ließ sie mich allein.
Ich wusste, sie trank nur, um sich zu trösten. Wenn der Schmerz sie überkam, griff sie zur Flasche. Sie hatte ihre Dämonen, und die teilte sie mit mir.
Als habe sie meine Gedanken gelesen, sagte sie: »Heute beginnt ein neues Leben.«
»Wirklich?«
Sie trommelte einen wilden Rhythmus auf das Lenkrad. »Versprochen.«
Ich beschloss, ihr zu glauben. Ich hatte keine andere Wahl.
Wir hielten vor einem Haus mit heller Fassade. Es sah freundlich aus. Bei einer Nachbarin war der Schlüssel hinterlegt. Schließlich öffnete Mutter unser neues Zuhause.
»Willkommen«, sagte sie strahlend und führte mich durch die Räume. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Hohe Decken, Stuckverzierungen, Parkettboden. Auch die Möbel sahen edel aus.
»Können wir uns das leisten?«
Sie verwuschelte mein Haar. »Das Glück ist endlich auf unserer Seite.«
Wir packten unsere Sachen aus. Mein Zimmer ging zum Hof hinaus, das Bett war bequem. Ich fürchtete, dass irgendetwas an der Sache faul war, aber ich ließ mir nichts anmerken, um Mutter nicht die Stimmung zu verderben.
Ich kannte sie nur allzu gut. Sie war mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Dazwischen gab es nichts für sie.
Sie hüpfte in ihrem Schlafzimmer auf der Matratze auf und ab, ausgelassen wie ein kleines Kind.
»Das gehört jetzt alles uns.«
Ich nickte.
»Mach mit«, rief sie und reichte mir die Hand.
Wir tanzten beide unseren Freudentanz.
Sie war so übermütig, dass sie abends unser Lieblingsessen zubereitete. Sie hielt nichts von gewöhnlichen Mahlzeiten. Manchmal gab es Frühstück am Abend und Gebäck zum Mittag, an anderen Tagen dafür gar nichts. Mutter aß, wann und wie sie Lust hatte, und ich hatte mich darauf eingestellt.
Sie rührte den Teig an, drückte ihn in die Formen, dann schob sie das Blech in den Ofen.
Bald füllte sich die Wohnung mit dem herb-süßen Duft nach Zimt, Nelken und Kardamom.
Nach einer Stunde zog sie das Blech heraus. »Wir essen sie von nun an jeden Tag. Ganz egal zu welcher Jahreszeit.«
Es machte mich froh, sie so glücklich zu sehen.
»Komm, du darfst den Ersten haben.«
Ich nahm einen der Lebkuchenmänner in die Hand und schaute in sein lächelndes Gesicht.
An diesem Abend schien das Glück tatsächlich auf unserer Seite zu sein.
Doch das Unheil ließ nicht lange auf sich warten.
Der Lebkuchenmann grinste zuckersüß.
Nur ein kurzes Zögern, dann biss ich ihm den Kopf ab.
EINS
SONNTAG, 19. NOVEMBER, ABENDS
Er mochte die Zeit, wenn es draußen dunkel wurde. Stille herrschte in seinem Atelier. Nur der Wind war zu hören, der leise ums Haus strich. Er liebte die intensiven Momente am Ende des Tages, da sich die Gedanken beruhigten und es nur ihn und sein Werk gab. Er tauchte in die Farben auf der Leinwand ein und war so fokussiert, dass sich das Bildnis, mit dem er beschäftigt war, wie von selbst erschuf.
Es störte ihn nicht, bei künstlichem Licht zu arbeiten. Er hatte verschiedene Tageslichtlampen aufgestellt, sie waren so ausgerichtet, dass keine Schatten fielen. In diesem Raum, etwa fünfzehn mal zehn Meter breit, verbrachte er nun schon seit vielen Jahren seine Abende. Er hatte den Überblick über die genaue Anzahl seiner Gemälde verloren. Nur seine Frau und sein Galerist führten darüber Buch. Er schätzte sich glücklich, von seiner Arbeit leben zu können. Doch letztlich war es ihm egal.
Robert Lumen war ein Kunstmaler, der ganz in seinem Werk aufging. Er saß kerzengerade auf dem Schemel vor der Staffelei, daneben ein Spiegel, in den er gelegentlich einen prüfenden Blick warf.
Mit einem Kohlestift hatte er eine Woche zuvor die Umrisse seines Gesichts auf die Leinwand aufgetragen. Danach hatte er lange auf dem Hocker gebrütet, dessen Holz vom stundenlangen Sitzen blank poliert war, und auf Eingebung gewartet. Es brauchte einige Zeit, bis er ein Gefühl für die richtige Farbgebung entwickelte.
Nun mischte er die Farben an, in der Linken die Palette, in der Rechten einen Rosshaarpinsel, und trug sie auf, gefühlvoll strichelnd, dann wieder großflächig markierend. Seine Bewegungen hatten Schwung, seine Mimik war hoch konzentriert.
Noch nie hatte er ein Porträt von sich selbst erschaffen. Doch nun, im Alter von Mitte fünfzig, hielt er es für an der Zeit, sein Gesicht für die Ewigkeit zu konservieren. Es war kantiger geworden, die Wangen schmaler, die Stirn höher, sein frühzeitig ergrautes Haar war längst schlohweiß.
Er fand es beschämend, andere Männer in den Fünfzigern hatten zum Teil noch dunkle Haare. Mit einem eleganten Silber wäre er schon zufrieden. Während er den Pinsel führte, zwang er sich, liebevoller über sein Äußeres zu denken, doch die großen Ohren störten ihn, die Wulst über seinen Augen, die buschigen Brauen.
Seine Frau Karla wurde nicht müde zu betonen, er habe einen Charakterkopf.
Lumen mengte Blau für seine Augen in das Gemälde, vermischte es mit Weiß. Die Augen waren das Schwierigste, das wusste er aus langjähriger Erfahrung.
Werk für Werk mühte er sich ab, die Menschen, die er porträtierte, mit einem besonderen Augenaufschlag abzubilden, der ihn seit seiner Jugend beschäftigte.
Es war der Grund, weshalb er Kunst studiert hatte.
Auf all seinen Bildern schienen seine Modelle entrückt, verloren und doch wie erlöst zu sein. Beinahe selig schauten sie aus einer anderen Welt auf den Betrachter herab.
Lumen stand auf, entfernte sich von der Leinwand und dachte nach. Würde ihm das mit seinem Selbstbildnis auch gelingen? Er sah sich in seinem Atelier um. Seine jüngsten Arbeiten waren an die Wand gelehnt, allesamt Porträts von Frauen, Männern, die meisten alt, aber auch Jüngere waren darunter, sogar ein Kind.
Ihre Augen. Das war das Wichtigste. Nur darum ging es ihm.
Diesen einen Blick einzufangen. Zu verewigen.
Er schaute in den Spiegel. Dann auf sein Porträt.
Er setzte sich wieder und arbeitete weiter.
Plötzlich war ihm, als würde er sich selbst als Toten malen. Er schauderte.
Unsinn, dachte er. Sind nur die Nerven. Wenn er mit einem neuen Bild begonnen hatte, vergaß er alles um sich herum und malte bis an den Rand der Erschöpfung. Karla warnte ihn häufig vor diesen Zuständen, mahnte ihn, er solle Pausen einlegen.
Doch sie wusste auch, wie wichtig der Schaffensdrang für ihn war. Das Grübeln, Skizzieren, die langen Planungsphasen für ein Gemälde, die mindestens ebenso wichtig waren wie der eigentliche Malprozess, drückten auf seine Stimmung, machten ihn gereizt. Nur wenn er endlich loslegen konnte und wie berauscht vom Geruch nach Farbe und Terpentin war, lief er zur Hochform auf.
Die Zeit verstrich. Das Bildnis wuchs. Er arbeitete am Hintergrund. Das weiße Haar, wild verwirbelt, sein markanter Kopf, der grimmig entschlossene Mund, all das schien aus den Farbflächen herauszustechen. Nun war die Wirkung der Augen noch stärker. Nur zu, dachte er, weiter so. Er traute sich mehr, spachtelte die Farbe, bis er wieder filigraner arbeitete, mit feinem Pinsel, manchmal berührte er mit der bloßen Fingerspitze die Leinwand und arbeitete sacht eine Kontur heraus.
Da ließ ihn ein Geräusch zusammenfahren. Es knackte, kurz darauf heulte es vorm Fenster.
Nur der Wind, versuchte er sich zu beruhigen. Doch die Konzentration war dahin.
Er hielt inne und lauschte. Das Heulen dämpfte sich zu einem Säuseln.
Wie Stimmen. Ganz entfernt meinte er, jemand riefe seinen Namen.
Lumen legte Pinsel und Palette weg, erhob sich von seinem Schemel und trat ans Fenster.
Es war Ende November, der Winter nahte. Ein eisiger Wind, der am Fenster rüttelte, das nicht richtig schloss. Die Tanne vorm Haus wogte hin und her.
Auf dem Rasen bewegte sich noch etwas. Sah aus wie eine Gestalt mit zerzaustem Haar. Etwas Helles blitzte auf, als sich kurzzeitig der Mond hinter den Wolken hervorschob und den Vorgarten in gleißendes Licht tauchte.
War das ein Gesicht?
Schon war es weg.
Möglicherweise ein Irrtum.
Achselzuckend wandte sich Lumen vom Fenster ab.
Ein erneuter Windstoß, und dann hörte er es so deutlich, dass er erneut zusammenzuckte.
Robert, wisperte eine Stimme.
Das kam nicht von draußen. Es war nicht der Wind.
Ich bin hier. Hier.
Er sah sich um. Das Gemurmel so nah, als sei es im Gebäude. Spielten ihm seine Nerven einen Streich? War er schon zu lange mit seinem Porträt beschäftigt?
Hier bin ich. Noch immer hier.
Er schaute auf die Gemälde an der Wand. Für einen Moment war ihm, als würde sich eines der gemalten Modelle bewegen.
Nein, das war nicht möglich.
Robert.
Die Stimme wirkte erschreckend echt.
So nah an seinem Ohr, als stünde jemand direkt hinter ihm. Hastig drehte er sich um. Doch da war niemand. Nur sein erschrockenes Gesicht, das sich in der Fensterscheibe spiegelte.
Plötzlich legte sich der Wind, und alles war still.
Bloß sein Herzschlag war zu vernehmen.
Verlor er allmählich den Verstand? Verbrachte er zu viel Zeit mit seiner Kunst?
Ich muss hier raus, dachte er. Kurzentschlossen wusch er die Pinsel aus und räumte die übrigen Arbeitsutensilien weg. Er warf einen letzten Blick auf sein Selbstporträt, dann schlüpfte er in seinen Mantel.
Er zog das Handy aus der Tasche und schaltete es ein.
Drei Textnachrichten in Abwesenheit, allesamt von Karla: Arbeitest du noch lange?
Eine Stunde später war die nächste eingetroffen. Wo bleibst du?
Und die letzte: Ich gehe jetzt zu Bett.
Lumen löschte das Licht und ging die Stufen ins Erdgeschoss hinunter. Er hatte dieses Haus schon vor vielen Jahren erworben. Es war alt und zugig, das Dach in schlechtem Zustand, das Mauerwerk feucht. Doch er mochte es. Er brauchte den Abstand zu seinem Privathaus, um in Ruhe arbeiten zu könne.
Er trat in den Vorgarten hinaus. Fröstelnd schlug er den Mantelkragen hoch.
Plötzlich berührte ihn etwas im Gesicht, und er wich entsetzt zurück.
Wieder fuhr das Mondlicht hinter den Wolken hervor.
Ein Gesicht starrte ihn an. Zwei Augen, ein geschwungener Mund.
Erst mit einiger Verzögerung erkannte er, was dort vor ihm hing. Es war mit einem Bindfaden an einem Zweig der Tanne befestigt.
Ein Lebkuchenmann, etwa so groß wie eine Hand. Augen und Mund aus Zuckerguss.
Das wie ein Mensch geformte Gebäckstück bewegte sich sacht hin und her.
Es lächelte ihn an.
Lumen brauchte mit dem Auto nicht länger als eine Viertelstunde bis nach Hause. Er sah an der Fassade hoch. Hinter dem Schlafzimmerfenster brannte Licht. Also war Karla wohl noch wach.
Der Gedanke kam heftig, und unwillkürlich presste er die Kiefer zusammen. Sie sollte lieber schlafen. Er wollte heute Abend nicht mehr mit ihr sprechen.
Sofort tat es ihm leid. Er musste geduldig mit ihr sein.
Er schloss auf, zog seinen Mantel aus und hängte ihn an die Flurgarderobe. Er ging so leise wie möglich nach oben, falls sie doch schon eingeschlafen war.
Langsam näherte er sich der angelehnten Tür und spähte ins Schlafzimmer. Das Bett war leer.
Er wandte sich um. Ein Streifen Licht unter der Tür zum Bad.
»Karla?«
Stille.
»Ja, Robert«, kam es schließlich leise zur Antwort.
»Alles in Ordnung bei dir?«
Ein Schweigen, das nichts Gutes verhieß.
Dann, kaum hörbar: »Hilf mir. Bitte.«
Beherzt öffnete er die Tür.
Das Erste, was er sah, war ihr Krückstock. Er lag auf dem Boden. Dann sah er ihre nackten Knie. Sie hockte auf dem Badewannenrand, trug ihr weißes Nachthemd.
»Was ist passiert?«
»Mir wurde schwindlig. Und jetzt schaffe ich es nicht mehr hoch.«
Er griff ihr unter die Arme und zog sie an sich. Wacklig kam sie zu stehen. Ihre Blicke trafen sich, und er atmete durch.
Sie war noch immer wunderschön. Ihr Haar glänzend, in ihren Augen dieser Schimmer, der ihn seit ihrer ersten Begegnung fasziniert hatte. Er musste daran denken, wie er sie das erste Mal zum Tanzen ausgeführt hatte. Ihre Bewegungen fließend und elegant, das lindgrüne Kleid, das sie getragen hatte. Ihr Lächeln, die Wärme ihrer Wange, als sie sich an ihn geschmiegt hatte.
Sie zitterte. »Ich wollte noch ein Bad nehmen.«
»Du sollst doch damit warten, bis ich zurück bin.«
»Aber es wurde spät. Und du hast auf meine Nachrichten nicht geantwortet.«
»Tut mir leid, Karla.«
Ihre Krankheit war unberechenbar. Mal gab es einen Schub, der sie zurückwarf und sie leiden ließ. Dann gab es Pausen, manchmal sogar leichte Besserungen. Doch stets drohte der nächste Schub. Wann er eintreffen würde, ließ sich nicht vorhersagen. Eine Autoimmunerkrankung, die das Nervensystem angriff. Nach Meinung der Ärzte hatte sie noch Glück gehabt. Andere Menschen mit Multipler Sklerose traf es stärker. Karla hatte einen äußerst schleichenden Krankheitsverlauf.
»Ich helfe dir, mein Liebling.«
Sie wog nicht viel. Robert trug sie hinüber ins Schlafzimmer und legte sie behutsam aufs Bett. Liebevoll deckte er sie zu.
Ihr Blick war weich. »Ich will dir nicht zur Last fallen.«
»Tust du nicht.«
Einen Moment stand er reglos da und schaute auf sie herab. Seltsamerweise musste er an den Lebkuchenmann denken. Wer zum Teufel hatte sich diesen Scherz mit ihm erlaubt?
»Kommst du auch schlafen?«, fragte sie.
Er setzte sich zu ihr auf den Bettrand. »Ich bin noch zu aufgewühlt.«
»Dein Selbstporträt?«
»Ja.«
»Es wird ein großartiges Werk, Robert, davon bin ich überzeugt.«
Er liebte Karla. Nicht nur für ihre sanfte Art, ihre Schönheit, den Mut, den keine Krankheit brechen konnte, sondern auch für ihre Klugheit, den Kunstverstand.
Er drückte ihre Hand. »Vor meinem Atelier hing ein Lebkuchenmann.«
»Wie bitte?«
»Du weißt doch, dieses Weihnachtsgebäck. Jemand hat es an die Tanne gehängt. Mit einem Bindfaden.«
»Wie sonderbar.«
Plötzlich richtete sie sich auf und legte beide Händen an seine Wangen. »Versprich mir eines, Robert.«
»Was denn?«
»Verlass mich nicht.«
»Aber warum sollte ich das tun?«
»Du hast mich als gesunde Frau kennengelernt.«
Er küsste sie so rasch auf den Mund, dass sie leicht zusammenzuckte. »Niemals verlasse ich dich.«
Auf einmal wurde ihm kalt. Er hob die Schultern.
Wieder dachte er an das lächelnde Gesicht aus Zuckerguss.
Es war eine Vorahnung, die ihn traf wie ein eisiger Windhauch. Es wird etwas Böses geschehen, dachte er.
Etwas sehr Böses.
ZWEI
Die Gestalt war ihr sehr nah. Sie sprach zu ihr. Doch Katrina konnte die Worte nicht genau verstehen. Ängstlich sah sie auf einen großen, roten Mund. Wulstige Lippen, sie waren riesig, schnappten auf und zu.
Katrina wollte sich umdrehen, weg von diesem Gesicht. Doch es ging nicht, sie war wie gelähmt.
Sie spürte heißen Atem auf ihrer Haut, begann zu schwitzen.
Dann wurde sie bei ihrem Namen gerufen.
»Katrina?«
»Ja?«, fragte sie zögernd.
»Das Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben.«
Eine Geste mit der Hand, als würden sich die Lippen für immer verschließen.
Die Gestalt beugte sich noch weiter vor. Das Gesicht weiß, kalkweiß.
»Auch du darfst es nicht verraten. Hörst du?«
»Ja«, entgegnete sie.
»Kein Mensch darf je davon erfahren.«
Sie nickte.
Und plötzlich drang ein seltsames Kichern aus dem übergroßen Mund. Es war verstörend. Denn es erinnerte mehr an ein Schluchzen. Mal glucksend, dann wimmernd.
Auf einmal wurde Katrina an den Schultern gepackt. »Du musst schweigen wie ein Grab.«
Ein modriger Geruch stieg ihr in die Nase. Das Lachen, das wie ein Weinen klang, giggelnd und jammernd zugleich, verstärkte sich zu einem Dröhnen. Katrina wälzte sich herum.
Es gab einen Sprung in ihrer Wahrnehmung.
Sie stand vor einer Tür, tastete nach der Klinke. Rüttelte daran. Endlich war sie draußen. Ihre nackten Füße auf dem kalten Dielenboden.
Sie irrte umher. Noch eine Tür. Sie öffnete sie.
Katrina stieß sich den Fuß an.
Und dann schrie jemand laut auf.
Das Licht ging an. Sie starrte in ein anderes Gesicht. Erst allmählich begriff sie, wo sie sich befand.
»Katrina!«
Es war ihre Mutter. Sie saß aufrecht im Bett. Katrina stand vor ihr, schlaftrunken, verwirrt.
»Mama?«, fragte sie leise.
»Du hast mich zu Tode erschreckt.«
Katrina atmete durch. »Wie bin ich hierhergekommen?«
Der Blick ihrer Mutter war vorwurfsvoll. »Erklär du es mir.«
»Hab ich dich geweckt?«
»Natürlich hast du das. Es ist mitten in der Nacht.«
War es ihr wieder passiert? Offenbar war sie aufgestanden, ohne es mitbekommen zu haben.
Wie zur Bestätigung sagte ihre Mutter streng: »Du hast geschlafwandelt.«
»Tut mir leid.«
»Kind, so kann das nicht weitergehen.«
»Ich mache es nicht mit Absicht.«
Ihre Mutter verdrehte die Augen. Dann ließ sie sich aufs Kissen zurücksinken.
»Wirklich, Mama, ich kann es nicht steuern.«
»Vielleicht muss ich mit dir zu einem Psychologen.«
Sie sprach es aus, als sei es die schlimmste Sache der Welt. Katrina schämte sich dafür. Offenbar gingen nur Versager zum Seelenklempner. Hatte sie etwas Verbotenes getan? Wie Bettnässen? War Schlafwandeln wie Schmutz? Wie sich nicht die Hände waschen? Mit dreckigen Fingernägeln an den Frühstückstisch? In der Nase bohren und hinter Mutters Rücken Grimassen schneiden?
Sie könnte die Liste unendlich fortführen. Oft beruhigte es sie, sich Unartigkeiten auszudenken. Verhaltensweisen, die ihre Mutter nervten. Es war anstrengend, für sie das gute Kind zu sein.
Katrina war eine Meisterin der Verstellung. In ihrem Kopf waren verschlossene Kammern, darin eingesperrt all die Gedanken, die ihre Mutter böse fand.
Unwillkürlich veränderte sie ihre Stimme, fragte im kindlichen Tonfall, obwohl sie schon zwölf war: »Darf ich zu dir, Mama? Nur für einen Moment?«
Es war ein Trick, der manchmal funktionierte. Das Herz der Mutter erweichen, sich kleinmachen.
Doch es kam keine Antwort.
»Eine Minute kuscheln?«
Wieder nichts.
»Eine halbe?«
Endlich hob ihre Mutter die Bettdecke an. »Also schön. Aber nur kurz.«
Im Nu war Katrina bei ihr. So warm war es an ihrer Seite, halbwegs sicher.
Und doch nagte das Schuldgefühl an ihr. Wenn Mutter aus dem Schlaf gerissen wurde, kam sie oft nicht mehr zur Ruhe. Das verhieß auch für den nächsten Tag nichts Gutes. Ihre Launen konnten aufreibend sein, und Katrina gelang es selten, sie aufzuheitern. Wenn sie doch endlich wieder bei ihrem Vater sein könnte.
Die Mutter sah sie an.
»Was ist denn los, Schätzchen? Hast du schlecht geträumt?«
»Kann sein.«
»Keine Erinnerung daran?«
»Nur wenig.«
»Immer derselbe Traum?«
»Ja.«
»Erzähl mir nicht, was passiert ist. Sonst träume ich selbst davon.«
Plötzlich erinnerte sich Katrina an den großen, roten Mund. Die fiesen Lippen. Den Grabgeruch.
Eigentlich wäre sie bereit gewesen, darüber zu sprechen, doch es war wohl besser, zu schweigen.
»Man kann seine Albträume beeinflussen«, sagte ihre Mutter. »Hab einen Artikel darüber gelesen.«
»Wie soll das funktionieren?«
»Denk dir am Abend einen guten Schluss dafür aus. Vor dem Schlafengehen nimmst du dir fest vor, wie dein Traum enden soll. Ist da ein Monster, schickst du es weg und sperrst es aus.«
»So einfach ist das?«
»Imagination. Sich eine Tür vorstellen. Und einen Schlüssel. Die Tür abschließen. Das Böse draußen lassen. Du musst es trainieren. Es dir immer und immer wieder vorstellen.« Nach einer Pause fügte sie hinzu: »Ich hatte auch Albträume, als uns dein Vater verlassen hat.«
Katrinas Rücken verkrampfte sich. Sie mochte es nicht, wenn ihre Mutter so über den Vater sprach.
»Du kannst deine Träume beherrschen. Mit viel Disziplin. Ich hab es geschafft. Einen Schlüssel und eine Tür imaginieren. So bleibst du vom Bösen verschont.«
»Ich will es versuchen.«
»Gut.«
Neulich Nacht hatte ihre Mutter sie im Garten erwischt. Am Baumhaus. Mutter mochte das Baumhaus nicht. Denn Vater hatte es gebaut. Sie hatte an ihren Schultern gerüttelt. Mit ihr geschimpft. Aufwachen. Schlafwandlerin. Du holst dir noch den Tod.
Sich draußen im Garten den Tod holen. Böser Gedanke. Gehörten die roten Lippen zu ihrer Mutter? Träumte sie deshalb davon?
Wulstige Lippen. Schweigen wie ein Grab. Mit einem Seelenklempner darüber reden. Doch der war nur etwas für Verlierer.
»Genug jetzt. Ich muss schlafen.«
Katrina verstand. Die halbe Minute war längst um. Gehorsam stand sie auf.
»Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Kind.«
Zurück in ihrem Zimmer, im eigenen Bett, ballte sie die Hand zur Faust.
Sie flüsterte: »Ich hasse dich, Mama.«
Schon tat es ihr leid. Darum murmelte sie dreimal hintereinander: »Hab dich lieb.«
Am nächsten Morgen war sie sehr früh wach. Stille im Haus. Die Mutter schlief offenbar noch.
Katrina stand auf, duschte, zog sich an und ging hinunter in die Küche. Sie setzte Kaffee für ihre Mutter auf. Das würde sie vielleicht freuen, zumindest ihre Laune bessern.
Danach machte sie sich einen Kakao, nahm die dampfende Tasse und trat ans Fenster. Sehnsüchtig schaute sie in den Garten hinaus, halbdunkel in der Dämmerung, verlockend und geheimnisvoll. Wenn sie leise und rechtzeitig zurück war, könnte sie noch vor der Schule ins Baumhaus klettern, ohne dass die Mutter es merkte.
Sie schlüpfte in ihren Mantel, zog sich Schuhe an, nahm die Tasse und ging durch die Hintertür hinaus. Erleichtert sog sie die kühle Morgenluft ein.
Im Haus fühlte sie sich beengt, hier draußen war ihr wohler.
Sie ging zu der großen Linde weiter hinten im Garten und sah an der Strickleiter hinauf. Wehmütig dachte sie an ihren Vater. Vor der Trennung ihrer Eltern hatte sie viele Nachmittage mit ihm dort oben verbracht.
Selbst als das Baumhaus fertig war, kamen ihm immerzu Ideen für Verbesserungen, kleine Anbauten und spezielle Ausstattungen. Begeistert hatte er gesägt, gehämmert und gebohrt, um das Haus für sie zu einem besonderen Ort zu machen.
Sogar einen Lastenaufzug, wie er es nannte, hatte er für sie gebaut. Es war ein Flaschenzug mit einem stabilen Korb. Darin stellte sie nun ihre Tasse mit dem Kakao ab und zog sie vorsichtig an den Schnüren hinauf.
Schließlich stieg sie die Hängeleiter hinauf und kletterte ins erste Stockwerk. Es gab noch ein zweites, eine sogenannte Aussichtsplattform, die man von der unteren Etage aus erreichen konnte, ebenfalls über eine Strickleiter. An diesem Ausguck hatte Vater besonders intensiv gebaut. Sie war gerne mit ihm hoch oben gewesen, beinahe schon im Baumwipfel.
Doch in letzter Zeit mied sie diesen Bereich. Neuerdings wurde ihr dort schwindlig, und sie bekam es mit der Angst zu tun.
Sie nahm die Kakaotasse aus dem Korb, setzte sich auf den Holzboden und schmiegte sich in ihre Lieblingsecke am Geländer, die sie mit einer Baumwolldecke ausstaffiert hatte. Ihrer Mutter gefiel das nicht, nach ihrer Meinung könnte sie in der Feuchtigkeit Stockflecken bekommen.
Oft waren sie darüber in Streit geraten, doch Katrina hatte sich ausnahmsweise durchgesetzt. Seit ihrer früheren Kindheit war das ihre Kuscheldecke. Sie brauchte sie hier oben.
Auch zwei Windlichter und eine Packung Streichhölzer lagen für sie parat. Manchmal zündete sie die Kerzen an, um es besonders gemütlich zu haben.
Fröstelnd hüllte sie sich in ihre Decke und schlürfte den Kakao.
Dann betätigte sie den Schalter, den ihr Vater am Geländer angebracht hatte, mit spezieller Isolierung für den Außenbereich, und die Lichterkette ging an.
Unzählige kleine Lichter, über die Zweige verteilt. Sie tanzten sachte im Wind.
Wie Glühwürmchen, hatte ihr Vater einmal gesagt.
Halb beglückt, halb melancholisch sah Katrina in den erhellten Baum, blinzelte in sein leuchtendes Geäst.
Sie drückte sich noch enger in die Ecke vor dem kleinen Tisch, den Vater für sie gebaut hatte. Darauf legte sie ihre Bücher ab, wenn sie an den Nachmittagen hier oben las. Im Frühjahr unterm noch hellgrünen Laub, den Sommer über im kühlenden Schatten, im Herbst und Winter im Schein einer Taschenlampe, bis ihr entweder so kalt war, dass sie es nicht mehr aushielt, oder ihre Mutter sie rief und vor einer Erkältung warnte.
Da fiel ihr Blick auf etwas, das sie irritierte.
Was war das?
Dort auf dem Tisch.
Zwei Augen schauten sie an. Ein Mund lächelte ihr zu.
Katrina streckte die Hand danach aus.
Es war ein Lebkuchenmann, ziemlich groß, etwa zwanzig Zentimeter lang.
Sie nahm ihn auf und betrachtete ihn genauer. Das Gesicht war aus Zuckerguss gestaltet. Ein würzig-süßlicher Duft nach Weihnachten, Nelken, Kardamom und Zimt stieg ihr in die Nase.
Ob den ihre Mutter für sie gebacken hatte? Eine Leckerei als Zeichen der Versöhnung, weil sie in letzter Zeit nicht gut miteinander ausgekommen waren? Als Überraschung für sie bereitgelegt?
Mama wusste doch, wie gerne sie hier oben saß, auch schon vor der Schule.
Katrina stellte die Tasse mit dem Kakao ab und führte den Lebkuchenmann an ihren Mund. Ein kurzes Zögern, dann biss sie ihm den rechten Arm ab, danach den linken. Genüsslich kauend, nahm sie sich erst den einen Fuß vor, dann den anderen.
Der Geschmack war herrlich, herb und süß zugleich, pfeffrig und zuckrig.
Doch dann verzog sie das Gesicht.
Da war etwas, was entschieden nicht hineingehörte.
Voller Ekel zog sie es sich aus dem Mund.
In dem Gebäckstück waren Haare. Blond. Ein ganzes Büschel davon.
Niemals würde ihre Mutter beim Backen so unachtsam sein. Außerdem war sie nicht blond.
Angewidert spuckte Katrina aus.
Von wem war dieser Lebkuchen? Und wer um alles in der Welt war auf ihr Baumhaus geklettert?
In diesem Moment erschien ihre Mutter an der Hintertür zum Garten.
»Katrina«, rief sie.
Der Tonfall war scharf.
»Komm runter. Du wirst dich noch erkälten.«
Katrina sog die Luft ein. Sie durfte ihrer Mutter nichts davon erzählen. Essen von Fremden. Ausgefallene oder ausgerissene Haare. Mangelnde Hygiene. Das würde sie wütend machen.
Entsetzt ließ Katrina die Reste des Lebkuchenmanns fallen. Nur der Kopf war übrig geblieben.
Die Augen schienen zu blinzeln. Der Mund aus Zuckerguss lächelte sie an.
DREI
MONTAG, 20. NOVEMBER, MORGENS
Carlotta Weiss trat Viertel nach sechs aus dem Haus. Es war noch dunkel draußen. Sie bemühte sich um einen aufrechten, federnden Gang. Erst neulich hatte sie in einer psychologischen Abhandlung gelesen, dass die Körperhaltung eines Menschen entscheidenden Einfluss auf sein Gefühlsleben hatte. Angeblich reichte es aus, das Kinn zu heben, die Schultern zurückzurollen und die Brust rauszustrecken, um sich stark und selbstbewusst zu fühlen.
Sie hatte ihre Zweifel, und dennoch versuchte sie es. Als sie von der Bötzowstraße in die Hufelandstraße einbog, kam ihr ein Passant entgegen und warf ihr einen verwunderten Blick zu. Wahrscheinlich wirkte ihre Haltung albern und aufgesetzt. Schon ließ Carlotta die Schultern wieder hängen, senkte den Kopf und verlangsamte ihren Schritt.
Besser so, dachte sie, passt eher zu einem nasskalten Novembermorgen.
Sie war nervös. Etwas Neues stand an, und das machte ihr Angst. Carlotta war ein Freigeist, eine Einzelgängerin, sich auf ein Team einzulassen und das für einen längeren Zeitraum, war nicht ihre Sache. Fluchtgedanken meldeten sich, und doch mahnte sie eine innere Stimme, sich endlich der Herausforderung zu stellen. Sie konnte doch nicht ewig ausweichen. Nächtelang hatte sie darüber gegrübelt. Heute Morgen stand die Entscheidung an. Noch war sie sich nicht sicher, wie ihre Antwort lauten würde.
Auch in der letzten Nacht hatte sie kaum ein Auge zugedrückt. War drauf und dran gewesen, Nils Trojan anzurufen und ihn um Rat zu bitten. Aber sie wusste ja, wie er über die Sache dachte. Er glaubte fest daran, dass sie sich durchkämpfen würde.
Nur sie selbst nicht.
Es war schon merkwürdig. Da hatte sie ihr Studium in Rekordzeit und mit Auszeichnung abgeschlossen, ganz nebenbei die Polizeiakademie absolviert, sich als Frau im Machogehabe der Kripo durchgesetzt, und dennoch nagte ständig das Gefühl an ihr, nicht zu genügen.
Lag es daran, dass ihre Mutter zu früh gestorben war? Ihr Vater ihr nicht genug Halt und Anerkennung geboten hatte?
Oder war Inga der Grund? Hatte es damit zu tun, dass sie von dieser Person abgrundtief gehasst wurde?
Carlottas Magen verkrampfte sich. Bloß nicht daran denken. Das könnte ihr heute Morgen den Rest geben.
Doch als Psychologin wusste sie nur allzu gut, dass der Versuch, Gedanken zu unterdrücken, nahezu unmöglich war.
Die schmerzhaften Erinnerungen an ihren letzten Fall würden sie so schnell nicht loslassen. Das musste sie akzeptieren.
Das Urteil war unumstößlich. Lebenslange Haft für eine der gefährlichsten Serienmörderinnen in der Geschichte der Bundesrepublik. Niemand anderes als Carlotta selbst hatte dafür gesorgt, dass Inga hinter Schloss und Riegel saß.
Man hatte ihr zu diesem Erfolg gratuliert. Sollte sie sich etwa darüber freuen?
Auch das war nicht möglich. Auf ihrer Familie würde ewig ein Schatten lasten. Und Carlotta Weiss war nun für immer die Profilerin, die ihre eigene Schwester zur Strecke gebracht hatte. Eine Bürde, mit der sie leben musste.
Gebückt ging sie weiter.
Erst als sie ihren VW-Bus erreicht hatte, wurde ihr ein wenig leichter ums Herz. Luisa, ihr geliebter Bulli, das legendäre Modell Helsinki. Hellblau, leicht verbeult, mit rostigen Stellen, das Aufstelldach nicht mehr ganz dicht. Sie hatte ihn von ihrer Mutter geerbt und nach ihr benannt.
Unbeschwerte Luisa. Hippiefrau in Schlaghosen. Kein Tag verging, an dem sie sie nicht vermisste.
Carlotta schloss auf und setzte sich ans Steuer.
Sie atmete durch. Der Bus war ein wichtiger Rückzugsort für sie. Schlafraum, Küche und mobiler Arbeitsplatz in einem. Am liebsten würde sie sämtliche Ermittlungen von hier aus durchführen. Sacht strich sie über den Flokati, mit dem ihre Mutter die Armaturen ausgelegt hatte, und schob eine Kassette in die altmodische Stereoanlage. Es war Dark Side Of The Moon von Pink Floyd. Sie spulte vor bis »Brain Damage«, lauschte dem Gesang von Roger Waters, lehnte sich zurück und schaute verträumt auf die Discokugel, die von der Decke hing.
»Auch ich werde dich auf der dunklen Seite des Monds wiedersehen.«
Carlotta fuhr zusammen.
Die Stimme war deutlich an ihrem Ohr. Ein entsetzter Blick in den Rückspiegel, und da war sie.
Inga auf der Rückbank des Bullis. In Häftlingskleidung, ein schmales Lächeln auf den Lippen.
Nur eine Halluzination, durchfuhr es Carlotta. Kann vorkommen bei Übermüdung und Stress.
Sie presste die Augen zusammen. Doch als sie erneut in den Rückspiegel sah, war ihre Schwester noch immer da.
»Hau ab. Du hast in meinem Leben nichts mehr zu suchen.«
Inga grinste. »Aufgeregt vor deinem ersten Arbeitstag?«
Carlotta zwang sich, ruhiger zu atmen.
Nach einer Pause meldete sich erneut die unheimliche Stimme von der Rückbank. »Ich denke, du wirst sie alle beeindrucken.«
»Wieso?«
»Weil du mich hast.«
»Wie meinst du das?«
Inga lehnte sich vor. »Befrag die dunkle Seite des Monds. Besuch mich im Knast. Dein böses Schwesterherz kann dich künftig beraten.«
»Niemals.«
»Aber warum denn nicht? Ich werde dir helfen.«
»Wir haben uns nichts mehr zu sagen.«
»Ach nein? Überleg doch mal. Wer kann sich besser in die Seele eines Mörders hineinversetzen als jemand, der schon ein paar Menschen abgeschlachtet hat?«
Energisch startete sie den Motor.
Sie versuchte auszuparken, ohne in den Rückspiegel zu schauen, manövrierte vor und zurück.
Schließlich scherte sie aus der Parklücke aus und fuhr los.
Als sie in die Greifswalder Straße einbog, war Inga endlich fort.
Sie parkte ihren Bulli auf dem Hof des Kommissariats und schaute zur Uhr. Zehn Minuten vor sieben.
Sie verließ den Wagen, ging ins Innere des Gebäudes und stieg die Treppe hinauf.
Ihre Schritte hallten im Flur. Sie hob das Kinn, straffte die Schultern. Vielleicht half es ja doch, ihre Unsicherheit zu kaschieren.
Sie blieb vor der Bürotür stehen und horchte auf ihr pochendes Herz.
Ein letzter prüfender Blick auf ihr Handy. Es war eine Minute vor sieben.
Carlotta Weiss zählte die Sekunden runter. Um punkt sieben klopfte sie an die Tür.
»Herein.«
Landsberg empfing sie mit einem strahlenden Lächeln.
»Carlotta.« Er kam hinter seinem Schreibtisch hervor, eilte auf sie zu und drückte ihr fest die Hand. »Guten Morgen.«
Sie war überrascht. Diese Dynamik und Freundlichkeit kannte sie nicht von ihm.
»Hallo«, murmelte sie.
»Setz dich doch.« Er wies auf einen Stuhl. Auch dass er sie plötzlich duzte, war ihr neu.
Sie nahm Platz.
Zu ihrer Verwunderung setzte er sich auf die Kante seines Schreibtischs. Er war ihr so nah, dass sein Knie beinahe ihre Hüfte berührte. Sie hatte ihn als einen eher zurückhaltenden Menschen kennengelernt. Instinktiv rückte sie ein Stück von ihm ab.
Auch äußerlich hatte er sich verändert. Er trug einen dunklen Anzug, ziemlich lässig geschnitten, beinahe jugendlich und dennoch korrekt. Und was war mit seinen Haaren passiert? Es waren nicht mehr viele, schon ziemlich angegraut, aber die elegante Stirnlocke stand ihm gar nicht schlecht. Vielleicht hatte er den Friseur gewechselt.
Eine kürzliche Trennung? Hatte er eine Affäre? Oder erhoffte er sich eine? Sie sah auf seine Hände. Den Ehering trug er noch. Daran konnte es wohl nicht liegen.
»Schön, dass du so früh kommen konntest.«
»Keine Ursache.«
Es entstand eine Gesprächspause.
Sein permanentes Lächeln machte sie misstrauisch. Was war hier los? Als sie bei ihrem letzten Fall auf Trojans Veranlassung hin mit der fünften Mordkommission zusammengearbeitet hatte, war der Chef ihr gegenüber bloß abweisend und kühl gewesen.
Versuchte er, sie aus irgendeinem Grund zu umgarnen? War der Vorschlag, den er ihr am Telefon unterbreitet hatte, so wichtig für ihn? Oder war das alles bloß Show?
»Also.« Landsberg schlug die Hände zusammen, noch so eine Geste, die sie nicht von ihm kannte.
Er stand auf und ging federnden Schritts durch sein Büro. Die Schultern gestrafft, das Kinn gestreckt. Hatte er etwa die gleiche Abhandlung wie sie gelesen? Bisher war er ihr stets etwas hüftsteif vorgekommen, verhalten, mit einer gewissen Strenge.
»Ich erwähnte es ja bereits am Telefon: Die Polizeipräsidentin rief mich an.«
Er betonte es, als sei es ein Anruf aus dem britischen Königshaus gewesen. Er kam wieder zu ihr, setzte sich erneut auf die Tischkante und drückte sacht ihren Arm. Carlotta war irritiert. Sie nahm etwas Frisches, Minziges an ihm wahr. War das sein Rasierwasser, oder hatte er einen Lutschbonbon in seinem Mund versteckt?
Zu ihrer Erleichterung nahm er die Hand schnell von ihr weg.
»Das ist ein aufregender Moment«, sagte er.
»Ja?«
»Solche Anrufe verheißen normalerweise nichts Gutes. Entweder es wird Druck gemacht. Oder es geht um Stellenstreichungen. Wir leben in schlechten Zeiten.«
»Hmm.«
»Doch diesmal war es wie ein Neubeginn.«
Carlotta wartete ab.
»Die Präsidentin hat mir eine neue Planstelle versprochen. Für meine Mordkommission.«
»Das sagten Sie bereits am Telefon.«
Eine Irritation machte sich in seinem Gesicht breit. »Waren wir nicht beim Du?«
»Natürlich«, entgegnete sie rasch.
Er runzelte die Stirn. »Ich bin mir sicher, dass wir uns von Anfang an geduzt haben. Ist doch eigentlich selbstverständlich bei uns.«
So war es aber nicht. Carlotta tat sich ohnehin schwer damit. Sie brauchte Distanz, besonders zu Landsberg. Doch sie wollte nicht unhöflich erscheinen.
Nach einer Pause schlug er erneut die Hände zusammen. Er ist mindestens so verunsichert wie ich, dachte sie.
Er hob die Stimme. »Kommen wir endlich zur Sache. Wie ist deine Entscheidung, Carlotta?«
Sie zögerte.
Der Chef musterte sie. Je länger sie schwieg, desto schmaler wurde sein Lächeln.
Schließlich begann sie leise: »Sie wissen ja … du weißt ja, dass ich nicht gerne im Team arbeite.«
Seine Lippen verkniffen sich. »Richtig.«
»Zuletzt ließ man mir bei meinen Tätigkeiten als Kriminalpsychologin gewisse Freiheiten.«
»Schon klar.«
Offenbar wurde er in seiner Absicht, freundlich zu erscheinen, von ihr auf eine harte Probe gestellt. Er erhob sich und nahm nun doch hinter seinem Schreibtisch Platz.
»Darum …«
Er fiel ihr ins Wort. »Ich will ehrlich zu dir sein. Anfangs hatte ich meine Schwierigkeiten mit dir. Doch du hast dich bei unserem letzten Fall bewährt, trotzdem du sehr eigenwillig vorgegangen bist. Und du hast in Nils Trojan einen großen Fürsprecher. Er hält große Stücke auf dich. Und da wir in letzter Zeit chronisch unterbesetzt waren, dachte ich nach dem Anruf der Polizeipräsidentin sofort an dich.«
»Das weiß ich zu schätzen.«
»Und ich habe dir ausreichend Bedenkzeit gewährt.«
»Natürlich.«
Er breitete die Hände aus. »Gibt es noch irgendein Problem? Hast du Fragen?«
»Nein.«
»Also?«
Er mag mich nicht, durchfuhr es sie. Er kann mich einfach nicht leiden. Warum unterbreitet er mir dann dieses Angebot? Hatte Nils Trojan so viel Einfluss auf ihn?
Nein. Ganz im Gegenteil. Landsberg war nicht der Typ, der sich in seine Arbeit reinreden ließ.
Und plötzlich kam ihr ein furchtbarer Verdacht: Er will mich verheizen. Er möchte zusehen, wie ich versage. Aus irgendeinem Grund möchte er es Trojan damit heimzahlen. Ihm zeigen, dass er sich in mir irrt. Es passt ihm einfach nicht, dass Nils sich für mich einsetzt.
»Komm schon, Carlotta. Spann mich nicht auf die Folter. Andere würden ihr letztes Hemd für diesen Posten geben.«
Da brachte sie es wie zum Trotz hervor: »Ich bin dabei.«
»Tatsächlich?«
»Ja, ich möchte Teil dieses Teams werden.«
Kein Lächeln mehr, dafür ein Blick, kühl und überlegen, wie sie ihn von Landsberg kannte. »Ich wusste es. Es ist ein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. Gut so. Herzlich willkommen in der fünften Mordkommission.«
»Danke.«
»Kommen wir gleich zu den Details.«
Sie wurde hellhörig. »Ja?«
Er holte tief Luft. »Nils hat sich für dich stark gemacht, dich sogar als potenzielle Nachfolgerin vorgeschlagen für den Fall, dass er sich mal aus dem Job zurückzieht. Er ist ja älter als du. Darum möchte ich herausfinden, ob du dich bei uns auch in höchster Position bewähren kannst. Die Planstellen sind ja leider festgeschrieben, dennoch möchte ich deinen Aufgabenbereich variabel gestalten.«
»Und das heißt?«
»Ich möchte, dass du bei uns arbeitest, als wärst du die erste Ermittlerin. Du kommst also in der Rangfolge direkt nach mir.«
Sie war überrascht. »Aber das ist doch Trojans Posten.«
»Natürlich. Und den wird er vorerst auch behalten. Trotzdem sollst du einige seiner Aufgaben mit übernehmen.«
»Wie stellst du dir das vor?«
»Ich verlange von dir vollen Einsatz.«
»Das steht außer Frage. Ich gebe immer mein Bestes.«
»Du agierst künftig, als seist du die leitende Ermittlerin.«
»Ich will Trojan keine Konkurrenz machen.«
»Solltest du aber, wenn du tatsächlich deine Zukunft in diesem Team siehst. Trojan ist mein bester Mann. Und wenn er schon dermaßen von deinen Fähigkeiten überzeugt ist, musst du dich auch vor den anderen beweisen. Zeig mir und dem gesamten Team, dass du die Größe hast, seinen Posten zu übernehmen.«
Carlotta stieg Hitze ins Gesicht. Sie lag also richtig mit ihrer Einschätzung. Und Landsberg schien sogar noch einen Schritt weiterzugehen. Offenbar wollte er einen Keil zwischen sie und Trojan treiben.
»Ich glaube nicht, dass sich Nils in absehbarer Zeit zurückziehen wird.«
Landsberg wiegte den Kopf. »Zuletzt wirkte er ein wenig ausgebrannt auf mich. Außerdem ist mir nicht entgangen, dass er eine Liebesbeziehung zu einer Kollegin im Team unterhielt, obwohl er das stets abgestritten hat.«
Stefanie Dachs, dachte sie.
»Ein Fehlverhalten und eine Lüge, die mein Verhältnis zu ihm belastet haben.«
Das also war der Grund.
»Bei allem Respekt. Bitte versuch nicht, Trojan und mich gegeneinander auszuspielen.«
»Ich will dir lediglich die Voraussetzungen klarmachen, unter denen du hier arbeitest.«
»Es ist also eine Probe«, sagte sie forsch.
»Nennen wir es eine Herausforderung. Wir haben eine hohe Aufklärungsquote, und die fünfte Mordkommission verfügt über einen hervorragenden Ruf, der sogar über die Stadtgrenzen hinausreicht.« Wieder dieses falsche Lächeln. »Wenn wir uns nun mit einer Mitarbeiterin wie dich verstärken, die Hauptkommissarin und Profilerin in einer Person ist, sind das beste Voraussetzungen, oder etwa nicht?«
Er sagte es überaus freundlich, und doch klang es wie eine Drohung.
Carlotta schwieg.
»Bist du noch immer einverstanden?«
»Ich stehe zu meinen einmal getroffenen Entscheidungen.«
»Sehr gut.«
»Weiß Nils von deinen Plänen?«
»Nein. Ich denke, es ist besser, wenn dieses Gespräch unter uns bleibt.« Er lehnte sich vor. »Ich behalte dich im Auge, Carlotta. Und das Angebot ist eine einmalige Chance für dich. Also, bitte enttäusch mich nicht.«
Sie war um Haltung bemüht. »War es das?«
Er nickte, noch immer mit einem Lächeln. »Ich habe dir ein Büro am Ende des Flurs freiräumen lassen.«
Sie stand auf. »Vielen Dank.«
»Auf gute Zusammenarbeit.«
Wortlos verließ sie den Raum.
Niemand kam ihr entgegen. Das Kommissariat wirkte verstörend leer. Am Ende des Gangs entdeckte sie ihren Namen auf einem kleinen Schild.
Sie blieb stehen, drückte nach einer Pause die Klinke und öffnete.
Es gab ein lautes Krachen.
Die Tür stieß gegen den Schreibtisch.
Sie trat ein und sah sich um. Ihr neuer Arbeitsplatz war nicht viel größer als eine Abstellkammer.
Ihr erster Impuls war, alles hinzuschmeißen und Landsberg eine wüste SMS zu schreiben. Ihr fielen verschiedene Beschimpfungen dafür ein.
Doch dann atmete sie durch.
Jetzt erst recht, dachte sie.
VIER
MONTAG, 20. NOVEMBER, NACHTS
Marianne Fries schreckte aus dem Schlaf hoch. Ein Geräusch hatte sie geweckt.
Sie lauschte.
War jemand in ihrem Zimmer?
Plötzlich vernahm sie eine gedämpfte Stimme: »Der rote Mund.«
Sie stieß einen erstickten Schrei aus.
Kaum hatten sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt, bemerkte sie die Umrisse einer Gestalt.
Entsetzt knipste sie die Nachttischlampe an.
Da war tatsächlich jemand und starrte sie an.
Ihr Atem stockte.
Sekunden später erkannte sie ihre Tochter wieder. Sie trug den gestreiften Pyjama. Stand reglos vor ihr, die Augen geöffnet, mit einem seltsamen Schimmer darin.
»Katrina.«
Ihre Tochter reagierte nicht.
Marianne Fries legte die Hand auf ihren Brustkorb. Ihr Herz schlug laut und schnell.
»Verdammt«, entfuhr es ihr. Wieder dieses Schlafwandeln. Das musste aufhören.
»Der rote Mund«, wiederholte ihre Tochter. »Er macht mir Angst.«
»Du schläfst. Es ist nur ein Traum.«
Marianne stand auf und berührte Katrina am Arm. Diesmal wollte sie behutsamer vorgehen. Nicht an ihr rütteln, sie nicht wecken.
»Komm mit.«
Sie griff ihr unter die Achsel und schob sie vorsichtig hinaus in den Flur. Willenlos ließ es Katrina geschehen. Die Tür zu ihrem Zimmer war nur angelehnt.
»Du legst dich wieder hin.«
Schritt für Schritt führte sie Katrina zu ihrem Bett. Kein Widerstand von ihr. Doch ihre Bewegungen waren unheimlich. Ungelenk, ruckartig. Und ihre Augen wirkten leblos.
»Alles gut. Das gibt sich wieder.«
In ihrem tranceartigen Zustand ließ sich Katrina auf der Bettkante nieder.
»Hinlegen.«
Sie gehorchte.
Marianne setzte sich zu ihr und deckte sie zu. »Schließ die Augen, Kind.«
Keine Reaktion.
Marianne seufzte. »Augen zu, bitte.«
Ungeduldig strich sie ihrer Tochter über den Kopf. Doch Katrinas Blick war unablässig ins Leere gerichtet, beklemmend und starr.
Wie tot.
Was sollte sie nur tun? Am besten gleich morgen einen Termin bei einem Psychologen vereinbaren. Aber sie mochte diese Seelenklempner nicht. Fortwährend im Schmutz der Vergangenheit wühlen, wozu sollte das gut sein?
Schuld war letztlich nur ihr Exmann. Die Trennung hatte Spuren hinterlassen. Das Kind war doch erst zwölf Jahre alt.
Katrinas Augenlider flackerten. Endlich schlossen sie sich. Ihre Atemzüge wurden ruhiger.
Marianne wartete eine Weile ab.
Schließlich ging sie zurück in ihr Zimmer und kroch unter die Bettdecke.
Voller Zorn dachte sie an ihren Exmann. Es dauerte lange, bis sie zurück in einen unruhigen Schlaf fiel.
Erneut wurde sie wach. Was war das? Klang wie ein Wispern.
Sie richtete sich auf. Lauschte ängstlich.
Schließlich sank sie auf ihr Kissen zurück. Nur der Wind, der in den Nussbaum fuhr. Die Äste strichen gegen die Hausfassade. Müssten dringend geschnitten werden.
Früher hatte sich ihr Exmann darum gekümmert. Jetzt musste sie ein Unternehmen dafür beauftragen. Sie selbst traute sich das nicht zu. Die hohe Leiter, auf der er gestanden hatte, die Säge in der Hand. Überhaupt sein handwerkliches Geschick.
Das Baumhaus, dachte sie. Wie lange er daran gebastelt hatte. Sie sollte es abreißen lassen. Doch das würde ihrer Tochter das Herz brechen. Und wenn schon. Es konnte sich nicht immer alles um Katrina drehen.
Plötzlich war sie hellwach. Das Baumhaus. Katrinas Schlafwandeln. War sie etwa draußen im Garten gewesen? Wieder einmal? Mitten in der Nacht?
Rasch stand sie auf, trat ans Fenster und öffnete die Vorhänge.
Die Äste des Nussbaums wogten im Wind. Weiter hinten im Garten brannte Licht. Die kleinen Glühlampen in der Linde waren eingeschaltet. Auch einen matten Feuerschein bemerkte sie. Im Baumhaus hatte jemand Kerzen angezündet.
Die Windlichter, dachte Marianne erzürnt. Also war Katrina wohl tatsächlich heute Nacht dort draußen gewesen.
Wie gefährlich das war. Feuer könnte ausbrechen. Das Kind würde sie noch ins Unglück stürzen, wenn sie weiterhin nachts unkontrolliert umherwandelte.
Marianne Fries verließ das Schlafzimmer und ging die Treppe hinunter. Sie zog sich ihre Jacke über und schlüpfte in ihre Schuhe. Dann ging sie durch die Hintertür in den Garten hinaus. Die nächtliche Kälte fuhr ihr in die Glieder. Sie schlang die Arme um die Brust und eilte in den hinteren Teil des Gartens.
Die Lichterkette an den Zweigen tänzelte im Wind. Die Strickleiter schwang hin und her.
Marianne griff danach und stieg langsam hinauf. Morgen früh würde sie ihre Tochter zur Rede stellen. So konnte das nicht weitergehen. Das Baumhaus zerstören, am besten gleich die Linde fällen. Nichts mehr im Garten sollte an ihren Exmann erinnern. Das Kapitel schließen. Die Vergangenheit begraben.
Die Leiter wackelte. Marianne wurde leicht schwindlig.
Endlich hatte sie die Unterkante des Baumhauses erreicht. Schwer atmend kletterte sie hoch und richtete sich auf.
Sie sah Katrinas Baumwolldecke am Boden, zu einem länglichen Knäuel zusammengebauscht. Wie nachlässig von ihrer Tochter. Sie sollte doch keine Sachen im Garten liegen lassen.
Das Kind konnte so dickköpfig sein.
In einer Ecke standen die flackernden Windlichter. Daneben befand sich die Schachtel mit den Zündhölzern. Noch etwas, was sie Katrina nicht austreiben konnte. Hier oben zu zündeln, war höchst gefährlich. Und dann auch noch im Schlaf. Von nun an wäre Schluss damit.
Marianne blies die Kerzen aus. Fortan sollte sie ihre Tochter nachts im Zimmer einsperren. Die Tür abschließen. Den Schlüssel abziehen. Ganz egal, was Katrina davon hielt. Nur rabiate Methoden schienen zu helfen.
Gerade wollte Marianne die Lichterkette ausschalten, da fuhr sie zurück.
Hatte sich hier oben etwas bewegt?
Es war wohl nur ihr Schatten.
Im matten Widerschein der Glühlampen schaute sie auf die Baumwolldecke am Boden. Lichtreflexe tanzten darüber hinweg.
Die Zweige knarrten im Wind. Marianne blickte sich um.
Sie hörte noch etwas. Sehr leise.
Ein gedämpftes Kichern.
Auf einmal war sie wie erstarrt. Was war das nur?
Nur ruhig, dachte sie. Bloß ein schwaches Säuseln im Geäst der Linde. Nichts als Windgeräusche. Es war recht stürmisch heute Nacht.
Doch da hörte sie es wieder. Klang mehr wie ein Schluchzen. Oder eher eine Mischung aus beidem. Ein Giggeln und Weinen. Ein Wimmern und Prusten.
Ihr Blick fiel erneut auf den Boden.
Die Decke. Kein Zweifel. Die eigenartigen Geräusche kamen direkt darunter hervor.
Plötzlich war es still.
Nur weg hier, durchfuhr es sie, doch ihre Glieder waren vor Schreck wie gelähmt.
Nach einer Weile vernahm sie von Neuem das merkwürdige Kichern. Es wurde lauter. Ein Japsen und Glucksen, kurz darauf steigerte es sich zu einem Lachen und Heulen.
Plötzlich schob sich eine Hand unter der Decke hervor.
Marianne wollte schreien, doch kein Laut drang aus ihrer Kehle.
Und dann ging alles sehr schnell. Eine zweite Hand tauchte auf, danach ein Kopf.
Endlich konnte sich Marianne aus ihrer Erstarrung lösen. Sie eilte zur Strickleiter.
In ihrem Rücken ein kühler Lufthauch.
Ein ratterndes Geräusch ertönte. Etwas erfasste sie von hinten. Sie verspürte einen höllischen Schmerz.
Dann brach sie zusammen.
Das Letzte, was sie sah, war ihr Blut, das auf den Holzboden spritzte.
FÜNF
DIENSTAG, 21. NOVEMBER, MORGENS
Trojan joggte barfuß am Strand entlang. Er fühlte sich frei und gelöst, voller Energie. Gelegentlich wich er den Wellen aus, die sacht am Ufer ausliefen. Er sog die salzige Luft ein und ließ den Blick über den klaren Horizont schweifen.
Das Meeresrauschen hatte eine beruhigende Wirkung auf ihn, und sein Atem war tief und gleichmäßig. Weiter vor ihm eine Strandhütte, kaum sichtbar noch. Vielleicht drei Kilometer entfernt. Er setzte sie sich zum Ziel und trabte ruhig pulsend weiter.
Nach einiger Zeit vernahm er ein schwaches Geräusch. Eine wiederkehrende Tonfolge, die ihn irritierte. Von irgendwoher kannte er die Melodie. Er verband sie mit Stress und mangelndem Schlaf.
»Nicht ablenken lassen«, sprach er leise zu sich selbst und nahm Tempo auf. Doch plötzlich sackten seine Füße ein, und er kam aus dem Rhythmus, begann zu schnaufen.
Die Töne wurden lauter. Wolken zogen heran, wie aus dem Nichts. Trojan sank bis zu den Knien in den Sand. Hilflos ruderte er mit den Armen, als ihn Wasserwogen überspülten. Er schlug die Hände über den Kopf, bekam keine Luft mehr.
Schon war er wach.
Verwundert blickte er zur Zimmerdecke hinauf, bis er begriff, was los war.
Sein Mobiltelefon brachte die Töne hervor, die ihn aus dem Schlaf gerissen hatten. Beharrlich läutete es auf seinem Nachttisch.
Seine Hand tastete danach.
Als er den Namen auf dem Display erkannte, richtete er sich auf und schaltete das Licht ein.
Er nahm den Facetime-Anruf an, und das Gesicht seiner Tochter erschien auf dem Bildschirm.
»Emily«, sagte er atemlos. »Ist was passiert?«
»Nein, Paps. Aber ich hab dich offenbar geweckt.«
Seine verschlafenen Augen, das verstrubbelte Haar in einem Ausschnitt am Bildrand.
»Kein Problem. Wie spät ist es bei dir?«
»Zehn Uhr abends.«
»Hier ist es früher Morgen.«
»Tut mir leid.«
Er rieb sich über das Kinn. »Macht nichts. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir?«
Sie sah blass aus. Und ihre Miene war ernst. Nicht das strahlende Lächeln, das er von ihr gewohnt war.
Sie jobbte noch immer auf einer Farm auf Vancouver Island, konnte sich für kein Studium entscheiden. Er vermisste sie sehr.
»Emily?«
Sie wiegte schweigend den Kopf, fuhr sich mit der Hand durch ihre blonden Locken.
»Sag nur. Weswegen rufst du an? Was bedrückt dich?«
»Ach, es ist komisch. Ich hab schon den ganzen Tag schreckliches Heimweh. Eigentlich zum ersten Mal, seitdem ich hier bin.«
»Komm doch nach Berlin.«
»Ganz spontan?«
»Ja. Ich spendiere dir den Flug.«
»Im Ernst?«
»Na klar.«
Sie schien darüber nachzudenken. Doch dann zuckte sie mit den Schultern. »Ich weiß nicht.«
»Dir steht doch noch Urlaub auf der Farm zu, oder etwa nicht?«
»Ich könnte fragen, ob sie mir ein paar Tage freigeben.«
»Mach das, Emily.«
»Aber lohnt sich das auch?«
»Zwei, drei Wochen sollten es schon sein. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, dich endlich wiederzusehen.«
Sein letzter Besuch bei ihr lag eine Weile zurück. Er erinnerte sich an die unbeschwerte Zeit an der Pazifikküste. Wie er mit seiner Tochter in der Brandung gebadet hatte. Damals war sie so fröhlich gewesen.
Später hatten sie sich ein Wohnmobil gemietet und waren quer durch British Columbia gefahren. Einmal hatten sie in der Ferne Braunbären gesehen. Und an einem Nachmittag auf der einsamen Landstraße, die schnurgerade durch die atemberaubende Wildnis führte, hatten sie einen Elch beobachtet, der etwa zweihundert Meter vor ihnen gemächlich ihren Weg kreuzte.
»Und was wäre, wenn du zu mir kommst?«, fragte sie.
»Liebend gern. Leider hab ich keinen Resturlaub mehr.«
»Schade.«
»Überleg dir das mit dem Flug.«
»Okay.«
In diesem Moment kündigte sich ein weiterer Anruf an. Er war dienstlich.
»Emily, ich muss leider Schluss machen. Kann ich dich später zurückrufen?«
»Klar, Paps.«
»Hab dich lieb.«
»Ich dich auch.«
Als ihr Gesicht vom Bildschirm verschwand, versetzte es ihm einen Stich. Er sah seine Tochter viel zu selten.
Erneut hob er ab. Diesmal war es Stefanie.
»Nils?«
»Ja.«
Er hörte, wie sie am anderen Ende tief Luft holte. »Wir brauchen dich hier.«
»Worum geht es?«
Ihre Stimme klang belegt. »Komm einfach schnell her.«
Sie nannte ihm eine Adresse.
Schon hatte sie aufgelegt.
Lepsiusstraße, Nähe Botanischer Garten in Berlin-Steglitz. Einfamilienhäuser mit gepflegten Vorgärten. Trojan erkannte schon von Weitem die zuckenden Blaulichter der Einsatzfahrzeuge.
Er hielt an, stieg aus dem Wagen, zeigte einem uniformierten Polizisten seinen Dienstausweis vor und duckte sich unter den Absperrbändern hindurch.
Es war ein hell getünchtes, zweistöckiges Wohngebäude im Bauhausstil. Stefanie kam ihm auf dem Kiesweg vor der Eingangstür entgegen, ihr Haar wie so oft zu einem Pferdeschwanz gebunden.