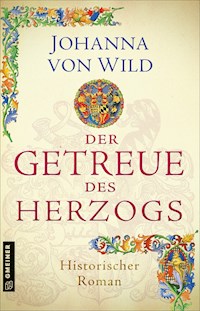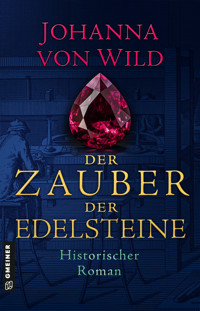Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Würzburg 1574: Bäckerlehrling Simon leidet unter seinem brutalen Stiefvater und dessen Sohn Wulf. Als die Streitigkeiten eskalieren, muss er die Stadt verlassen und erlernt in Venedig die Kunst der Zuckerbäckerei. Nach Jahren in der Ferne kehrt Simon nach Würzburg zurück. Dort übernimmt er die Backstube des Juliusspitals und gewinnt die Zuneigung des mächtigen, unnahbaren Fürstbischofs Julius Echter. Doch Simons Stiefbruder Wulf, getrieben von Neid und Missgunst, lässt nichts unversucht, um ihm zu schaden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Johanna von Wild
Der Pfeiler der Gerechtigkeit
Historischer Roman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Merian_Frankoniae_156.jpg und HAH / Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruetschenhausen_Kirche_Wappen.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boucicaut_Master_-_Book_of_Hours_(Use_of_Paris)_-_1942.169_-_Cleveland_Museum_of_Art.tif
Wappensymbol im Buch: © Echter-Wappen.png – Wikimedia Commons
ISBN 978-3-8392-6898-8
Widmung
Für Ralf. Danke für so viele zuckersüße Jahre.
Zitate
»Geselle ist, der etwas kann, Meister ist, der etwas ersann, Lehrling ist jedermann.«
Johann Wolfgang von Goethe
*
Tibi de relictus est pauper – in praece pauperum spem habui (Dir ist der Arme anvertraut – Ich setze meine Hoffnung auf das Gebet der Armen)
Spruchband der steinernen Stiftungsurkunde des Juliusspitals Würzburg – Stiftungsgründer: Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn
Personenverzeichnis
historische Personen sind mit * gekennzeichnet
Familie Reber
Simon: Bäckerlehrling
Anna: seine Mutter
Barbara: seine Schwester
Gebhard: sein Vater
Familie Bernbeck
Melchior: Bäckermeister
Wulf: sein Sohn
Sibylla: seine Tochter
Gerfried: sein Bruder
Ranhild: seine Enkelin
Jörg: sein Schwiegersohn
Familie Sterzing
Konrad: Apotheker, Lilien-Apotheke
Teresa: seine Frau
Julia: seine Tochter
Familie Landauer
Friedhelm: Apotheker, Einhorn-Apotheke
Josepha: seine Frau
Ferdinand: sein Sohn
Katharina, Magdalene: seine Töchter
Theodor, Martin: seine Schwiegersöhne
Familie Tardelli
Francesco: Zuckerbäcker
Carlotta: seine älteste Tochter
Aurora: seine Frau
Benedetto, Matteo, Tomaso
Isabella, Bianca, Antonio,
Michele: seine weiteren Kinder
Davide: sein Enkel
Familie Hansen
Philipp: Kaufmann
Reinhild seine Frau
Agatha, Renata, Meinhard: seine Kinder
Adalbert, Rudolf: seine Schwiegersöhne
Julius Echter von Mespelbrunn*: Fürstbischof von Würzburg
Weitere Personen
Balthasar von Dernbach*: Fürstabt von Fulda
Joris Robijn*: Baumeister aus Flamen
Wilhelm Upilio*: Stadt- und Leibarzt
Johannes Posthius*: Leibarzt
Jonas Adelwerth*: Leibarzt, Dekan med. Fakultät
Hans Rodlein*: Bildhauer
Friedrich Albrecht: Oberschultheiß
von Heßberg*
Johann Voit von Rieneck: Adliger in Echters Dienst
Neidhart von Thüngen*: Domdekan
Erasmus Neustetter
genannt Stürmer*: Domherr
Johann Stamitz: Schreinermeister
Reinhold Zollner: Rechtsgelehrter
Andreas Riehl: Schneidermeister
Stefan Dinkel: Oberpflegherr im Juliusspital
Walther: Koch
Rupert: Küchenmeister
Gottfried Schwarzmann: Rabenwirt
Alfred Heber: Zimmermeister
Wulfram Heber: sein Sohn
Anselm: Zimmergeselle
Dietrich Wenzel: Goldschmied
Vater Magnus Pfarrer: Marienkapelle
Martin Tauchert: protestantischer Pfarrer
Johann Eschbach: Apotheker
August: Apothekengehilfe
Otto: Bäckergehilfe
Friedlinde, Berta: Mägde
Max Krämer, Bartl, Lorenz,
Winfried und Caspar: Knechte
Karl und Lois: Bäckergesellen
Schloss Mespelbrunn
Christina Alberdinen*: Magd
Michel Vetterer*: Knecht
Korbinian: Förster
Zunftmeister der Bäcker
Sebastian Schlichting
Robert Wachter
Adalbert Sieber
Gerhard Schedel
1550 Schloss Mespelbrunn, Spessart
»Arkan, hierher!«, rief Julius Echter dem davonjagenden Hund nach.
Doch es nützte nichts. Die schwarzbraune Dachsbracke hetzte weiter und kümmerte sich nicht um die Befehle des Fünfjährigen. Arkan hatte vermutlich einen Hasen aufgespürt, jetzt gab es für ihn kein Halten mehr. Der Hund war erst sechs Monate alt und seine Ausbildung noch nicht weit fortgeschritten; eigentlich hätte Julius ihn gar nicht mit in den Wald nehmen dürfen. Aber der blonde dünne Fünfjährige hatte nicht widerstehen können. Schließlich war es sein Hund, denn er hatte den Welpen aus dem Wurf ausgesucht, oder umgekehrt.
Der damals acht Wochen alte Arkan war mit wedelnder Rute und auf tapsigen Pfoten geradewegs auf Julius zugekommen und hatte sich in dessen Schoß zusammengerollt. Die Ausbildung des Welpen oblag dem Förster Korbinian, der seit Jahren für die Echters arbeitete. Schließlich sollte der Hund einmal ein erfolgreicher Spürhund werden. Arkan hatte zwar schon einiges gelernt, doch er hörte nicht auf einen kleinen Jungen, sondern auf Korbinian.
Wieder und wieder brüllte Julius dem Hund hinterher, rannte so schnell er konnte und blieb irgendwann keuchend stehen. Arkan würde erst zurückkommen, sobald er entweder den Hasen – oder was auch immer ihm in die feine Nase gestiegen war – erlegt hatte oder seine Beute entkommen war. Was dagegen sicher war: Julius konnte sich auf eine Strafpredigt gefasst machen.
Rascheln und das laute, wütende Grunzen eines durch das Unterholz brechenden Wildschweins drangen an seine Ohren, gepaart mit Arkans aufgeregtem Gebell und plötzlichem schrillem Aufjaulen. Julius blieb vor Schreck beinahe die Luft weg. Angestrengt horchte er in das Gebüsch hinein, hörte, wie das Wildschwein sich entfernte, dann ein schwaches Winseln.
»Arkan?«
Das Herz des Jungen hämmerte vor Angst und Aufregung, als er den kläglichen Hundelauten folgte und Arkan schließlich am Fuße einer Fichte liegen sah. Blut rann aus einer tiefen, klaffenden Wunde am linken Hinterbein und tränkte den Waldboden. Julius fiel auf die Knie, schob beide Arme unter den Körper des Hundes und kam mit zitternden Beinen zum Stehen. So schnell er konnte, lief er durch den Wald, den schwer verletzten Hund an sich gedrückt.
»Julius! Julius, wo steckst du?« Michel Vetterer, der treue Hausknecht der Familie Echter, rief nach ihm.
»Hier! Michel, hilf mir!« Die Stimme des Jungen klang dünn und gequält. Julius weinte, ohne es zu bemerken. Tränen rannen seine Wangen hinab, tropften auf Arkans seidiges Fell. Dann stand er plötzlich am Waldrand vor dem Knecht, der scharf die Luft einsog, als er den verletzten Hund sah.
»Gib ihn mir«, sagte er und nahm das Tier sanft aus Julius’ Armen. »Geh, und lauf zu Korbinian, schnell! Er wird wissen, was zu tun ist«, drängte Michel. »Ich bringe Arkan zum Schloss.«
Julius stürmte los zum Forsthaus, das ganz in der Nähe des Schloss Mespelbrunn umgebenden Sees lag.
Wenig später kam er in Begleitung des Försters über die heruntergelassene Zugbrücke durchs Tor. Im Innenhof hatte Michel bereits den Hund auf eine alte Decke gelegt. Wortlos kniete sich Korbinian nieder, betastete vorsichtig die Wunde, die inzwischen zu bluten aufgehört hatte.
»Michel, besorg sauberes Leinen und verdünnten Wein, ich bin gleich wieder hier«, ordnete der Forstmeister an.
Julius blieb bei seinem Schützling, redete auf ihn ein und streichelte seinen Kopf.
Eiligen Schrittes kehrte Korbinian mit einem Beutel zurück. Er spülte die Wunde mehrfach mit Wein und entfernte das Fell um die Wundränder mit einem scharfen Messer, während Michel den Hund festhielt. Dann nahm er eine Salbe aus dem Beutel und trug sie auf die nun sichtbare rosafarbene Haut auf.
»Wofür ist das?« Julius schluckte, als er sah, wie Arkan zusammenzuckte und wieder zu winseln begann.
»Die Opiumsalbe nimmt Arkan die Schmerzen«, brummte Korbinian, ohne aufzusehen.
Nachdem er die Wunde mit einem Pferdehaar vernäht und eine kleine Öffnung gelassen hatte, damit später der Eiter abfließen konnte, bestrich er ein Leinentuch mit Honig, legte es auf die Wunde, nahm ein weiteres Tuch, faltete es geschickt und brachte einen Verband an.
»Ich nehme Arkan mit zu mir, damit ich ihn weiter versorgen kann. Er bekommt einen Lederkragen, so kann er sich den Verband nicht abreißen.«
»Wird er wieder gesund?«, fragte Julius mit trockenem Mund.
»Ich weiß es nicht, doch wenn er es schafft, ist er wahrscheinlich als Jagdhund nicht mehr zu gebrauchen«, erwiderte der Forstmeister missmutig.
Julius stand mit gesenktem Kopf vor seinem Vater im Jagdzimmer des Schlosses und weinte. Die ausgestopften Köpfe der erlegten Hirsche, Böcke und Keiler an den Wänden schienen anklagend auf ihn herunterzustarren.
»Hör auf zu weinen. Du enttäuschst mich, mein Sohn. Es war dir verboten, Arkan mit in den Wald zu nehmen, und trotzdem hast du es getan. Wenn er stirbt, ist es deine Schuld, nicht die des Keilers. Dem Herrn sei Dank, dass unser Forstmeister auch heilkundig ist und weiß, wie man verletzte Tiere behandelt. Doch trotz seiner Kunst liegt es allein in Gottes Hand, ob Arkan überlebt.«
Nachdem sein Vater ihn entlassen hatte, ging Julius zur Kapelle, die sich im kleineren der beiden Schlosstürme befand. Der Ballsaal im Erdgeschoss, durch den man zur Kapelle gelangte, war verlassen, worüber Julius froh war. Oft spielten er und seine Brüder dort Ball, wenn der Hauskaplan sie aus dem Unterricht entließ. Julius kniete sich in eine der Gebetbänke, auf deren hölzerner Front das Echterwappen prangte. Ein silberner Balken mit drei blauen Ringen, gekrönt von einem blausilbernen Helm, dessen Büffelhörner ebenso mit Ringen verziert waren. Das durch die Glasfenster fallende Sonnenlicht erleuchtete die winzige Kapelle und tauchte die farbigen Heiligenbilder an der Gewölbedecke in warmes Licht. Stumm betete der Junge zum Allmächtigen, er möge ihm vergeben und Arkan gesund werden lassen. Gelobte, sich fortan um Schwächere und weniger Begünstigte zu kümmern. Zeit seines Lebens.
Sein Vater hatte ihm mehr als deutlich gemacht, was er von ihm erwartete. Er, Julius, sei der Kirche versprochen und solle ein würdiger Diener Gottes werden. Ein Pfeiler des Glaubens auf dem Fundament der Nächstenliebe – das waren seine eindringlichen Worte gewesen. In eine ehrenhafte und reiche Familie hineingeboren worden zu sein, bedeute auch, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. Irgendwann erhob sich Julius mit schmerzenden Knien und verließ die Kapelle. Traurig und mit hängenden Schultern schlich er durch die Gänge des Schlosses.
»Julius, was ist mit dir?«
Plötzlich stand er vor Christina Alberdinen. Die zwergenhafte Magd mit ihrer verwachsenen Schulter war nur wenig größer als er. Sie war die gute Seele auf Mespelbrunn und wurde von allen geliebt, besonders von den Kindern, Adolf, Julius und Sebastian. Meist hütete sie die kleine Schwester der Echterbrüder, Margarethe, und kümmerte sich um den wenige Monate alten Valentin, der im Mai zur Welt gekommen war.
Julius begann zu schluchzen und stürzte sich in Christinas Arme. Sie drückte ihn an ihren üppigen Busen, und nachdem er sich etwas beruhigt hatte, fasste sie nach seiner Hand und führte ihn in die Schlossküche mit ihrem Kreuzrippengewölbe. Warm und behaglich war es hier. Über dem Herd baumelten Kupfertöpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe. Die Köchin bereitete das abendliche Mahl zu, und es duftete bereits köstlich.
»Setz dich, mein Junge«, sagte Christina.
Auf dem gemauerten Wandvorsprung neben dem großen Backofen stand ein frisch gebackenes, süßes Brot gefüllt mit Rosinen und Nüssen. Die kleinwüchsige Magd schnitt zwei dicke Scheiben ab, legte sie auf einen einfachen Teller und brachte ihn an den Tisch. Dann nahm sie Julius auf den Schoß und sah ihn aufmerksam an.
»Und nun erzählst du mir, was dich so bedrückt.«
Während Julius von seinem Ungehorsam, den Geschehnissen im Wald und von seiner Angst um Arkan berichtete, brach Christina immer wieder ein kleines Stückchen Brot ab und reichte es ihm, wenn er ins Stocken geriet und die Tränen zurückdrängte. Am Ende war das himmlisch schmeckende Brot aufgegessen. Julius fühlte sich erleichtert und so voller Zuversicht, Arkan werde wieder gesunden, dass sich sogar ein Lächeln auf sein Gesicht stahl.
Er schmiegte seinen Kopf an Christinas Halsgrube und murmelte schläfrig: »Wie nennt man dieses Brot?«
»Ich nenne es Seelenbrot«, antwortete sie und strich dem Jungen sanft über den blonden Schopf. »Es ist mit Liebe gebacken.«
Erster Teil
1572 - 1578 Würzburg
Im kalten Nieselregen stand der dreizehnjährige Simon am Grab seines Vaters und fror erbärmlich. Es war Anfang November, und neben ihm zitterte seine Mutter, Anna, die stumm weinte und die Hände vor dem Körper gefaltet hatte. Seine kleine Schwester Barbara hatte ihre rechte Hand in Simons Linke gelegt und schluchzte leise. Tränen rannen ihre blassen Wangen hinab und Rotz lief aus ihrer Nase. Simon spürte einen dicken Kloß im Hals, als der Priester die Grabstelle mit Weihwasser besprengte, das Kreuzzeichen schlug und den Sargträgern mit einem Kopfnicken bedeutete, die letzte Ruhestätte seines Vaters abzulassen.
Viele waren gekommen, um dem Bildhauermeister Gebhard Reber das letzte Geleit zu geben. Simons Vater war ein angesehener und beliebter Bürger der Stadt gewesen. Wahre Kunstwerke hatte er hervorgebracht, und wer es sich leisten konnte, der ließ sich Grabplatten und Skulpturen fertigen, aber auch Rosenkränze, die Gebhard aus den bei der Bildhauerei anfallenden Bruchstücken herstellte. Doch das vermochten nur die Adligen, Fürstbischof Friedrich von Wirsberg und die gut betuchten Bürger und Amtmänner. Gebhard hatte gute Geschäfte mit reichen Kaufleuten gemacht, die kleinere Statuen für ihn verkauften, und so ein hübsches Vermögen angehäuft. Schon als junger Mann war er bis nach Florenz gezogen, um seine Kunst bei den Meistern der Bildhauerei zu erlernen. Simon hatte nie genug von seines Vaters Geschichten bekommen und beschlossen, wenn er einmal alt genug war, auch in die fernen Lande jenseits der Alpen zu ziehen.
Die Trauergäste zogen vorbei, schüttelten der Mutter die Hand, manche strichen Barbara mitleidig über den Kopf, und der eine oder andere legte Simon die Hand auf die Schulter.
»Dein Vater war ein guter Mann, sei tapfer, Junge.«
Als der letzte Händedruck erfolgt war, blieb Gebhards Familie noch einen Augenblick stehen, um einen letzten Blick auf den Sarg zu werfen, bevor der Totengräber das Grab zuschaufelte. Anna Reber legte die Arme um die Schultern ihrer Kinder und drückte sie an sich.
»Nun kommt, ihr beiden, der Leichenschmaus im ›Stachel‹ wartet schon.«
Der ›Stachel‹ war mehr als zweihundertfünfzig Jahre alt, und das Weinhaus hatte einst für geheime Zusammenkünfte während des Bauernkrieges gedient. Der Bildhauer und Ratsherr Tilman Riemenschneider hatte sich dort mit den Reichsrittern Götz von Berlichingen und Florian Geyer getroffen, um sich gegen den damals regierenden Fürstbischof Konrad von Thüngen zu verbünden. Nur wenige Wochen hatte der Aufstand in Würzburg gedauert. Den Soldaten des Bischofs, unterstützt vom Schwäbischen Bund, hatte das Bauernheer nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Am Ende waren Tausende Bauern tot, die Anführer verhaftet und gefoltert und mehrere Bürger auf dem Fischmarkt enthauptet worden.
Drinnen war es warm und der Geräuschpegel hoch. Simon rieb sich die kalten Hände und legte sie um den Becher mit dem verdünnten heißen Würzwein. Der deftige Linseneintopf mit Speck, seines Vaters Lieblingsspeise, wärmte ihn von innen und erweckte seine blau gefrorenen Zehen wieder zum Leben. Auf dem Friedhof hatte er noch gedacht, er brächte vor Trauer keinen Bissen hinunter, doch wider Erwarten schmeckte es ihm. Auch Barbara löffelte den Teller leer und wischte ihn mit einem Stück Brot aus. Dann kuschelte sie sich an ihren Bruder, lehnte den Kopf an seine Schulter und gähnte herzhaft.
Gemeinsam mit ihnen am Tisch saßen der Schreinermeister Johann Stamitz, Bäckermeister Melchior Bernbeck, zwei Zimmerleute und drei Steinmetze. Sie priesen Simons Vater und leerten dabei einen Krug Wein nach dem anderen. Simon erging es kaum anders als seiner kleinen Schwester, die längst eingeschlummert war, auch er verspürte eine bleierne Müdigkeit. Doch dann horchte er auf.
»Anna, was hast du nun vor?«, fragte Stamitz.
»Ich werde das Haus verkaufen. Eigentlich sollte Simon einmal Gebhards Werkstatt übernehmen, aber daraus wird wohl nichts werden.« Ihre Stimme zitterte, die Trauer drohte sie zu überwältigen.
»Sag ihm, er soll bei den Steinmetzen anfragen. Zumindest lernt er dort, wie man welchen Stein bearbeiten muss und kann. Und wenn er die Begabung seines Vaters geerbt hat, dann wird er eines Tages ebenso kunstvolle Statuen erschaffen.«
Anna berührte Stamitz kurz an der Schulter. »Du bist ein guter Mensch, Johann. Aber die Steinmetze ziehen von Baustelle zu Baustelle, ich weiß nicht, ob das das Richtige für ihn ist. Er soll nicht auch noch von mir fortgehen.«
Einen Monat später wurde das Haus samt Werkstatt für zweihundert Gulden an einen Goldschmied veräußert, und Anna mietete ein kleineres Haus für sich und ihre Kinder. Das Geld aus dem Verkauf hütete sie wie einen Schatz und sparte, wo sie konnte, bis sie wusste, wie es mit ihr weitergehen sollte. Sie war erst achtundzwanzig Jahre alt und zu jung, um ewig Witwe zu bleiben. Niemals hatte sie damit gerechnet, dass Gebhard so früh von ihr gehen würde. Er war so stark und immer gesund und fröhlich gewesen. Und nun war er mit sechsunddreißig ins Grab gestiegen.
Nur eine kleine Wunde war es gewesen, die ihm den Tod gebracht hatte. Ein rostiger Nagel hatte Gebhards Schuhsohle durchbohrt und war in seiner Ferse stecken geblieben. Fünf Tage nachdem der Nagel herausgezogen worden war, hatten die Krämpfe begonnen. Anna hatte Gebhard zum Stadtarzt geschickt, doch dieser war hilflos gewesen. Gebhards Kiefer weigerten sich, sich vollständig zu öffnen, und es hatte ausgesehen, als lächle er. Ein geradezu teuflisches Grinsen war es gewesen. Sprechen war ihm unmöglich gemacht, und der nächste Krampf hatte seine Wirbelsäule bis aufs Äußerte durchgebogen. Schließlich war Gebhard jämmerlich erstickt.
Anna besaß nun genug Geld, um ihre Kinder durchzubringen. Gebhard hatte viele Gulden verdient und beiseitegelegt. In der Truhe auf dem Dachboden waren vierhundertfünfzig Gulden verstaut gewesen, und hinzu kam noch das erkleckliche Sümmchen aus dem Verkauf des Hauses. Aber all die Münzen würden nicht auf ewig reichen. Nahrung war teuer geworden, die Miete betrug zwanzig Gulden im Jahr, und eine Magd erhielt einen Jahreslohn von zwölf Gulden. Hinzu kamen noch Kosten für Brennholz, Kerzen, Kleidung und Schuhe. Simon schoss in die Höhe und brauchte allein zwei neue Paar Schuhe und Stiefel im Jahr, von den Hosen ganz zu schweigen. Sie würde arbeiten müssen. Oder neu heiraten.
Anna war das siebte und jüngste Kind ihrer Eltern, hatte vier Schwestern und zwei Brüder. Ihr Vater betrieb gemeinsam mit ihrer Mutter einen Gasthof in Passau. Dort war ihr einst Gebhard begegnet, der auf der Durchreise gewesen war. In den riesigen Wäldern der Gegend wurden verschiedenste Gesteine und Erze gewonnen, und Gebhard hatte sich selbst davon überzeugen wollen, ob diese gut genug für seine Bildhauerkünste waren.
Annas ältere Geschwister waren bereits ein paar Jahre aus dem Haus, nur sie – mit ihren fünfzehn Lenzen – wohnte noch in einer Kammer unter dem Dach und arbeitete als Schankmagd in der Wirtsstube. Der große Blonde mit den breiten Schultern war ihr gleich aufgefallen, als er den Schankraum betrat und mit einem Lächeln ein Bier und einen Teller Suppe orderte. Noch mehr als von seinen blitzenden blauen Augen war sie von den schmalen, langen Fingern beeindruckt gewesen. Hände, die zugleich zupacken konnten, aber auch zartfühlend aussahen. Gebhard war fast eine Woche geblieben, und Anna hatte jedem Abend entgegengefiebert, um dem Gast das Essen aufzutragen und sich, wenn Zeit blieb, kurz zu ihm zu setzen. Am letzten Tag hatte Gebhard, ohne lange zu überlegen, bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten und sie mit nach Würzburg genommen.
Seufzend flickte Anna das Kleid ihrer Tochter. Mehr schlecht als recht, befand sie, während sie das Ergebnis betrachtete. Als Schankmagd wollte sie nicht arbeiten, und zur Näherin taugte sie nicht. Also blieb ihr doch nur eine zweite Heirat.
Kurz vor Weihnachten starb die Frau des Bäckermeisters Melchior Bernbeck. Auf dem Weg zum Schneider war sie so unglücklich auf dem vereisten und schneebedeckten Kopfsteinpflaster ausgeglitten und mit dem Hinterkopf aufgeschlagen, dass sie drei Tage später ihren letzten Atemzug tat.
Mitfühlend legte Anna Reber beim Leichenschmaus ihre Hand auf die groben, kräftigen Finger des Witwers.
»Gott sei ihrer armen Seele gnädig. Du musst jetzt stark sein für deine Kinder.«
Melchior legte seine andere Hand über die ihre und räusperte sich vernehmlich.
»Wiltrud war wieder guter Hoffnung, Anna. Das macht den Verlust umso schrecklicher. Die letzten beiden Schwangerschaften hatte sie verloren, und wir hatten schon beinahe die Hoffnung aufgegeben, noch ein weiteres gesundes Kind zu bekommen.«
»Jesus Christus im Himmel, ich hatte ja keine Ahnung«, entfuhr es Anna und entzog ihm ihre Hand.
»Kaum jemand wusste davon, und unter dem dicken Wintermantel konnte man nichts erkennen.« Er schüttelte den Kopf, als könne er immer noch nicht begreifen, was geschehen war. »Wulf ist fünfzehn, alt genug, um ohne Mutter aufzuwachsen, aber Sibylla ist erst sieben, genauso alt wie deine Barbara.«
Anna nickte nur. Der Bäckermeister und seine Frau hatten viel verkraften müssen. Vor zwei Jahren waren drei ihrer fünf Kinder unter die Räder eines Fuhrwerks gekommen, als die Zugpferde durchgegangen waren und alles, was ihnen im Weg gewesen war, überrannt hatten. Wiltrud hatte diesen Schicksalsschlag nie verwunden. Aus der fröhlichen Bäckersfrau war ein zurückgezogenes, verhärmtes Weib geworden. Anna hatte alles versucht, um Wiltrud aufzumuntern, doch es war ihr nicht gelungen.
»Das Weihnachtsfest wird dieses Jahr kein Fest werden, dabei hat sich vor allem Sibylla so auf das Krippenspiel gefreut«, seufzte Melchior.
»Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam mit unseren Kindern die Feierlichkeiten begehen? Wir gehen in die Christmette und feiern dann das Ende der Fastenzeit«, schlug Anna vor. Melchior sah nicht so gut aus wie sein Bruder Gerfried, dafür besaß er ein Haus, auch wenn es nicht so groß wie das ihre war. Für die Dauer eines Lidschlags tauchte Gerfrieds Gesicht vor ihrem inneren Auge auf. Und mit ihm diese kurze und stürmische Begegnung in Gebhards Werkstatt vor langer Zeit. Einsam war sie gewesen, weil ihr Ehegatte sie, wie so oft, allein gelassen hatte, um sich nach Steinen umzusehen, die seinem Urteil standhielten, um neue Figuren daraus entstehen zu lassen.
Melchior schürzte die Lippen. »Warum nicht? Ja, das ist ein guter Einfall. Und für unsere Kinder wird es so bestimmt ein bisschen einfacher.«
1573 Würzburg
Simon hielt einen Augenblick inne und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. In der Backstube war es schon am frühen Morgen unerträglich heiß, und das Teigkneten trug sein Übriges dazu bei. Doch nun waren alle Laibe ordentlich geformt und die ersten bereits in der Backkammer.
Anna Reber und Melchior Bernbeck hatten kurz nach Ablauf der dreimonatigen Trauerzeit geheiratet. Simons Mutter brachte eine Menge Geld mit in diese Ehe, und ihr gerade angetrauter Gatte hatte sich ermuntert gefühlt, darüber nachzusinnen, sich ein großes Backhaus mauern zu lassen. Nur noch wenige Bäcker brachten ihre Laibe zu gemeinschaftlich genutzten Backhäusern, wie er bisher auch. Durch die Heirat hatte er nun genügend Gulden, um seine Brote im eigenen Ofen zu backen. Doch damit nicht genug. Er kaufte zwei Esel, ließ einen Stall errichten, riss den windschiefen Schuppen ab, um für einen größeren Platz zu schaffen, und erstand neue Möbel und Kleidung für sich und seine Kinder.
Simon, obwohl er noch keine vierzehn Lenze gezählt hatte, war argwöhnisch gewesen. Doch seine Mutter hatte nichts hören wollen.
»Es ist mein Erbe, das Melchior nun im wahrsten Sinne verbrennt, indem er einen Ofen bauen lässt. Wie kannst du nur so blind sein? Wir hatten genug zum Leben, warum musstest du unbedingt diesen Bäcker heiraten?«
»Schweig still, kümmere dich nicht um Dinge, die du noch nicht verstehst«, hatte ihn Anna entgegen ihrer sonst sanftmütigen Art zurechtgewiesen.
»Doch, ich verstehe nur zu gut, was hier vor sich geht. Melchior verfügt nun über Vaters Geld! Vierhundertfünfzig Gulden waren in der Truhe, das hast du mir selbst erzählt. Das kann nicht rechtens sein. Glaubst du, Vater hätte das so gewollt? Warum hast du Melchior überhaupt geehelicht? Die meisten Witwen kümmern sich um ihre Kinder und Bedürftige und führen ein gottgefälliges Leben. Konntest wohl nicht schnell genug in Melchiors Bett kommen. Was scheren dich Barbara und ich!«
Simon hatte sich eine schallende Ohrfeige eingefangen und ohne Abendbrot zu Bett gehen müssen. Seine Kammer, die er mit seiner kleinen Schwester teilte, grenzte an Annas und Melchiors Schlafraum, und er hatte sich die Finger in die Ohren gesteckt, um nicht hören zu müssen, was nebenan vor sich ging.
Simon erhielt einen Stoß in den Rücken, und die ihm verhasste Stimme seines Stiefbruders Wulf gellte in seinen Ohren.
»Was stehst du hier rum, du Faulpelz? Es gibt noch jede Menge zu tun!«
»Lass mich zufrieden, Wulf. Die Brote habe ich längst zu Laiben geformt, und die Backkammer ist gefüllt. Wolltest du nicht Holzscheite nachbringen, damit das Feuer nicht erlischt?«
»Ich bin der Sohn des Meisters, geh du und hol das Holz«, entgegnete Wulf hochmütig.
Ein Meistersohn konnte schon, kaum dass er geboren war, aufgedingt und freigesprochen werden. Er musste lediglich von seinem Vater bei der Zunft angemeldet werden. Kein Lehrbrief, keine Lehrjahre, keine sonstigen Bedingungen. Wulf war es einfach in den Schoß gelegt worden.
Simon seufzte und schluckte seine Erwiderung hinunter. Schweigend nahm er den großen Weidenkorb und ging nach draußen in den Hof zur Scheune, wo die Buchenscheite fein säuberlich gestapelt und trocken gelagert waren. Es war kalt, und die Luft roch nach Schnee. Für einen Augenblick hielt er inne und sah hinauf in den grauen Novemberhimmel, dachte an seinen Vater, der vor einem Jahr verstorben war. Er fröstelte, schüttelte sich und zog das Scheunentor auf.
Morgen war Simons Aufdingung. Seit er mit seiner Familie bei Bernbeck eingezogen war, half er zwar in der Backstube mit, aber bisher war die Aufnahme in die Zunft noch nicht erfolgt. Die Zunftmitglieder entschieden darüber, wer sein künftiger Lehrmeister sein sollte. Simon schickte jeden Abend vor dem Einschlafen ein Stoßgebet zum Himmel und bat Gott darum, ihn nicht bei seinem Stiefvater zu belassen. Lehrjungen lebten meist im Haushalt ihres Meisters, und Simons Hoffnung klammerte sich daran, wenigstens nicht mehr mit Wulf unter einem Dach wohnen zu müssen.
Außer Simons morgiger Aufdingung stand einen Tag später noch eine spannende Entscheidung an. Ganz Würzburg, ob Bettler oder Kaufleute, Dirnen oder Hebammen, Katholiken oder Protestanten, sprach von nichts anderem mehr als darüber, auf wen die Wahl zum nächsten Fürstbischof fallen würde. Schließlich vereinte ein Fürstbischof die geistliche und weltliche Macht auf sich. Vor nicht einmal vier Wochen war Friedrich von Wirsberg gestorben, der gegenüber seinen Schäfchen ziemlich geduldig gewesen war. Nun fragte sich ganz Würzburg, ob ihm ein sittenstrenger Zuchtmeister auf den Thron folgte oder alles mehr oder weniger beim Alten blieb. Was die meisten hofften, mit denen Simon gesprochen hatte. Die angespannte Stimmung lag über der Stadt wie eine schwere wollene Decke. In den Wirtshäusern redeten die Leute über nichts anderes mehr, und sie schlossen Wetten ab, wer Wirsbergs Nachfolger werden würde.
Im Zunftsaal hatten sich alle Mitglieder eingefunden und sich an mehreren Tischen verteilt. Zunftmeister Schlichting läutete eine Glocke, damit Ruhe einkehrte.
»Simon Reber, du weißt, dass es mehrere Bedingungen gibt, damit du in die Bäckerzunft aufgenommen werden kannst«, begann Schlichting.
»Ja, Meister«, antwortete Simon mit klarer Stimme.
Seine Mutter hatte ihm neue Kleider gekauft. Eine knielange, geschlitzte weite braune Hose, ein dunkelgrünes Wams und ein gefälteltes weißes Hemd mit Stehkragen, außerdem hatte sie darauf bestanden, dass er zum Barbier ging und sich die Haare schneiden ließ. Nun stand er mit fein säuberlich geschnittenem und gekämmtem Haar vor den Zunftmitgliedern, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und knetete aufgeregt seine Mütze.
»Als Zunftmeister habe ich alle Bedingungen überprüft, wie es die Zunftordnung vorschreibt. Du bist von ehrlicher und ehelicher Geburt und alt genug, um eine Lehre zu beginnen. Das Lehrgeld für den Meister, bei dem du arbeiten wirst, beträgt sechs Gulden. Zusätzlich musst du einen Gulden für die Armenkasse und fünf Viertel Wein für die Zunft berappen.« Sorgsam legte er den Geburtsschein in die Zunftlade, die vor ihm auf dem Tisch lag.
»Jawohl, Meister, ich habe das Geld zusammen und kann die Rechnung begleichen.«
»Simon, kannst du zwei Bürgen benennen, die das Bürgschaftsgeld von dreißig Gulden für dich garantieren?«
»Ja, Meister. Meine Bürgen sind Schreinermeister Stamitz und der Apotheker Konrad Sterzing.«
Seine Mutter hatte ihm zu den eben Genannten geraten, beide waren Freunde seines Vaters gewesen.
Stamitz und Sterzing erhoben sich und bekräftigten ihre Bürgschaft. Das Geld diente dazu, falls ein Lehrknecht Schaden in Haus oder Werkstatt seines Meisters anrichtete, diesen zu begleichen, aber auch um den Lehrling an den Meister zu binden, damit er nicht davonlief. Dies kam hin und wieder vor. Dann drohte dem Lehrling der Ausschluss aus der Zunft, kein anderer Meister durfte ihn ausbilden, und die Bürgen verloren ihr Geld. Außer die Schuld lag beim Meister, weil er seinen Lehrjungen schlecht behandelte, was tatsächlich viele taten. Doch meistens schrieben die Zunftmitglieder die Schuld dem Lehrling zu.
»Simon Reber, schwörst du, dich an die Zunftordnung zu halten, deinen Meister zu ehren und ihm gehorsam zu dienen und deine volle Kraft in die drei Lehrjahre einzubringen? Dann lege die linke Hand auf die Zunftlade und hebe deine Rechte zum Schwur.«
Simon trat näher an den Tisch und gelobte feierlich, was von ihm verlangt wurde. Als er geendet hatte, klopften die Zunftmitglieder mit den Handknöcheln zustimmend auf die Tischplatten.
»Wir haben lange überlegt, wer dein Lehrmeister werden soll, und uns für Melchior Bernbeck entschieden, da er keinen Lehrling hat und du sein Stiefsohn bist«, sagte Schlichting.
Simon schluckte, ließ sich aber seine Enttäuschung nicht anmerken. Dann verneigte er sich vor seinem Stiefvater und dankte ihm, dass er ihn in die Lehre nahm.
»Und nun lasst uns feiern gehen«, rief Melchior laut. Bernbeck hatte die Zunftmitglieder in den Gasthof ›Zu den drei Raben‹ eingeladen, um dort Simons feierliche Aufnahme zu zelebrieren. Das Gasthaus war das größte der Stadt und verfügte über riesige Stallungen, um die Pferde der Durchreisenden aufnehmen zu können. Hier gab sich die Welt die Klinke in die Hand, und man erfuhr die neuesten Nachrichten von den Treidelreitern, die die Schiffe von Mainz bis in den Würzburger Hafen brachten. Niemand sonst konnte so viel Platz für Rösser und Menschen bieten wie der Rabenwirt. Allerlei fahrendes Volk befand sich im Schlepptau der Treidler, und die Würzburger erfreuten sich an der Vielzahl der Spielmänner, Gaukler und Bänkelsänger, ganz zu schweigen von den hübschen Dirnen.
Wulf warf Simon einen scheelen Blick zu. Er hasste es, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Ihm war solch ein Fest nicht vergönnt gewesen, er als Sohn eines Meisters hatte keine Aufdingung benötigt. Einerseits war es ihm recht gewesen, denn so waren ihm die Lehrjahre erlassen worden und mit sechzehn Jahren war er Bäckergeselle. Aber andererseits, angesichts der Zeremonie, die für Simon abgehalten wurde, packte ihn der Neid. Auf dem Weg nach draußen, um sich zu erleichtern, drängte er sich an Simons Platz vorbei und beugte sich zu ihm hinunter.
»Glaub bloß nicht, du wärst jetzt etwas Besseres, weil du in die Zunft aufgenommen wurdest, anstatt wie bisher nur als Handlanger in der Backstube zu arbeiten«, zischte er Simon zu.
Simon tat so, als hätte er ihn nicht gehört, und hob seinen Becher, um Stamitz zuzuprosten.
Der gute Wein aus Franken floss in Strömen, und das Gespräch drehte sich um die bevorstehende Fürstbischofswahl. Inzwischen waren auch die meisten Ehefrauen der Zunftmitglieder anwesend, die bei Simons Aufnahmezeremonie nicht hatten dabei sein dürfen.
»Ich setze auf den Domherren Erasmus Neustetter genannt Stürmer«, verkündete der Apotheker lautstark seine Meinung. »Er und kein anderer wird unser nächster Landesherr werden.«
»Seid Euch nicht zu sicher, Sterzing. Da wette ich doch lieber auf Albrecht Schenk von Limpurg. Er wäre der Richtige, um die beiden Glaubensrichtungen zu versöhnen, damit der Frieden in der Stadt gewahrt bleibt. Auch Wirsberg war dies immer wichtig«, wandte Schlichting ein.
»Limpurg ist ein kränkelnder Mann. Und wer wählt schon einen Mann zum Fürstbischof, der bald vor unserem Herrgott stehen könnte? Aber vielleicht wäre es an der Zeit, wenn wieder mehr Strenge geübt werden würde«, mischte sich Melchior ein. »Seht euch doch nur um. Es wird zu viel gesoffen und gehurt, das ist nicht gottgefällig. Selbst in den Klöstern schert man sich nicht um das Keuschheitsgebot, und die Nonnen und Mönche trinken mehr Frankenwein, als sie vertragen können.«
Stamitz, der dem Wein bereits ordentlich zugesprochen hatte, lachte und hieb sich auf die Schenkel. »Das sagst ausgerechnet du, Melchior? Du hast doch ständig deine Finger unter irgendwelchen Röcken!«
Simon erstarrte. Aufmerksam hatte er die Gespräche der Männer verfolgt. Stimmte, was Stamitz gerade behauptet hatte? War sein Stiefvater untreu und beging Ehebruch? Er war froh, dass seine Mutter nicht mit am Tisch saß. Sie war untröstlich gewesen, als der Arzt sie ermahnt hatte, wegen des Fiebers das Bett zu hüten und auf Simons Aufdingungsfeier zu verzichten.
Bernbeck winkte ab. »Unter die Röcke zu fassen, ist keine Hurerei, Stamitz, allenfalls holt man sich Appetit für das eheliche Schlafgemach«, lallte er und schenkte sich einen weiteren Becher voll.
Angewidert stand Simon von der Bank auf, warf seinen Mantel über und ging nach draußen, um frische Luft zu schnappen. An die Hauswand gelehnt betrachtete er den Unrat in den Straßen. Vielleicht wäre es tatsächlich gut für die Stadt, wenn jemand hier für Ordnung sorgte. Es wurde immer schlimmer, jeder kippte einfach seinen Dreck aus dem Fenster in die Gassen. Er hatte keine Lust mehr, wieder hineinzugehen, stieß sich von der Hauswand ab und schlug den Weg zur Lilien-Apotheke ein. Die Feier würde ohnehin bald zu Ende sein. In seiner Manteltasche tastete er nach den Kreuzern, die Anna ihm für ihre Arznei mitgegeben hatte.
Die Apotheke mit ihren kunstvoll gedrechselten Möbeln aus Walnussholz wirkte gediegen. Getrocknete Kräutersträuße baumelten vor den Fenstern, und die Schränke und Regale, auf denen in verschiedensten Holzstandgefäßen die Arzneien und Gewürze Platz fanden, reichten bis unter die Decke. Davor stand ein Tisch von beeindruckender Handwerkskunst, auf ihm eine Waage aus Messing mit unterschiedlichen Gewichten, ein steinerner Mörser mit Pistill und ein silbernes Tablett mit feinstem Marzipan. Simon spürte, wie ihm das Wasser im Munde zusammenlief.
»Junge, kann ich dir helfen?«
Die Frau des Apothekers war gerade vom angrenzenden Laboratorium in die Offizin gekommen. Dort wurden Destillationen durchgeführt und Salben hergestellt. Sie trug eine schneeweiße Tudorhaube, die ihr Haar vollständig bedeckte und ihre Haut dunkler erscheinen ließ.
Teresa Sterzing war die Tochter eines Kaufmanns, den ihr Gatte Konrad auf einer Reise nach Venedig kennengelernt hatte. Pietro Tardelli war ein liebenswerter Kerl, alle Zeit munter und fröhlich und redete ohne Unterlass. Konrad und er hatten sich auf Anhieb verstanden, und Pietro hatte den Apotheker eingeladen, Gast in seinem Hause zu sein, bevor dieser die Rückreise nach Würzburg antreten musste. Als Konrad Sterzing Teresa Tardelli zum ersten Mal gesehen hatte, war er der schwarzhaarigen, glutäugigen Schönheit gleich verfallen. Seine Familie hatte später die Nase gerümpft ob der etwas dunkleren Haut seiner Braut, doch Konrad hatte es nicht gekümmert. Pietro Tardelli hingegen hatte keine Einwände gehabt. Im Gegenteil, Teresa war das zwölfte von dreizehn Kindern, und jedes Maul, das er nicht zu stopfen hatte, war eine Erleichterung.
Simon fischte den Zettel des Arztes heraus, und Teresa streckte auffordernd die Hand danach aus, die Simon geflissentlich übersah.
»Gott zum Gruße. Meine Mutter ist krank«, antwortete Simon und las von dem Stück Papier ab. »Sie soll ein Elixier aus Weidenrinde, Lindenblüten und Sauerdornwurzel bekommen. Die Weidenrinde zur Hälfte, die beiden anderen Kräuter je zu einem Viertel.«
In den dunklen Augen der Apothekerfrau lag ein erstaunter sowie ein belustigter Ausdruck.
»Verzeih, ich konnte nicht ahnen, dass du des Lesens mächtig bist. Die meisten Jungen und Mädchen können es nicht. Nun, dann wollen wir mal sehen, ob wir den Trunk für deine Mutter bereiten können.« Sie drehte ihm den Rücken zu und angelte drei Gefäße aus den Regalen hinter sich. »Es dauert nicht lange, ich muss nur das Elixier zusammenmischen.«
Geschickt nahm sie die Glasflaschen und verschwand im Laboratorium. Simon ließ seine Augen umherwandern, murmelte dabei die Namen der Inhalte vor sich hin, die auf den Gefäßen prangten.
»Pfefferminzblätter, Rosenblüten, Süßholzwurzel, Ingwer, Kamille, Schafgarbe, Augentrost …«
»Suchst du was?«, unterbrach ihn eine glockenhelle Stimme.
Simon fuhr zusammen und drehte sich um. Ihm gegenüber stand ein Mädchen mit schwarzen Haaren und dunklen Augen, eindeutig die Tochter der Familie. Sie trug ein schlichtes blaues Kleid mit einem viereckigen Halsausschnitt, der mit weißer Spitze gesäumt war und ihren heranreifenden Busen erahnen ließ. Ihre Lippen besaßen die Farbe tiefroter Kirschen, und die langen Locken wurden durch zwei seitlich geflochtene Zöpfe, die am Hinterkopf zusammengebunden waren, nur mühsam gebändigt. Bisher hatten Mädchen Simon nur mäßig interessiert, doch dieses Mal war es anders. Sie war etwas Besonderes.
»Bist du stumm?« Nun klang ihre Stimme besorgt, und ihre Augen ruhten auf seinem schmalen Gesicht mit den hohen Wangenknochen.
»N… nein, ich warte nur auf die Arznei für meine Mutter.«
»Oh, was hat sie denn?«
»Fieber. Der Arzt hat ihr verboten, das Bett zu verlassen. Dabei wollte sie unbedingt mit zu meiner Aufdingung.«
Wieso erzählte er ihr das? Das ging sie doch gar nichts an.
»Ich bin Julia, meinem Vater gehört die Apotheke. Tut mir leid, dass sie nicht dabei sein konnte.« Sie hielt ihm ihre rechte Hand hin.
Simon nahm die dargebotene Hand und spürte die samtweiche Haut.
»Mein Name ist Simon.«
»Du kannst meine Hand wieder loslassen«, schmunzelte sie.
Errötend entließ er die zarte Mädchenhand aus seiner, wenn auch widerstrebend. Es hatte sich so gut angefühlt, sie zu halten. Was war nur auf einmal los mit ihm?
»Was für eine Lehre wirst du denn beginnen?«
»Bäcker. Ich werde Bäcker.«
»Du klingst nicht sonderlich begeistert«, stellte sie fest und musterte ihn aufmerksam.
»Ich wäre viel lieber in die Fußstapfen meines Vaters getreten, er war Bildhauermeister. Weißt du, als Bildhauer schafft man ständig irgendetwas Neues, Eigenes, man kann seine ganze Seele in die Werke legen. Ein Laib Brot ist ein Laib Brot, dafür bedarf es keines Einfallsreichtums«, sprudelte es aus ihm heraus.
Sie strich sich eine Locke aus dem Gesicht. »Du sagst ›war‹. Ist dein Vater gestorben?«
Simon sah zu Boden. »Ja, letztes Jahr«, erwiderte er leise.
Julia legte ihm für einen Augenblick mitfühlend die Hand auf die Schulter.
»Das tut mir leid. Nun weiß ich auch, wer dein Vater war. Gebhard Reber. Meine Eltern haben eine kleine Marienfigur aus Alabaster von ihm fertigen lassen. Möchtest du sie sehen?«
Sie wartete seine Antwort gar nicht ab und nahm ihn bei der Hand, zerrte ihn hinter sich her und führte ihn in den Nebenraum, wo ihre Mutter gerade dabei war, das fertiggestellte Elixier zu verkorken.
»Julia, was machst du hier?«, fragte sie stirnrunzelnd. »Du solltest doch den Wintertrunk abfüllen.«
»Mutter, das ist Simon. Weißt du, sein Vater war der Bildhauermeister, der die Marienstatue geschaffen hat, die auf der Anrichte steht. Ich wollte sie ihm zeigen. Und dann fülle ich den Trank ab«, entgegnete Julia.
Teresa Sterzing stellte die Flasche beiseite. »Ja, geht nur. Dein Vater war ein herausragender Künstler, Simon, du kannst stolz auf ihn sein.«
Die Marienstatue war ein kleines Kunstwerk. Die verschiedenen Rosétöne durchzogen das Alabasterweiß und ließen Mariens Mantelfalten lebendig wirken. Auf ihrem Gesicht lag ein gnadenbringender Ausdruck. Simon hatte viele Werke seines Vaters gesehen, doch diese Marienstatue rührte ihn an. In ihrer Linken hielt sie einen Rosenkranz, dessen Kreuz mit winzigen Röschen verziert war.
»Sie sieht aus, als ob sie jeden Sünder in die Arme schließen wollte«, sagte er mit Blick auf die Hände, die sich dem Betrachter entgegenreckten.
»Ja, sie ist wunderschön«, bekräftigte Julia leise.
Als sie wieder in der Offizin angelangt waren, bezahlte Simon den Trunk und bedankte sich bei der Apothekerfrau.
»Julia, nun geh aber an deine Arbeit«, mahnte Teresa Sterzing. »Und Gottes Segen für deine Mutter, Simon«, fügte sie hinzu und verschwand nach nebenan.
»Danke, dass du mir die Statue gezeigt hast«, sagte Simon leise und wandte sich zur Tür.
»Warte! Hier, nimm ein Stück Marzipan, das ist gut gegen Kummer.«
Simon bekam große Augen, griff zaghaft zu und ließ das Konfekt zwischen seinen Lippen verschwinden.
»Weißt du«, gab ihm Julia zum Abschied mit auf den Weg, »Teig lässt sich formen und verändern. Vielleicht kannst du ja auch damit Neues schaffen.«
Der Junge hatte Julia gefallen. Seine blonden Haare und die strahlenden blauen Augen, die an die Fayencekeramikgefäße in der Apotheke erinnerten. Zudem mochte sie sein eher schüchternes Auftreten, er war so anders als die Gassenjungen, die ihr nachpfiffen und ihr manchmal anzügliche Worte zuriefen.
»Julia, träumst du?«, fragte ihr Vater, der plötzlich neben ihr stand. »Du solltest doch deiner Mutter zur Hand gehen.«
»Verzeih, ich mache mich gleich an die Arbeit. Weißt du, gerade war Simon da. Sein Vater hat die Marienstatue auf der Anrichte geschaffen.«
»Ach, sieh an, der junge Reber. Ich kannte seinen Vater gut, Gebhard, Gott hab ihn selig.«
Julia schlang ihrem Vater die Arme um die Körpermitte und drückte sich an ihn. »Simon hat mir erzählt, sein Vater sei letztes Jahr gestorben. Ist das nicht schrecklich? Ich will nicht, dass du so jung stirbst«, murmelte sie.
Konrad Sterzing strich ihr über den dunklen Scheitel. »Das liegt allein in Gottes Hand, mein Kind. Was wollte Simon denn?«
»Arznei für seine kranke Mutter. Er hat mir leidgetan, deshalb habe ich ihm ein Stück Marzipan gegeben und ihm die Statue gezeigt.«
Sie legte den Kopf in den Nacken und sah aus ihren dunklen Augen zu ihrem Vater auf. Vielleicht mochte sie Simon deswegen, weil auch ihr Vater blond und blauäugig war.
»Du magst den Jungen«, stellte Konrad lächelnd fest. »Ich komme eben von Simons Aufdingungszeremonie und habe für ihn die Bürgschaft für seine Lehrzeit übernommen.«
»Wirklich?« Julia strahlte.
»Ist meine schöne Tochter ein klein wenig verliebt?« Belustigt zwinkerte er ihr zu.
Ihr schoss die Röte ins Gesicht. »Nein«, wehrte sie ab, »wo denkst du hin, er ist ein netter Junge, das ist alles.«
Der gewaltige Würzburger Dom, dem Heiligen Kilian als Schutzheiligem der Stadt geweiht, war festlich geschmückt. Hunderte Kerzen erleuchteten sein Inneres, der Weg zum Kapitelsaal, in dem nach dem Hochamt die geheime Bischofswahl stattfand, war mit dicken Teppichen ausgelegt. Maler hatten die Wappen der Domherren neu aufbereitet, wo sie in einem Seitenschiff bewundert werden konnten. Alle von Rang und Namen innerhalb und außerhalb Würzburgs waren gekommen, und Kirchendiener wiesen ihnen ihren Platz zu: hohe Geistliche, Bürgermeister, die Räte der Stadt, Amtmänner und Zentgrafen. Der Dom schien aus allen Nähten zu platzen. Hinter den kunstvoll geschmiedeten Gittern, die den Altarraum abtrennten, saßen die Domherren, ihre Mienen angespannt und doch erhaben. Einer von ihnen würde zum nächsten Fürstbischof gewählt werden.
Nachdem die Messe gelesen war, erklang Musik vom Positiv, einer fein gearbeiteten tragbaren Tischorgel, begleitet vom Domchor, der das Te Deum anstimmte. Ergriffen lauschten die Menschen den herrlichen Klängen, bis die letzten Töne verhallten und es plötzlich ganz still wurde. Kaum jemand traute sich, sich zu rühren. Dann erklang die glockenhelle zarte Stimme eines Mädchens adliger Herkunft und verzauberte die Anwesenden mit der Reinheit ihres Gesangs, der manchen gar zu Tränen rührte. Als sie geendet hatte, wurden die Anwesenden, mit Ausnahme der Chorherren, vom Dompropst aus der Kirche geschickt. Doch nur zögernd wurde der Aufforderung Folge geleistet. Alle wollten der Prozession der Domherren durch den Kreuzgang und vorbei an den Grablegen ihrer Vorgänger zum Kapitelsaal beiwohnen. Nachdem der letzte Domherr vorübergeschritten war und das Tor sich hinter den Hofschreibern und Wahlleitern geschlossen hatte, hängten Hellebardenträger eine Kette vor und stellten sich mit gekreuzten Waffen zum Schutz auf.
Draußen auf dem Platz vor dem Dom drängte sich das Volk. Kinder, Alte und Junge, Huren und Handwerker, Bauern, Bürger und Bettler. Sie alle waren gekommen und warteten gespannt auf den Ausgang der Wahl. Die Luft schwirrte von all den Stimmen, denn natürlich wurde lauthals darüber debattiert, wer Wirsbergs Nachfolger werden würde. Auch die umliegenden Wirtshäuser waren zum Bersten voll, kein Platz war mehr frei. Schließlich konnte man sich ja so lange mit einem Becher Wein die Zeit vertreiben. Das war allemal besser, als draußen in der Kälte des ersten Dezembertages sich die Beine in den Bauch zu stehen. Bestimmt reichte die Zeit auch für einen zweiten Becher oder vielleicht für ein schnelles Stelldichein mit einer Dirne in der Gasse um die Ecke.
Simon hatte einen Platz vor dem Hauptportal ergattert. Langsam war er immer weiter nach vorn gerückt. Menschen vor ihm hatten der Kälte nicht mehr getrotzt und sich lieber in eine warme Gaststube gezwängt oder die Menge verlassen, um sich irgendwo zu erleichtern. Inzwischen hatte er eiskalte Füße, doch er wollte auf keinen Fall den großen Augenblick verpassen, wenn verkündet wurde, wer künftig über Würzburg und das gesamte Hochstift herrschte. Zusammen mit Melchior und Wulf – Anna hütete noch immer das Bett – war er zum Domplatz gegangen, doch den beiden war es schnell zu langweilig auf dem Platz geworden, und so hatten sie sich davongemacht. Simon war es nur recht.
Auf der Suche nach bekannten Gesichtern ließ er seinen Blick durch die Menge schweifen. Dort drüben unterhielt sich Schlichting, der Zunftmeister der Bäcker, mit Schreinermeister Stamitz. Etwas abseits von ihnen war der Apotheker Sterzing ins Gespräch mit dem Stadtarzt vertieft. Simons Herz machte einen kleinen Sprung, als er Julias schwarze Locken entdeckte. Sie stand neben ihrer Mutter zur Rechten ihres Vaters. Dieses Mädchen war etwas Besonderes, ganz anders als die Gören in seiner Nachbarschaft. Plötzlich trafen sich ihre Blicke, und, als sie ihn erkannte, huschte über Julias Gesicht ein Lächeln. Er hob die Hand und winkte ihr zu, doch sie kehrte ihm den Rücken und war mit einem Mal nicht mehr zu sehen. Enttäuscht wandte er sich ab und heftete den Blick auf das Hauptportal. So allmählich könnten die Domherren sich einig werden, wen sie in den Rang eines Fürstbischofs erhoben.
Als ob seine stumme Bitte erhört worden war, erklang ein dreimaliges Pochen aus dem Dominneren. Das Stimmengewirr der Menge ebbte ab, alle Köpfe richteten sich auf das Portal. Das Tor öffnete sich und heraus traten zwei Domherren. Einer davon war Erasmus Neustetter, auf den viele gewettet hatten. Nun, sie hatten sich offenbar getäuscht.
»Der Fürstbischof von Würzburg wurde erwählt. Preiset den Herrn. Von Stund an ist unser geschätzter Domdekan Julius Echter von Mespelbrunn euer und unser Herr. Gelobt sei der Herr.«
Verblüffung machte sich breit, nur vereinzelt erhoben sich Jubelschreie. Simon wusste mit dem Namen nichts anzufangen. Gespannt lauschte er den Gesprächen in seiner Nähe.
»Sie haben den Domdekan gewählt? Der ist doch noch so jung. Ist er überhaupt in der Lage, das fürstbischöfliche Amt zu vertreten?«
»Echter soll sehr gelehrt sein, trotz seiner jungen Jahre.«
»Trotzdem. Wie kommen die Domherren dazu, solch ein Jüngelchen zu wählen? Echter zählt keine dreißig Lenze.«
»Frag den Herzog von Bayern, der hat sicher seine Finger im Spiel. Albrecht ist ein strenger Verfechter des alten Glaubens, die Protestanten sind ihm schon lange ein Dorn im Auge. Echter, dem man nachsagt, er sei ein Gegner der Reformation, ist damit für Herzog Albrecht genau der Richtige auf dem Bischofsstuhl. Außerdem wird gemunkelt, Echters Vater sei mit dem Bayern gut bekannt.«
»Wir können uns alle darauf gefasst machen, dass sich viel verändern wird.«
»Zum Guten oder zum Schlechten?«
»Das kommt darauf an. Wenn sich Mönche, Nonnen und Priester wieder mehr auf ihre Gelübde besinnen, anstatt zu huren und zu saufen, ist das nicht das Schlechteste. Ob der Friede in der Stadt gewahrt wird, wenn der neue Fürstbischof die Protestanten, wie der Bayernherzog die Juden, aus der Stadt und dem ganzen Hochstift vertreibt und damit Geld, Handel und Handwerker verlustig gehen, ist das wohl eher zu unser aller Schaden.«
»Düstere Aussichten. Kein Würfelspiel, keine Besäufnisse, keine Hurerei. Alles, was das Leben etwas bunter macht, wird von einem wie Echter ausgemerzt werden.«
Plötzlich setzte Domglockengeläut ein. Der Augenblick war gekommen, da sich der neue Fürstbischof in vollem Ornat seinem Volk zeigte. Die Glocken verstummten und Posaunen ertönten. Als wäre der Herrgott selbst mit der Wahl zufrieden, riss die graue Wolkendecke auf, und die Sonne sandte ihre Strahlen herab auf Julius Echter von Mespelbrunn, der just in diesem Augenblick vor die Menge trat. Sein mit Perlen besetzter und mit Gold- und Silberfäden durchzogener Chormantel funkelte im Sonnenlicht, die Reliefstickereien, die das Gewand zierten, eine meisterliche Kunst der Seidensticker. Es schien, als ob die fein gearbeiteten, farbenprächtigen Figuren darauf gleich zum Leben erweckt würden.
Julius Echter hob seinen Bischofsstab und klopfte damit auf die Stufe, auf der er stand. Die Menge sank zu Boden, kniete vor dem Mann mit dem schmalen, scharf geschnittenen Gesicht.
»In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen«, rief er mit klarer Stimme.
»Amen«, scholl es aus der Menge.
Der Fürstbischof schritt die Stufen hinab, ihm entgegen kam der Dompropst mit dem fränkischen Herzogsschwert. Echter gürtete sich selbst das Zeichen der weltlichen Gewalt um. Das kostbare Schwert, dessen Parierstange reich mit Edelsteinen besetzt war, steckte in einer Scheide mit goldgetriebenem Rankenmuster. In dem sich windenden Blattwerk tummelten sich Tiere und Fabelwesen. Wie auch bei den Reliefstickereien des Chormantels war hier ein wahrer Meister zu Werke gewesen.
Echters Schimmel wurde herbeigeführt. Zaumzeug und Sattel waren poliert und glänzten mit den Goldfäden des Bischofsmantels um die Wette. Geschmeidig schwang sich der Fürstbischof auf den Rücken des edlen Tieres und ritt durch die Menge, gefolgt von den hohen Herren, die ihn hinauf zur Burg begleiteten. Dort oben über der Stadt, mit Blick auf den Main und die umliegenden Weinberge, würde er ab jetzt residieren. Echter zügelte sein Pferd, sah auf die Menschen herab und segnete sie ein weiteres Mal.
Eine zarte Hand schob sich plötzlich in Simons Linke. Verblüfft wandte er den Kopf. Er war von der bischöflichen Pracht so gefangen gewesen, ohne zu bemerken, dass Julia sich zu ihm gesellt hatte. Für einen Augenblick hatte er gar das Gefühl gehabt, der Fürstbischof hätte ihm tief in die Augen gesehen und seine Seele berührt. Doch das war sicher nur Einbildung gewesen.
»Er sieht wahrlich fürstlich aus, findest du nicht?«
»Doch. Erhaben und unnahbar«, erwiderte Simon und genoss es, ihre Hand zu halten.
»Wollen wir der Menge bis hinauf zur Burg folgen?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht. Eigentlich sollte ich nach meiner Mutter sehen. Und du? Musst du nicht zu deiner Familie?«
Sie schüttelte den Kopf. »Meine Eltern mögen dich offenbar und vertrauen dir. Schließlich hat mein Vater für dich gebürgt, wie ich erfahren habe. Warum hast du das nicht erzählt? Ist ja auch gleich, jedenfalls habe ich gesagt, du begleitest mich bis zur Außenmauer und wieder nach Hause, und sie waren einverstanden.« Auf ihrem Gesicht lag ein spitzbübisches Grinsen.
»Du bist ein wahrer Schelm, Julia«, entgegnete Simon lachend. »Gut, lass uns gehen. Ich war noch nie dort oben.«
Sie hatten die Hälfte des steilen Anstiegs bewältigt und blieben einen Moment stehen. Noch immer hielten sie sich an den Händen. Es war wie ein Zauber. Ihnen zu Füßen breitete sich die Stadt aus. Über die einzige Brücke, die den Main mit ihren acht steinernen Bögen überspannte, eilten jede Menge Menschen, oder sie drängten sich an den Verkaufsständen. Dazwischen mühten sich Fuhrwerke voran, um von einem Ufer zum anderen zu gelangen. Die Wasser des Flusses glichen einem breiten glitzernden Band.
»Wie schön muss es hier erst im Frühling sein, wenn alles blüht«, entfuhr es Simon, der sich an dem Anblick nicht sattsehen konnte.
»Hier steckst du also«, herrschte eine raue Männerstimme ihn an.
Simon fuhr herum, ließ Julias Hand los und sah sich seinem Stiefvater gegenüber. Hinter diesem stand Wulf mit vor Anstrengung gerötetem Gesicht und schnaufte.
»Warum bist du nicht längst zu Hause und kümmerst dich um deine kranke Mutter? Stattdessen treibt sich der junge Herr herum«, fuhr Bernbeck fort.
»Es geht ihr besser, wie du weißt. Außerdem ist die Magd da, falls meine Mutter etwas braucht«, erwiderte Simon trotzig.
»Widersprich mir nicht! Du gehst jetzt auf der Stelle nach Hause. Auch in der Backstube gibt es zu tun.«
»Ich werde zuerst Julia begleiten.«
»Wulf kann das machen. Du kommst jetzt mit mir.«
Melchior Bernbeck packte Simon am Arm, seinen Zorn nur mühsam unterdrückend, und zerrte ihn den Hang hinunter.
»Meister Bernbeck«, rief Julia, »so haltet ein! Es ist meine Schuld, dass Simon hier ist. Er wollte zu seiner Mutter, aber ich habe ihn überredet.«
»Lass gut sein, Mädchen«, entgegnete Bernbeck unwirsch. »Geh mit meinem Sohn.«
»Ich will aber, dass Simon mich begleitet. Mein Vater ist der Apotheker Sterzing, nur damit Ihr’s wisst.«
Julia legte die Stirn in Falten und sah den Bäckermeister finster an, die Arme in die Hüften gestemmt. Simon war hingerissen. Was für ein mutiges Ding sie war.
»Was fällt dir ein, mir zu widersprechen, du rotzfreches, eingebildetes Gör! Du wirst jetzt tun, was ich sage!«
Doch Julia blieb bockig. »Sonst?«
»Sonst kannst du allein durch die Stadt gehen. Das wird dir nicht gefallen, bei all dem Gesindel in den Gassen.«
Stur schüttelte sie den Kopf.
Wulf nahm sie am Arm, auch ihm schien das Mädchen mit den schwarzen Haaren außerordentlich gut zu gefallen.
»Nun komm schon, übertreib es nicht. Ich bringe dich nach Hause.«
Sie versuchte, ihn abzuschütteln.
»Wenn du nicht augenblicklich mitkommst, dann werde ich dafür sorgen, dass Simon es noch bitter bereuen wird, mit dir gegangen zu sein«, raunte Wulf ihr ins Ohr.
Julias Widerstand erlahmte. Sie warf Simon einen bedauernden Blick zu und folgte Wulf, der nun ihren Arm freigab.
Kaum waren sie außer Sichtweite, versetzte Bernbeck seinem Stiefsohn eine schallende Ohrfeige.
»Wag es nie wieder, dich mir zu widersetzen. Hast du verstanden?«
Simons Wange brannte, von seiner aufgeplatzten Lippe rann warmes Blut, das er mit dem Handrücken abwischte. Er hasste diesen Mann und seinen Sohn. Doch sein Entschluss stand fest. Er würde die Zähne zusammenbeißen und die drei Jahre Lehrzeit hinter sich bringen. Der Tag seiner Freisprechung würde der letzte sein, den er in Würzburg zu verbringen gedachte.
1574 Würzburg
Das neue Jahr war gerade erst wenige Monate alt, da bereuten bereits einige der Domherren, ihre Stimme Julius Echter gegeben zu haben. Solch einen sittenstrengen Fürstbischof hatten sie nun doch nicht haben wollen, ebenso wenig wie der Großteil der Würzburger. Anhänger des alten Glaubens und Protestanten lebten bislang gut und vergnügt miteinander. Warum sollte sich das ändern? Der Mensch war nicht dafür gemacht, sich die wenigen Lustbarkeiten, die das ohnehin schon harte Leben zu bieten hatte, zu versagen. Immer mehr bekannten sich sowieso zum lutherischen Glauben. Und wen störte es, wenn Mönche und Nonnen beieinanderlagen und Priester und Domherren sich Mätressen hielten? Außer dem neuen Fürstbischof offenbar niemanden.
Julius Echter war zwar gewählt worden, aber bestätigt durch den Papst und den Kaiser war die Wahl bisher nicht. Auch seine Priesterweihe hatte er noch nicht empfangen. Manche Hoffnung ruhte auf dem jetzigen Kaiser, denn Maximilian II. war dem Protestantismus nicht abgeneigt. Ganz anders als seine Vorgänger, sein Onkel Karl und sein Vater Ferdinand. Sollte Kaiser Maximilian tatsächlich zum neuen Glauben übertreten, konnte Julius Echter mit dessen Zustimmung nicht rechnen. Sicher, Papst Gregor würde Echter bestätigen, doch was, wenn der Kaiser sie ihm versagte? Dann besäße Echter nur die geistliche Macht in Würzburg, aber nicht die weltliche. Was würde dann geschehen?
Simon kümmerte es nicht, wer das Hochstift nun regierte. Seine Tage bestanden aus Arbeit, Arbeit und Arbeit und der Erduldung von Wulfs Bösartigkeiten. Kaum ein Tag verging, an dem Wulf nicht irgendetwas ausheckte, um Simon das Leben so schwer wie möglich zu machen oder, was er am liebsten tat, die Schuld, wenn etwas schiefgegangen war, auf ihn zu schieben. Simons Mutter hörte kaum hin, wenn er sich bei ihr über seinen Stiefbruder beschwerte. Seit Jahresbeginn schlief er in einer Ecke des Lagerhauses, nachdem Melchior darauf bestanden hatte, Simon solle sich das Zimmer mit Wulf teilen, damit die beiden Mädchen in einer Kammer schlafen konnten.
Wortlos hatte er Strohmatratze, Decke und Kissen genommen, war in den angrenzenden Hof gegangen und hatte sich im Lager eingerichtet. Anna hatte ihn angefleht, es doch mit Wulf zu versuchen, und dabei sogar ein paar Tränen vergossen.
»Simon, kannst du auch einmal an mich denken? Ich bin zu jung, um bis an mein Lebensende ein Witwendasein zu führen, deshalb habe ich wieder geheiratet. Melchior ist ein guter und angesehener Mann, wir hätten es schlechter treffen können. Er behandelt Barbara und dich wie sein eigen Fleisch und Blut, ich verstehe nicht, was du gegen ihn hast.«
Ihre Worte hatten ihn nur verächtlich auflachen lassen.
»Lass gut sein, Mutter. Lieber schlafe ich bei den Eseln, als mit Wulf eine Kammer zu teilen.«
Die Turmuhr schlug dreimal. Simon rieb sich den Schlaf aus den Augen und schälte sich aus seiner Decke. Er stieg in seine Kleidung, ging nach draußen zum Brunnen und wusch sich das Gesicht. Das eiskalte Wasser vertrieb die Müdigkeit, und er fröstelte.
Heute mussten sie noch mehr Brote backen als sonst, denn Fürstbischof Julius hatte Gesandte geladen, die er nach Rom schicken wollte, um die Bestätigung seiner Wahl durch den Papst zu erhalten. Am morgigen Abend würde auf der Burg ein fürstliches Bankett für die Gesandten, Domdekan Neidhart von Thüngen, Chorherr Georg Fischer vom Stift Neumünster und alle Domherren stattfinden. Eine stattliche Anzahl von sechsundfünfzig Männern, die zu verköstigen der Koch und seine Gehilfen allein nicht bewältigen konnten. Daher war die Order ergangen, ein Bäcker aus der Stadt sollte zusätzliches Brot backen. Die Zunft hatte das Los entscheiden lassen, wer den fürstbischöflichen Auftrag erhalten möge, und Bernbeck war der glückliche Gewinner gewesen.
Vor einigen Tagen war Simon zur Brauerei gegangen, um sich Hefe zu besorgen. Eigentlich war es Wulfs Aufgabe, doch dieser hatte sich einmal mehr davor gedrückt. Ächzend hob er einen Sack Roggenmehl an und verteilte einen Teil des Inhalts auf mehrere hölzerne Wannen. Die Hefe, die er mit Sauerteig und Wasser vermischen wollte, gab er in eine Schüssel.
»Verdammt, Wulf, wo ist der Sauerteig?«, fluchte er leise vor sich hin und sah sich suchend um.
»Redest du mit mir?« Wulf stand plötzlich in der Backstube. Die Arme vor dem Körper verschränkt lehnte er am Durchgang zum Hof.
»Ja. Wo ist der Sauerteigansatz? Ich brauche ihn, um den Teig fertigzustellen.«
»Hab ich gestern aufgebraucht«, erwiderte Wulf leichthin.
»Bist du noch bei Trost? Wieso hast du einen Teil davon nicht weitergezüchtet? Es dauert Tage, bis wir wieder einen Sauerteig haben!«
»Hüte deine Zunge, Schwachkopf, es geht auch ohne Sauerteig. Los, bring Wasser!«, zischte Wulf und gab Salz und Hefe in die Holzwannen.
»Du kannst das Wasser selbst holen. Ich gehe zu Meister Wachter und werde ihn um Sauerteig anbetteln.« Simon riss sich die Schürze vom Leib und stürzte aus der Tür.
»Was fällt dir ein?«, schrie Wulf wütend hinter ihm her, doch Simon kümmerte es nicht.
Um zum zweiten Zunftmeister, Robert Wachter, zu kommen, musste er fast die ganze Stadt durchqueren. Keuchend rannte er durch die noch dunklen Gassen, wich einer zwielichtigen Gestalt aus, die nach ihm griff, und erreichte schließlich schwitzend und mit rasendem Herzschlag Wachters Backstube. Der Meister und sein Geselle kneteten die Teige in den Wannen und sahen erstaunt auf, als plötzlich Simon auftauchte.
»Meister Wachter, Ihr müsst mir helfen!«
»Dein Benehmen lässt zu wünschen übrig. Solltest du uns nicht zunächst begrüßen?«, spottete der Geselle gutmütig.
»Verzeiht, natürlich, Gott zum Gruße, verehrter Zunftmeister und Geselle Jörg«, antwortete Simon mit hochrotem Kopf.
»Schon gut, Junge. Was treibt dich um diese Zeit zu uns?«, brummte Wachter, ohne seine Arbeit zu unterbrechen.
»Könnt Ihr mir mit etwas Sauerteig aushelfen?«
Wachter runzelte die Stirn. »Wie kann es sein, dass in Bernbecks Backstube kein Sauerteig vorhanden ist? Hast du ihn etwa ausgehen lassen? Du bist schon lang genug dabei, um zu wissen, dass dies nicht geschehen sollte. Dein Meister sollte dir die Ohren lang ziehen.«
»Es war nicht meine Schuld. Könnt Ihr mir nun aushelfen oder nicht?« Er klang patzig.
»Jörg, gib ihm etwas Sauerteig. Und du, Simon Reber, bist nur ein Lehrjunge und solltest es in Zukunft nicht an Höflichkeit und Respekt fehlen lassen. Hast du mich verstanden?«
Der Geselle reichte Simon eine kleine irdene Schale gefüllt mit Sauerteig.
»Ja, Meister. Und habt Dank.« Er wandte sich zum Gehen, doch Wachter hielt ihn auf.
»Wenn es nicht deine Schuld war, wie du sagst, wessen war es dann?«
Simon blieb stumm. An seiner Statt antwortete Jörg.
»Es war Wulf, Melchiors Sohn, nicht wahr?«
Das darauffolgende Schweigen war Antwort genug.
»Nun geh schon«, entließ ihn der Zunftmeister seufzend.
Als Simon zurück zu Bernbecks Haus kam, empfing ihn sein Stiefvater mit einer Ohrfeige und riss ihm die Schale aus der Hand. »Wie oft hab ich dir eingebläut, dass der Sauerteig immer weitergezüchtet werden muss.«
Wulf stand feixend daneben, nahm seinem Vater das Gefäß ab und verschwand in der Backstube.
»Hast du nichts zu sagen?«
Simon schüttelte den Kopf. Melchior würde die Wahrheit nicht hören wollen und sicher auch nicht glauben.
»Zur Strafe wirst du die Sauerteigbrote allein fertigen. Und nun verschwinde.«
Wulf hatte während Simons Abwesenheit den Roggenteig geknetet. Immerhin hatte er den Ofen angefacht, denn es dauerte eine Zeit, bis die Backsteine die richtige Temperatur besaßen. Stirnrunzelnd beobachtete Simon seinen Stiefbruder. Offenbar hatte Wulf zu viel Wasser genommen und gab nun Mehl nach. Wusste er denn nicht, dass der Teig das gar nicht mochte? Doch er hütete sich, Wulf zurechtzuweisen. Nachdem dieser mit seiner Arbeit fertig war, verließ er ohne ein Wort die Backstube. Die hölzernen Wannen, in denen der Roggenteig geknetet worden war, hatte er einfach stehen lassen. Wie jeden Tag kümmerte er sich nicht darum, sie sauber zu machen. Dafür gab es ja schließlich den Lehrjungen.
Simon war es nur recht, dann hatte er wenigstens seine Ruhe. Sorgfältig schrubbte er die Wannen und bereitete alles für seinen Teig vor. Nicht einmal ein halber Sack Roggenmehl war übrig. Für zwanzig Laibe würde er nicht ausreichen. Zischend stieß er die Luft aus. Nun musste er auch noch zum Mehllager gehen und die schweren Säcke vom Dachboden hinunterschleppen. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass kein Roggenmehlsack mehr dort war. Nur noch Weizenmehl. Nun gut, dann würde er eben mischen. Ächzend warf er sich den Sack über die Schulter und stieg die steile Treppe hinab.
Allmählich knurrte sein Magen, doch das Frühstück musste noch warten. Simon verteilte die Mehle in die Wannen, gab Sauerteig und warmes Wasser dazu und begann zu kneten. Es war eine anstrengende Arbeit, doch in den letzten Monaten hatten seine Hände so viel Kraft bekommen, dass sie ihm kaum mehr etwas ausmachte. Simon liebte inzwischen das Gefühl des Teiges zwischen seinen Fingern. Ganz anders als Wulf, von dem er wusste, dass er das klebrige Gemisch verabscheute.