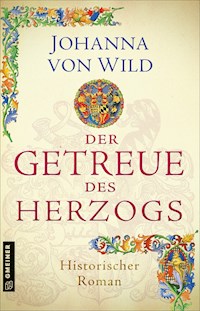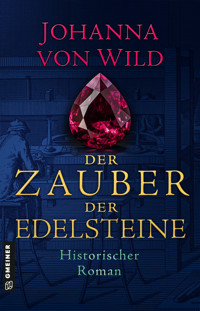Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Martin Waldseemüller studiert die sieben Künste, entdeckt seine Liebe zur Kosmographie und will sich ganz der Wissenschaft widmen. Während spanische und portugiesische Seefahrer immer mehr unbekannte Winkel der Erde entdecken, beschließt Martin, sein beschauliches Leben aufzugeben und eine lange Reise anzutreten. In Lissabon begegnet er der schönen Spanierin Elena. Doch ihrer heimlichen Liebe droht Gefahr, als Elenas verschollen geglaubter Ehemann von einer Reise mit Amerigo Vespucci zurückkehrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johanna von Wild
Der Meister der Karten
Historischer Roman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universalis_cosmographia_secundum_Ptholomaei_traditionem_et_Americi_Vespucii_alioru(m)que_lustrationes._LOC_2003626426.tif und
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carta_marina_navigatoria_Portvgallen_navigationes,_atqve_tocius_cogniti_orbis_terre_marisqve_formam_natvram_sitvs_et_terminos_nostris_temporibvs_recognitos_et_ab_antiqvorum_traditione_differentes,_LOC_2016586433-2.jpg
ISBN 978-3-8392-7936-6
Widmung
Für Ralf. Meine beste Entdeckung.
Zitat
»Keiner unserer Vorfahren hatte von diesen Ländern Kenntnis, die wir gesehen. Die meisten von ihnen glaubten, dass sich südlich des Äquators kein Festland befände, sondern nur unendliche See. Meine Fahrt hat nun bewiesen, dass diese Ansicht irrig ist und der Wahrheit schroff entgegensteht, da ich südlich des Äquators einen Kontinent fand.«
Aus dem Reisebericht »Mundus novus« von Amerigo Vespucci, 1502.
*
»Irrtümer haben ihren Wert;
jedoch nur hie und da.
Nicht jeder, der nach Indien fährt,
entdeckt Amerika.«
Erich Kästner (1899–1974)
Personenverzeichnis
Die wichtigsten Mitwirkenden – historische Personen sind mit * gekennzeichnet
Familie Waldseemüller
Martin*: Kosmograph
Konrad*: sein Vater
Margarethe*: seine Mutter
Jakob*: sein Onkel
Außerdem:
Oskar Rieber: Martins Kinderfreund
Daniel: Pfarrer in Wolfenweiler
Matthias Ringmann*: Philologe
Gregor Reisch*: Hochschullehrer
Familie Rebmann
Karl: Martins Studienfreund
Adelheid: seine Schwester
Wilhelmine: seine Mutter
Außerdem:
Reinhard Andris: Martins Studienfreund
Frieder Haug: Martins Studienfreund
Handelnde Personen in Sevilla und Lissabon
Juanoto Berardi*: Kaufmann in Sevilla
Elvira Berardi*: seine Frau
Aurelia Barroso: Elviras Gesellschafterin
Elena: ihre Tochter
Naira: Sklavin
Enzo de Cabrera: Seefahrer
Amerigo Vespucci*: Seefahrer, Entdecker
Cristóbal Colón*: Seefahrer, Entdecker
Juan Rodríguez de Fonseca*: spanischer Bischof
Manuel I.*: König von Portugal
Maria von Aragón*: seine zweite Gemahlin
Filomea de Mendes: Marias Hofmeisterin
Padre Luis: Pfarrer in Lissabon
Valentim Fernandes Alemão*: Buchdrucker
Isidro und Edgardo: Brüder und in Elenas Diensten stehend
Weitere Personen
René II.*: Herzog von Lothringen
Vautrin Lud*: Theologe in Saint-Dié
1478 Wolfenweiler
»Steh nicht faul rum, rühr lieber«, blaffte sein Vater ihn an und schlug Martin mit der flachen Hand in den Nacken.
Wie immer zu Martini wurden Schweine geschlachtet, denn der Novembertag markierte den Jahresabschluss für die Bauern, und mittlerweile war es kalt genug, um Würste und Schinken herzustellen. Die Ernte war eingebracht, Kohl, Rüben, Äpfel und Birnen in den Kellern eingelagert.
Der sechsjährige Martin stand auf einem großen Stein und mühte sich mit dem langen, schweren Holzstab, um das Blut unter die vorgekochten Schwarten und Zwiebeln, Salz und Gewürze zu rühren. Sein Magen hob sich ob des Geruchs, und wieder hielt er inne, legte den Kopf in den Nacken, sah zum Himmel und atmete tief durch. Er liebte diese Weite über sich. Oft stand er nachts heimlich auf und starrte aus dem Fenster, um den Mond und die Sterne zu betrachten. Wie viele es wohl von ihnen gab? Ob sie je einer gezählt hatte?
Grob wurde er an der Schulter gepackt und herumgedreht, der Stab entglitt seinen Händen, und schon hatte ihm sein Vater eine Maulschelle versetzt.
»Wenn du jetzt nicht rührst, dann endest du selbst im Topf. Hast du mich verstanden?«, schrie er, sein Gesicht rot vor Zorn.
Konrad Waldseemüller war der Metzger im Dorf und hatte an Martini alle Hände voll zu tun. Jeder musste mithelfen. Därme waren zu reinigen, um später der Wurst ein Zuhause zu geben, und das Fleisch sollte in den Kaminrauch gehängt werden, um es für den Winter haltbar zu machen. Martins Vater war ein jähzorniger Mann und bei den Dorfbewohnern nicht wohlgelitten, aber er verstand sein Handwerk wie kein anderer. Die Tiere starben schnell und schmerzlos. Konrads Hiebe mit dem Beil und seine Schnitte mit dem scharfen Messer, um das Fleisch zu zerteilen und von den Knochen zu lösen, saßen immer.
»Lass ihn zufrieden«, rief Margarethe und kam herbeigeeilt, als Konrad erneut die Hand hob. Sie fiel ihm in den Arm. Wutentbrannt fuhr er herum.
»Das wagst du nicht noch einmal!« Er gab seiner Frau eine gewaltige Ohrfeige.
»Mutter!« Mit aufgerissenen Augen und vor Angst zitternd stand Martin neben dem Kessel.
Konrad wollte seiner Frau gerade einen weiteren Schlag versetzen, als eine Stimme donnerte: »In Gottes Namen haltet ein, Waldseemüller.« Wie aus dem Boden gestampft erschien Pfarrer Daniel, ein großer Mann mit breiten Schultern.
Konrad schnaubte, ließ Margarethe jedoch in Ruhe, die sich die schmerzende Wange rieb. Martin drückte sich an sie.
»Nichts für ungut, Hochwürden, aber meine Familienangelegenheiten gehen Euch nichts an«, knurrte er. »Martin, hör auf zu heulen und mach weiter.«
Zu dessen Überraschung übernahm jedoch der Pfarrer den Stab und rührte das Blut unter. Der Junge staunte, wie leicht Daniel die kraftraubende Arbeit von der Hand ging. Es sah aus, als täte er nichts weiter, als einen Strohhalm in einem Becher Wasser zu bewegen.
»Was tut Ihr da?«, fragte Konrad verblüfft.
»Blut rühren, schließlich sollen die Würste ja heute noch fertig werden«, grinste der Geistliche.
»Wenn Ihr glaubt, Ihr bekommt davon etwas ab, täuscht Ihr Euch. Dieses Schwein ist nur für mich gestorben und nicht wie der Heiland für uns alle.« Konrad nahm das scharfe Messer und durchtrennte ein paar Sehnen.
»Hütet Eure ketzerische Zunge«, fuhr der Pfarrer den Metzgermeister an und bedachte ihn mit einem so zornigen Blick, der Martin erschauern ließ.
Auch sein Vater schien eingeschüchtert und senkte demütig den Kopf. »Vergebt mir, Hochwürden«, murmelte er. Dann sah er in den Kessel, befand, die Masse wäre gut vermengt. »Margarethe, füll die Därme damit, Martin, hilf deiner Mutter.«
»Ich sehe Euch am Samstag bei der Beichte, Waldseemüller, und am Sonntag bei der Messe«, verabschiedete sich der Pfarrer.
Martin sah ihm sehnsüchtig nach und wünschte, der Geistliche würde seinen Vater öfter in die Schranken weisen. Seufzend half er, das Gemisch in die gesäuberten Schweinedärme zu stopfen. Als alle gefüllt waren, band seine Mutter jede zweite Handbreit eine Schnur darum und zog sie fest. Nach und nach entstanden so gleich große Würste, die dann gekocht wurden. Später kamen auch sie zu den Schinken in den Kaminrauch. Während sein Vater weitere Schweine der Dorfbewohner schlachtete und zerteilte, kochten die Frauen Knochen aus, gaben kleinere Fleischreste, Wurzeln und Zwiebeln dazu. Platzten einige der Blut- und Leberwürste, landeten auch diese im Kessel. Waren alle Metzgerarbeiten erledigt, feierte man gemeinsam das Schlachtfest mit der sogenannten Metzelsuppe und frisch gebackenem Brot. Jeder, der mithalf, bekam einen Teller ab.
Martins Magen knurrte, als ihm der Duft des dunklen Brotes in die Nase stieg, welches Agnes gerade aus dem Ofen holte. Agnes war die Witwe eines Schuhmachermeisters und nächste Nachbarin der Waldseemüllers. Nach dem Tod ihres Mannes war sie in ihr Heimatdorf zurückgekehrt und lebte bei ihrem Bruder. Ihre beiden erwachsenen Söhne waren im nahen Freiburg geblieben und studierten dort an der Universität, wie sie nicht müde wurde, stolz zu erzählen. Martin mochte die pausbäckige, alte Frau, die ihm immer freundlich begegnete und ihm hin und wieder Leckereien zusteckte.
»Du erinnerst mich an meinen dritten Sohn, Martin, den der Herr mir leider viel zu früh genommen hat«, hatte sie ihm vor einiger Zeit gesagt. »Johannes war ein kluger Junge mit ebenso kastanienbraunen Haaren und genauso feingliedrig wie du. Ganz anders als Ludwig und Alfons. Die sind groß und stark, fast so wie unser Pfarrer Daniel.«
»Aber sie müssen doch trotzdem klug sein, wenn sie an der Universität studieren«, war Martins Antwort gewesen. »Also ist es gleich, ob man kräftig oder schwach ist, Hauptsache, man kann lesen, schreiben und rechnen und noch viel mehr.«
Lächelnd hatte Agnes ihm über den Kopf gestrichen. »Da hast du wohl recht, Martin. Du bist ein schlauer, kleiner Mann, und bestimmt wirst auch du einmal zur Universität gehen.«
»Ich glaube nicht«, hatte er traurig erwidert, »Vater erlaubt mir nicht, zur Schule zu gehen.«
Am späten Abend nach dem Schlachtfest, als alle nach Hause gegangen waren, hörte Martin, wie seine Eltern sich stritten. Seine einfache Bettstatt stand an der Wand, die seine winzige Kammer von der seiner Eltern trennte.
»Du hast verdammtes Glück gehabt, dass Pfarrer Daniel kam. Wenn du es noch einmal wagst, mich vor aller Augen zu demütigen, erlebst du den nächsten Morgen nicht mehr.« Die wütende Stimme seines Vaters klang schwer und undeutlich vom vielen Bier.
»Martin ist noch so klein, und die Arbeit, die du ihm aufbürdest, ist zu schwer für ihn«, traute sich seine Mutter zu widersprechen.
»Du benimmst dich wie eine Glucke, in seinem Alter habe ich noch viel schwerer arbeiten müssen. Der Junge muss lernen, wie hart das Leben ist. Er soll einmal mein Nachfolger werden, und du, du verzärtelst ihn nur.« Konrad lachte verächtlich.
»Martin ist nicht wie du. Sieh ihn dir doch an. Er wird niemals so kräftig werden«, entgegnete Margarethe. »Du solltest ihn in die Schule schicken. Wünschst du dir nicht auch für unseren Sohn, dass es ihm einmal besser gehen wird als uns?«
»Du denkst, es geht uns schlecht? Ich werde dir zeigen, wie schlecht es einem ergehen kann, wenn man ständig Widerworte hat, du nichtsnutziges Weib. Nur einen Sohn hast du mir geschenkt, und dazu noch einen Schwächling, der zu nichts taugt.«
Martin hörte das Gerangel zwischen den beiden, und das Flehen seiner Mutter.
»Nicht, Konrad, bitte.«
Die nachfolgenden Geräusche, Schläge, das Wimmern und Stöhnen versetzten ihn einmal mehr in Angst. Es war nicht das erste Mal, dass sein Vater ihr Gewalt antat. Martin stopfte sich die Deckenzipfel in die Ohren und wünschte, er wäre so kräftig wie sein Freund Oskar, der gut ein Jahr älter und beinahe zwei Köpfe größer war. Dann könnte er seine Mutter beschützen. Dafür war Oskar aber ziemlich langsam, was das Denken anbelangte. Und wenn Martin darüber nachsann, wollte er lieber doch nicht wie Oskar sein.
Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest begegnete Martin Pfarrer Daniel, der in Begleitung seiner beiden Messdiener war. Andreas trug drei Bücher vor sich her und Reinhold einen Korb, der mit einem Tuch abgedeckt war. Martin vermutete Messwein und Brot darunter. Er war auf dem Weg zum Backhaus und ging hinter ihnen, lauschte ihrem Gespräch.
»Ptolemaios war ein kluger Kopf, der vor mehr als tausend Jahren im fernen Alexandria gelebt hat«, hörte Martin den Pfarrer sagen.
»Wo liegt dieses Alexandria?«, wollte Andreas wissen.
»Reinhold, kannst du seine Frage beantworten?«, gab Daniel den Stab weiter an den anderen Jungen.
»In Ägypten, Vater, einem Land jenseits des Mare Mediterraneum.«
»Sehr gut, mein Junge«, lobte der Pfarrer.
»Und was hat dieser Ptomäu…«, begann Andreas.
»Ptolemaios«, berichtigte ihn Reinhold.
»… ja, eben der, was hat er so Kluges getan?«
»Er hat Bücher hinterlassen, die uns die Welt erklären«, lautete Daniels Antwort. »Die Erde steht fest im Mittelpunkt, und um sie herum bewegen sich die Planeten Mars, Venus, Merkur, Jupiter und Saturn in Kreisen. Dabei zieht beispielsweise der Mars auf einem größeren, also weiter entfernten Ring um die Erde als die Venus.«
»Was ist mit der Sonne? Und dem Mond?«, fragte nun Reinhold.
»Auch Sonne und Mond ziehen kreisförmig ihre Bahn um die Erde. Der Mond ist uns am nächsten, deshalb können wir ihn auch so deutlich sehen«, erklärte der Pfarrer.
Martin war hingerissen und sperrte die Ohren auf. Für ihn gab es nichts Schöneres, als den Nachthimmel zu betrachten.
»Und die Sterne? Wie heißen sie?«, wollte Andreas wissen.
»Ja! Und kreisen auch sie um unsere Welt?« Wissbegierig sah Reinhold zu Pfarrer Daniel auf.
»Ein sehr wichtiger Stern ist der Polarstern …«, begann der Geistliche.
»Ist er dieser hell leuchtende Stern am Himmel, den man immer in klaren Nächten sehen kann und der immer senkrecht über uns steht?«, rief Martin aufgeregt.
Daniel und die beiden Messdiener fuhren herum.
»Martin, was machst du denn hier?« Der Pfarrer sah ihn erstaunt an.
»Ich, ich … bin auf dem Weg zum Backhaus, aber … aber ich konnte nicht anders, als Euch zu folgen und zuzuhören«, stammelte er.
»Am Backhaus sind wir längst vorbei, Kleiner«, spöttelte Andreas.
Betreten blickte Martin zu Boden, spürte, wie seine Ohren heiß wurden. Was hatte er sich nur dabei gedacht, hinter den dreien herzulaufen, anstatt Brot zu holen, wie ihm aufgetragen worden war. Mit hängendem Kopf schickte er sich an, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen.
»Warte, Martin«, hörte er Daniel sagen und hielt inne.
»Du hast ganz recht, der helle Stern am Nachthimmel ist der Polarstern. An ihm orientieren sich die Seefahrer, so wie tagsüber am Sonnenstand«, erklärte der Pfarrer. »Dir gefallen also unsere Gestirne?«
»Ja, Hochwürden, sie sind wunderbar anzusehen, und ich wünschte, ich wüsste mehr darüber. Ich möchte so vieles lernen«, antwortete Martin, erfreut über die Freundlichkeit des Pfarrers und zugleich traurig, dass er wahrscheinlich kaum mehr über die Welt um sich herum erfahren würde, sollte er doch Metzger werden. Seine Zukunft würde blutig sein, verbunden mit dem Schreien der Tiere und harter Arbeit. Ihm graute jetzt schon davor.
»Reinhold, Andreas, geht voraus in die Sakristei«, ordnete Daniel an, bevor er sich wieder Martin zuwandte. »Wie alt bist du? Sechs, sieben? Ich habe dich zwar aus der Taufe gehoben, aber ich kann mich nicht genau an das Jahr deiner Geburt erinnern.«
»Sechs«, antwortete Martin leise.
»Du solltest in die Schule gehen, lesen, schreiben und rechnen lernen«, empfahl Daniel sanft und legte ihm die Hand auf die schmale Schulter.
Niedergeschlagen schüttelte der Junge den Kopf. »Vater erlaubt es nicht. Er sagt, die Nase in Bücher zu stecken, sei Zeitverschwendung. Ein Metzger müsse mit dem Messer und der Waage umgehen können, mehr nicht.«
Der Pfarrer legte seinen rechten Zeigefinger unter Martins Kinn und hob es an, damit er zu ihm aufsah. »Du darfst deinem Vater nicht gram sein. Wie jeder Mann wünscht er, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt. Und nebenbei bemerkt, auch er muss rechnen und schreiben können, um Buch über seine Arbeit zu führen.«
Martin kämpfte mit den Tränen. »Ich sei ein Schwächling, der zu nichts taugt, und meine Mutter ein nichtsnutziges Weib, hat er gesagt«, entgegnete er erstickt. »Er tut ihr Gewalt an, und ich habe Angst, dass er sie eines Tages totschlägt«, fügte er kaum hörbar hinzu.
Daniels Gesicht verfinsterte sich.
»Geh jetzt, Martin«, war alles, was er sagte. Sanft strich er ihm über den kastanienbraunen Schopf und strebte der Sakristei zu.
1479 Wolfenweiler
An einem klirrend kalten, aber sonnigen Sonntag Ende Januar nach der Messe standen die Dorfbewohner wie üblich im Kirchhof zusammen und tauschten den neuesten Klatsch aus.
»Auf ein Wort, Meister Waldseemüller«, hielt Pfarrer Daniel den Metzger auf, der gerade im Begriff war, mit seiner Familie nach Hause zu gehen. Seit vor einigen Jahren der Binzenmüller verstorben war und keinen Erben hinterlassen hatte, bewohnten die Waldseemüllers das Haus und nutzten die Nebengebäude. Mühlen gab es im Schwarzwald zur Genüge, durchzogen doch eine Vielzahl von Bächen und Flüssen die Region, und so war der Verlust der Binzenmühle vor Ort für die Leute aus Wolfenweiler nicht allzu groß. Konrad besaß außerdem Rebstücke, mehrere Fischweiher und weitere Güter und war somit kein armer Mann.
»Hochwürden, was kann ich für Euch tun?«, fragte Konrad und hielt inne.
»Kommt mit ins Pfarrhaus, dort ist es wärmer«, schlug der Pfarrer vor.
Stirnrunzelnd folgte ihm die Familie hinein und nahm in der Stube Platz.
»Ich möchte mit Euch über Martin sprechen«, begann Daniel.
»Was hast du wieder angestellt?«, zischte Konrad Martin an, der die Augen durch den kleinen Raum wandern ließ.
Bücher gab es hier, fein säuberlich aufgereiht hatten sie auf einem Holzbrett an der Wand ihren Platz gefunden. Zwar nicht viele, aber Martin hätte alles dafür gegeben, lesen zu können. Er zuckte zusammen, als sein Vater ihm einen leichten Schlag in den Nacken verpasste.
»Nichts habe ich getan, Vater«, murmelte er.
»Lasst das sein, Waldseemüller«, tadelte Daniel.
»Weswegen sind wir hier?«, wollte Konrad wissen. »Mein Magen knurrt, und zu Hause wartet das Essen.«
»Ich möchte, dass Ihr Euren Sohn zur Schule schickt. Er kann jeden Morgen mit den anderen Jungen gehen und ist etwa eine Stunde vor der Vesper wieder zurück.«
»Wozu soll das gut sein? Martin soll mir zur Hand gehen und das Metzgerhandwerk lernen«, entgegnete Konrad unwirsch.
»Ihr wisst genauso gut wie ich, dass er nie so ein geschickter Metzger werden wird wie Ihr. Er ist ein heller Kopf, und statt seiner könnte Oskar Euch helfen, der ein Jahr älter und ein kräftiger Bursche ist. Eugen Rieber wird Euch dankbar sein, er hat schließlich noch fünf andere Söhne, und nicht alle können seine Rebstücke übernehmen und Winzer werden«, entgegnete Daniel ruhig. »Lasst Euren Jungen zur Schule gehen. Zumal auch Ihr des Lesens, Schreibens und Rechnens mächtig seid.«
Martins Herz klopfte schneller. Bitte, Heiliger Jesus, mach, dass Vater nachgibt, dachte er.
Als Konrad schwieg, fuhr der Pfarrer fort: »Sagt Ihr nicht selbst, dass Euer Sohn ein Schwächling und Taugenichts ist? Ihr habt nichts zu verlieren, wenn Ihr ihn lernen lasst.«
Margarethe räusperte sich und straffte ihren Rücken. »Pfarrer Daniel hat recht, Konrad«, murmelte sie.
»Halt den Mund«, herrschte der Metzger seine Frau an, die wieder in sich zusammenfiel und den Kopf gesenkt hielt. »Oskar? Der Junge ist zwar groß und kräftig, aber auch tumb.«
»Warum seid Ihr stets so voller Zorn? Er ist eine der sieben Todsünden, Meister Waldseemüller«, mahnte der Geistliche sanft. »Ihr solltet Euch glücklich schätzen, anstatt ständig zu hadern. Weder lebt Ihr in Armut noch müsst Ihr Euch sorgen, Eure Familie nicht sattzubekommen wie so viele andere. Befleißigt Euch lieber der sieben Gaben des Heiligen Geistes, wovon die Einsicht die zweite ist. Sie ist die Schwester des Verstandes, von dem Ihr eigentlich genügend besitzen dürftet. Also, mäßigt Euch, jetzt und für alle Zeit.«
Martin war voller Bewunderung für den Mann Gottes. Keiner außer ihm durfte so mit seinem Vater sprechen. Erstaunt stellte der Junge fest, wie sich die Zornesfalten auf Konrads Stirn glätteten und sein Vater dem strengen Blick des Pfarrers auswich.
»Na schön, soll er es versuchen. Ich rede mit Eugen«, gab Konrad Waldseemüller missmutig nach.
»Eine weise Entscheidung«, lobte der Pfarrer von Wolfenweiler und unterdrückte mühsam ein Grinsen. »Gleich morgen früh wirst du dich Andreas und Reinhold anschließen und mit ihnen nach Schallstadt gehen, Martin.«
»Jawohl, Hochwürden«, brachte Martin hervor, der sein Glück kaum fassen konnte. »Ich weiß nicht, wie ich Euch danken soll.«
»Indem du fleißig bist«, lächelte Daniel.
Martin hatte in der Nacht vor Aufregung fast kein Auge zugetan. Hastig löffelte er am frühen Morgen den Gerstenbrei, trank einen Schluck Milch und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Sein Vater würdigte ihn kaum eines Blickes, aber Martin war es gleich. Die Gelegenheit, die sich ihm bot, irgendwann die Binzenmühle für immer hinter sich lassen zu können, würde nie wiederkommen. Also würde er lernen, lernen und nochmals lernen. Er leckte seinen Löffel sauber und steckte ihn hinter seinen Gürtel. Dann nahm er den wollgefilzten Umhang vom Nagel neben der Tür und schlang ihn um seine Schultern.
»Pass auf dich auf, mein Sohn«, sagte seine Mutter leise und strich ihm zärtlich über den Kopf, als Konrad gerade nicht hinsah.
Dann war Martin zur Tür hinaus und trabte zur Kirche, wo er die beiden älteren Jungen treffen sollte. Reinhold und Andreas waren nicht zu sehen, und für einen Augenblick fuhr ihm der Schreck in die Glieder. Hatten sie ihn vergessen und waren etwa schon aufgebrochen? Langsam beruhigte sich sein jagender Puls, er war bestimmt viel zu früh dran. Ungeduldig trat er von einem Bein auf das andere. Die Tür des Pfarrhauses öffnete sich, und Daniel kam heraus, eine Tasche aus Leinen in der Hand.
»Grüß dich Gott, Martin, sieh her, ich habe etwas für dich. Du brauchst eine Wachstafel, ein Alphabet und eine Rechenkette. All dies befindet sich hier drin«, sagte der Geistliche und klopfte auf die Tasche.
»Vergelt’s Gott, Herr Pfarrer.« Ehrfürchtig nahm Martin den Beutel entgegen und spähte hinein. »Ich weiß gar nicht, was ich tun kann, um …«
»Du musst kein schlechtes Gewissen haben, mein Junge. Als ich so alt war wie du, war ich oft verzweifelt. So gern wäre ich Zimmermann geworden, wie unser Herr Jesus Christus, aber das kam für meinen Vater nie infrage. Ich wurde der Kirche versprochen wie fast alle Zweitgeborenen aus adligem Haus. Mit meinen Händen wollte ich etwas erschaffen und nicht nur beten. Immer war ich todmüde, wenn wir mitten in der Nacht zur Matutin aufstehen mussten. Neidisch war ich auf meine Brüder, die Väter wurden und ihre Kinder aufwachsen sahen. Was hätte ich darum gegeben, einmal einen eigenen Sohn oder eine Tochter zu haben. Doch das bin ich längst nicht mehr. Der Herr in seiner Weisheit hat mir den Weg gezeigt, und deshalb nehme ich mich Kindern wie dir an, damit ihre Wünsche und Träume vom Leben vielleicht einmal wahr werden können. Nur müde bin ich immer noch«, zwinkerte er.
Martin hatte mit offenem Mund zugehört. Daniel wäre bestimmt ein liebender und fürsorglicher Vater geworden.
»Ich werde alles tun, damit ich Euch keine Schande mache, Hochwürden«, versprach er.
»Da bin ich mir sicher, und nun geh. Dort kommen Reinhold und Andreas.«
1480 Wolfenweiler
Heulend saß Martin im Schatten der Linde im Pfarrhof und klagte Daniel sein Leid.
»Mein Vater will Wolfenweiler verlassen«, schluchzte er und zog geräuschvoll die Nase hoch. »In Freiburg könne er mehr verdienen und mehr aus sich machen als hier in diesem gottverlassenen Nest.«
Der Pfarrer schüttelte den Kopf. All das Mahnen, Tadeln und Loben hatte nicht dazu geführt, aus Konrad Waldseemüller einen besseren Menschen zu machen. Wenigstens ließ er den jungen Oskar Rieber zufrieden, seit Daniel dem Metzgermeister die Leviten gelesen hatte.
»Was soll denn nun aus mir werden? Ich gehe zur Schule und habe Freunde gefunden«, klagte Martin und sah den Pfarrer mit geröteten Augen an.
»Dann wirst du in Freiburg weiterlernen, Martin, und neue Freunde finden. Deswegen musst du nicht verzweifeln. Freiburg ist nicht das Ende der Welt, es sind gerade einmal gut zwei Stunden Fußmarsch bis dorthin«, lächelte Daniel.
Martin wischte sich mit dem Ärmel über sein Gesicht, hielt den Kopf gesenkt. »Vater sagt, wenn wir dort sind, ist Schluss mit der Schule. Aber ich will Latein verstehen und alles über die Gestirne und die Welt erfahren. Der Schulmeister ist sehr zufrieden mit mir.«
»Ich rede mit deinem Vater, versprochen. Sag, was wird aus Oskar, wenn deine Familie Wolfenweiler den Rücken kehrt?«
Stirnrunzelnd sah der Junge auf. »Er wird hierbleiben. Wo soll er denn sonst hin?«
»Nun, er könnte mit euch kommen«, überlegte der Pfarrer und tupfte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Seine Soutane war ihm zu warm, obwohl sie nicht unmittelbar in der Sonne saßen.
»Warum sollte mein Vater dies erwägen? Er ist doch froh, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat«, erwiderte Martin.
»Ich muss noch die Messe vorbereiten, mein Junge. Vertraue mir und vertraue auf den Herrn, dann wird alles gut werden«, gab Daniel ihm mit auf den Weg.
Einige Tage später erschien der Pfarrer in der Binzenmühle, wo Konrad Waldseemüller gerade ein Lamm zerlegte.
»Grüßt Euch Gott, Hochwürden«, brummte der Metzger und widmete sich weiter seiner Arbeit.
»Martin hat mir erzählt, Ihr wollt nach Freiburg ziehen«, begann Daniel, »und er dürfe dort nicht weiter die Schule besuchen.«
»Ganz recht. Er kann etwas lesen, schreiben und rechnen, so wie Ihr es wolltet. Nun ist es genug, und er soll ein vernünftiges Handwerk erlernen.« Das Messer schabte entlang der Wirbelsäule, löste das Fleisch von den Rippen.
»Könnt Ihr damit aufhören und mich ansehen, wenn Ihr mit mir redet?« Daniel behagte das Geräusch keineswegs.
»Vergebt mir, Herr Pfarrer, es ist warm, und deswegen muss die Arbeit schnell erledigt werden, bevor das Fleisch schlecht wird. Am Sonntag ist Trinitatis, und ich habe noch ein weiteres Lamm zu zerteilen und ein paar Hühner zu schlachten. Entweder Ihr seht zu oder Ihr kommt morgen wieder«, erwiderte Konrad und durchtrennte mit geübtem Schnitt einige Sehnen. Dann brüllte er nach seiner Frau. »Margarethe, geh her und bring das Fleisch in den Eiskeller.«
Sie stutzte, als sie kurz darauf erschien und Daniel gewahr wurde.
»Nanu? Grüßt Euch Gott, Herr Pfarrer«, sagte sie freundlich, während sie eines der schwer mit Fleisch und Knochen befüllten Tongefäße aufnahm, um es in die Kühle zu bringen. Konrad hatte im Winter seine Weiher vom dicken Eis befreit und letzteres eingelagert. Meist hielt es sich gerade so bis in den April hinein. Doch der vergangene Winter war lang und sehr kalt gewesen, und noch war das Eis im Keller nicht aufgetaut.
Daniel entschied sich zu bleiben.
»Martin ist ein sehr guter Schüler, lernt schneller als die anderen. Ihr verwehrt ihm die Möglichkeit, später die Universität zu besuchen, wenn Ihr ihn nicht weiter zur Schule schickt. Seid doch vernünftig«, redete er auf den Metzgermeister ein.
Ungerührt griff sich Konrad den Wetzstein und schärfte die Klingen, reihte die Messer eines nach dem nächsten säuberlich auf der Fleischbank auf.
»Martin ist mein Sohn, Hochwürden, und ich bestimme, was aus ihm werden soll.«
»Und was wird aus Oskar?«
Konrad legte ein frisch geschliffenes Messer zur Seite, nahm sich eines weiteren an. »Oskar ist ein Einfaltspinsel, meist muss ich ihm zweimal erklären, was er zu tun hat. Soll sich Rieber um seinen Sprössling selber kümmern. Wenn Ihr sonst nichts weiter zu sagen habt, dann könnt Ihr wieder in Eure Kirche gehen und beten.«
Der Pfarrer hatte genug und machte zwei große Schritte auf Konrad zu, packte ihn am Kragen. »Hört genau zu, Meister. Ihr schickt Martin in Freiburg weiter zur Schule, und Oskar nehmt Ihr mit, damit aus ihm ein Metzger wird. Oder Eugen Rieber erfährt, dass er nicht der Vater des Jungen ist, sondern Ihr. Haben wir uns verstanden?« Damit ließ er ihn los.
Konrad Waldseemüller erbleichte. »Woher wisst Ihr …«, stammelte er, doch er fing sich sogleich wieder, als Margarethe erschien, um sich das nächste schwere Gefäß zu nehmen und wieder zu verschwinden.
»Auguste hat gebeichtet, das dumme Weibsbild«, brummte Konrad, »und Ihr habt das Beichtgeheimnis verraten. Von mir aus kann es das ganze Dorf erfahren, dass Auguste ihrem Eugen einen Kuckuck untergeschoben hat. Doch dann werden die Leute von mir zu hören bekommen, wie es um ihre Beichte bei Euch bestellt ist.« Verschlagen grinste Konrad ihn an.
Daniel strich sich die Hände an seiner Soutane sauber, als habe er sie sich an dem Metzger schmutzig gemacht.
»Ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Ich bin damals an der Waldhütte vorbeigekommen und habe Euer sündiges und wollüstiges Treiben nur allzu gut hören und durch das Fenster sehen können. Auguste bedurfte keiner Beichte. Und bedenkt, Waldseemüller, Eugen Rieber ist mindestens genauso dem Jähzorn verfallen wie Ihr. Ihr kennt das Gerücht, dass Eugen einen Knecht totgeprügelt haben soll, bevor er aus der Eidgenossenschaft nach Wolfenweiler kam.« Er ließ dem Metzger einen Augenblick Zeit, darüber nachzusinnen, bevor er mit gesenkter Stimme weitersprach. »Und wer genauer hinsieht, Konrad, erkennt, wessen Sohn Oskar in Wahrheit ist.«
Zwei Wochen später zogen die Waldseemüllers mit Sack und Pack nach Freiburg. Oskar ging mit seligem Lächeln neben Martin her, der noch immer nicht fassen konnte, wie Pfarrer Daniel dies wieder zuwege gebracht hatte, und zu seinem Entzücken steckte ein Schreiben für den Rektor der Lateinschule in Freiburg in seiner Tasche.
1488 Sevilla
»Komm her, du kleine Hexe«, knurrte Juanoto Berardi und griff Aurelia grob am Arm, zog sie in sein Kontor, trat die Tür mit dem Fuß zu und drehte den Schlüssel um. Wenn er sich mit Aurelia vergnügte, wollte er nicht gestört werden. Er zwang sie auf die Knie, ließ die Hosen herab, packte sie bei den dichten schwarzen Haaren, drückte ihren Kopf gegen sein Gemächt. Das Würgen in ihrer Kehle bekam er nicht mit, und bald erreichte er den Gipfel, den er schon vor einigen Stunden herbeigesehnt hatte.
Immer wenn der aus Florenz stammende reiche Kaufmann einen lukrativen Handel abgeschlossen hatte, benötigte er die Dienste einer Frau. Nicht seiner Frau Elvira, sondern meist bediente er sich Aurelia Barrosos. Berardi, dessen Vornamen Giannotto die Spanier Juanoto aussprachen, leitete das Kontor der mächtigen florentinischen Familie de’ Medici in Sevilla. Nebenher handelte er mit Sklaven und Orchilla, einem begehrten, aus einer Flechte gewonnenen Farbstoff, um Tuchen das begehrte Purpur zu verleihen. Die vor Afrika gelagerten Islas Canarias beherbergten die Pflanze an ihren steilen Felsküsten, und Sklaven verrichteten die gefährliche Erntearbeit. Heute hatte ihm Bartolomeo Marchionni zwanzig kräftige, junge Männer aus Afrika gebracht. Marchionni, der wie Juanoto aus Florenz stammte, leitete das Kontor der de’ Medici in Lissabon. Die Florentiner Familie erlaubte es den Männern, nebenbei eigene Geschäfte zu machen, solange sie ihre Arbeit versahen. Der Menschenhandel blühte, und das Vermögen der Männer mehrte sich stetig.
Die Portugiesin Aurelia Barroso war mit sechzehn Jahren in Berardis Haus gekommen. Sie war nicht nur eine schöne, junge Frau, sondern sprach fließend Spanisch, beherrschte dank ihrer deutschen, inzwischen verstorbenen Mutter auch diese Sprache, konnte lesen, schreiben und rechnen. Aurelia war ein Glücksgriff gewesen. Seine Frau Elvira hatte nach einer Gesellschafterin für sich verlangt, die auch später mittels ihrer guten Bildung einmal die gemeinsamen Kinder unterrichten sollte. Marchionni, der mit Aurelias Vater, Adao Barroso befreundet war, hatte dafür gesorgt, dass die junge Portugiesin nach Sevilla geschickt wurde. Adao, der noch sieben weitere Kinder hatte, war froh gewesen, einen Esser weniger am Tisch zu haben. Zu Anfang hatte Berardi die Finger von Aurelia gelassen, doch nachdem sie sich eingelebt hatte und Elvira zufrieden mit ihr war, musste Aurelia ihm das erste Mal zu Willen sein. Und noch immer war die Portugiesin begehrenswert.
»Steh auf«, forderte er und riss gleichzeitig an Aurelias Haaren. Sie stieß einen leisen Schmerzensschrei aus, kam auf die Füße und wich vor ihm zurück, während Berardi seine Hosen ein Stück hochzog. Aurelia näherte sich der Tür, bekam den Schlüssel zu fassen und drehte ihn im Schloss. Flink wie ein Wiesel packte er sie an der linken Hand und versetzte ihr mit seiner Rechten eine Ohrfeige.
»Ich habe dir nicht erlaubt zu gehen, Aurelia. Wir sind noch nicht fertig.« Ein böses Lächeln huschte über seine scharf geschnittenen Gesichtszüge.
»Señor, bitte nicht.« Aurelia wusste, was ihr blühte, und ihre großen, dunklen Augen weiteten sich.
»Señor, bitte nicht«, äffte er sie nach. »Aurelia, ich habe Grund zu feiern«, raunte er ihr ins Ohr. »Und du bist meine Auserwählte, um das gute Geschäft zu krönen.«
Angeekelt wandte sie ihren Kopf ab und vollführte blitzschnell eine halbe Drehung nach rechts, fuhr ihm mit krallengleich ausgestreckten Fingern durchs Gesicht. Juanoto grunzte verblüfft, ließ sie los und betastete seine verletzte Wange. Ungläubig starrte er auf seine blutigen Fingerspitzen. Noch nie hatte sie sich so gewehrt.
»Das wirst du mir büßen, du elendes Miststück«, schrie er, bekam sie erneut zu packen, bevor sie wieder die Tür erreichte. Wieder schlug er sie, dieses Mal so hart, dass sie taumelte. Im nächsten Augenblick lag sie bäuchlings über dem großen Schreibtisch, und der Kaufmann fesselte ihr mit seinem Gürtel die Hände hinter dem Rücken. Das Tintenfässchen fiel auf den Steinboden und zersprang. Aurelia zappelte wie ein Fisch auf dem Trockenen und erntete einen Faustschlag gegen den Hinterkopf, der sie erschlaffen ließ. Berardi schlug ihre Röcke hoch.
Als er von ihr abgelassen hatte, schlich Aurelia in ihre Kammer, die sie sich mit ihrer Tochter teilte. Vor zwölf Jahren hatte sie Berardis Kind empfangen. Elena war ein bildhübsches Mädchen, das die großen dunkelblauen Augen und die dichten schwarzen Haare seiner Mutter geerbt hatte. Auch wenn Elena eine Frucht der Gewalt war, liebte Aurelia sie von ganzem Herzen. Sie war ein aufgewecktes Kind, und selbst Elvira Berardi hatte irgendwann ihren Frieden mit Aurelia und Elena gemacht. Juanotos Gattin hatte erfahren, was ihr Mann nebenbei trieb, verachtete ihn dafür, wagte aber keine Widerworte und gab die Duldsame. Elena wuchs mit ihren Halbgeschwistern Maria und Lorenzo auf. Maria war nur wenige Monate und Lorenzo ein gutes Jahr jünger als sie, und Elena erhielt die gleiche Kleidung und Bildung wie die beiden Kinder. Fünfmal in der Woche erschien ein Hauslehrer, unterrichtete sie in Latein und brachte ihnen die Werke römischer Dichter näher. Elena wusste nicht, wer ihr Vater war, und so sollte es, wenn es nach Aurelia ging, auch bleiben. Sie hatte ihrer Tochter erzählt, ihr Vater wäre vor ihrer Geburt gestorben und ein entfernter Vetter von Berardi gewesen. Sie hätten sich geliebt, aber er wäre einer schrecklichen Krankheit zum Opfer gefallen. Juanoto hätte ihr ein Dach über dem Kopf geboten und die Vormundschaft für Elena übernommen. Und deshalb nannte Elena Berardi »tío Juanoto« und seine Frau »tía Elvira«. Onkel und Tante.
»Momia«, rief Elena bestürzt und starrte auf Aurelias geschwollene und gerötete Wange. »Hat dir jemand wehgetan?«
Aurelia umfing ihre Tochter, die sich an sie drückte, mit beiden Armen. »Nein, nein, mi niña, ich bin gestürzt. Es ist nicht schlimm«, log sie, obwohl ihre Wange schmerzte und wie Feuer brannte.
Elena legte den Kopf in den Nacken und sah zweifelnd zu ihr auf. »Ist das wahr? Ich gehe zu tío Juanoto, er wird den Schuldigen bestrafen.«
Bei der Vorstellung wie Berardi sich selbst auspeitschte, legte sich ein Lächeln auf Aurelias Gesicht. »Bestimmt, aber es gibt niemanden, den er züchtigen muss.« Sie hauchte Elena einen Kuss auf die Stirn, dann machte sie sich behutsam von ihr los und tauchte ein Tuch in das kalte Wasser der Waschschüssel, wrang es aus und kühlte ihre Wange. »Solltest du nicht in der Stube sein und Kissen besticken?«
»Maria und ich haben uns gestritten, sie wollte mir nichts von dem roten Faden abgeben«, antwortete Elena und zog ein Gesicht.
»Dann nimm eine andere Farbe«, seufzte Aurelia. Der Schmerz ließ nach, dafür schien ihr Unterleib nun in Flammen zu stehen. Nur mühsam unterdrückte sie ein Stöhnen. »Geh zurück und mach deine Arbeit, Elena«, ordnete sie streng an.
Zerknirscht wandte sich ihre Tochter ab und verschwand. Aurelia kämpfte mit den Tränen und legte sich aufs Bett, versuchte, der Pein Herr zu werden. Heute war Berardi roher als sonst gewesen. Sie hätte sich besser nicht wehren sollen, das hatte alles noch schlimmer gemacht. Wie sie ihn hasste. Am liebsten wäre sie mit Elena einfach davongelaufen. Doch was dann? Und wohin? Zurück nach Hause konnte sie nicht. Vor vielen Jahren hatte sie ihrer Mutter geschrieben und ihr Leid geklagt. Doch die Antwort war ernüchternd gewesen.
Aurelia, wir sind Frauen und haben uns den Männern zu fügen. Du bist in einem guten Haus untergekommen, und dafür solltest du dich glücklich schätzen.
Die Zeilen hatten sich in ihr Gedächtnis gebrannt. Ihre Mutter hatte ihr untersagt, zurück nach Lissabon zu kommen, dort wäre kein Platz mehr für sie. Damals hatte sich Aurelia geschworen, eine bessere Mutter für Elena zu sein. Eine Mutter, die ihr Kind beschützte. Vielleicht würde Berardi irgendwann das Interesse an ihr verlieren, hoffte sie. Und bis dahin war sie bereit, ihn zu ertragen. Um Elenas Willen.
1490 Freiburg
In der Löwengasse im Haus »Zum Hechtkopf« summte es wie in einem Bienenkorb, denn es musste alles für die Feier vorbereitet werden. Endlich hatte Konrad Waldseemüller die Bürgerrechte der Stadt erhalten, und jede Menge Gäste waren geladen. Lange hatte es gedauert, um die Bedingungen zu erfüllen. Mindestens zehn Jahre musste man in Freiburg leben und einen tadellosen Leumund vorweisen. Das große Wohnhaus des Metzgermeisters mit Innenhof, Stallungen und Nebengebäuden stand nicht weit entfernt vom Kornhaus, das auch als Schlachthaus diente. Von dort war es kaum mehr als ein Katzensprung zum Münster Unserer Lieben Frau und zum Marktplatz.
Martin war damals aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, als er den großartigen Kirchenbau zum ersten Mal gesehen hatte, nachdem sie umgezogen waren. Die unglaublich kunstfertigen Figuren an den Portalen und Choreingängen waren beeindruckend, vor allem das Marienportal am Südchor hatte es ihm angetan. Der sanfte Gesichtsausdruck der Mutter Gottes, die rechts neben dem Tympanon stand, das Mariens Krönung und Tod zeigte, war wunderbar. Wie sie ihr Kind auf dem Arm hielt und liebevoll auf es hinunterlächelte, hatte Martins Herz berührt. Noch war das Münster nicht fertiggestellt, aber schon jetzt nahm sein Anblick die Menschen gefangen.
Es gab für Martin so vieles in Freiburg zu entdecken. Die stolzen Häuser der Kaufmänner zeugten vom Wohlstand der Stadt. Eine seiner ersten Fragen an den Schulmeister Berthold Rombach war diejenige nach den zahlreichen Bächle gewesen, die Freiburg durchzogen.
»Sie versorgen Freiburg mit Wasser und speisen die städtischen Brunnen, damit die Menschen zu trinken haben. Durch weitere Runzen fließt es aus der Dreisam, was dem Schutz vor möglichen Feuern, aber auch den Tieren als Tränke dient. Zu guter Letzt entfernen die Rinnen auch den Unrat oder führen überflüssiges Regenwasser über Kähner – diese hölzernen Brücken – aus der Stadt, und das wiederum kommt den Feldern zugute. Und um sie sauber zu halten, beschäftigt Freiburg »Bächleputzer«, hatte ihm Rombach erklärt.
Die Zeit war seither wie im Flug vergangen. Martin beherrschte inzwischen Latein und verstand sich gut aufs Rechnen. Neben der Schule hatte er bemerkt, dass er gern zeichnete. Er hatte sich bei einem Maler Rat geholt, wie er seine Künste weiter verfeinern konnte. Oft saß er sonntags nach dem Kirchgang irgendwo in der Stadt oder draußen vor den Mauern und hielt auf einem Stück Papier fest, was sich gerade vor seiner Nase abspielte. Bäume, Büsche, den Verlauf des Stadtgrabens, einen Vogel, ein Boot, das die Dreisam entlangkam, Klusenknechte beim Flößen. Längst trauerte Martin Wolfenweiler nicht mehr hinterher. Zu Anfang wäre er am liebsten zurück zu Pfarrer Daniel gelaufen, denn er hatte das Gefühl, die anderen Schüler sähen auf ihn herab, weil er aus einem kleinen Dorf und nicht aus der Stadt stammte. Doch nach und nach hatte er Freunde gefunden und begonnen, sich heimisch zu fühlen.
Erfreulicherweise hatte sein Vater sich mit der Zeit zum Guten verändert. Neben seiner Metzgerei betrieb Konrad einen munteren Viehhandel und war sogar zum Spitalpfleger des Heiliggeistspitals bestellt worden. Sein Jähzorn kam nur noch selten zum Vorschein, zur großen Erleichterung der Familie. Heute war Konrad sogar stolz auf Martin, der sich im kommenden Winter an der Universität einschreiben wollte. Oskar dagegen würde es Konrads Meinung nach wohl nie zum Meister bringen, aber aus ihm war ein fleißiger, junger Mann geworden, der Konrads Launen mit einem Schulterzucken abtat. Einzig war es manchen Menschen ein Dorn im Auge, welch freundschaftlichen Umgang Martins Vater mit den jüdischen Viehhändlern pflegte.
»Judenküng« – »Judenkönig« – wurde er genannt, doch den Metzgermeister scherte das nicht. Seit vielen Jahrzehnten war es den Juden untersagt, sich in Freiburg niederzulassen, aber außerhalb der Stadtmauern konnte man gut mit ihnen Handel treiben.
»Münzen bleiben Münzen, ob sie nun aus jüdischer oder christlicher Hand in mein Säckel wandern«, pflegte Konrad grinsend zu sagen.
Ein streitbarer Geist war er trotzdem geblieben. Vor einigen Jahren hatte Martins Vater Rebstücke, die er noch in Wolfenweiler besaß, an einen Breisacher Bürger verkauft. Ohne ihm kundzutun, dass sie zinsbelastet waren. Drei Jahre danach ereilte ihn erneut der Betrugsvorwurf, als er weitere Güter an zwei Männer aus Martins ehemaliger Heimat und auch an einen Freiburger verschacherte. Beide Male war Konrad Waldseemüller vor Gericht gelandet. Jedoch hatte es ihm nicht geschadet, sonst wäre ihm das Bürgerrecht verwehrt worden.
»Margarethe, es muss mehr als genug Essen aufgetischt werden. Die Gäste sollen sehen, dass in meinem Haus an nichts gespart wird. Die Magd soll jede Menge Brot backen und der Knecht den Hof fegen. Oskar, geh zum Stiftungsweingut und besorge den besten Wein. Nimm den Ochsenkarren«, ordnete Konrad an.
In zwei Tagen sollte das Fest zu Konrads Aufnahme stattfinden. Alle Stadträte waren in die Löwengasse geladen, ebenso sämtliche Mitglieder der Metzgerzunft und die Oberpflegherren des Heiliggeistspitals. Sogar dem Rektor der Albertina, der Universität, hatte Konrad eine Einladung gesandt. Da so viele Leute keinen Platz in der Stube fanden, würden Tische und Bänke im Hof aufgestellt werden. Das Wetter war freundlich und warm, um unter freiem Himmel feiern zu können.
Während im Haus alle emsig den Vorbereitungen für das Fest nachkamen, stahl sich Martin fort. Ein Händler hatte ihm vor Wochen versprochen, eine Sternenkarte zu besorgen, Anfang August käme er wieder nach Freiburg. Nach wie vor galt Martins Leidenschaft den Himmelskörpern, er konnte es kaum erwarten, die Karte zu erstehen. Heute war Markttag, und Martin strebte dem Münster zu, wo die Händler ihre Waren in den fest bestehenden Ständen feilboten. Unzählige Menschen waren unterwegs, und die Luft war erfüllt von den dröhnenden Stimmen der Marktschreier. Dazwischen gackerten Hühner, muhten Ochsen und Kühe, schnaubten Pferde. Es roch nach Gewürzen, Fleischpasteten und Bohnensuppe, vermengt mit dem Gestank von Dung. Seinen Karren hatte der Händler am Rande des Platzes abgestellt, beladen mit Schriftrollen und Büchern.
»Ich habe Euch nicht vergessen, junger Herr, eine besondere Sternenkarte habe ich für Euch erworben«, rief er, als er Martins ansichtig wurde. Dann wandte er sich wieder einer Käuferin zu, deren Kleidung darauf schließen ließ, dass sie die Frau eines reichen Bürgers war. »Hier ist eine Ausgabe der Mentelin-Bibel, verehrte Frau Kolher.«
Johannes Mentelin aus dem nicht allzu weit entfernten Sélestat, oder Schlettstadt, wie man hierzulande sagte, war der Drucker der in deutscher Sprache hergestellten Bibel.
Sie nahm das Buch, strich über den schweinsledernen Einband und schlug es auf. »Wahrhaftig eine schöne Bibel«, sagte sie ehrfürchtig und blätterte um, zuckte nicht mit der Wimper, als der Händler ihr den Preis nannte.
Martin dagegen schluckte. Dafür hätte man gut und gerne vier Ochsen erstehen können. Vermeintlich unauffällig reckte er den Hals, um einen Blick auf das Werk werfen zu können. Zarte Blumenranken schlängelten sich seitlich der Buchstaben, die Anfangslettern eines jeden Abschnitts waren viel größer als die übrigen und in leuchtenden Farben koloriert.
»Beeindruckend, nicht wahr?« Lächelnd drehte sie das Buch in ihren Händen, damit er es besser sehen konnte.
Martin nickte nur, peinlich berührt, dass sie seine heimlichen Blicke bemerkt hatte.
»Ich schenke sie meiner künftigen Schwiegertochter zur Hochzeit«, plauderte die Frau und zerrte am Geldbeutel an ihrem Gürtel.
»Darüber wird sie sich bestimmt freuen. Soll ich die Bibel für Euch halten?«, bot er an.
»Sehr freundlich von Euch.« Sie gab ihm das Buch, kramte das Geld hervor, um es an den Händler weiterzureichen. Dann nahm sie Martin die Bibel ab und steckte sie in ihren Korb, breitete ein Tuch darüber.
»Einen schönen Gruß an Euren Gatten«, verabschiedete sich der Mann von der Käuferin und ließ die Münzen in einen Beutel gleiten.
»Wartet einen Augenblick, ich muss die Karte erst hervorholen«, beschied ihm der Händler und stieg auf seinen Karren. Er hievte zwei Kisten zur Seite, öffnete eine dritte und entnahm ihr ein in Leinen gehülltes Bündel.
Martin runzelte die Stirn. »Darin soll eine Karte sein?«
Der Mann grinste. »Besser. Ich habe Euch ein Astrolabium mitgebracht.«
»Das kann ich niemals bezahlen«, entgegnete Martin ärgerlich, im Begriff zu gehen. »Ich wollte eine einfache Karte, nicht mehr und nicht weniger. Und diese sind schon teuer genug.«
»Was haltet Ihr davon, erst einen Blick darauf zu werfen, bevor Ihr vielleicht zu vorschnell urteilt«, erwiderte der Händler und klopfte mit der flachen Hand auf das Leinen.
Widerwillig blieb Martin stehen. »Na schön, ich sehe es mir an, aber ich kann Euch jetzt schon sagen, dass ich es nicht kaufen werde.«
Der Mann schlug das Leinen auseinander und holte eine flache Scheibe hervor. »Seht her.«
Das Messinstrument, bestehend aus zwei drehbaren Messingscheiben zur Bestimmung der Position anhand des Sternenhimmels, zeugte von Kunstfertigkeit. Martins Augen leuchteten auf, als er die Rete mit ihren Sternsymbolen drehte und den kleinen Bären entdeckte, eines der wenigen Sternbilder, das ihm bekannt war.
»Es gefällt Euch, wie ich sehe«, grinste der Händler.
»Nun ja, aber was auch immer Ihr verlangt, wird zu viel sein«, entgegnete Martin betrübt und legte die drehbare Karte widerwillig aus der Hand.
Der Händler wandte sich um und förderte ein Pergament zutage, das er entrollte. »Ich dachte sogleich an Euch, als mir die Karte angeboten wurde«, schmeichelte er Martin. »Zusammen mit der Sternenscheibe wird sie Euch dienlich sein. Ihr erwähntet doch Euer Studium, das Ihr bald beginnen wollt.«
Martin fragte nach dem Preis und schnappte nach Luft, als der Mann ihn nannte. »Das kann ich mir nicht leisten, aber habt Dank dafür, dass Ihr mir diese Dinge gezeigt habt«, seufzte er und wandte sich ab.
»Wartet.« Der Händler machte ihm ein neues Angebot, das Martin erneut kopfschüttelnd ablehnte. Zähneknirschend sah der Händler ein, dass er dem jungen Mann nichts verkaufen können würde, und verstaute Karte und Drehscheibe wieder in der Kiste.
Bedrückt ging Martin nach Hause. Zu gern hätte er wenigstens die Sternenkarte gekauft. Nun hatte er nichts.
Konrad Waldseemüller trug sein bestes Wams über einem blütenweißen Hemd und empfing überschwänglich die nach und nach eintreffenden Gäste. Neben ihm stand Margarethe in einem hellblauen Kleid, dessen gerader Ausschnitt und Ärmel bestickt waren. Die bunten Fäden bildeten ein hübsches Blumenmuster. Auf ihren hochgesteckten Haaren saß eine dazu passende Haube. Auch Martin und Oskar waren mit neuen Gewändern ausgestattet worden. Kein billiges Unterfangen, aber vor einigen Jahren hatte Margarethe Waldseemüller eine Erbschaft erhalten, nachdem ein mit ihr verwandter Kirchherr in Radolfzell am Bodensee verstorben war. Es war ein erkleckliches Sümmchen gewesen, und Konrad hatte das erworbene Geld für besondere Ereignisse zur Seite gelegt.
Ehrerbietig begrüßten Konrad und seine Frau die Ratsherren der Stadt, den Bürgermeister und die Mitglieder der Metzgerzunft. Zuletzt erschien der Rektor der Albertina samt Gattin. In ihr erkannte Martin die Käuferin der Mentelin-Bibel.
»Herr Rektor, Frau Kolher, welche Ehre«, sagte Konrad und lüpfte sein Barett. »Darf ich Ihnen meinen Sohn Martin vorstellen? Er wird bald sein Studium an der Universität beginnen.«
»Wohl, wohl. Was möchtet Ihr denn studieren, junger Mann? Medizin?«, fragte Heinrich Kolher.
Seine Frau kam Martin mit einer Antwort zuvor. »Ich glaube, Martin interessiert sich mehr für die Astronomie. Nicht wahr?«
Martin senkte den Kopf. »Verzeiht, ich habe Euch vorgestern auf dem Markt nicht erkannt.«
»Wie könntet Ihr auch«, erwiderte sie, »wir sind uns noch nie zuvor begegnet.«
Heinrich Kolher zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Eure geschätzte Gattin hat bei einem Händler eine Mentelin-Bibel erworben, als ich just zum Stand kam, um mir eine Sternenkarte zeigen zu lassen«, klärte Martin die Umstehenden auf.
»Ah, die Sterne. Wie prachtvoll sie am Firmament anzusehen sind. Und neben ihrer Schönheit zeigen sie uns auch den Weg, wenn wir sie zu lesen wissen«, sagte Kolher.
»Ich möchte nicht nur Dinge über die Sterne lernen, sondern mehr über unsere Welt erfahren«, traute sich Martin zu erwidern.
Konrad Waldseemüller lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf sich, bat die Anwesenden zu den festlich gedeckten Tafeln und hielt eine kurze Rede, bevor das Essen aufgetragen wurde. Nachdem sich die Gäste gestärkt hatten, spielten drei Musikanten einige Volksweisen, und die meisten Anwesenden stimmten in den Gesang ein. Bald erhoben sich die Gäste, um dem Tanze zu frönen. Martin gesellte sich zu Rektor Kolher.
»Darf ich mich zu Euch setzen?«, fragte er, und Heinrich Kolher wies einladend auf den freien Platz gegenüber.
»Meine Frau liebt den Tanz, ich dagegen ziehe ein gutes Gespräch vor«, lächelte der Rektor. »Ihr werdet also bald an unsere schöne Albertina kommen. Es erfreut uns immer, wenn Sprösslinge eines Handwerkers nach Höherem streben. Aber nicht, dass Ihr denkt, unsereins schätze nicht die Arbeiten der Bäcker, Steinmetze oder Zimmerleute, so war dies nicht gemeint.«
»Ich verstehe schon«, winkte Martin ab, »die meisten jungen Männer an den Universitäten kommen aus adligem Haus oder sind Söhne von Gelehrten. Mein Vater hat früh gemerkt, dass ich nicht zum Metzger tauge, worüber er nicht glücklich war«, grinste er schief.
Kolher lachte leise. »Davon bin ich überzeugt. Umso erfreulicher ist es aber, dass er Euch heute das Studium ermöglicht«, erwiderte Kolher und trank einen Schluck Wein. Er hob das Glas gegen die tief stehende Sonne und betrachtete die satte gelbe Farbe des Weins. »Ein guter Tropfen, den Euer Vater uns angedeihen lässt.«
»Ein Gutedel vom Stiftungsweingut. Mein Vater ist Spitalpfleger. Wir kommen in den Genuss der feinen Tropfen, und das Heiliggeistspital zieht durch den Weinverkauf auch seinen Nutzen daraus«, sagte Martin. »So schließt sich der Kreis.«
»Euer Vater scheint mir ein kluger und zielstrebiger Mann zu sein. Doch nun zu Euch. Ihr sagtet vorhin, Ihr wolltet mehr über unsere Welt erfahren. In welcher Hinsicht?« Der Rektor blinzelte angestrengt.
»Wir können gerne die Plätze tauschen, wenn Euch das Sonnenlicht stört«, bot Martin an.
»Sehr aufmerksam von Euch, ich bin tatsächlich froh, wenn ich nicht ständig die Augen zusammenkneifen muss.« Kolher seufzte dankbar.
»Ich kenne nur Freiburg und den kleinen Weiler, wo ich geboren wurde«, kam Martin auf die ursprüngliche Frage zurück. »Ich bewundere die Seefahrer, die unterwegs in ferne Länder sind und Neues entdecken, fremdartige Dinge sehen. Ich habe die Reiseberichte des Marco Polo gelesen und war sogleich begeistert von der Vielfalt und Andersartigkeit, die er beschreibt.«
»Ihr werdet an der Universität auf Gregor Reisch treffen. Vergangenes Jahr hat er seinen Magister Artium gemacht und lehrt nun an der Albertina. Ich bin überzeugt, Ihr werdet Euch sehr gut verstehen. Reisch ist ein Mann, der sich für vieles begeistert, auch für die Kosmographie.«
1492 Sevilla
Amerigo Vespucci saß im Kontor von Berardis Schiffswerft vor einer langen Zahlenreihe und rechnete sie mithilfe eines Rechenbretts zusammen. Der Lärm, der von draußen hereindrang, störte den bärtigen Mann nicht. Das Hämmern und Sägen, die Rufe der Handwerker, all dies hörte er nicht, nur das Kratzen seiner Feder auf dem Papier. Anfang vergangenes Jahr war der Florentiner Kaufmann von Lorenzo de’ Medici, den man den Prächtigen nannte, nach Spanien gesandt worden. Er sollte dort in der Niederlassung in Sevilla arbeiten, nachdem sein Vorgänger Tommaso Capponi entlassen worden war. Angeblich hatte Letzterer Geld für seine eigenen Zwecke abgezweigt. Vespucci war ein gebildeter Mann. Sein Onkel Giorgio Antonio gehörte dem Dominikanerkloster San Marco an und war ein Gelehrter, der ihm Zugang zu den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft bot. Vespucci beherrschte Latein, kannte die Werke antiker Philosophen und die Reiseberichte von Marco Polo, die ihn faszinierten. Trotzdem war er Buchhalter geworden, auch wenn sein Herz für die Astronomie und die Geographie schlug.
Sevillas Binnenhafen am Guadalquivir war ein wichtiger Standort, liefen doch hier große und kleinere Handelsschiffe ein, beladen mit feiner Seide, fremdländischen Gewürzen, Baumwolle, Edelsteinen und begehrten Arzneien wie dem Mohnsaft. Juanoto Berardi und Vespucci hatten sich auf Anhieb gut verstanden. Die Männer waren in ähnlichem Alter, und Amerigo zeigte ebenso großes Interesse an Berardis Sklavenhandel wie an der Seefahrt. Inzwischen führte er nicht nur die Bücher, wie schon zuvor als er für die de’ Medici in der Bank gearbeitet hatte, sondern eignete sich mehr und mehr Wissen über Schiffe an. Über ihren Bau, ihre Reparaturen, ihre Ausstattung.
»Maestre«, gut gelaunt kam Berardi herein. Er nannte ihn oft so, vertraute seinem Landsmann sehr und zählte auf ihn bei wichtigen Aufgaben.
»Señor Berardi, ich wähnte Euch bei Eurem Freund Cristóbal Colón.« Amerigo steckte die Feder in den Halter.
Juanoto zog sich einen Stuhl heran und ließ sich darauf nieder.
»Mich erreichte soeben die Kunde aus al-Andalus, dass Granada gefallen ist. Emir Boabdil hat die Festung Alhambra an Königin Isabella und König Ferdinando übergeben. Cristóbal wird in den nächsten Tagen nach Santa Fé aufbrechen, um erneut bei Ihrer Majestät vorstellig zu werden.«
»Das sind gute Neuigkeiten, endlich ist der letzte spanische Landstrich von den Mauren befreit worden«, freute sich Amerigo. »Nun hat Isabella eigentlich keinen Grund mehr, den Krieg vorzuschieben und Señor Colón die längst geplante Reise nach Westen zu verweigern.«
Der Mann, über den sie redeten, hatte schon vor Jahren zunächst bei König João II. von Portugal zwecks Unterstützung seiner Fahrt vorgesprochen. Doch der Portugiese hatte abgelehnt. Indien über den Westweg zu erreichen, sei nicht möglich, so des Königs Berater. Cristóbal Colóns Berechnungen wären falsch. Nie und nimmer sollten es nach ihrem Ermessen von den Islas Canarias nur knapp zweitausendsiebenhundert Seemeilen sein, wie Colón behauptete. Der Weg wäre viel länger. Cristóbal war daraufhin von Lissabon weitergereist, um die Spanische Krone um Hilfe zu bitten. Aber auch Königin Isabella hatte kein großes Interesse an seinem Vorhaben gezeigt. Zu wichtig und vor allem zu kostspielig war es, Spanien endgültig eins werden zu lassen und sich der Mauren zu entledigen. Colón war hartnäckig und stets in der Nähe des spanischen Hofs geblieben. Eine erneute Verhandlung mit Portugal Jahre später war nicht von Erfolg gekrönt gewesen, ebenso wenig wie ein zweiter Versuch, Isabella von seinem Vorhaben zu überzeugen. Cristóbals Beharrlichkeit gegenüber der Königin hatte lediglich die Zusage bewirkt, man werde sich seiner Sache annehmen, wenn die Reconquista – die Rückeroberung – beendet sei.
»Ganz genau, Vespucci. Ich finde, wir sollten darauf anstoßen, dass Cristóbal mit guten Nachrichten zurückkehrt«, grinste Berardi.
Die beiden Männer verließen die Werft und gingen zur im maurischen Stil erbauten Villa des Händlers, die sich inmitten der Stadt befand. Das zweistöckige Herrenhaus mit seinen Bogengängen war umgeben von einem üppigen Garten, der seine ganze Pracht in den nächsten Wochen und Monaten entfalten würde. Die ersten Mandelblüten waren gerade dabei, sich zu öffnen, und schon bald würde sich das Land in einen rosafarbenen und weißen Blütentraum verwandeln. Obwohl die Spanier die Mauren nicht schätzten, liebten sie doch deren Bauten und ihre Mosaiken. Die bunten Kachelfliesen zierten Wände und Fußböden, auch Amerigo hatte sich bei seiner Ankunft in Sevilla dieser Kunstfertigkeit nicht entziehen können.
Auf einer Steinbank im Garten nahe des Eingangsportals saß Elena, vertieft in ein Buch auf ihrem Schoß. Die dunklen, langen Haare fielen wie ein Schleier rechts und links über ihre schmalen Schultern.
»Elena, wo ist deine Mutter?«, schreckte Berardi sie auf.
Sie fuhr zusammen und konnte gerade noch verhindern, dass ihr das Buch aus den Händen glitt. »Tío Juanoto, verzeiht mir, ich habe Euch und Señor Vespucci nicht kommen gehört. Momia spielt oben in ihrem Zimmer mit tía Elvira ›Juego de la Oca‹.«
Das Gänsespiel erfreute sich landauf, landab großer Beliebtheit. Berardi hatte ein besonders schönes Spielbrett erworben. Die dreiundsechzig spiralförmig angelegten Spielfelder waren mit bunten Ornamenten verziert, Würfel und Gänsefiguren aus Elfenbein gefertigt. Die Regeln waren einfach. Neue Spieler konnten dadurch schnell mitmachen und versuchen, ihre Gans als erste in den Gänsegarten zu bringen.
Berardi strich ihr sanft übers Haar. »Was liest du, mein Kind?«
Eine zarte Röte breitete sich über ihren hohen Wangenknochen aus.
»Eine traurige Geschichte von Diego de San Pedro: ›Cárcel de Amor‹, das Gefängnis der Liebe. Das Buch ist erst vor zwei Wochen gedruckt worden, und ich musste es unbedingt haben.«
»Eine junge Dame wie Ihr, Doncella Elena, sollte fröhliche Bücher lesen«, meinte Amerigo.
»Da habt Ihr ganz recht«, stimmte Berardi zu. »Und nun lasst uns einen guten Schluck nehmen.«
Sie gingen hinein und stiegen die Steintreppe ins Obergeschoss hinauf. Im Esszimmer war eine Magd dabei, den Boden auszufegen.
»Rosa, bring uns Wein, Ziegenkäse und Brot, los, eil dich. Señor Vespucci und ich haben Hunger und Durst«, herrschte Berardi sie an.
Die kleine, dralle Frau stellte den Besen an die Wand und hastete an ihm vorbei. Grob packte er sie am Arm. »Und nimm den Besen mit.« Er stieß sie von sich.
Flugs verließ Rosa mit dem Besen das Zimmer, als ob der Leibhaftige hinter ihr her wäre.
»Doncella Elena ist ein außerordentlich hübsches Mädchen. Habt Ihr schon einen Ehegatten für sie ausgewählt?«, fragte Amerigo und sah aus dem Fenster hinunter in den Garten. Elena saß noch immer dort, gefesselt von ihrem Buch. Mit der linken Hand wischte sie sich über die Augen. Sie weinte. Die Geschichte musste tragisch sein.
»Nein. Wollt Ihr sie?«, antwortete Berardi.
Vespucci wandte sich um und lachte. »Nein, so war das nicht gemeint. Sie ist mir zu jung.«
Rosa brachte das Gewünschte und stellte es mit zitternder Hand auf den Tisch, bemühte sich, beim Einschenken keinen Tropfen zu verschütten. Berardi bedeutete ihr mit einer Handbewegung, sich zu entfernen. Die Erleichterung darüber stand der Magd ins Gesicht geschrieben. Während die Männer den edlen Wein kosteten, schnalzte Amerigo anerkennend mit der Zunge.
»Eine wunderbare Traube und vermutlich aus unserer Heimat. Ein Malvasia?« Er griff nach einem Stück Brot.
»Euer Gaumen hat Euch nicht getrogen. Nun da die Mauren endlich verjagt worden sind, werden hoffentlich wieder mehr spanische Weine gekeltert. Wein zu trinken, ist ihnen verboten, doch anbauen hätten sie ihn sollen, allein der Weinsteuer wegen. Stattdessen haben sie sich nicht um die Reben gekümmert, und so wurden nur wenig schmackhafte Trauben geerntet. Eine Schande ist das«, sagte Berardi und schob sich ein Stück streng riechenden Ziegenkäse in den Mund.
»Wie viel, denkt Ihr, wird Cristóbals Reise kosten?«, fragte Amerigo und ließ den Wein in seinem Glas kreisen.
»Eine Million Maravedís, wenn nicht mehr. Ich bin bereit, die Hälfte davon für die Entdeckungsfahrt zur Verfügung zu stellen«, lautete Berardis Antwort.
»Eine stolze Summe. Seid Ihr sicher, es lohnt sich, so viel Geld in dieses Unterfangen zu stecken? Es könnte Euch ruinieren, wenn Colón den Westweg nicht findet, oder noch schlimmer, erst gar nicht zurückkehrt«, überlegte Vespucci kauend.
»Zunächst muss er von der Spanischen Krone erst einmal einen Vertrag bekommen, dann sehen wir weiter. Eure Bedenken kann ich verstehen, aber ich bin sicher, Cristóbal wird reich beladen mit Schätzen und Sklaven in den Heimathafen einlaufen.« Berardi leerte sein Glas. »Nun zurück ins Kontor, Maestre, es gibt viel zu tun.«
Ihm selbst stand der Sinn nicht nach Arbeit, sondern vielmehr nach Aurelia. Sie hatte lange genug mit Elvira gespielt, jetzt war es an der Zeit, dass er mit ihr spielte. Manchmal wunderte er sich tatsächlich, dass Elena nach wie vor nicht wusste, was er mit ihrer Mutter trieb, geschweige denn, dass sie ein Spross seiner Lenden war. Als Elena vor zwei Jahren ihren vierzehnten Geburtstag beging, hatte Aurelia ihm gedroht.
»Ich habe dich beobachtet, Juanoto. Wie du sie ansiehst und ihr übers Haar streichst. Wenn du Elena jemals anrührst, bist du ein toter Mann. Das schwöre ich bei allen Heiligen.«
Er hatte nur gelacht. »Was glaubst du, wer ich bin? Ich werde mich doch nicht an meiner Tochter vergreifen und die Sünde der Blutschande auf mich laden, du dummes Weib.«
»Wer du bist? Ein mieses Schwein bist du. Dass du es wagst, von Sünde zu sprechen, du doppelzüngiger Heuchler«, hatte Aurelia ihm entgegengeschleudert. Ihre Wut hatte sie noch begehrenswerter gemacht, und Berardi hatte sie ordentlich dafür büßen lassen.
Freiburg
Martin Waldseemüller studierte in der Universitätsbibliothek akribisch die Schriften von Aristoteles. In seinem Werk »De Caelo« legte der griechische Gelehrte dar, dass nach seinen Beobachtungen der Gestirne die Erde eine Kugelgestalt besaß und viel kleiner sein müsse, als sein Landsmann Platon einst behauptete.
Gehe ich nur ein Stück von Norden nach Süden, oder umgekehrt, sind die Sterne am Himmel verändert. In Ägypten beispielsweise gibt es Sterne, die in nordischen Gefilden nicht erscheinen. Andersherum sehen wir dort nicht die Sterne, die wir hier das ganze Jahr über beobachten können. Betrachtet man dann noch die Mondfinsternisse, so kann man klar kreisförmige Schatten erkennen, die der Mond auf andere Himmelskörper wirft.
Wie weit nach Süden müsste ich wohl gehen, um dies zu bestätigen, fragte sich Martin und las weiter. Aristoteles zog folgenden Schluss aus seinen Wahrnehmungen: Indien sei auch erreichbar, wenn man westwärts in See stach. Der Atlantis thalassa führe im Osten und Westen letztendlich dieselben Wasser.
»Waldseemüller, Ihr verderbt Euch noch das Augenlicht«, mahnte Gregor Reisch. Er kam gerade herein mit einem dicken Buch in Händen, welches er dem Bibliothekar reichte, damit dieser es an seinen angestammten Platz brachte. Der aus dem württembergischen Balingen stammende Lehrer, der nur zwei Jahre älter war als Martin, besaß die Gabe, bei seinen Schülern aus einem lediglich glimmenden Interesse für die Natur eine wahre Glut zu entfachen.
Martin rieb sich die Augen. Reisch hatte recht, zwei Dochte glommen kaum noch, und die dritte Kerze warf lediglich einen schwachen Schein auf die Papiere vor ihm.
»Ich lese gerade Aristoteles’ Werk ›Über den Himmel‹. Glaubt Ihr, es stimmt, dass man Indien erreicht, wenn man nach Westen segelt?«
Reisch zog sich einen Stuhl heran. »Ja, das tue ich. Aristoteles’ Begründung ist logisch und nachvollziehbar. Kennt Ihr bereits die Berechnung des Erdumfangs von Eratosthenes? Nein? Nun, der griechische Gelehrte wurde etwa hundert Jahre nach Aristoteles geboren. Zum einen folgte er dessen Meinung, die Erde sei eine Kugel, und stellte Beobachtungen über die Sonne an. Wann warf sie wo welchen Schatten, fragte er sich. Dabei stellte er fest, dass im südlichen Ägypten die Sonne lotrecht stand, zur gleichen Zeit aber im weit entfernten nördlichen Alexandria ein Stab einen Schatten warf. Diese Erkenntnis nutzte er, um den Erdumfang zu berechnen, und kam auf etwas mehr als fünftausenddreihundert Meilen.«
Martin lauschte gebannt den Ausführungen.
»Dann hatte Aristoteles tatsächlich recht: Die Erde ist kleiner als Platon mutmaßte.«
Reisch nickte lächelnd. »Löscht die Kerzen, Martin, und lasst uns ein Glas in der ›Traube‹ trinken gehen. Dort trifft sich jeden Donnerstag eine gesellige Runde.«
Martin Waldseemüller hatte von den regelmäßigen Zusammenkünften von Lehrern und Studenten gehört, sich aber nie getraut, die Runde aufzusuchen. Zumal ihm zu Ohren gekommen war, dass man von einem der Lehrer aufgefordert werden müsste und sich nicht einfach dazusetzen konnte. Erfreut über die Einladung sagte er zu. Der junge Mann befeuchtete mit seiner Zunge Daumen und Zeigefinger, drückte die Dochte zusammen, und das spärliche Licht erlosch.