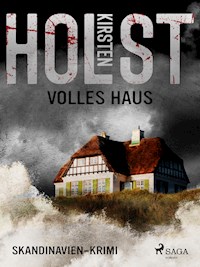Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kriminalkommissar Høyer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein neuer Fall für Kriminalkommissar Høyer im dänischen Rockermilieu: Nachdem der "König" der Rockerbande Blue Devils nach einem Unfall im Koma liegt, wird sein Nachfolger, der "Prinz" Lars Sørensen, ermordet. Kriminalkommissar Therkelsen glaubt, dass der Täter aus derselben Gang kommt, da es Rivalitäten um die Nachfolge des "Königs" gab. Doch dann geschieht ein weiterer mysteriöser Mord... -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirsten Holst
Der Prinz ist tot – Skandinavien-Krimi
Übersetzt Hanne Hammer
Saga
Der Prinz ist tot – Skandinavien-Krimi ÜbersetztHanne Hammer OriginalSom ringe i vandetCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1991, 2020 Kirsten Holst und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726569544
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
1
Es waren die Hunde, die eine erste leise Ahnung in ihm aufkommen ließen, dass etwas nicht in Ordnung war.
Die Hunde!
Warum um alles in der Welt schlugen die verdammten Köter nicht an? Gewöhnlich hörte er sie schon bellen, wenn das Gittertor in der äußeren Umzäunung aufging und er auf die alte Scheune Zufuhr, die als Garage diente.
Aber heute Abend – kein Laut.
Er hatte das Auto abgestellt und war ausgestiegen, die Tür war hinter ihm zugefallen und er hatte schon mehrere Schritte gemacht, bevor ihm klar wurde, dass etwas absolut nicht in Ordnung war.
Die Hunde! Jetzt hätten sie sich heulend und winselnd gegen den Maschendraht des inneren Zauns werfen müssen. Seltsam, wie man sich so sehr an etwas gewöhnen konnte, dass es einige Sekunden brauchte, bevor man registrierte, dass es nicht da war.
Wo waren die verdammten Köter? Sie mussten das Auto gehört, seine Schritte auf dem Kies erkannt haben, seinen Geruch.
Hatte er vergessen, sie herauszulassen, bevor er gefahren war?
Was für eine idiotische Frage. Sie waren draußen. Sie waren immer draußen. Jedenfalls die beiden Pitbulls. Das waren Wachhunde, keine Schoßhunde. Nur Tjekka, die Schäferhündin, durfte manchmal ins Haus, aber nur wenn er selbst da war. Hunde mussten wissen, wer der Herr im Haus war.
Er blieb ein paar Schritte von dem Tor entfernt stehen. Lauschte. Strengte sein Gehör bis zum Äußersten an, doch da war nichts als die üblichen Nachtlaute. Das leise Rauschen des Windes in dem trockenen Gras, das ferne Brummen der Autos auf der einige Kilometer entfernten Autobahn. Sein eigener Atem. Sonst war alles still.
Er machte einen Schritt und fand sich plötzlich zu laut, erschreckend laut. Oder war da noch etwas anderes? Ein anderes Geräusch?
Wieder blieb er stehen. Sah sich um.
Licht war ausreichend vorhanden. An dem Zaun entlang standen Lampen, alle fünfzehn Meter eine. Die verlassene Häuslerstätte war ihre Festung gewesen, mit Wachtürmen, Zäunen, Hunden und Lampen. Er hatte Hunde, Zäune und die Beleuchtung behalten, obwohl er jetzt allein hier lebte. Meistens jedenfalls. Manchmal wohnte ein Mädchen für einige Wochen bei ihm, doch die Mädchen waren es schnell müde, hier draußen in der Pampa zu hausen und nichts zu tun zu haben, außer seine Sachen zu waschen, für ihn zu kochen und Videos anzuschauen. Sie wurden der Hunde und der Lampen und der Einsamkeit überdrüssig.
Der Gedanke, dass sie vielleicht auch seiner müde wurden, streifte ihn nicht einmal.
Eine von ihnen hatte ihm erzählt, dass in der Nachbarschaft das Gerücht umging, er habe Angst vor Gespenstern. Dass er deshalb die vielen Lampen habe. Sobald es dämmerte, gingen sie automatisch an.
Angst! Er hatte nur gelacht.
Er hatte vor nichts Angst. Hatte nie Angst gehabt.
Sie hatte ihn angesehen und gedacht, dass das stimmen konnte. Er hatte zu wenig Fantasie, um Angst zu haben. Er lebte in einem verkrüppelten Jungentraum, einer Mischung aus Western- und Ritterromantik, den andere sich ausgedacht hatten, und war naiv genug zu glauben, dass das das wirkliche Leben war.
Natürlich hatte er keine Angst. Er hatte die Beleuchtung und alles andere behalten, weil er die Sicherheit schätzte. Ihn sollte keiner überraschen. In seiner Branche konnte man nie sicher sein.
Er hatte auch jetzt keine Angst. War lediglich auf der Hut. Weil etwas nicht war, wie es sein sollte. Weil die verdammten Köter noch nicht einmal gebellt hatten.
Er öffnete das Schloss in dem Drahtzaun und tastete nach dem Schalter, um die Alarmanlage auszuschalten, während er sich hineinzwängte. Dann erstarrte er, die Finger auf dem Schalter. Die Alarmanlage war ausgeschaltet.
Er drückte den Schalter noch einmal. An? Aus? An? Aus? An ... oder aus? Er fluchte und schaltete die Alarmanlage wieder an, als er drinnen war. An? Ja, er war sich sicher, dass sie eingeschaltet war.
Seine Gedanken schienen nur träge durch sein Hirn zu fließen. War die Alarmanlage ausgeschaltet gewesen? Oder hatte er sich das eingebildet? Er wusste es nicht mehr.
Aber die Hunde. Wo waren die Hunde?
Im selben Moment entdeckte er den ersten. Er lag zwischen Haus und Zaun. Zuerst hielt er ihn für einen alten Sack, doch das war kein Sack. Das war Tjekka. Die Schäferhündin. Die älteste von ihnen. Seine Hündin.
Er beugte sich über sie. Tastete nach der Halsschlagader. Sie war tot. Wurde schon langsam steif.
Er richtete sich wieder auf. Er wusste, dass die beiden anderen auch tot waren. Und jetzt spürte er, wie die Angst ihn überrollte. Seine Nackenhaare sträubten sich, der Schweiß schoss ihm aus allen Poren und die Beine fühlten sich an wie Pfosten, die tief in die Erde gerammt waren. Irgendwo hier in der Nacht wartete jemand auf ihn. Behielt ihn im Auge.
Er wusste, dass er etwas tun musste, doch er konnte die Beine nicht bewegen. Hatte auch keine Ahnung, was er tun sollte. Wohin er flüchten sollte. Wo war er, der Feind? Der unsichtbare Feind, der ihm hier im Halbdunkel auflauerte. Er nestelte an dem Reißverschluss seiner Jacke herum, zog ihn herunter und steckte unendlich langsam und vorsichtig die Hand hinein, um nach der Pistole zu greifen.
Mit der Waffe in der Hand blieb er stehen.
Er fühlte sich gleich ein wenig sicherer. Das erste lähmende Entsetzen verflüchtigte sich. Auf seltsame Weise war er aufgedreht. Das war das Adrenalin, das sein Herz schneller schlagen und seinen Mund trocken werden ließ. Aber er konnte verdammt nochmal nicht die ganze Nacht hier stehen bleiben. Er wusste genau, wer in der Dunkelheit außerhalb der Lichtkreise auf ihn wartete.
Die Angst wich immer mehr. Er würde das schon schaffen.
»Brian!«, rief er ins Dunkel. »Ich weiß, dass du da bist, Brian. Was zum Teufel soll das, Mann?«
Er schwieg und lauschte.
Noch immer war kein Laut zu hören.
»Brian, verdammt! Was willst du? Das hier bringt doch nichts! Du weißt doch gar nicht, wo das Geld ist.«
Das Dunkel schwieg hartnäckig.
»Es ist nicht hier, Brian, falls es das ist, worauf du aus bist. Und ich habe auch nicht vor, dich reinzulegen. Du bist mein Freund, verdammt! Wir sitzen im selben Boot!«
Er hielt die Pistole noch immer schussbereit in der Hand, als er langsam auf die Haustür zuging. Und plötzlich antwortete das Dunkel.
Er hörte ein leises Lachen und dann hatte er das Gefühl, als träfe ihn ein Presslufthammer im Schritt.
Er fiel auf der Stelle um, nur wenige Schritte von dem toten Hund entfernt. Die Pistole glitt ihm aus der schlaffen Hand und landete mit einem kurzen metallischen Klick auf dem Kies.
Der Mörder – der noch nicht zum Mörder geworden war, denn der Mann auf dem Boden lebte noch – rührte sich nicht von der Stelle. Der Mann auf der Erde stöhnte, aber es war unmöglich zu sagen, ob er bei Bewusstsein war.
Noch einmal hob der Mörder langsam das Gewehr, um es dann wieder zu senken. Vielleicht war es besser so. Der andere hatte keine Möglichkeit, Hilfe zu holen. Er würde es nicht bis ins Haus schaffen und vor dem nächsten Vormittag würde hier mit Sicherheit keine Seele vorbeikommen.
Ja, es war am besten so.
Der verletzte Mann hörte die Schritte. Sie klangen fern, als steckte sein Kopf unter einer Bettdecke. Sie hielten ein einziges Mal inne, dann kamen sie näher, und er spürte, dass jemand still neben ihm stehen blieb und ihn ansah. Wenig später hörte er die Schritte wieder und dann quietschte das Tor, als der andere den Ort verließ. Jetzt war er allein mit den Schmerzen, die er noch nicht fühlte.
Doch bald würden sie kommen. Die Schmerzen. Und die Gespenster. Und keine Lampen konnten sie vertreiben.
2
Flemming Rosgård schob sein Fahrrad den Gartenweg hinauf in die Garage, stellte es in den Ständer, nahm den Instrumentenkoffer vom Gepäckträger und betrat das Haus durch die Seitentür, die über den hinteren Gang in den Windfang führte.
Er stellte den Koffer auf den Tisch, während er die Überschuhe abstreifte. Er betrachtete sie kritisch. Sie wurden langsam unbrauchbar. Tina verabscheute sie. Sie fand Überschuhe lächerlich. Noch lächerlicher hatte sie es gefunden, dass er sie letzten Frühling hatte vulkanisieren lassen.
»Wie geizig kann man eigentlich sein?«, hatte sie ihn gefragt.
Er konnte nichts Lächerliches daran finden. Es war viel alberner, sich seine guten Schuhe von Salz und Schneematsch ruinieren zu lassen. Und es bestand kein Grund, Geld für neue Überschuhe zum Fenster hinauszuwerfen, wenn man die alten reparieren lassen konnte.
Doch jetzt hatten sie ausgedient. Er warf sie in den Müllsack in der Ecke, bevor er den Instrumentenkoffer nahm und durch die Küche in die Diele ging. Er öffnete den Garderobenschrank, stellte den Koffer hinein und hängte seinen Mantel auf einen Bügel.
Im Wohnzimmer war Licht, aber er ging zunächst zum Kinderzimmer, öffnete die Tür und schaute hinein. Er stand einen Augenblick da und betrachtete die zwei schlafenden Kinder im Lichtschein, der von der Diele hereinfiel. Sie verblüfften ihn immer wieder, die Kinder. Selbst wenn er mit ihnen spielte, sie badete oder mit ihnen spazieren ging, versetzten sie ihn in Verwunderung. Wo kamen sie her? Natürlich wusste er, wo sie herkamen. Er hatte sie zum Teufel nochmal selbst gemacht, hatte mitgeholfen, sie zu machen, aber trotzdem blieben sie für ihn zwei kleine, seltsame Wesen, die aus dem Weltraum in sein Leben gefallen waren. Faszinierend, rührend und ein ganz klein wenig erschreckend. Aliens.
Vielleicht lag das daran, dass er sich nicht erinnern konnte, selbst einmal so klein gewesen zu sein. Er hatte nicht die leiseste Erinnerung an sich als Kind. Natürlich hatte er Fotos und sogar kurze Schmalfilme von einem Kind gesehen, das er sein sollte, aber sie sagten ihm nichts. Es hätte jeder x-beliebige kleine Junge sein können. Seine erste Erinnerung stammte aus der Schulzeit, als er zehn Jahre alt gewesen war. Er hatte seine Milch verschüttet und war erschrocken gewesen, wie viel Flüssigkeit in einen Zwei-Deziliter-Becher passte. In seiner Erinnerung war das fast wie ein Traum. Milch spritzte nach allen Seiten, lief über den Boden, die Wände hinunter und wurde schließlich zu einem riesigen See, der die ganze Klasse überschwemmte. Eine peinliche Erinnerung, auf die er gern verzichtet hätte. Er hatte keine Ahnung, was sonst noch passiert war. Ob er ausgeschimpft worden war oder ob jemand die Milch für ihn aufgewischt hatte. Idiotisch.
Tina glaubte ihm nicht, wenn er sagte, dass er sich nicht an seine Kindheit erinnern konnte. Sie behauptete, dass es das nicht gäbe oder dass er sich nicht erinnern wollte. Dass er etwas verdrängte.
Unsinn! Warum sollte er sich nicht erinnern wollen? Er hatte eine gute Kindheit gehabt, dessen war er sich sicher. Das Kind auf den Bildern lächelte und sah zufrieden aus. Es war mit Sicherheit ein glückliches Kind.
Vorsichtig schloss er die Kinderzimmertür und ging weiter zum Wohnzimmer. Unwillkürlich zögerte er kurz und holte tief Luft, bevor er eintrat.
Alles sah aus wie immer. Und warum sollte es das auch nicht? Tina saß in ihrem Lieblingssessel, die Beine auf dem Fußschemel.
»Ach, du bist es«, sagte sie.
Er bezwang seine Lust zu fragen: »Wer sollte es denn sonst sein? Hast du jemand anderen erwartet?« Mitunter brauchte es nicht viel, dass sie einen Streit anfing. Manchmal hatte er den Eindruck, dass sie das richtiggehend genoss. Er genoss es nicht. Streit erschreckte ihn.
Er ging zum Barschrank, nahm ein Glas und schenkte sich einen Whisky ein.
»Hast du noch nicht genug?«, fragte sie.
Er biss die Zähne fest zusammen. Aus ihrem Mund klang das, als hätte er ein Alkoholproblem, doch wenn er das sagte, würde sie erwidern, dass er überempfindlich reagierte.
Mit dem Whisky in der Hand setzte er sich in eine Ecke des Sofas.
»Ich habe meine Überschuhe weggeworfen«, sagte er und hörte selbst, wie idiotisch das klang.
Eine Gabe. Eine Opfergabe. Ein paar alte Überschuhe!
»Das wurde auch Zeit«, sagte sie.
»Nächsten Winter kaufe ich mir neue«, sagte er ein klein wenig provozierend. »Ich habe die alten in den Müllsack gesteckt.«
»Schön«, sagte sie. »Er wird morgen abgeholt, wenn du ihn rausstellst, bevor du gehst.«
Er nickte.
»Warum bist du noch auf?«, fragte er. »Du hättest nicht auf mich warten müssen.«
»Das habe ich auch nicht«, sagte sie. »Ich habe nachgedacht.«
»Aha«, sagte er wachsam. Er wurde immer nervös, wenn sie nachdachte. »Worüber?«
»Über die Englandreise. Du weißt doch, dass Lone mich gefragt hat, ob ich mitkäme, da Laust nicht kann. Ich habe so gut wie zugesagt.«
»Das ist eine gute Idee«, sagte er erleichtert. Sie hatte also nicht über ihre Beziehung nachgedacht. Warum rechnete er immer mit dem Schlimmsten?
»Es ist ein bisschen kurzfristig, aber wir haben dieses Jahr schließlich keinen Winterurlaub gemacht.«
Sie hatte ihre Argumente parat. Die Geschütze waren aufgefahren.
»Ja, und deshalb halte ich das auch für eine gute Idee. Aber was ist mit den Kindern?«
»Mutter hat versprochen, sie zu nehmen.«
»Schön«, sagte er mechanisch, während er darüber nachdachte, ob sich hinter der Bemerkung über die Winterferien ein versteckter Vorwurf verbarg. Bestimmt nicht, aber es war nicht auszuschließen, dass sie ein anderes Mal darauf zurückkommen würde.
»Das Problem ist, dass es bestimmt nicht billig wird. Wir haben zwar ein Superangebot, aber du kennst ja Lone. Sie nimmt nicht gerade das billigste Hotel. Ich kann immer noch Nein sagen, wenn du meinst, dass es für eine Woche London zu teuer ist.«
»Nein, mach das ruhig. Ihr hattet doch letztes Mal so viel Spaß.«
»Du findest nicht ...?«
»Nein, ich finde, dass das eine gute Idee ist. Außerdem habe ich vorläufig ohnehin keine Zeit, Urlaub zu machen, und so habe ich kein ganz so schlechtes Gewissen.«
»Ein schlechtes Gewissen?«
»Ja, weil wir dieses Jahr keinen Winterurlaub gemacht haben.« Er trank einen Schluck Whisky. Jetzt war der Winterurlaub an ihre Londonreise gekoppelt. Falls das Gespräch wieder darauf kommen sollte. Dafür warst du ja mit Lone in London.
»Wann geht es los?«
»Morgen in acht Tagen. Von Kopenhagen aus. Wir fahren Mittwochabend hier los. Um auf Nummer sicher zu gehen.«
»Fliegt ihr?«
»Ja.«
»Was ist mit den Kindern?«, fragte er, während er alles in Gedanken zu ordnen versuchte. »Soll ich sie zu deiner Mutter bringen?«
»Nein, ich bringe sie im Laufe des Mittwochs zu ihr.«
»Ihr werdet mir fehlen«, sagte er.
Sie lachte. »Es ist doch nur für eine Woche. Und du kannst die Kinder am Wochenende besuchen, wenn du Lust dazu hast.« Sie sah zu ihm auf. »Und Zeit«, fügte sie hinzu.
»Ich werde dich vermissen«, sagte er eigensinnig.
Sie stand auf, ging zu ihm und fuhr ihm mit der Hand durchs Haar.
»Ab und zu fällt es mir wirklich schwer, dich nicht zu mögen«, sagte sie lächelnd. »Ich gehe jetzt ins Bett. Kommst du auch?«
»Gleich«, sagte er. »Ich muss nur noch etwas ...«
Sie blieb einen Augenblick stehen, dann seufzte sie leicht und verließ das Wohnzimmer. Er musste immer nur noch irgendetwas. Aber im Grunde genommen war er süß. Kein bisschen geizig, was sie und die Kinder anging. Diese Reise zum Beispiel. Nicht der leiseste Vorwurf. Ab und zu mochte sie ihn wirklich, aber ab und zu trieb er sie auch in den Wahnsinn. Sein krankhafter Geiz bei Kleinigkeiten. Diese verdammten Überschuhe. Und sein Fahrrad. Er fuhr immer mit dem Fahrrad in die Stadt. Nicht wegen der Umwelt oder der Kondition, wenn es denn das gewesen wäre, nein, um zu sparen! Und gleichzeitig wohnten sie in einem teuren Haus, machten teure Reisen und hatten ein teures Auto in der Garage stehen, das sie nach Lust und Laune nehmen konnte. Sie verstand das nicht. Verstand ihn nicht. Er bewahrte Essensreste, Plastiktüten, Schnüre und allen möglichen ausrangierten Mist auf, trug aber nur maßgeschneiderte Anzüge. Er sagte, dass sie länger hielten. Das war bestimmt richtig. Seit sie ihn kannte, hatte er nie etwas weggeworfen. Woher hatte er das? Jedenfalls nicht von seinen Eltern. Die hatten das Geld immer mit vollen Händen ausgegeben. Und es war ihnen nie schlecht gegangen. Es ging ihnen ausgezeichnet. Wovor also hatte er Angst?
Sie verstand ihn nicht. Würde ihn wohl nie verstehen. Doch vielleicht war das gar nicht nötig. Es funktionierte auch so. Im Großen und Ganzen. Sie dachte nicht im Traum daran, ihn zu verlassen. Sie wusste, dass sie Glück gehabt hatte, ohne genau sagen zu können, warum. Es war einfach so.
Sie hatte sich in ihn verliebt, hatte geglaubt, in ihn verliebt zu sein, weil er sich offensichtlich gleich auf den ersten Blick in sie verliebt hatte. Sie war in der Anwaltskanzlei, in der er als Prokurist eingestellt worden war, Sekretärin gewesen, eine von vielen. Sie war keine besonders tüchtige Sekretärin, darüber war sie sich durchaus im Klaren, aber sie war freundlich, höflich und umgänglich. Schön, ohne attraktiv zu sein. Sie hatte mit ein paar Typen zusammengewohnt, ohne dass mehr daraus geworden war. Sie waren wieder aus ihrem Leben verschwunden und sie hatte ihnen keine Träne nachgeweint. Und dann war Flemming aufgetaucht und hatte stumm, mit vor Bewunderung großen Augen vor ihr gestanden. Er hatte ihr auf eine charmante, altmodische Art den Hof gemacht. Hatte sie belagert. In Konzerte eingeladen, ins Theater und ins Restaurant. Er hatte ihr Blumen geschickt, Schokolade und kleine Geschenke.
»Der ist es«, hatten ihre Kolleginnen gesagt, aber sie war sich noch nicht ganz sicher gewesen. Sie war verliebt, ein wenig, aber reichte das?
Als er dann um ihre Hand angehalten hatte, hatte sie Ja gesagt.
Weder vor sich selbst noch vor anderen hatte sie jemals zugegeben, dass ihr Ja vielleicht damit zusammengehangen hatte, dass im Büro EDV eingeführt werden sollte. Der Gedanke hatte sie in Panik versetzt. Sie hatte gewusst, dass das ihre Fähigkeiten übersteigen, sie nicht mithalten können würde, dass ihr die Kündigung sicher wäre. Eine Ehe war der eleganteste Ausweg gewesen.
Und sie hatte es nicht bereut. Sie war kurz nach der Heirat schwanger geworden und hatte, noch bevor das Kind auf der Welt war, zu arbeiten aufgehört. Einen Computer zu bedienen, hatte sie nie gelernt.
Er sorgte gut für sie. Liebte sie und die Kinder und versuchte immer, es ihr recht zu machen. Er stand für Sicherheit und Stabilität. Hin und wieder war sie seiner etwas müde, der Sicherheit etwas müde. Stellte die Sicherheit auf die Probe. Stritt mit ihm. Tobte. Deutete an, dass es ihr in den Sinn kommen könnte, ihn zu verlassen. Zum einen, um ein wenig mit der Sicherheit zu spielen, sie herauszufordern, sie aufs Spiel zu setzen, und zum anderen, um sich immer wieder bestätigen zu lassen, dass er sie nie, nie im Stich lassen würde. Sie wusste auch, dass er alles tun würde, um sie zurückzuhalten, sollte es ihr eines Tages einfallen, ihn zu verlassen. Und dass er all seine Klugheit und all sein juristisches Wissen einsetzen würde, um zu verhindern, dass sie die Kinder bekäme.
Deshalb wusste sie, dass sie ihn nie verlassen würde, niemals!
Aber es bestand schließlich kein Grund, dass er sich ebenso sicher war.
3
Der Postbote kam um sechs Minuten vor zehn. Etwas früher als sonst. Donnerstag war einer der angenehmen Tage. Montag hatte er die ganze Werbung und Mittwoch die Wochenzeitungen, aber Donnerstag war ein angenehmer Tag.
Die Hunde ließen eine erste leise Ahnung in ihm aufkommen, dass etwas nicht in Ordnung war. In der Regel spielten die verdammten Köter jedes Mal verrückt, wenn er kam. Er öffnete das kleine Türchen neben dem Gittertor in dem Eternitzaun und trat vorsichtig auf den Weg, der zwischen den beiden Zäunen entlanglief. Was, wenn die verdammten Köter ihm auflauerten? Sie waren normalerweise hinter dem Maschendrahtzaun, aber man konnte nie sicher sein.
Er ging zu der kleinen Tür im Zaun, wo auch der Briefkasten war. Noch immer tauchten die Hunde nicht auf. Gaben keinen Laut von sich. Meistens versuchten sie, sich auf ihn zu stürzen, und nur der Zaun hielt sie zurück.
Anfangs hatte er immer freundlich und beruhigend auf sie eingeredet, wie man das mit Hunden so macht, aber sie hatten nur die Augen verdreht, sich gegen den Zaun geworfen und gebellt und geknurrt. Inzwischen knurrte er zurück und beeilte sich, die Post in den Kasten zu werfen. In der Nähe der Köter fühlte er sich nicht sicher. Über Pitbulls hörte man die schrecklichsten Geschichten und er vertraute nicht darauf, dass der Zaun sie abhalten würde, wenn sie wirklich wütend wurden.
Vielleicht hatten sie den Typen da drinnen aufgefressen. Vielleicht hatte er sie erschossen. Auf diesem Grundstück war schon so einiges passiert, doch da hatte die ganze Bande noch hier draußen gewohnt. Von ihm hörte man nicht viel, auch wenn er bestimmt nicht zu den bravsten Schäfchen unseres Herrn gehörte.
Als Erstes sah er den Hund. Er war tot – daran bestand kein Zweifel. Er starrte ihn einen Augenblick lang an. Dann wanderte sein Blick weiter zu dem dunklen Fleck wenige Schritte neben dem Hund, blieb einen Moment an einem weiteren rotbraunen Flecken hängen, der an die Umrisse Italiens erinnerte, um dann automatisch dem breiten, dunklen Streifen zu folgen, der bis zur Haustür führte.
Dort lag ein Mensch.
»Alles okay?«, rief er, obwohl er sofort wusste, dass überhaupt nichts okay war. Er rief noch einmal, ohne eine Antwort zu bekommen, dann lief er zurück zu dem Postauto, das er mit laufendem Motor geparkt hatte.
Hatte er es nicht immer gesagt? Dass es ein böses Ende nehmen würde mit den Kötern. Er konnte sich gut vorstellen, was passiert war. Heute Morgen, als der Mann aus dem Haus gekommen war, hatten sie ihn angefallen. Er hatte es noch geschafft, sie zu erschießen, war aber zu schwach gewesen, um ins Haus zu kommen und Hilfe anzufordern. Vielleicht hatte er die Tür hinter sich zugeknallt, als er das Haus verlassen hatte, und wieder hineinzukommen erwies sich als genauso schwer, wie eine Festung einzunehmen.
Der Postbote setzte sich ins Auto und fuhr, so schnell er konnte, den unebenen Feldweg hinauf zur Landstraße und weiter zu dem Hof, von dem er gerade gekommen war. Er hatte dort seinen Vormittagskaffee getrunken und wusste, dass jemand zu Hause war.
»Totgebissen?«, rief die Frau entsetzt und schlug die Hand vor den Mund.
»Es sieht ganz so aus«, sagte der Postbote.
»Wenigstens hat es ihn selbst erwischt«, meinte der Mann. Er hatte diesen Nachbarn nie gemocht.
Es war 10.38 Uhr, als ein Streifenwagen, der zufällig in der Nähe war, zu dem Haus gerufen wurde. In der Nachricht über Funk hieß es, dass ein Mann ernsthaft, vielleicht sogar tödlich verletzt war, nachdem seine Hunde ihn angefallen hatten. Die Beamten wurden gewarnt, dass ein oder zwei Hunde möglicherweise noch lebten und gefährlich sein könnten.
»Wie viele Hunde zum Teufel hat er denn?«, fragte einer der Polizisten. »Das hört sich ja fast so an, als hätte er ein ganzes Rudel.«
»Das hat er auch, Ralph«, sagte der andere. Er hieß Thomsen und war ein alter Hase. Er kannte alle und jeden in der Gegend. Er sprach den Namen seines Kollegen Ralp aus. Er fand es ziemlich affig, Ralph zu heißen. Mit ph. Entweder man hieß Ralf oder man hieß Ralp. Und deshalb nannte er ihn Ralp – egal wie lautstark er protestierte.
»Vielleicht ist er Grönländer und hat ein Hundegespann«, sagte Ralph lachend, klopfte dabei aber instinktiv auf seine Dienstwaffe.
Thomsen schaltete die Scheibenwischer ein, ohne zu antworten. Im Laufe der Nacht hatte es zu tauen begonnen und jetzt nieselte es. Platt wie ein Pfannkuchen breitete sich die Landschaft im Dunst vor ihnen aus. Der Westwind hatte die Windschutzhecken nach Osten gebogen und hier und da lagen kleine, weiß gekalkte Höfe oder ehemalige Häuslerstätten, die einsam, traurig und ärmlich aussahen. Im Sommer, wenn Erde und Horizont unter dem nördlichen Himmel mit seinem ganz besonderen Licht in Grün, Gelb und Blau erstrahlten, konnte das großartig aussehen, manchmal sogar pittoresk, doch jetzt bei dem schlechten Wetter wirkte es nur deprimierend.
Sie kamen an einem Hof vorbei, der direkt an der Straße lag, und ein paar Hundert Meter weiter, mitten im freien Feld, sahen sie mehrere, von einem hohen Eternitzaun umgebene Gebäude.
»Da sind wir«, sagte Thomsen, als sie sich der Festung näherten. »Ich war mir ziemlich sicher, dass es hier sein muss.«
»Was ist das?«, fragte Ralph. »Eine Minkfarm?«
Es hätte durchaus eine sein können. Alles Mögliche hätte sich hinter dem Eternitzaun verbergen können.
»Ein Fort«, sagte der andere. »Das war einmal ein Fort, aber in den letzten Jahren hat es hier draußen keinen Ärger mehr gegeben. Das Anwesen gehört Rockern. Inzwischen ist die Bande allerdings in der Auflösung begriffen. Die einen haben sich zurückgezogen, die anderen sitzen im Knast und ihr Anführer liegt seit drei Monaten im Krankenhaus und kann sich nicht entschließen, ob er leben oder sterben will. Als ich das letzte Mal von dem Fort gehört habe, wohnten hier drei, vier Typen, aber die sind offenbar nicht mehr da. Sie haben einen Teil des Rauschgifthandels in der Stadt kontrolliert und das tun sie, meinen Informationen zufolge, immer noch.«
Sie parkten vor dem Tor und Ralph stieg aus, um es zu öffnen.
Einen Moment später kam er zum Auto zurück.
»Ich glaube, das Tor öffnet sich automatisch, aber ich bekomme nicht heraus, wie.«
Thomsen drückte versuchsweise auf die Hupe – ohne Ergebnis.
»Probier es mal mit den Scheinwerfern«, sagte Ralph, doch auch ein Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer führte nicht zum Erfolg.
»Wahrscheinlich funktioniert es per Fernbedienung«, meinte Ralph. »Vielleicht hat er ein entsprechendes Teil in seinem Auto.«
»Okay«, sagte Thomsen. »Dann müssen wir zu Fuß rein.«
Er griff nach der Pistole und ging auf die kleine Tür zu. Bevor sie sie öffneten, blieben sie einen Augenblick stehen und sahen auf den Hofplatz.
»Da drinnen liegt ein Hund«, sagte Thomsen. »Tot.«
»Und da«, sagte Ralph, während er auf etwas zeigte.
»Wo?«
»Da bei der Pumpe. Du kannst den Kopf neben dem Wassertrog sehen.«
»Die beiden sind jedenfalls tot«, sagte Thomsen und griff versuchsweise nach der Klinke. Die kleine Tür öffnete sich mit einem leisen Quietschen.
Sie gingen zum Haus und blieben neben Tjekkas Leichnam stehen. Thomsen sah sich um. »Da liegt seine Pistole.«
Er kratzte sich kurz am Kopf. »Merkwürdig«, sagte er. Dann zuckte er mit den Schultern. »Na schön, sehen wir uns den Burschen einmal an. Ich glaube nicht, dass hier noch weitere Hunde sind. Zumindest keine lebenden.«
Die zusammengesunkene Gestalt lag auf dem Bauch, den Oberkörper auf der Stufe zur Eingangstür.
Thomsen beugte sich über ihn. »Mausetot«, sagte er. »Und steif wie ein Brett.«
Von der Landstraße waren Sirenen zu hören, die sich näherten.
»Das können sie sich ruhig sparen«, sagte Thomsen.
Ralph nickte und ging zu der Pumpe, die Pistole noch immer im Anschlag.
»Hier liegt noch ein Hund«, rief er kurz darauf. »Auch erschossen.« Er ging weiter Richtung Zaun, drehte eine Runde um das Haus und kam zum Eingang zurück.
»Mehr sind hier nicht«, sagte er. »Insgesamt drei und alle tot. Erschossen. Er hat sie erwischt. Aber offenbar zu spät.«
»Hm«, sagte Thomsen, während er sich wieder nachdenklich am Kopf kratzte.
»Juckt es dich?«, fragte Ralph.
Thomsen antwortete nicht und erst jetzt sah Ralph sich die Leiche genauer an.
»Das sieht merkwürdig aus«, sagte er. »Wo haben sie ihn denn gebissen?«
Thomsen schüttelte den Kopf. »Ich bin mir nicht sicher«, sagte er. »So, wie er liegt, lässt sich das nicht so leicht sagen, aber bei allem Respekt, ich glaube, in die Eier. Es sieht ganz so aus, als hätten sie ihm die Juwelen abgebissen.«
»Pfui Teufel!«, sagte sein Kollege.
»Aber etwas passt trotzdem nicht«, sagte Thomsen.
»Was meinst du?«, fragte Ralph.
»Ich kann es nicht vor mir sehen«, sagte Thomsen. »Ich kann es nicht vor mir sehen.«
»Das ist doch auch egal«, sagte Ralph. Er hatte nicht die geringste Lust, dieses Bild vor sich zu sehen. »Die Hunde müssen darauf trainiert gewesen sein, dort zuzubeißen. Das tun sie nicht von selbst.«
»Genau, aber das ist es nicht allein«, sagte Thomsen und sah sich um. »Er kommt raus. Der eine Hund springt ihn an und was passiert? Der Hund beißt ihn – er zieht den Revolver und erschießt ihn. Und dann erschießt er die beiden anderen. Einfach so, der Sicherheit halber.«
»Das hätte ich auch getan.«
»Du würdest also ein paar Hunde erschießen, die noch ziemlich weit weg sind, während du wie ein Schwein blutest? Statt im Haus Schutz zu suchen?«
»Sie hätten ihn innerhalb von Sekunden anfallen können. Vielleicht hatten sie ihn auch schon gebissen.«
»Wo? Er hat keine anderen Wunden. Sieh dir seine Arme an. Nicht ein Kratzer. Und er trifft sie. Beide. Würdest du wirklich mit einer tödlichen Verletzung hier stehen bleiben und einen Hund niederschießen? Und anschließend die beiden anderen kaltmachen? Die haben ihn nämlich nicht angerührt. Wenn du mich fragst, da stimmt etwas ganz und gar nicht.«
Der Krankenwagen hielt vor dem Tor. Ein Sanitäter kam herein.
»Wie bekommen wir das verdammte Tor auf?«
»Das eilt nicht«, sagte Thomsen. »Der Typ ist tot und ihr bekommt ihn ohnehin nicht sofort.«
»Wir haben nicht zu entscheiden, ob er tot ist«, wandte der Sanitäter ein. »Wir müssen nur dafür sorgen, dass er so bald wie möglich ins Krankenhaus kommt.«
»Ich übernehme die Verantwortung. Der Typ ist mausetot, da könnt ihr ganz beruhigt sein, aber es gibt Anzeichen, dass dafür nicht die Hunde verantwortlich sind.«
Der Sanitäter sah ihn skeptisch an.
Thomsen zeigte auf den Hund. »Was glaubst du, woran der gestorben ist?«, sagte er.
»Erschossen«, sagte der Sanitäter. »Lernt ihr so etwas nicht auf der Polizeischule?«
Thomsen tat, als hätte er nichts gehört.
»Ganz meine Meinung«, sagte er. »Aber ich glaube nicht, dass der Schuss hieraus abgefeuert wurde.« Er zeigte auf die Pistole.
»Das kann man nicht sehen.«
Thomsen lachte leicht. »Doch, das lernen wir nämlich auf der Polizeischule.« Er wandte sich an Ralph. »Ich gehe mal und gebe Bescheid. Aber du kannst ruhig schon anfangen.«
»Anfangen? Womit?«
»Den Tatort zu sichern.«
»Den Tatort?«
»Ja, mein Junge. Ich müsste mich schon sehr irren, wenn wir es hier nicht mit einem Mord zu tun haben, und keiner kann mir erzählen, dass die Hunde die Täter waren.«
4
Therkelsen sah sich um und schüttelte den Kopf. »Herr im Himmel. Was für ein trostloser Ort zum Leben.«
»Und zum Sterben«, sagte Bøjsen trocken.
Therkelsen zuckte mit den Schultern. Er fand, dass es gleichgültig war, wo man starb.
»Jetzt hören wir erst einmal, was unser Medizinmann zu sagen hat.«
Sie gingen zu dem Arzt, der sich gerade die Plastikhandschuhe auszog.
»Und, wie sieht es aus?«
»Ich kann euch nicht viel mehr sagen als das, was ihr selbst sehen oder folgern könnt«, sagte der Arzt. »Er ist aus nächster Nähe erschossen worden.«
»Mit einem Dumdumgeschoss«, warf Lyngsø ein. »Sollen wir wetten?«
Therkelsen warf ihm einen verärgerten Blick zu.