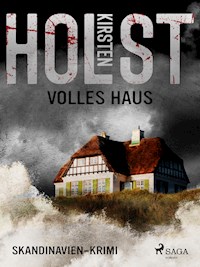
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kriminalkommissar Høyer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wieder stehen die Kommissare Høyer und Therkelsen vor einem rätselhaften Fall: Die kleine Bettina wird vermisst und die Polizei befürchtet, es könne sich um ein Sexualverbrechen handeln. Kurz darauf geschieht eine furchtbare Familientragödie, bei der ein Vater erst seine Frau und vier Kinder und dann sich selbst tötet. Als dann auch noch eine Leiche in einem besetzten Haus gefunden wird, steht die Frage im Raum, ob die erschütternden Ereignisse nicht vielleicht doch zusammengehören...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirsten Holst
Volles Haus - Skandinavien-Krimi
Saga
Volles Haus - Skandinavien-Krimi ÜbersetztHanne Hammer OriginalDet tomme husCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1982, 2020 Kirsten Holst und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711455869
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
1.
Der frühe Märzmorgen breitete sich fahl und zögerlich über der Stadt aus wie ein Rekonvaleszent, der nur notgedrungen das warme Bett verlässt. Auf der Straße hatte sich die leichte Decke aus in der Nacht gefallenem Schnee durch die vielen Autoreifen in einen schmierigen Morast verwandelt, der die Beine der wenigen Fahrradfahrer, die dem Wetter trotzten, mit Matsch bespritzte, und auf dem Gehweg bewegten sich die Fußgänger in dem Versuch, das Gleichgewicht zu halten, mit Storchenbeinen an den Hauswänden entlang. Hier und da waren einige früh aufgestandene Hausbesitzer oder Hausmeister mit Schneeschiebern beschäftigt und man hörte den eintönigen Laut von Metall, das auf Stein trifft.
Der Hafen machte keinen sonderlich belebten Eindruck. Ein kalter Wind füllte die Nasenflügel mit dem unvermeidlichen Geruch nach Teer, Tauwerk, Öl, Fjord und Industriefisch und rief vage Erinnerungen an Austern und Bier wach. Auf Deck eines Küstenmotorschiffs tauchte der Koch auf und goss mit einem Platsch einen Eimer schmutziges Wasser über die Reling, sodass von den niedrigen eis grünen Wellen des Hafens ein bleicher Dunst aufstieg. Etwas weiter entfernt pfiff eine Rangierlok und sauste fast ausgelassen über die Schienen. Zwei Vorruheständler, die sich noch nicht daran gewöhnt hatten, morgens länger zu schlafen, klapperten, die Hände in den Taschen, auf ihren gummibesohlten Holzschuhen leise die Hafenstraße hinunter, nachdem sie eine Runde um ihren alten Arbeitsplatz gedreht hatten. Beide warfen im Vorbeigehen einen Blick auf das leer stehende Haus und der eine machte eine Bemerkung, die im Geräusch eines vorbeifahrenden Tankwagens unterging.
In dem grauen Morgenlicht, das den Verfall verschleierte, sah das leer stehende Haus mit seiner weißen Fassade, den reinen, klassizistischen Linien und der imposanten Eingangstür fast vornehm aus. Wie ein Palais aus dem vorigen Jahrhundert, in dem ein wohlhabender Reeder sein Domizil gehabt hatte und von dem aus er die Ankunft seiner Schiffe im Hafen hatte beobachten können. In Wirklichkeit war es ein Hotel gewesen, doch mit Sicherheit eins der vornehmsten der Stadt. Hier, auf der Sonnenseite des Hafens, spielte die Musik, hier florierte das Vergnügungsleben und das alte Hotel war das Herzstück all dessen gewesen. Aber dann hatte die Entwicklung eine andere Wende genommen und das Hotel verlor erst langsam und dann immer schneller seinen Glanz, um schließlich von der Gemeinde übernommen und zu Wohnungen umgebaut zu werden. Und als auch diese nicht mehr den Anforderungen entsprachen, wurden der Abriss des Gebäudes und die Errichtung eines neuen Wohnblocks beschlossen. Doch zuerst mussten die Bewohner raus, mussten neue Wohnungen für sie gefunden werden, was nicht von einem Tag auf den anderen ging, und als auch der letzte Mieter, eine alte Witwe, sich schließlich zu sterben entschlossen hatte, um der Gemeinde weitere Mühen zu ersparen, und das Haus endlich leer stand, war auch die Gemeindekasse leer und das Bauvorhaben wurde eingestellt. Jetzt stand das Haus einfach an dem Platz, den ein geschäftstüchtiger Unternehmer einmal als den besten der Stadt bezeichnet hatte, und verfiel. Den Balkon, von dem aus Herren mit Kaiser-Wilhelm-Bärten und Damen mit Sonnenschirmen und hellen Kleidern das Leben im Hafen betrachtet hatten, schien nur die Erinnerung an die vergangene Pracht aufrecht zu halten; mehrere Fenster des Gebäudes waren kaputt und bei Tageslicht konnte man sehen, dass der Putz großflächig abblätterte. Der letzte Akt war erreicht, die letzte Szene.
In einer der oberen Etagen des Hauses erwachten langsam dessen illegale Bewohner. Der Tag streckte ein paar graue Hände hinein und tastete sich vorsichtig an die Stuckornamente der Decke heran, die die letzten Mieter, ein kreatives junges Paar, rosa und giftgrün gestrichen hatten, streifte einen Typen mit schwarzen Locken, der versuchte, einen Ofen in Gang zu bringen, sowie eine kleine Gruppe, die in der Nähe des Fensters auf dem Boden kampierte. Der Rest des Raums lag noch im Halbdunkel.
Die Hausbesetzer hatten sich aus strategischen Gründen für die oberste Etage entschieden. Zum einen war es leichter, sich hier zu verschanzen, und zum anderen ging man davon aus, dass die Polizei ihr Tränengas zuerst auf die unteren Etagen richten würde. Letzteres war eine überflüssige Überlegung, denn es war fraglich, ob das Tränengas in diesem Raum überhaupt seine Wirkung entfalten würde. Knapp zwanzig Menschen waren hier zusammengekrochen. Überall auf dem Boden lagen Matratzen herum, Schlafsäcke in allen möglichen Farben, mit und ohne Inhalt, Bücher, Zeitungen, Musikkassetten, Pappbecher, Flaschen mit Stearinkerzen und leere Blechdosen, die als Aschenbecher benutzt wurden. In einer Ecke standen eine Stereoanlage und ein Fernseher, unter dem Fenster war ein Gasradiator mit einer Elf-Kilo-Gasflasche aufgestellt worden, zu dem Ofen in der Mitte des Zimmers führte ein Trampelpfad.
Doch war die Unordnung nichts gegen den Geruch. Der Gestank in dem Raum war nahezu unerträglich. Ungewaschene Körper, Petroleum, Friteusenfett, Zigarettenrauch und feuchte Kleidung bildeten die Hauptbestandteile. Hinzu kam der unverkennbare Geruch nach Fäkalien, der das ganze Haus zu durchdringen schien. Die Hausbesetzung dauerte jetzt sechs Wochen.
Ursprünglich war das Haus von ungefähr siebzig jungen Leuten besetzt worden, die ein Jugendzentrum haben wollten – und das sofort. Inzwischen hatte sich die Zahl der illegalen Bewohner auf knapp zwanzig Personen reduziert, die noch immer in dem Abrisshaus ausharrten, in dem es weder Licht noch Heizung noch Wasser gab. Letzteres hatten die Besetzer offenbar übersehen oder als unwesentlich abgetan, obwohl es nicht lange gedauert hatte, bis alle Toiletten des Hauses verstopft waren. Einige halbherzige Versuche, Wasser zum Nachspülen in Eimern zu holen, waren im Sande verlaufen, als sich die Aufgabe als nahezu undurchführbar erwies, sodass man sich letztendlich mit dem Versuch begnügt hatte, die zu dieser Wohnung gehörende Toilette in einem halbwegs benutzbaren Zustand zu halten.
Die desertierten Rebellen hatten zumindest einige Vorteile der Zivilisation schätzen gelernt, die sie bisher als nahezu selbstverständlich angesehen hatten: fließend warmes und kaltes Wasser sowie eine Toilette mit Spülung.
Dem Typen mit den schwarzen Locken war es endlich gelungen, dem Ofen Leben einzuhauchen. Er richtete sich auf und sah zu der Gruppe am Fenster hinüber.
»Kannst du bitte einen Kessel Wasser holen, Søren?«, fragte er.
»Mach es doch selbst«, murmelte Søren mürrisch.
Der Lockenkopf sah von ihm zu dem blonden Mädchen, das neben Søren saß, und zu dem grünen Bündel, das vor ihnen auf dem Boden lag. Dann zuckte er mit den Schultern, nahm den Kessel und ging hinaus, um ihn mit Wasser aus einer Milchkanne zu füllen, die draußen stand.
»Jetzt reicht es aber, Søren!« Das blonde Mädchen sah Søren vorwurfsvoll an, während sie gleichzeitig das Mädchen in dem grünen Schlafsack tröstend streichelte. »Es reicht.«
Søren wand sich unbehaglich unter ihrem Blick.
»Ist schließlich nicht meine Schuld«, murmelte er.
»Wessen Schuld ist es dann, verdammt nochmal?«, schrie das Mädchen.
»Müsst ihr so laut schreien?«, klang es aus einem der anderen Schlafsäcke. »Ihr weckt uns doch alle.«
»Es ist Morgen, Lars«, sagte der Lockige, der gerade wieder hereinkam. »Du kannst ruhig aufstehen. Es graut ein neuer Tag.«
»Mensch, halt doch die Klappe«, sagte Lars, während er sich aufsetzte und mit fast hellwachen Augen im Zimmer umsah. »Weint sie, Winie?«, fragte er und zeigte auf das grüne Bündel.
»Was geht das dich an?«, sagte Winie. Ihr Atem stand im Raum wie weißer Nebel.
»Was ist los?«, fragte Lars unbeeindruckt.
Niemand antwortete ihm.
»Okay, dann ist es eben meine Schuld«, räumte Søren ein. »Aber schließlich habe ich das nicht gewollt, okay? Ich meine, es funktioniert einfach nicht. Ich war nie länger als einen Monat mit einem Mädchen zusammen und jetzt läuft das mit Louise schon seit zwei Monaten. Das ist ein Rekord. Und das in dieser gottverdammten Höhle hier, wo wir fast schon aufeinander kleben. Ich halte es einfach nicht mehr aus.«
Das grüne Bündel murmelte irgendetwas und Søren sah Winie fragend an.
»Es war deine Idee«, übersetzte sie.
»Komm, hör auf, ich hatte nicht das Geringste damit zu tun«, protestierte er.
Wieder murmelte das grüne Bündel etwas und Søren guckte von ihm zu Winie.
»Sie sagt, dass es deine Idee war, dass ihr mitmacht«, erklärte sie.
»Es hat sie schließlich niemand gezwungen«, wandte er ein.
»Jetzt stell dich nicht dümmer, als du bist, Mann!«, rief Winie. »Du weißt genau, dass sie nur mitmacht, weil du das vorgeschlagen hast.«
»Na und?« Søren ging jetzt in die Offensive. »Ich weiß überhaupt nicht, was dich das angeht.«
»Es geht mich etwas an, weil ich auch gehe, wenn sie geht«, sagte Winie.
Überall im Zimmer kam jetzt Leben in die Schlafsäcke.
Der Lockenkopf am Ofen sah zu Winie hinüber. »Seid ihr bald fertig mit Streiten? Das ist ja nicht zum Aushalten.«
»Halt du dich da raus, Anders!«, sagte Winie, ohne ihn anzusehen.
Das grüne Bündel bewegte sich und Louise tauchte aus dem Schlafsack auf, die Augen verweint und die roten Haare in alle Richtungen abstehend.
»Natürlich gehe ich«, sagte sie. »Ich habe die Nase voll von diesem eiskalten, stinkenden Haus. Ich habe die Nase voll von Fritten und Würstchen und fauligem Wasser und ich habe die Nase voll von dir!« Hasserfüllt sah sie Søren an. »Ich verstehe dich nicht. Vor einer Woche hast du gesagt, dass du dich mit mir verloben willst, wenn wir hier rauskommen, und erst gestern hast du gesagt, dass du mich liebst, und jetzt machst du einfach so Schluss.«
Ihre Stimme brach, die Tränen liefen, sie schniefte kräftig und packte wütend ihre Sachen zusammen.
»Ich habe doch gesagt, dass es mir Leid tut, weil ich weiß, wie du dich fühlst, okay?«, murmelte Søren entschuldigend, ohne sie anzusehen. »Nach spätestens vierzehn Tagen werde ich es wahrscheinlich bereuen, aber ich kann einfach nicht ... es funktioniert nicht. Verdammt nochmal, wir können uns nicht verloben. Ich bin doch erst achtzehn.«
»Deshalb können wir doch trotzdem zusammenbleiben« sagte Louise. »Ich habe schließlich nicht angefangen, von Verlobung zu reden.«
Sie hatte ihren Schlafsack zusammengerollt und in die Hülle gestopft. Sie sah sich suchend auf dem Boden um, stieg über ein paar Schlafsäcke, sammelte ein paar Kassetten und einen Pullover zusammen und stopfte alles obendrauf.
Winie stand einen Moment unentschlossen da und sah von ihr zu Søren, bevor sie eine resignierte Bewegung machte und selbst zu packen begann.
Lars saß, den Schlafsack um die Schultern, da und sah ihnen interessiert zu. Er fand, dass er viel gelernt hatte in den sechs Wochen, die er dabei war, ganz verloren waren sie also nicht.
»Wir haben bald kein Heizöl mehr«, sagte Anders und sah bekümmert zum Ofen hin. »Einer von uns muss einen Kanister holen.« Er drehte sich um und bemerkte plötzlich, was vor sich ging. »Ihr geht doch nicht etwa?«, rief er.
Louise zog wortlos und mit einem wütenden Ruck die Schnur der Schlafsackhülle zusammen.
»Ihr geht doch jetzt nicht, oder?«, fragte Anders und sah sie appellierend an. »Ihr könnt doch nicht einfach so gehen!«
Louise drehte sich zu Winie um. »Bist du fertig?«, fragte sie.
Winie nickte und nahm ihren Schlafsack. Sie gingen Richtung Tür.
»Ihr könnt doch nicht einfach so gehen!«, wiederholte Anders.
»Das kannst du verdammt nochmal glauben, dass wir das können!«, sagte Louise. »Wir gehen nach Hause, nehmen ein warmes Bad, waschen uns die Haare, frühstücken gut und legen uns in ein richtiges Bett. Glaubst du etwa, ich bleibe mit diesem ... diesem Arschloch zusammen hier?«
»Ihr könnt doch nicht einfach aus persönlichen Gründen gehen«, versuchte es Anders. »Wo bleibt denn da die Sache? Was ist mit dem Haus?«
»Die Sache! Das Haus!«, sagte Louise mit spöttisch verzerrter Stimme. »Glaubst du, wir sind scharf darauf, mit Chauvinisten wie euch zusammen zu sein? Du musst verrückt sein. Außerdem könnt ihr auch gleich aufgeben. Niemand interessiert sich für euch. Man lässt euch hier verrotten.«
Sie marschierte auf die Tür zu, Winie im Gefolge.
»Nun denn!«, rief Lars ihnen nach und winkte.
Anders sah aus, als wollte er sie aufhalten, doch dann ließ er die Arme herunterfallen und seufzte tief. Er drehte sich zu Søren um.
»Wir müssen zumindest mit runtergehen und hinter ihnen zusperren«, sagte er.
Søren erhob sich mürrisch.
»Verdammt, stinkt das!«, sagte Louise und hielt sich die Nase zu, als sie unten im Flur standen und warteten, bis Anders und Søren die Barrikaden vor der Tür entfernt hatten.
»Irgendjemand muss den Schrank als Klo benutzt haben«, meinte Winie und machte mit dem Kopf eine Bewegung in Richtung des Schranks unter der Treppe.
»Nein, das riecht irgendwie anders«, sagte Louise. »Wie nach verwesendem Fleisch. Nach Eingeweiden oder so.«
»Kein Wunder bei dem Fraß hier«, sagte Winie. »Wir können froh sein, dass wir nicht Typhus oder die Ruhr bekommen haben oder was es sonst noch so alles gibt.«
Endlich war die Tür auf. Die Mädchen atmeten begierig die frische Luft ein, nahmen ihre Sachen und liefen in den Hof.
Anders sah ihnen nach, bis sie durch die Einfahrt verschwunden waren. Dann schloss er mit einem Seufzer die Tür und befestigte Riegel und Querstangen wieder, bevor er gemeinsam mit Søren die Kiste mit den Steinen auf ihren Platz vor der Tür schob.
»Idiotisch, dass wir den Kanister nicht mitgenommen haben«, sagte er. »So müssen wir das hier alles nochmal machen.«
Søren antwortete nicht.
»Jetzt sind wir nur noch siebzehn«, fuhr Anders fort. »Warum zum Teufel musstest du dich auch mit ihr streiten?«
»Ich weiß nicht. Es hat eben nicht funktioniert«, erklärte Søren noch einmal.
»Es war auch nicht gerade clever, von Verlobung zu reden«, sagte Anders.
»Verdammt nochmal, was sagt man nicht alles, wenn man Eindruck auf eine Braut machen will, oder?«
Sie stiegen die Treppe hinauf.
»Riecht verdammt streng hier«, sagte Søren und schnupperte.
»Holst du Petroleum, wenn wir gefrühstückt haben?«, fragte Anders. Søren zögerte.
»Ich weiß nicht«, sagte er dann. »Eigentlich denke ich auch darüber nach, zu gehen.«
Anders blieb abrupt stehen und sah ihn über die Schulter hinweg an. »Das meinst du nicht ernst!«
»Doch, mal ganz ehrlich, sie hat doch Recht, oder? Louise, meine ich. Niemand interessiert sich für uns. Sie lassen uns einfach in Vergessenheit geraten.«
»Aber Jesper sagt, dass die Gemeinde die Räumung des Hauses verlangt.«
»Das ist jetzt über eine Woche her, dass er das gesagt hat, und absolut nichts ist passiert«, Søren schüttelte den Kopf. »Daran glaube ich nicht.«
»Natürlich kommen sie«, sagte Anders. »Und wenn die Bullen erst hier sind, rückt auch die Presse an. Wir brauchen die Konfrontation, Mann! Begreifst du das nicht?«
»Mit siebzehn Mann? Das wird eine ganz große Sache. Es bringt nichts, Revolution zu spielen, wenn die anderen nicht mitspielen wollen.«
»Revolution spielen? Wie meinst du das? Das ist kein Spiel, hörst du.«
»Okay, dann eben nicht. Aber jetzt sind wir seit sechs Wochen hier und gemütlich ist es nicht gerade.«
»Hattest du das erwartet?« Anders starrte ihn mit eiskalten graugrünen Augen an. Søren fühlte sich unwohl unter seinem Blick.
»Nein«, sagte er. »Aber ... ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Da ist ja auch noch die Schule, nicht? Bis zur Prüfung sind es nur noch zwei Monate und ...«, er zuckte mit den Schultern.
»Nur noch ein paar Tage. Bleib noch ein paar Tage. Jesper sagt, dass bald etwas passieren wird.«
»Okay, bis Samstag«, sagte Søren. »Aber keinen Tag länger. Dir macht das natürlich nichts. Du rennst die Hälfte der Zeit draußen herum. Und ich habe keine Lust, Petroleum zu holen. Das kannst du einen deiner Lakaien machen lassen.«
Høyer saß bereits an seinem Schreibtisch, sah die Post durch und trank seinen ersten Becher Kaffee, als Therkelsen in sein Büro kam.
»Scheißwetter!«, knurrte Therkelsen, während er das Wasser von seiner Mütze klopfte.
»Guten Morgen!«, meinte Høyer sarkastisch. »Nichts ist so aufmunternd an einem grauen Tag wie dein fröhliches Lächeln.«
»Ach, halt doch die Klappe!«, lachte Therkelsen und ging zu der Tür zu seinem Büro, um seinen Mantel aufzuhängen.
Beide Büros hatten Türen zum Gang, aber Therkelsen hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, bei Høyer vorbeizuschauen, wenn er morgens kam.
»Komm und lass uns einen Kaffee trinken«, sagte Høyer. »Damit wir in die Gänge kommen.«
»Eines schönen Tages werden wir uns eine Kaffeevergiftung zuziehen«, meinte Therkelsen, während er sich die Hände rieb.
»Schneit es?«, fragte Høyer und sah unwillkürlich aus dem Fenster.
»Pappschnee«, sagte Therkelsen. »Fast schon Schneeregen. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, aber es ist scheußlich nasskalt. Und das Auto wird nicht warm, sieh mal!«
Er streckte die Hände aus. Die Finger an beiden Händen wachsbleich.
»Weiße Finger«, stellte Høyer fest. »Das lässt auf eine schlechte Durchblutung schließen. Du solltest aufhören zu rauchen.«
»Was du nicht sagst!«, schnaubte Therkelsen, der sich bereits seine Pfeife stopfte. »Ich finde, dieser Winter zehrt an einem.«
»Das hast du letztes Jahr um diese Zeit auch gesagt, wenn ich mich recht erinnere«, sagte Høyer.
»Schon möglich. Ich finde auch, dass es jedes Jahr schlimmer wird. Jetzt kann der Frühling wirklich bald kommen.«
»Er ist auf dem Weg«, sagte Høyer.
»Wer sagt das?«, fragte Therkelsen misstrauisch, als er sich seine Pfeife angezündet hatte.
»Das hier.« Vorsichtig hielt Høyer ein zerdrücktes Schneeglöckchen zwischen zwei Fingern und reichte es Therkelsen.
»Verdammt!«, rief Therkelsen. »Schicken dir deine Fans jetzt Blumen?«
»Es ist von Sofie«, sagte Høyer. »Es war in dem Osterbrief«, fügte er erklärend hinzu.
»Den hat sie doch nicht selbst geschrieben«, sagte Therkelsen.
Sofie war Høyers Enkelkind. Das erste. Und dem Großvater zufolge ein Wunderkind, aber es gab schließlich Grenzen. Sofie war gerade ein Jahr alt geworden und Therkelsen weigerte sich zu glauben, dass sie Osterbriefe schrieb.
»Nein, natürlich nicht«, sagte Høyer so todernst, als wäre der Gedanke gar nicht so absurd. »Den hat ihre Mutter geschrieben, aber Sofie hat etwas gezeichnet.«
Vorsichtig legte er das Schneeglöckchen wieder in den Brief und steckte ihn in den Umschlag. Therkelsen war überzeugt, dass er ihn zu Hause als Erinnerung aufbewahren würde.
»Also, ich glaube, dass das heute ein guter Tag wird«, sagte Høyer. »Eigentlich mag ich den Mittwoch nicht. Haben die Wochentage bei dir Farben?«, fuhr er fort.
»Was?«, fragte Therkelsen und nahm verblüfft die Pfeife aus dem Mund. »Wer hat Farben?«
»Die Wochentage«, wiederholte Høyer.
»Nein, weiß Gott nicht!« Therkelsen schüttelte den Kopf, als käme ihm allein der Gedanke absurd vor. »Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst!«
»Das liegt daran, dass du ein fantasieloser Mensch bist«, sagte Høyer. »Viele Menschen verbinden eine bestimmte Färbe mit einem bestimmten Wochentag.«
»Kann schon sein«, lachte Therkelsen. »Und du gehörst vermutlich zu ihnen. Welche Farbe hat denn für dich der Mittwoch?«
»Grau«, sagte Høyer. »Der Mittwoch ist grau. Der Dienstag grün und der Donnerstag braun. Der Freitag ist weiß. Der Samstag lila und der Sonntag rot. Für mich, versteht sich.«
»Das klingt total verrückt«, sagte Therkelsen. »Und welche Farbe hat der Montag? Blau?«
»Nein«, sagte Høyer und schüttelte den Kopf. »Mein Montag nicht. Der ist gelb. Kanarienvogelgelb.«
»Kanarienvogelgelb!«, rief Therkelsen. »Ich glaube nicht, dass ich den Mut hätte, an einem kanarienvogelgelben Montag aufzustehen. Wer weiß, vielleicht fängt er an zu zwitschern! Irgendetwas Interessantes dabei heute?« Er zeigte mit der Pfeife auf den Poststapel.
Høyer zuckte mit den Schultern. »Sieht nicht so aus. Da ist ein Brief von einem, der meint, Bettina in Schweden gesehen zu haben.«
»Hm«, sagte Therkelsen. »Aber du glaubst das nicht?«
Høyer schüttelte den Kopf. »Nein, tue ich nicht. Wir finden sie, wenn der Schnee weg ist und die Tümpel aufgetaut sind. Warte nur ab.«
Einen Moment saß er in Gedanken versunken da. Therkelsen blies eine Rauchwolke in die Luft und sah Høyer durch sie hindurch an. Der Fall Bettina war ein heikles Thema. Die zwölfjährige Bettina war Anfang Dezember auf dem Heimweg von einer Freundin verschwunden. Die Strecke betrug nur gut einen Kilometer, aber Bettina war nie zu Hause angekommen. Die Letzte, die sie mit Sicherheit gesehen hatte, war eine Frau, die sie von dem Kiesweg auf die Landstraße hatte einbiegen sehen. Seitdem war sie wie vom Erdboden verschluckt.
»Das ist doch schon einmal was, dass die Leute den Fall nicht einfach vergessen haben«, sagte Therkelsen.
»Ja«, räumte Høyer ein. »Aber wir hätten mehr davon, wenn sie uns auch etwas zu erzählen hätten.« Er seufzte leicht. »Nun gut, aber wie gesagt, sie wird schon noch auftauchen. Und das Fahrrad auch.«
»Tja«, sagte Therkelsen. Beide wussten, dass sie auf keinen Fall lebendig auftauchen würde. »Sonst noch was?«, fragte er.
»Sieht nicht so aus«, sagte Høyer. »Die Nachtschicht hatte auch nichts. Zumindest nichts, was wir brauchen können. Und auch nichts, worum wir uns kümmern müssen.«
»Letzteres ist doch nicht schlecht«, sagte Therkelsen. »Und von der Charmeoffensive am Freitag hast du auch nichts Neues gehört?«
»Von der Charmeoffensive?«, wiederholte Høyer.
»Ja, von der Charmeoffensive oder: Wie wir lernten, die Bullen zu lieben!«, sagte Therkelsen lachend.
»Ach so, das besetzte Haus. Nein, ich weiß nicht einmal, wann die stattfinden soll.«
»Um sieben Uhr morgens. Sie wollen sie im Bett überraschen. Unser Big Boss hat sechzig Leute bereitgestellt.«
»Sechzig Mann? Das ist nicht wahr!«
»Doch, das sind alle, die er zusammenbekommen und sich im Umkreis ausleihen konnte. Und nichts mit Visieren, Knüppeln, Hunden oder Tränengas. Sie sollen mit Samthandschuhen angefasst werden. Ob sie ihnen auch Frühstück im Bett servieren, weiß ich nicht, aber es sollte mich nicht wundern.« Er schüttelte den Kopf. »Mehr als zwanzig dürften es übrigens nicht mehr sein.«
»Es sind siebzehn«, sagte Høyer. »Ich habe heute Morgen Louise, die Tochter eines Nachbarn, und ihre Freundin getroffen. Sie hatten das Kampieren satt, glaube ich. Und nachdem, was Louise erzählt hat, brauchen sie ein Bad dringender als ein Frühstück. Man sah ihr an, dass das stimmte. Die beiden meinten, dass das ganze Haus stinkt wie ein Raubtierkäfig, nur zehnmal schlimmer.«
»Vielleicht empfangen sie die Plattfußindianer ja als Befreier«, lachte Therkelsen. Er bezeichnete die Kollegen von der Ordnungspolizei in der Regel als Plattfußindianer. »Also, danke für den Kaffee. Ich werde mal in mein Büro gehen und sehen, ob da etwas Spannendes auf mich wartet.«
»Du musst doch heute um eins in der Hehlereigeschichte vor Gericht«, erinnerte ihn Høyer.
»O nein, das hatte ich erfolgreich verdrängt. Und du hast gesagt, das würde ein guter Tag.«
»Ja, warum auch nicht?«, sagte Høyer. »Ich muss ja nicht vor Gericht.«
Der Landpolizist Thorsen drehte seine Runde, wie er das nannte. Das bedeutete, dass er seinen Bezirk abfuhr, wie er es nun seit über dreißig Jahren fast jeden Morgen tat, und es gab nicht viel, das seiner Aufmerksamkeit entging. Der Schäferhund Jacques lag auf dem Rücksitz und döste. Bis vor ungefähr einem Jahr hatte er reglos und kerzengerade neben ihm gesessen und wachsam alles beobachtet, was vor sich ging, doch eines schönen Morgens war er auf den Rücksitz gesprungen und seitdem war das sein fester Platz.
»Ja, ja, wir werden alt, Jacques«, sagte Thorsen halblaut und rollte seine Kirschkerne im Mund herum. Es war eine Angewohnheit aus seiner Zeit als Geländeläufer. »Man bekommt keinen Durst, wenn man ein paar Kirschkerne im Mund hat«, behauptete er und er wusste, wovon er sprach. Er war einmal dänischer Meister im Geländelauf gewesen und jütischer Meister im Zehnkampf, doch jetzt waren die Kirschkerne das einzige sichtbare Zeichen dieses Abschnitts seines Daseins. Die Silberbecher und Bronzepokale, die viele Jahre lang in einem Regal in seinem Büro gestanden hatten, waren in einer Kiste auf dem Speicher verschwunden, als ihm eines Tages klar geworden war, dass sie ihn lediglich daran erinnerten, dass er alt geworden war.
Eigentlich hatte er sich gar nicht so sehr verändert. Ein stämmiger, fast weißhaariger Mann mit bleichen Brauen und Augenwimpern über freundlichen blauen Augen, die ganz unerwartet unwirsch blicken konnten. In seinen ersten Jahren hier draußen war er der Schrecken und Held des nahe gelegenen Kinderheims für Jungen gewesen. Es hatte nicht einen Jungen gegeben, den er nicht einholen konnte, und er hatte keine Bedenken gehabt, von seiner Hand Gebrauch zu machen. Das hieß in Thorsens Terminologie, dass die Welpen ein paar hinter die Ohren bekamen, wenn er das für angemessen hielt. Jetzt war das Heim geschlossen, und die vielen Stunden hinter dem Schreibtisch mit dem stetig wachsenden Papierkram sowie die vielen Kilometer hinter dem Steuer hatten Thorsens Muskeln und Glieder steif und seine Taillenweite umfangreicher werden lassen, aber er war noch immer ein guter Polizist.
»Ja, ja, wir werden alt, Jacques«, wiederholte er. »Aber du hast wenigstens gewusst, wann es an der Zeit war, dich zurückzuziehen.«
Im Laufe der Jahre war die Diskussion mit dem Hund, wann er seinen Abschied nehmen sollte, zu einem täglichen Ritual auf seiner Runde geworden. Im Mai wurde er achtundsechzig und eigentlich hatten Asta und er schon vor vielen Jahren beschlossen, dass er mit siebenundsechzig aufhören würde. Doch als es so weit war, hatte Thorsen sich nicht dazu durchringen können. Und in gewisser Weise war Asta daran schuld. Nicht dass er Angst hatte, sich zu langweilen oder zu Hause zu sein, sie lebten schließlich seit vielen Jahren eng zusammen, nein, es hatte mit Astas Erwartungen an das Rentnerdasein zu tun. Sie war fest entschlossen, dass sie es auf ihre alten Tage gut haben sollten, was sich allmählich zu einer fixen Idee entwickelt hatte. Manchmal hatte Thorsen den Eindruck, dass ihr Leben in den letzten sieben, acht Jahren eine lange Vorbereitung auf das Alter gewesen war. Sie hatten das Haus isolieren lassen, solange sie noch gut verdienten. Die Küche war modernisiert worden, im letzten Jahr hatten sie neue Betten und Federbetten bekommen, sie besaßen Staatsanleihen und hatten Geld auf der Bank und Asta sah ihn schief an, wenn er sich nur eine Zigarre anzündete. Und was die Flaschen anging, die er zu seinem sechzigsten Geburtstag und zu seinem vierzigjährigen Dienstjubiläum bekommen hatte, so standen die meisten noch im Keller, wo sie Staub ansammelten und auf die Rente warteten.
»Asta«, protestierte er manchmal. »Warum zum Teufel sollen wir jetzt jeden Pfennig umdrehen, um im Alter wie die Fürsten leben zu können.«
»Wie die Fürsten!«, pflegte sie dann zu sagen. »Von der Rente?«
Sie konnte das Wort Rente aussprechen, dass es wie ein Schimpfwort klang.
»So niedrig ist sie nun auch wieder nicht«, hatte Thorsen eingewandt. »Und wir haben schließlich auch ein bisschen auf die Seite gelegt.«
Aber an dem Punkt ließ sie nicht mit sich reden und Thorsen hatte das abergläubische Gefühl beschlichen, dass das Schicksal ihn, nur um sich einen bösen Spaß zu erlauben, an dem Tag tot umfallen lassen würde, an dem er in Rente ging, und aus genau diesem Grund schob er den Tag immer weiter hinaus.
Plötzlich verringerte er die Geschwindigkeit. Sein Unterbewusstsein hatte etwas registriert, was nicht stimmte, aber es dauerte einen Augenblick, bevor ihm klar wurde, was es war. Vorsichtig fuhr er noch ungefähr fünfzig Meter weiter den matschigen Weg hoch, hielt an und blickte über das Feld. Ja, richtig!
Am Wegrand lag ein altes Herrenfahrrad und von dem Fahrrad aus führten Fußspuren über das Feld, auf dem der Schnee noch weiß und unberührt lag. Sie verschwanden an dem Hang, der zum Schafstümpel hinführte.
Thorsen stieg aus dem Auto und blieb einen Augenblick mit geöffneter Tür stehen und sah Jacques an, der zu schlafen schien. Nein, Thorsen bestand nicht darauf.
Insgeheim hatte er beschlossen, dann seinen Abschied zu nehmen, wenn Jacques einmal sterben würde, weshalb er streng darauf achtete, ihn keinen unnötigen Strapazen zu unterziehen.
Er ging über das Feld und den Abhang hinunter zu dem Tümpel. Vor dem Rand des Eises standen zwei spitze Holzschuhe ordentlich nebeneinander.
Thorsen blieb eine Weile stehen und blickte kopfschüttelnd über den Schafstümpel.
»Was für eine Scheißmethode«, murmelte er. »Was für eine Scheißmethode«. Aber natürlich war die eine Methode so gut wie die andere und diese schien wenigstens effektiv gewesen zu sein.
Der Schafstümpel war klein und selbst an der tiefsten Stelle nicht tiefer als zwei Meter. Der Mann hatte fast bis zur Mitte des Tümpels eine Rinne in das Eis getreten, sich dann vermutlich flach hingelegt und unter das Eis geschoben. Thorsen seufzte. Es würde nicht leicht werden, ihn herauszuholen. Früher hatte er vom nächsten Hof immer ein paar Kerle bekommen, die ihm geholfen hatten, aber das gehörte einer anderen Zeit an, deshalb war es wohl besser, die Feuerwehr zu alarmieren.
Er seufzte noch einmal und ging langsam zum Auto zurück, während er sich fragte, wer das sein könnte, der da seinem Leben ein Ende gemacht hatte. In den letzten Jahren war so etwas ein wenig zu oft vorgekommen, fand er, nur hatten die meisten den Strick genommen.
Die Feuerwehr hatte die Leiche geborgen. Sie waren in einem Gummiboot hinausgestakt und hatten das Eis zerschlagen, bis sie ihn endlich greifen konnten.
Thorsen sah zu, wie sie den Mann auf die Trage legten und diese ins Auto schoben. Als Letztes sah er die nassen Wollsocken. Selbst gestrickte. Jens Olsen war es also gewesen. Wer hätte das gedacht, dachte Thorsen. Ein stiller, wortkarger Mann, der seinen kleinen Hof bewirtschaftete und früher für andere gearbeitet hatte, bis er einen Unfall mit dem Traktor hatte. Thorsen wusste nicht viel über die Familie. Sie gehörten irgendeiner Sekte an und blieben meistens für sich. Der Mann mochte um die fünfzig sein, die Frau ungefähr zehn Jahre jünger. Jens Olsen war schon viele Jahre Witwer gewesen und sie war mit ihrer Tochter allein. Zusammen hatten sie, soweit Thorsen wusste, noch vier oder fünf kleine Kinder. In Gedanken versuchte er, eine kleine Rede vorzubereiten, von der er wusste, dass er sie doch nicht halten würde. In solchen Situationen musste man sich vom Gefühl leiten lassen. Es war keine schöne Nachricht – weder für den Boten noch für den Empfänger.
Er hatte Jens Olsens Haus fast erreicht, als er das gelbe Postauto sah, das ihm von der anderen Seite entgegenkam.
Thorsen fuhr an die Seite und bedeutete dem Postboten, anzuhalten. Er kurbelte das Fenster herunter.
»Haben Sie etwas für Jens Olsen?«, fragte er.
»Die Wochenzeitung«, sagte der Landbriefträger. »Das ist praktisch die einzige Post, die sie bekommen. Und seine Invalidenrente.«
»Was ist mit Rechnungen?«, fragte Thorsen.
»Die bekommen keine Rechnungen«, antwortete der Briefträger mit leiser Verachtung, als sei er der Meinung, dass es schon schlecht um einen stehen musste, wenn man nicht einmal mehr Rechnungen bekam.
»Nicht mal von der Futtermittelfirma?«, fragte Thorsen leicht verblüfft.
Der Postbote schüttelte den Kopf. »Nein, warum?«
»Nur so«, sagte Thorsen. »Sie gehen besser zuerst hinein. Bekommen Sie normalerweise einen Kaffee?«
»Nicht, wenn ich nur die Zeitung bringe«, sagte der Postbote. »Den gibt es nur, wenn die Invalidenrente kommt.«
»Ich warte dann hier«, sagte Thorsen.
»Wollen sie mit Jens Olsen reden?«, fragte ihn der Postbote neugierig.
»Nein«, sagte Thorsen wahrheitsgemäß. »Mit seiner Frau.«
»Hm.« Der Postbote zögerte ein wenig, doch da Thorsen nicht den Eindruck machte, als seien noch weitere Informationen von ihm zu erwarten, startete er das Auto und fuhr vor dem Hauswirtschaftsraum vor. Thorsen beobachtete im Rückspiegel, wie er aus dem Auto stieg und mit der Zeitung in der Hand zur Tür ging. Er klopfte einmal und ging hinein und Thorsen machte sich auf eine längere Wartezeit gefasst. Doch nur einen Moment später stand der Postbote neben seinem Auto, die Zeitung noch in der Hand. Er sah bleich und erschrocken aus.
Thorsen sah ihn an. Eine Ahnung befiel ihn, ohne dass er sich richtig im Klaren darüber war, was er da empfand.
»Sie ... ich denke, Sie sollten mitkommen Thorsen«, stammelte der Postbote unsicher. »Der Hund, wissen Sie. Er liegt im Hauswirtschaftsraum. Mausetot. Es sieht so aus, als ob ... Da ist schrecklich viel Blut. Sie sollten besser mitkommen.«





























