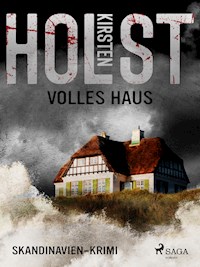Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Nichts los in der jütländischen Provinz? Wohl kaum, wie Bea schnell feststellen muss. Nach 10 Jahren in den USA kehrt die Dreißigjährige zurück in ihre Heimatstadt, wo sie als Privatdetektivin zu arbeiten beginnt. Die Langeweile vergeht schnell, als sie die charismatische und lebendige Marion kennenlernt. Doch dann wird Marion tot in ihrer Garage gefunden. Aber war es wirklich Selbstmord? Wenig später sterben zwei weitere Personen aus Marions Umkreis, und auf Bea wird ein Anschlag verübt...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirsten Holst
Zu lebendig zum Sterben - Skandinavien-Krimi
Übersetzt Hanne Hammer
Saga
Zu lebendig zum Sterben - Skandinavien-Krimi ÜbersetztHanne Hammer OriginalVar det mord?Coverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1999, 2020 Kirsten Holst und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726569490
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
1
Ich stellte das Glas so hart auf dem Tisch ab, dass der Inhalt überschwappte und Flecken auf der ohnehin nicht allzu sauberen Tischdecke hinterließ.
»Das meinst du nicht ernst!«, rief ich, und als Henrik mir nur einen seiner trägen, nachsichtigen Blicke zuwarf, die ich nur allzu gut kannte, und langsam den Kopf drehte, um den Glanz der Sonne auf den leichten Wellen des Fjords zu betrachten, die Segelboote, die Möwen oder was er nun vorgab zu betrachten, wiederholte ich indigniert: »Das kannst du verdammt nochmal nicht ernst meinen! Ich glaub’s einfach nicht!«
Er drehte wieder den Kopf und sah mich an. »Warum nicht?«
»Ladendetektivin! Jetzt mal ehrlich, Mann!«
Es war mehr als zehn Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen hatten, wir waren beide unserer Wege gegangen, doch dann war er unerwartet zu Allies Beerdigung aufgetaucht. In der Kirche hatte ich ihn nicht gesehen. Ich hatte überhaupt niemanden gesehen. Ich hatte nur Augen für den mit Blumen geschmückten Sarg gehabt und das einzige Mal, das ich aufgeblickt hatte, war mein Blick auf eine Tafel gefallen, auf der in goldenen, verschnörkelten Buchstaben stand: Nicht mein, dein Wille geschehe.
Ich war so wütend geworden, dass ich nicht noch einmal aufgeblickt hatte. Wenn das dein Wille ist, dann brauche ich dich nicht!
Ich sah Henrik erst, als wir vor der Kirche standen, um die Trauergemeinde zu begrüßen. Er hielt sich etwas abseits, als wüsste er nicht, ob er kondolieren sollte oder nicht. Ich erkannte ihn sofort. Er hatte sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Als Zwanzigjähriger hatte er wie ein großer Junge ausgesehen, lang und schlaksig, mit dunklem, zerzaustem Haar und blaugrauen neugierigen Augen hinter der Brille. Jetzt war er etwas kräftiger geworden, was ihm gut stand; das sonnengebräunte Gesicht hatte mehr Charakter bekommen, das Haar war gut geschnitten und die Brille durch Kontaktlinsen ersetzt.
War er doch noch eitel geworden oder war das Marias Werk? Ich wusste, dass er und Maria vor vier Jahren geheiratet hatten, und dachte ein wenig schadenfroh, dass er doch noch seinen Meister gefunden hatte. Ich kannte Maria, wir waren vor langer Zeit alle drei zusammen aufs Gymnasium gegangen.
Aber es war nett von ihm, zu der Beerdigung zu kommen, und ich war so erleichtert, zwischen all den fremden Gesichtern ein bekanntes zu sehen, dass ich ihn unwillkürlich anlächelte, und im nächsten Augenblick stand er neben mir.
Er gab mir die Hand und sprach mir sehr formell sein Beileid aus, aber im nächsten Moment legte er den Arm um mich und umarmte mich freundschaftlich, sodass ich beinahe wieder in Tränen ausbrach.
Wir standen einen Augenblick schweigend da.
»Wann geht’s wieder nach Hause«, fragte er schließlich. »Nach Philadelphia, nicht?«
Ich nickte. »Ja, das heißt, Philadelphia gehört der Vergangenheit an. Ich denke, ich werde nicht zurückgehen.«
»Heißt das, dass du ...?«
»Das heißt, dass ich nach Hause zurückgekommen bin. Vielleicht. Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden.«
»Wirst du hier in der Stadt bleiben?«
»Jedenfalls vorläufig.«
Nach dem Leichenschmaus kam er zu mir und schlug mir vor, uns an einem der nächsten Tage zu treffen.
»Nicht um alte Erinnerungen aufzufrischen«, sagte er, als ich zögerte. »Ich möchte dir einen Vorschlag machen.«
Natürlich machte mich das neugierig. Vielleicht hätte ich schon da an den Spruch denken sollen: Curiosity killed the cat to say nothing of Bluebeard’s wives!
Wir verabredeten uns für heute, eine Woche nach der Beerdigung. Ich hatte vor dem Haus, in dem ich wohne, auf ihn gewartet und wir waren zu einem der kleinen Restaurants am Vestre Bådhavn hinausgefahren, wo wir uns an einem Tisch auf der Terrasse niedergelassen hatten.
Er war um seinen Vorschlag herumgeschlichen wie die Katze um den heißen Brei, während wir hier an einem der ersten warmen Sommertage bei unserem Bier saßen – einem kleinen und einem großen –, und ich wurde immer gespannter, was er mir vorschlagen wollte. Ich wusste, dass es um irgendeinen Job ging, und jetzt war die Spannung gelöst.
Ladendetektivin, Gott steh mir bei!
Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Alles andere, nur das nicht. Der Typ musste verrückt sein!
»Was ist daran nicht in Ordnung?«, fragte er.
»Ich dachte, du meintest einen richtigen Job.«
»Zum einen hast du mich missverstanden und zum anderen ist Ladendetektivin ein richtiger Job. Hast du überhaupt eine Ahnung, worum es dabei geht?«
»Ja, natürlich habe ich das. Ich habe einmal eine Ladendetektivin bei der Arbeit erlebt.«
»Wann?«
»Vor einer Ewigkeit. Als ich 13 oder 14 war. Es gab eine Zeit, da war es in meiner Klasse ein Sport zu klauen. Wir mussten alle etwas klauen, um mit zur schlechten Gesellschaft zu gehören. Wer wollte das nicht?«
»Du?«
»Natürlich wollte ich. Unbedingt. Ich hatte keinen Bedarf, mich noch mehr von den anderen zu unterscheiden, als ich das ohnehin bereits tat. Ich war nur zu feige. Nach der Schule fielen wir wie ein Schwarm Heuschrecken über K & L her, du weißt schon, und klauten, was das Zeug hielt. Meistens Kleinigkeiten, die wir leicht in die Tasche stecken konnten.«
»Du auch?«
»Nee, aber bestimmt nicht aus Tugendhaftigkeit, sondern aus purer, schierer Feigheit. Großmutter hätte mich umgebracht, wenn ich geschnappt worden wäre, und ich war sicher, dass ich das würde. Meine Freundin Gladys und ich schworen uns immer wieder, endlich den Mut aufzubringen, aber wir bekamen jedes Mal kalte Füße.«
»Hieß sie wirklich so?«
»Gladys? Ja.« Ich lachte kurz. »Großmutter sagte immer: ›Musst du mit diesem Mädchen befreundet sein? Sie sieht aus, als hätte sie Polypen, sie drückt sich furchtbar aus und dann auch noch der Name!‹« Ich machte Großmutters Art zu sprechen nach und Henrik lachte.
»Na gut, aber an jenem Tag sollte es passieren und schließlich klauten wir jede eine Serviette aus indischer Baumwolle, ein Riesencoup, was? Ich steckte meine in die Jackentasche und hatte das Gefühl, von allen angestarrt zu werden, während wir die Rolltreppe hinunterfuhren und zum Ausgang gingen. Und da stand sie! Die Ladendetektivin. Sie war mindestens vierzig, fünfzig Jahre alt, groß wie ein Haus und sah in ihrem Wintermantel, den vernünftigen braunen Schuhen und der Einkaufstasche in der einen Hand wie eine deutsche Hausfrau aus. Reine Tarnung; sicher war sie in ihrer Freizeit Karatekönigin oder so etwas, denn mit der anderen Hand hielt sie mit eisernem Griff einen unserer Klassenkameraden fest, Pickel-Aksel, der vergebens versuchte, sich zu befreien.«
»Pickel-Aksel?«, fragte Henrik interessiert.
»So wurde er genannt, weil sein Gesicht voller Pickel war. Und Aksel hieß er nun einmal. Er wand und drehte sich und war so verlegen, dass seine Pickel leuchteten wie die roten Lampen im Tivoli.«
Henrik sah mich skeptisch an. »Jetzt übertreibst du aber.«
»Überhaupt nicht. Wir hatten keinerlei Zweifel, dass er auf frischer Tat ertappt worden war. Pickel-Aksel war der Dieb in der Klasse und er war ziemlich dreist. Er begnügte sich nicht mit indischen Servietten, das kannst du mir glauben. Er klaute Transistorradios, Tonbandgeräte, Uhren und Füllfederhalter. Teure Sachen!
Gladys und ich waren vor Entsetzen wie gelähmt. Wir wagten nicht, uns mit unseren Servietten hinauszuschleichen, aber wir wagten auch nicht, sie zurückzulegen, also endete es damit, dass wir sie in der Toilette hinunterspülten und flüchteten.«
»Und das war das Ende deiner kriminellen Karriere«, lachte Henrik.
»Ja, verdammt nochmal! Ich habe nicht die Nerven zur Kriminellen. Ich hatte noch dazu Angst, dass die Servietten die Toiletten verstopften und uns auf die eine oder andere Weise verrieten. Gladys hielt mich für verrückt. ›Zum Teufel ob verstopft oder nicht‹, sagte sie. ›Die wissen doch nicht, dass wir das waren.‹«
»Das konnten sie auch nicht«, sagte Henrik.
»Natürlich nicht, aber damals habe ich begriffen, dass man unglaublich paranoid werden kann, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, nicht? Ich bildete mir ein, dass die Toiletten videoüberwacht waren. Dort ziehen sich die Leute doch immer die geklauten Sachen an.«
»Woher weißt du das?«
»Das weiß doch jeder. Nachher haben Gladys und ich uns natürlich weisgemacht, dass alles total spannend und superlustig war, aber ich wagte mich erst Wochen später wieder zu K & L.«
»Was ist aus deiner Freundin geworden?«
»Aus Gladys? Keine Ahnung. Ich bin aufs Internat gekommen, sodass wir fast von einem Tag auf den anderen auseinander gedriftet sind, aber in Wirklichkeit hatte es wohl schon an dem Tag bei K & L begonnen. Weil wir etwas voneinander wussten. Etwas Beschämendes. Obwohl wir darüber gelacht haben, war es uns peinlich. Mir jedenfalls.«
Ich trank einen Schluck von meinem Bier. Es war bereits lauwarm.
Henrik schüttelte den Kopf. »Wäre das jetzt eine richtige Erbauungsgeschichte, wäre die Moral die, dass du und deine Freundin vom Weg der Verdammnis gerettet wurdet, nachdem ihr schon fast auf die schiefe Bahn geraten wart, und seitdem ehrlich und glücklich gelebt habt, weil Tugend belohnt wird, während Pickel-Aksel in einer Erziehungsanstalt gelandet ist.«
»Das ist er bestimmt auch«, sagte ich leichthin. »Was aus Gladys geworden ist, weiß ich, wie gesagt, nicht.«
»Das tue ich aus guten Gründen auch nicht«, sagte Henrik. »Aber ich weiß, was aus Pickel-Aksel geworden ist.«
»Hast du ihn gekannt?«, fragte ich verblüfft. »Du bist doch gar nicht auf unsere Schule gegangen.«
»Nee, aber wenn das der ist, den ich meine, hat er heute ein blühendes Geschäft. Er verkauft Gebrauchtwagen. Und seine Firma heißt Pickel-Aksel!«
Ich brach in Gelächter aus. »Wunderbar! Das sieht ihm ähnlich, auf diese Weise Kapital aus seinem Spitznamen zu schlagen, aber von ihm würde ich nie ein gebrauchtes Auto kaufen. Er war trotz seiner Pickel sehr charmant, aber er war ein bisschen zu clever.«
»Das ist er bestimmt noch immer, aber seine Autos sind in Ordnung. Er hat einen guten Ruf in der Branche.«
»Woher weißt du das?«
»Es gehört zu meinem Job, so etwas zu wissen. Es gehört auch zu meinem Job, nach neuen Mitarbeitern Ausschau zu halten. Und dich können wir brauchen.«
»Als Ladendetektivin. Vergiss es.«
»Nein, du hast mir nicht richtig zugehört. Als Beraterin.«
»Ist das nicht das Gleiche? What’s in a name?«
»Nein, das ist nicht das Gleiche und ich kann dir nicht versprechen, dass du die ganze Zeit Außendienst hast, es gehört wohl auch ein Teil ganz gewöhnlicher Büroarbeit dazu. Aber gerade im Moment können wir ein Gesicht, das noch nicht so abgenutzt ist, ganz gut gebrauchen.«
»Danke.«
»Ich meinte ...«
»Ja, ja, ja, ich weiß genau, was du gemeint hast. Wozu?«
»Wir haben einen Auftrag von einem großen Kaufhaus. Sie meinen, dass zu viel verschwindet.«
»Doch nicht etwa von K & L?«
Er lächelte entschuldigend. »Doch, in der Tat.«
»Okay«, seufzte ich. »Diebstahl?«
»Ja, vermutlich. Oder Betrug.«
»Also doch Ladendetektivin.«
»Ja und nein. Du sollst nicht die Kunden, sondern das Personal im Auge behalten. Nur ein oder zwei Personen werden wissen, dass du überhaupt da bist. Und nur der Direktor weiß, wer du bist.«
»Was soll ich tun?«
»Das erfährst du, wenn du Ja sagst.«
Ich dachte nach, dann schüttelte ich den Kopf. »Nein, das ist nichts für mich.«
»Was willst du dann machen?«
»Das weiß ich nicht«, sagte ich.
»Du klingst so resigniert.«
»Das bin ich nicht. Das Ganze ist nur ...«
Henrik sah mich fragend an. »Was?«
»Das ist nicht so leicht zu erklären. Manchmal habe ich meine Zweifel, ob ich wirklich hier bleiben soll. Ich habe wohl geglaubt, dass ich einfach nach Hause kommen und dort wieder anfangen kann, wo ich aufgehört habe, aber alles hat sich verändert. Die Stadt hat sich verändert, die Dänen haben sich verändert, ich habe mich verändert. In den paar Monaten, die ich jetzt hier bin, habe ich nur unregelmäßig Zeitung gelesen, aber ich glaube, dass das Leben hier härter geworden ist. Es scheint so, als übernähme man nur das Schlechteste aus dem Ausland. Vieles von dem, was mir in den USA nicht gefallen hat, finde ich nun hier wieder, während die guten Dinge fehlen. Vielleicht irre ich mich und habe Dänemark ein wenig idealisiert, während ich fort war, dafür ist man wahrscheinlich anfällig, wenn man im Ausland lebt; es kann aber auch sein, dass mir die Veränderungen nur nicht aufgefallen sind, als ich noch hier gelebt habe. Sie kommen ja allmählich.«
»Was meinst du zum Beispiel?«
»Das scheinen alles nur Nebensächlichkeiten zu sein. Aber nimm zum Beispiel das Fernsehen. Es ist schlechter geworden. Es gibt fast nur noch Quizsendungen und minderwertige amerikanische Serien. Viel brutaler als früher. Dann sind da die Einwanderer, mit ihnen gab es früher nicht diese Schwierigkeiten. Irgendetwas müsst ihr falsch gemacht haben. Und die Sprache. Sie ist so hässlich geworden, dass meine Großmutter sich im Grabe umdrehen würde. Alle fluchen und gebrauchen eine Menge englischer und amerikanischer Ausdrücke. Ich habe Fernsehwerbung gesehen, in der nicht ein einziges dänisches Wort vorkam, das ist doch grotesk! Selbst kleine Kinder laufen herum und sagen Fuck you und Oh, shit. Und außerdem habt ihr einen Rockerkrieg und brutale Überfälle.«
»Letzteres ist doch nichts Neues«, wandte Henrik ein. »So etwas kommt immer wieder vor.«
»Vielleicht. Aber ich finde das erschreckend. Und all die fetten Menschen. Jedes Mal wenn ich zu Hause war, gab es mehr davon. Extrem dicke. Bald ist es so wie in den USA, wo die Hälfte der Bevölkerung Übergewicht hat. Und dann die Trinkerei.«
»Laut Statistik wird weniger getrunken.«
»Ja, danke, nur sind es jetzt Kinder von vierzehn, fünfzehn Jahren, die sich jedes Wochenende voll laufen lassen, ohne dass jemand einschreitet, obwohl sie halb betäubt mit einem Bier in der Hand durch die Gegend torkeln. In Philadelphia würde man sie festnehmen und zu einer Geldstrafe verurteilen und die Gastwirte würden ihre Lizenz verlieren.«
»Wir waren doch selbst nicht besser, oder?«
»Wir waren viel älter, Henrik. Für uns wäre es als Vierzehnjährige undenkbar gewesen, ein Bier in einer Kneipe zu bestellen. Wir wären nicht einmal hineingekommen. Ich jedenfalls nicht.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Okay, vielleicht erinnere ich mich falsch«, räumte ich ein. »Vielleicht bin ich nur alt und mürrisch geworden. Ich bin nicht mehr zwanzig und es ist viel passiert. Ich bin selbst eine andere geworden.«
»Ja?«, Henrik sah mich fragend an, aber ich hatte keine Lust, das Thema zu vertiefen.
»Kümmere dich nicht um mich. Ich stecke einfach nur in einer Identitätskrise«, sagte ich leichthin und lächelte ihn an.
Er lächelte nicht zurück, sondern sah mich weiter fragend an. Sein Blick machte mich verlegen. »Warum?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, Henrik, ich mag diese Nabelschau nicht. Vergiss es.«
»Nein, ich möchte gerne wissen, was du meinst.«
Ich saß stumm da und guckte in mein Glas, als wäre ich dem versunkenen Atlantis auf der Spur.
»Es ist nur ...«, begann ich endlich und verstummte.
»Nur was?«
»Okay. Vor zehn Jahren war ich Tochter, Schwester und Hausfrau. Und plötzlich bin ich nichts mehr von all dem. Ich bin nicht einmal mehr eine richtige Dänin. Ich spreche anders. Ich bin niemand! Und das ist irgendwie ... Man sollte meinen, das sei Freiheit, aber das ist es nicht ... es ist erschreckend.«
»Wie meinst du das?«
»Es ist erschreckend, nirgendwohin zu gehören. Alle Wurzeln sind gekappt. Ich habe das Gefühl, mich im Niemandsland zu bewegen. Wie ... wie eine Koralle. Ich muss einen Platz finden, an dem ich festwachsen kann und ... ich weiß nicht mehr, ob der hier ist.«
Henrik sah mich forschend an und ich sah über das Wasser, um seinem aufmerksamen Blick zu entgehen.
»Was ist mit der Wohnung, in der du wohnst?«, fragte er schließlich. »Teilst du sie mit jemandem?«
Ach so, darüber hatte er sich also Gedanken gemacht. Das sah ihm ähnlich, auf diese Weise zu fragen. Was er in Wirklichkeit wissen wollte, war, ob ich einen Freund hatte.
»Nein, ich habe sie für mich. Sie ist nicht sehr groß.«
»Ist es eine Mietwohnung?«
»Nein, Eigentum.«
»Also hast du dich in deinem tiefsten Innern entschlossen zu bleiben. Warum hättest du sie sonst gekauft?«
» ... sagte Dr. Freud.« Ich lächelte ihn ironisch an. »Aber du irrst dich. Ich habe sie gekauft, weil ich irgendwo wohnen musste und weil sie so billig war, dass ich ziemlich sicher sein konnte, sie ungefähr zum gleichen Preis wieder verkaufen zu können, wenn ich es bereuen und mich entschließen sollte zurückzugehen.«
Die Wahrheit war, dass ich sie gekauft hatte, um mich zu überzeugen, dass Allie wieder gesund würde. Und um sie zu überzeugen, dass ich daran glaubte. Zusammen hatten wir Pläne gemacht, was wir alles unternehmen wollten, wenn sie wieder gesund war. Die Wohnung war unsere Versicherung.
Natürlich war das dumm. Eine Art Aberglaube. Genau wie damals, als Allie und René ihr erstes Kind erwarteten und Allie einen Versicherungsvertreter kommen ließ. Nachdem er Lebensversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen und so weiter. für sie beide abgeschlossen hatte, fragte er verwundert und leicht besorgt, ob sie sehr große Angst habe, dass ihnen etwas passierte. »Nein«, antwortete sie. »Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir ja versichert.«
Weder meine Wohnung noch ihre Versicherungen hatten etwas genutzt.
»Aber erst einmal bist du jedenfalls hier«, sagte Henrik. »Und irgendetwas musst du schließlich machen.«
»Ich werde schon etwas finden.«
»Was?«
»Das weiß ich nicht. Etwas Befristetes«, antwortete ich leicht irritiert. Schließlich ging ihn das nichts an. »Ich habe ein fast fertiges Psychologiestudium«, fuhr ich fort. »Und ich hoffe, es hier abschließen zu können. Ich habe mit dem Studienausschuss gesprochen und meine Examensunterlagen zur Prüfung eingereicht.«
»Wann bekommst du Bescheid?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich nicht. Sie haben gesagt, dass es etwas dauern kann.«
»Du wirst auf jeden Fall nicht gleich nach den Sommerferien hier anfangen können.«
»Das hoffe ich doch.«
»Das kannst du vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nach Neujahr anfangen kannst. Wenn sie dich zulassen.«
»Warum sollten sie nicht?«
»Es ist nicht so einfach, wie du offenbar glaubst. Und es braucht Zeit.«
»Dann ist es eben so.«
»Und was willst du bis dahin machen?«
»Ich werde schon etwas finden«, beharrte ich störrisch.
»Ich werde schon etwas finden, ich werde schon etwas finden! Es nutzt nichts, das wie ein Mantra zu wiederholen. Was kannst du? Was hast du zu bieten?«
»Englisch zum Beispiel«, sagte ich.
»Das können alle.«
»Das glauben sie nur.«
»Bea, es hilft nicht, sauer zu werden, und ich will dir nicht den Mut nehmen, aber du musst realistisch sein. Die Arbeitslosigkeit ist ziemlich hoch hier, verdammt nochmal, und ich kann dir versichern, dass du nicht an erster Stelle in der Reihe stehst.« Er hielt die Hände vor sich und begann an den Fingern abzuzählen. »Du warst über zehn Jahre im Ausland; du hast keine abgeschlossene Ausbildung; du stehst auf der falschen Seite der dreißig, du ...«
»Jetzt hör aber mal auf, ich bin vor einem Monat dreißig geworden«, protestierte ich.
»Ja, wie ich gesagt habe, auf der falschen Seite; du bist keine Schönheit ...«
»Danke!«
Er seufzte ergeben. »Ich sage nicht, dass du hässlich bist. Du bist ein hübsches Mädchen. Wenn du willst, kannst du sogar ein schönes Mädchen sein, aber du bist keine Naomi Campbell, oder? Die Leute bleiben nicht stehen, nur um dich anzustarren.«
»Sollen wir wetten?«
Er lachte. »Nein, aber wenn du wie jetzt Jeans und T-Shirt trägst, gleichst du tausend anderen hübschen, blonden Mädchen. Du hinterlässt keinen unauslöschlichen Eindruck.«
»Weiter«, zischte ich.
»Außer auf mich natürlich«, sagte er. »Wo waren wir?«, fuhr er fort und sah auf seine Finger. Ich hasse es, wenn Leute die Finger zu Hilfe nehmen, um meine Mängel aufzuzählen. »Ach ja, du bist kein herausragendes Talent.«
Er lächelte triumphierend und griff nach seinem Glas; die Aufzählung war offenbar beendet. Ich hätte gut noch ein paar Mängel hinzufügen können, ließ es aber.
»Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich ein besseres Abitur gemacht habe als du«, sagte ich stattdessen.
Er lachte. »Das macht dich doch nicht zu einer herausragenden Begabung! Du bist klug, du besitzt einen gesunden Menschenverstand und du verfügst über Intuition, aber du bist weder Freud noch Einstein.«
Plötzlich erinnerte ich mich, warum damals auf dem Gymnasium nie wirklich etwas aus uns geworden war. Wir sind eine Weile miteinander gegangen, aber dann war ich es müde, immer klein gemacht zu werden.
Ich holte tief Luft. Ich hatte Psychologie studiert, ich hatte eine Analyse hinter mir und ich wusste, dass mein schwacher Punkt – einer meiner schwachen Punkte – der war, dass ich Kritik zu persönlich nahm. Das nicht zu tun ist schwer, wenn es sich um die eigene Person dreht. Am liebsten würde ich eben hören, dass ich einfach großartig bin. In jeder Beziehung! Wer will das nicht? Aber okay, das waren die facts.
Natürlich habe ich Fehler und Mängel, wer hat die nicht? Und er hatte sie schließlich nicht aufgezählt, um mich zu kritisieren oder zu verletzen.
Ich trank einen Schluck Bier, lächelte ihn an und konnte förmlich sehen, wie er erleichtert aufatmete.
»Du hast bestimmt Recht«, sagte ich. »Mit gewissen Vorbehalten. Aber willst du mir nicht bitte erklären, warum du mir diesen Job anbietest?«
Und Gott steh mir bei, er fing wieder mit seinen Fingerübungen an. »Weil du ein fast fertiges Psychologiestudium hast, weil du über dreißig bist, weil ...«
Ich legte meine Hände um seine. »Hör auf damit. Das macht mich wahnsinnig.«
Verwundert sah er erst seine Hände und dann mich an. »Tut es das?«
»Ja.«
»Aber ich muss das tun. Das mache ich immer.«
»Ja, ich weiß.«
Er zog die Hände zu sich. Ich wette zehn zu eins, dass er unter dem Tisch an den Fingern abzählte.
»Du kannst total anonym arbeiten, die berühmte Fliege an der Wand, sollte das nötig sein. Du bist so lange fort gewesen, dass dich niemand kennt. Du bist zwar klug, aber ich glaube nicht, dass du so genial bist, dass die Uni sich auf dein Gesuch stürzt und schreit: Halleluja, die müssen wir sofort haben! Ein halbes Jahr werden wir dich wohl mindestens behalten dürfen und vielleicht bleibst du ja. Du hast einen gesunden Menschenverstand und dann ist da deine berühmte Intuition. Früher war das jedenfalls so.«
»Jetzt sind die Minuspunkte plötzlich zu Pluspunkten geworden.«
»Ich habe nie gesagt, dass das Minuspunkte sind. Das wären sie nur, wenn du dir einen gewöhnlichen Job suchen würdest.«
»War das jetzt alles?«
»Nein, ich glaube, dass du super für den Job geeignet bist. Außerdem bist du ehrlich – von den indischen Servietten einmal abgesehen –, das ist ziemlich wichtig in unserer Branche, und du brauchst einen Job, nicht? Von irgendetwas musst du ja leben. Allein das müsste dich dazu bewegen, Ja zu sagen.«
In diesem Punkt irrte er sich jedoch. Ich brauchte nicht zu arbeiten, um von etwas leben zu können, aber das sagte ich ihm nicht.
»Mmm«, murmelte ich nur.
Er nahm meine Hand. »Und außerdem würde ich dich verdammt nochmal gerne öfter sehen. Ich will nicht, dass du einfach wieder aus meinem Leben verschwindest. Als du neulich da draußen vor der Kirche standest ...«
Ich entzog ihm meine Hand.
»Es war nett von dir zu kommen«, sagte ich.
»Ich mochte deine Schwester sehr. Und außerdem wusste ich, dass du da sein würdest.«
Ich warf ihm einen schnellen Blick zu. Ich hatte Lust, ihn zu fragen, wie es mit Maria lief.
»Das war eine merkwürdige Beerdigung, nicht?«, sagte ich stattdessen.
»Warum?«
»Die meisten waren so jung. Abgesehen von Allies Schwiegereltern, waren fast nur junge Menschen da. Jüngere. Unter vierzig.«
»Sie war schließlich selbst erst sechsunddreißig.«
»Ja. Deshalb ist es eigentlich doch nicht so verwunderlich.«
Aber trotzdem. Für mich waren Beerdigungen immer etwas für ältere Leute. Alte Leute. Hier war die Kirche voller junger Menschen, die bunte Sommerkleider trugen. Alle Pädagogen und Mitarbeiter des Kindergartens, dessen Leiterin sie gewesen war. Ihre alten Freundinnen aus der Schul- und Studienzeit, ihre und Renés Freunde. Und Kinder, Massen von Kindern. Es glich keiner Beerdigung. Es wirkte fast widernatürlich. Aber es war auch widernatürlich, mit sechsunddreißig zu sterben. Und drei kleine Kinder zu hinterlassen. Und einen Mann. Und mich.
Ich fühlte, wie meine Unterlippe zu zittern begann, presste die Lippen zusammen, räusperte mich und sah über das Wasser.
Allie war mehr als eine Schwester für mich gewesen. Sie war meine Ersatzmutter, meine beste Freundin, mein fester Halt.
Ich spürte, dass Henrik mich ansah. Er überlegte wohl, ob er etwas über Allie sagen sollte, aber glücklicherweise verstand er, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür war. Stattdessen nahm er wieder meine Hand und beugte sich ein wenig vor.
»Also, was sagst du, Bea? Zu dem Job? Wirst du wenigstens darüber nachdenken?«
Ich nickte. »Wie viel Zeit zum Nachdenken habe ich?«
»Nicht sonderlich viel«, räumte er ein.
»Sag schon.«
»Kannst du mir morgen Bescheid geben?«
Er verlangte viel. Aber wenigstens hatte er genug Scham im Leib, um ein bedauerndes Gesicht zu machen.
»Verstehst du, ich hatte nicht das Gefühl, dich gleich nach Allies Beerdigung um ein Treffen bitten zu können, aber jetzt drängt die Zeit.«
Ich nickte. Wir saßen eine Weile schweigend da. Ich ging seinen Vorschlag in Gedanken durch. Es war nicht viel, was ich erfahren hatte, aber wenn der Job total hoffnungslos war – oder ich –, konnte ich ja einfach abspringen. Das konnte ich auch, falls ich trotz seiner pessimistischen Voraussagen bereits jetzt zum Studium zugelassen werden sollte. Jedenfalls konnte es nicht schaden, es zu versuchen, sagte ich mir.
Einen Moment später sagte ich das auch zu ihm.
»Okay, ich sage Ja. Ich kann ja jederzeit wieder abspringen, oder? Ich riskiere also nichts, wenn ich Zusage.«
Das habe ich wirklich gesagt!
Gott weiß, wo meine berühmte Intuition in diesem Moment war?
2
Ich schlug Henriks Angebot aus, mich zurück in die Stadt zu fahren. »Wie kommst du dann nach Hause? Es ist weit zu laufen.«
»Ich laufe gerne und außerdem kann ich den Bus nehmen. Jetzt, wo ich schon einmal in der Nähe bin, werde ich ins Kunstmuseum gehen. Es ist Jahre her, dass ich das letzte Mal dort war.«
Er umarmte mich kurz, fast brüderlich, bevor er sich ins Auto setzte. »Schön, dass du wieder zu Hause bist.«
Ich lächelte schief. »Hoffen wir, dass du in einem Monat noch das Gleiche denkst.«
»Das werde ich«, versicherte er. »Wir sehen uns morgen.« Er setzte sich ins Auto und ließ das Fenster herunter. »Ich freue mich wirklich, dass du Ja gesagt hast.«
Ich nickte. Ich tat das nicht, aber jetzt war es zu spät, das zu sagen.
Ich wollte eigentlich ins Museum gehen, aber das Wetter war so schön, dass ich stattdessen durch den Hafen schlenderte und mir die Boote ansah, die auf dem Wasser lagen und in den Vertäuungen schaukelten, während der Wind es in den Takelagen wie von hunderten von Schellen klingeln und bimmeln ließ.
Ich wusste noch immer nicht genau, um was es in meinem neuen Job ging.
»Das wirst du morgen erfahren«, hatte Henrik gesagt. »Wir treffen uns um neun in meinem Büro. Dann erkläre ich dir, worum es bei dem Ganzen geht und was deine Aufgabe ist.«
Das war alles, was ich aus ihm herausbekommen hatte.
Ich landete schließlich bei den Ruderklubs. Die alten Holzgebäude liegen seit undenklichen Zeiten dort. Der Damenruderklub, die Seepfadfinder, der Kajakklub, Ägir und so weiter. Alles sah genauso aus wie immer. Vielleicht ein bisschen heruntergekommener. In den drei Jahren, die ich aufs Gymnasium gegangen war, hatte ich hier gerudert. Rudern und Schwimmen waren die einzigen Sportarten, aus denen ich mir wirklich etwas mache. Allie behauptete immer, das komme daher, dass ich im Zeichen der Fische geboren bin; ich sagte, sie sei geisteskrank, wenn sie an so etwas glaube.
Das Tor zu dem Weg, der zu dem grasbewachsenen Platz hinter meinem alten Klubhaus führte, stand offen. Ich erlag der Versuchung hineinzugehen und hatte fast das Gefühl, auf verbotenen Pfaden zu wandeln. Die Türen zur Bootshalle standen weit offen, die meisten der Boote schienen drinnen zu sein und nirgendwo war eine Menschenseele zu sehen.
Hinten bei dem Bollwerk stand ein Tisch mit ein paar befestigten Bänken. Ich setzte mich auf eine der Bänke und zündete mir eine Zigarette an. Es war ein altes Laster, das ich voller Freude wieder aufgenommen hatte, nachdem ich nach Hause gekommen war. In den USA war ich mir wie ein Paria vorgekommen, wenn ich rauchte, und ich hatte bereits festgestellt, dass es hier kaum anders war, sodass es sicher darauf hinauslaufen würde, dass ich wieder aufhörte, aber nicht gleich.
Es war seltsam still hier. Ich hörte nur das Glucksen des Wassers gegen das Bollwerk, die Schreie der Möwen und in der Ferne wie ein schwaches Dröhnen den Verkehr.
Ich blies einen dünnen Streifen Rauch in die Luft und betrachtete durch ihn hindurch die Aussicht. Rechts von mir lag die Eisenbahnbrücke und etwas weiter entfernt die Straßenbrücke. ›Die neue feste Brücke‹, wie Großmutter sie immer genannt hatte. In ihrer Kindheit – vor fast hundert Jahren – war dort eine Pontonbrücke gewesen, weshalb die Straßenbrücke für sie immer ›die neue feste Brücke‹ blieb.
Auf der anderen Seite des Fjords konnte ich die Bäume von Skansen und direkt unter ihnen die funktional gebauten Häuser sehen, in denen Großmutters Freundin, Tante Eja, gewohnt hatte. Manchmal besuchten wir, Allie und ich, sie zusammen mit Großmutter und jedes Mal wunderte ich mich darüber, dass die kleine, muntere, lebhafte Tante Eja und meine große, strenge Großmutter Freundinnen waren. Manchmal, glaube ich, wunderte das auch sie.
Weiter unten links erahnte ich etwas von der Kirche, in der Allie und ich getauft worden waren. Großmutter hatte das durchgesetzt. Ich war fast ein Jahr und Allie muss knapp sieben gewesen sein. Es war das erste Mal – aber bei weitem nicht das letzte –, dass unsere Eltern uns der Obhut unserer Großmutter überließen und von ihrer Seite war es die reinste Erpressung. »Ich passe nur unter der Bedingung auf sie auf, dass sie getauft werden. Ich will nicht die Verantwortung für ein paar ungetaufte Kinder.«
Vater begehrte auf. Er war gegen die Kindstaufe. Seiner Meinung nach war das nichts als sentimentaler Unsinn, doch war ihm für drei Monate eine Stiftungswohnung in Paris angeboten worden und Paris war nicht nur eine Messe, sondern auch eine Kindstaufe wert, sodass Großmutter – wie fast immer, wenn es um uns ging – ihren Willen bekam. Mutter und Vater nahmen noch obendrein an der Komödie teil, wie Vater das nannte. Wir haben ein Foto von dem Tag. Ich gleiche einem fetten, haarlosen Buddha, während Allie mit ihren goldenen Korkenzieherlocken und ihrem halblangen weißen Kleid mit der rosa Schleife um die Taille einem alten englischen Gemälde entsprungen zu sein scheint. Sie sieht aus wie ein Engel.
In der Kirche benahmen wir uns beide exemplarisch.
Als Allie an der Reihe war und der Priester sie – mit einem Blick zu Großmutter hin – fragte, ob sie dem Teufel und all seinen Werken entsagen wollte, knickste sie höflich und sagte Ja, danke. Sowohl der Priester wie auch mein Vater mussten zu Großmutters großem Ärger lachen, während Großvater, der schwerhörig war, verständnislos von einem zum anderen sah, ohne einen Ton von dem zu verstehen, was vor sich ging.
Meine Augen wurden nass, während ich dasaß und vor mich hin starrte. Ich schniefte und trocknete mir die Augen.
Der Klang von Stimmen ließ mich den Kopf drehen. Zwei große Burschen mit einem kleineren im Schlepptau kamen eifrig diskutierend aus der Bootshalle. Gymnasiasten, schätzte ich.
»Er hätte ruhig ein bisschen früher anrufen können«, sagte der Kleinste irritiert.
»Jetzt sei mal ein bisschen vernünftig, Anders«, sagte einer der anderen. »Das ist wohl nicht das Erste, woran man denkt, wenn man mit einem gebrochenen Arm in der Unfallstation sitzt.«
»Ich hätte das getan«, behauptete der Junge, der Anders hieß. »Du nicht auch, Martin?« Er wandte sich an den dritten.
»Nee. Ich habe kein Handy. Außerdem hätte das nichts gebracht. Es wäre trotzdem zu spät gewesen, um einen Ersatz zu finden.«
Sie waren von ihrem Gespräch so in Anspruch genommen, dass sie mich erst jetzt sahen. Sie starrten mich ungeniert an, als wäre ich ein merkwürdiges Tier.
»Hei, Mutter!«, rief Anders.
Mutter! Nicht Schwester. Genau das hatte mir noch gefehlt. Zuerst erinnerte mich Henrik daran, dass ich auf der falschen Seite der dreißig stand und jetzt Mutter! Was zum Teufel bildete der kleine Rotzlöffel sich eigentlich ein?
Ich sah ihn drohend an. »Nenn mich noch einmal Mutter und du fängst dir eine ein!«
Sie starrten mich verblüfft an und ich bereute die Worte in dem Moment, in dem ich sie ausgesprochen hatte. In Philadelphia bedurfte es weniger, um zusammengeschlagen zu werden, und sie waren zu dritt.
Ich beeilte mich zu lächeln, um zu zeigen, dass das nur ein Witz gewesen war.
Glücklicherweise grinsten alle drei. »Entschuldigung, die Dame, Entschuldigung! Nichts für ungut!«, sagte Anders.
Ich fand Dame nicht viel besser, aber ich ließ es durchgehen.
Sie schlenderten weiter zu dem Weg und blieben eifrig diskutierend an der Ecke des Klubhauses stehen. Der, der Martin hieß, drehte sich um und rief mir irgendetwas zu, das ich nicht verstand. Es klang, als würde er fragen, ob ich rodeln könnte.
»Ob ich was kann? Ich habe es nicht verstanden.«
»Rudern!«, rief er. »Ich habe gefragt, ob Sie rudern können!«
»Ja, kann ich«, rief ich zurück.
Er kam zu mir und die anderen folgten ihm leicht widerstrebend.
»Stimmt das? Können Sie rudern?«, fragte er. Es klang noch immer wie rodeln.
Ich lenkte ein wenig ein. »Jedenfalls konnte ich das, aber es ist zehn Jahre her, seit ich das letzte Mal gerudert habe.«
»Was haben Sie gerudert?«
»Einen Vierer mit Steuermann. Warum?«
»Glauben Sie, Sie können das noch?«
»Ja, davon gehe ich aus. Das ist doch wie Radfahren. Wenn man es erst einmal kann, verlernt man es nicht mehr. Aber ich bin überhaupt nicht in Form und du hast nicht gesagt, warum du das wissen willst.«
Aber ich hatte natürlich eine qualifizierte Vermutung.