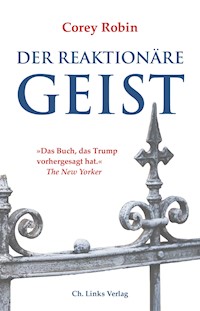
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Politik & Zeitgeschichte
- Sprache: Deutsch
»Eines der einflussreichsten politischen Bücher des letzten Jahrzehnts.«
The Washington Monthly
Der Rechtspopulismus, für den US-Präsident Trump steht, wird meist vom klassischen Konservativismus unterschieden. Zu Unrecht, wie dieses Buch zeigt. Denn alles, was den Rechtspopulismus ausmacht, gehört zum grundlegenden Ideenbestand der Konservativen seit der Französischen Revolution. Europäische Intellektuelle haben das Fundament für die amerikanische Rechte gelegt, in deren Gedankenwelt der Anti-Intellektuelle Trump verankert ist. Anhand prägender Gestalten wie Edmund Burke – von Alexander Gauland gern zitiert –, Friedrich Nietzsche und Ayn Rand deckt Corey Robin die Kontinuitäten im konservativen Denken auf und stellt viele überraschende Verbindungen her. Ein kluges, elegant geschriebenes und provozierendes Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Corey Robin
DER REAKTIONÄREGEIST
Von den Anfängen bis Donald Trump
Aus dem Englischen von Bernadette Ott
Für Laura
Orthographie und Interpunktion in den Zitaten wurden dem aktuellen Gebrauch angepasst.
Die englische Originalausgabe erschien zuerst 2011 unter dem Titel The Reactionary Mind. Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin bei Oxford University Press. Die deutsche Übersetzung folgt der vollständig überarbeiteten zweiten Auflage von 2018 The Reactionary Mind. Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump.© Oxford University Press 2018
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Oktober 2018entspricht der 1. Druckauflage vom Oktober 2018© der deutschen Ausgabe Christoph Links Verlag GmbHSchönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0www.christoph-links-verlag.de; [email protected] Zitat S. 19 aus: T. S. Eliot, Werke in vier Bänden. Band 2. Essays I. Herausgegeben von Helmut Viebrock. Aus dem Englischen von Gerhard Hensel. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1967. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlags. Covergestaltung: Eugen Bohnstedt, Ch. Links Verlag, unter Verwendung einer Grafik von iStock (880624824)
Inhalt
Vorwort
I Reaktion. Eine Einführung
Das Private ist politisch
Was Konservative bewahren wollen
Über die Gegenrevolution
Welchen Wandel Konservative begrüßen
Melancholie und Gewalt
Warum Kampf das Lebenselixier der Konservativen ist
II Europas Erbe und Aufbruch
Der erste Konterrevolutionär
Thomas Hobbes und die Freiheit in der Unterwerfung
Edmund Burkes Marktwert
Oder: Der neue Adel des Kapitals
An Nietzsches Rändern
Die Geburt des Neoliberalismus
III Ein amerikanisches Panorama
Metaphysik und Kaugummi
Ayn Rands kapitalistische Utopie
Der Fürst als Paria
Barry Goldwater oder: Die Konservativen als Opfer
Untergegangene Weltreiche fest im Blick
Die Kriegstrommeln der Neokonservativen
Viel Show um Nichts
Zur politischen Theorie des Trumpismus
Anhang
Anmerkungen
Dank
Personenregister
Zu Autor und Übersetzerin
Vorwort
Wie die meisten Beobachter der amerikanischen Politik war ich schockiert über Donald Trumps Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl im Herbst 2016. Anders als die meisten Beobachter der amerikanischen Politik war ich jedoch nicht schockiert über Trumps Sieg bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei. Meine Überraschung über Trumps Wahl, mehr noch aber die Tatsache, dass mich seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat keineswegs überrascht hatte, brachte mich auf die Idee, mein 2011 erschienenes Buchs Der reaktionäre Geist neu herauszubringen. Diese zweite Auflage liegt auch der deutschen Übersetzung zugrunde.
In der ersten Auflage hatte ich unter anderem die These vertreten, dass viele Merkmale, die wir mit dem gegenwärtigen amerikanischen Konservatismus verbinden – Rassismus, Populismus, Gewaltverherrlichung sowie eine notorische Verachtung für die guten Sitten und Gepflogenheiten, Rechtsprechung, demokratische Institutionen und die Eliten – keine Entwicklung der jüngsten Vergangenheit sind oder eine exzentrische Eigenart der amerikanischen Rechten darstellen. Sondern dass es sich dabei um Kernelemente des Konservatismus handelt, die noch von seinen Anfängen in Europa herrühren, wo er in Reaktion auf die Französische Revolution entstanden ist. Seit damals hat sich der Konservatismus stets auf die eine oder andere Weise einer Mischung aus all diesen Elementen bedient, um eine Koalition aus der Elite und der Masse eines Volkes gegen die Emanzipationsbewegungen der unteren Bevölkerungsschichten zu schmieden.
Im heutigen Amerika setzt Donald Trump am erfolgreichsten auf diese politische Strategie, die den Massen ungehinderten Zugang zu Privilegien verspricht. Deshalb passte er für mich als Konservativer wie als Republikaner vollkommen ins Schema.
In meiner Schlussbemerkung zur ersten Auflage von Der reaktionäre Geist war ich allerdings der Meinung, der amerikanische Konservatismus sei im Niedergang begriffen, zumindest in seiner jüngsten Erscheinungsform als Reaktion auf Kommunismus, Sozialismus und Sozialdemokratie, auf den New Deal und die Befreiungsbewegungen der 1960er-Jahre. Nicht, weil er nicht mehr genügend Anhänger hatte, auch nicht, weil er zu radikal oder rechtsextrem geworden war, sondern weil er nicht mehr über eine zwingende Daseinsberechtigung verfügte. Sein Lebenselixier war die Gegnerschaft zur Sowjetunion, zu Arbeiterbewegung, Wohlfahrtsstaat, Feminismus und Bürgerrechtsbewegung gewesen – und in dieser Hinsicht hatte er die meisten seiner Ziele erreicht. Der New Deal, die 1960er-Jahre und der Kalte Krieg waren überstanden und überwunden. Durch diesen Mehrfach-Triumph über den Kommunismus, die Afroamerikaner sowie zu einem gewissen Grad auch die Frauen hatte die Bewegung ihren konterrevolutionären Impuls und ihre Anziehungskraft verloren, jedenfalls für die Mehrheit der Wahlbevölkerung. Mit anderen Worten, der Sieg des Konservatismus schien zum Auslöser seines Untergangs zu werden.
Sicher mochte es immer noch Gruppierungen wie seinerzeit die Tea-Party geben, welche die Anhängerschaft der Rechten aufzurütteln und ihren reaktionären, rebellischen Geist zu bündeln vermochten. Doch das waren Aufwallungen eines Aktionismus, die lediglich vorübergehend den Verbleib an der Macht ermöglichten. Auf lange Sicht zeigte die Kurve nach unten.
Genauer gesagt, so lange, bis die Linke eine neue Runde emanzipatorischer Politik einläutete, so wie es 1789, im 19. Jahrhundert mit der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei und der Arbeiterbewegung, 1917, in den 1930er-Jahren und in den 1960er-Jahren der Fall gewesen war. Allerdings durfte eine solche linke Revolte nicht Episode bleiben, sondern musste in eine umfassende und anhaltende Bewegung münden, sonst sah die Prognose für die Rechte nicht gut aus.
In den Wochen nach der Wahl Donald Trumps und in der bisherigen Zeit seiner Präsidentschaft erschien mir sein Wahlsieg schließlich immer weniger überraschend. Im Rückblick bin ich nach wie vor nicht der Meinung, Trump und die Republikaner unterschätzt oder missverstanden zu haben; ich glaube jedoch, dass ich Hillary Clinton und die Demokraten überschätzt habe. Seither konnten wir alle dabei zusehen, wie Trump anhaltend die Partei und das Establishment in Bedrängnis brachte und bringt, die er kräftig aufzumischen gedroht hatte – egal ob es die Handelspolitik, die Beziehungen zu China, das Vorhaben, eine Mauer entlang der Grenze zu Mexiko zu bauen, Infrastrukturmaßnahmen, Sozialleistungen oder viele andere Themen betraf. Gleichzeitig war zu beobachten, wie die Republikanische Partei, obwohl sie den Präsidenten stellt und über die Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat verfügt, nicht in der Lage war – jedenfalls bis jetzt – ihre Reformvorhaben im Gesundheitswesen, im Steuersystem und bei den Haushaltsausgaben umzusetzen. Deshalb bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass meine ursprüngliche These von der Schwäche und mangelnden inneren Kohärenz der konservativen Bewegung ihre Richtigkeit hat.1
Sogar jetzt, wo sie an der Macht ist, mit ihrer dreifachen Dominanz auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten, haben die Konservativen mit sich zu kämpfen. Und zwar deshalb, weil ihre Vorgänger, bis hin zur Regierung von George W. Bush, die Ziele der Bewegung im Wesentlichen erreicht haben. Die Schwäche der Konservativen hat aber auch damit zu tun, dass ihre traditionellen Gegenspieler auf der Linken noch nicht präsent oder schlagkräftig genug sind, um für die etablierte Macht eine wirkliche Bedrohung darzustellen. Frühere reaktionäre Bewegungen lenkten ihre Feindschaft gegenüber der Linken in eine umfassende Rekonstruktion der überkommenen Herrschaftsordnung um. Das Versprechen dieser Bewegungen lautete, dass sie das alte System besser gegen die linken Aufrührer verteidigen konnten als die etablierteren Vertreter konservativen Gedankenguts. Von Barry Goldwater bis Ronald Reagan hat die konservative Bewegung auf diese Weise ihre Macht gefestigt.
Auch Trump bediente sich der Affekte gegen das Establishment auf vielfältige Weise. Er stand in keinerlei Beziehung zu der herrschenden politischen Führungsschicht und er verfügte über populistische Qualitäten. Den hohen Tieren bei den Republikanern und den liberalen Eliten würde er zeigen, wo’s langgeht. Er würde den Dämon der politischen Korrektheit besiegen. Er würde die einengenden Normen des Feminismus und Anti-Rassismus sprengen. Dieses Lied aus uralten Zeiten reichte aus, um ihn und seine Partei an die Macht zu bringen.
Als Regierungsprogramm war es jedoch zu wenig. Trumps Unfähigkeit seit der Wahl, die Republikanische Partei umzugestalten, seine beständige Rückkehr zum Status quo, was die Partei betrifft, sowie seine Unfähigkeit – abgesehen von Maßnahmen, die nicht von anderen Verfassungsinstitutionen abhängig sind –, den generellen Status quo zu verändern, sind Merkmale einer Bewegung, die nicht genau weiß, was sie mit der Macht anfangen soll und wohin sie will.
Dieses Regierungsversagen, die mangelnde Umsetzung vieler grundlegender Punkte des Wahlprogramms – zumindest bis jetzt –, ist kein Zeichen von Inkompetenz, sondern von Inkohärenz. (Gefragt, wofür seine Partei denn stehe, antwortete der republikanische Senator Ben Sasse aus Nebraska im Mai 2017: »Ich weiß es nicht.« Darum gebeten, die Republikanische Partei mit einem Wort zu beschreiben, antwortete Sasse, immerhin ein in Yale promovierter Historiker: »Fragezeichen.« Nachdem die Republikaner im Sommer 2017 im Senat damit gescheitert waren, ihren Gesetzesentwurf zum Rückbau von Obamacare noch vor den Parlamentsferien durchzubringen, äußerte sich der republikanische Abgeordnete Steve Womack aus Arkansas nicht weniger unverblümt: »Wir haben die Gelegenheit zu regieren und finden alle möglichen Ausreden, es nicht zu tun.«)2 Trump hat diesen Zustand nicht verursacht. Wie ich im letzten Kapitel ausführen werde, ist er sein auffälligstes Symptom.
Bei meiner Überarbeitung des Buchs ging es mir jedoch nicht darum, irgendwelche Vorhersagen über die Zukunft zu machen oder wenige Monate nach Trumps Amtsantritt bereits ein Urteil über seine Präsidentschaft abzugeben. Mein Feld ist nicht die Empirische Politikwissenschaft, sondern die Politische Theorie. Mein Material sind Texte und Ideen, meine Methoden sind Close Reading und historische Analyse. Ziel des Buchs ist es, Trumps Aufstieg und seine Präsidentschaft in den großen Bogen konservativer Tradition einzuordnen, die wesentlich eine Tradition darstellt, in der Ideen in politisches Handeln umgesetzt wurden. Um Trumps Aufstieg zu verstehen – wodurch er die Wähler anspricht, mit welchen Bildern und Themen er bei ihnen punktet – müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was er gesagt hat. Um seine Präsidentschaft zu verstehen, müssen wir uns damit befassen, wie er gehandelt hat. Der Großteil meiner Analyse widmet sich Trumps Aufstieg und deshalb seinen Worten, wenngleich ich es mir nicht nehmen lasse, dabei auch aufzuzeigen, wo sein Handeln von seinen Worten abweicht – was ziemlich häufig der Fall ist.
Vieles am Phänomen Trump, so meine These, das besonders verstört und auf besonders große Empörung trifft – vor allem der Rassismus, die mangelnde Selbstbeherrschung, die Rhetorik der Gewalt – ist nicht neu. Doch gibt es andere Aspekte seines Aufstiegs und seiner Präsidentschaft, die durchaus neu sind. Um besser herausstellen zu können, was an Trump neuartig ist, konzentriere ich mich deshalb nicht so sehr auf seine grobschlächtige Rhetorik, für die er zurecht gescholten und weltweit verurteilt wird, sondern stärker auf die so nicht zwangsläufig erwartbaren und häufig unbemerkten Neuerungen, die bei ihm zu finden sind, insbesondere im Hinblick auf die Haltung der Rechten zum Staat und zum Markt. Hier, so glaube ich, lässt sich am deutlichsten beobachten, wie und wo Trump mit seinen Vorgängern gebrochen hat.
Außer Trumps Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gibt es noch zwei weitere Gründe, die mich zur Überarbeitung von Der reaktionäre Geist veranlasst haben. Der erste Grund ist, dass ich schon seit längerem der Meinung war, in der ersten Auflage der englischen Ausgabe nicht genügend auf die ökonomischen Theorien der Rechten eingegangen zu sein. Einige Kapitel streiften diese Ideen zwar en passant, doch nur ein einziges – das über Ayn Rand – beschäftigte sich explizit damit. Zum Teil hatte dies damit zu tun, wodurch mein Interesses am Konservatismus geweckt wurde, und mit dem Zeitraum, in dem mir die ersten Ideen zu mehreren Kapiteln dieses Buchs kamen: die Jahre der Präsidentschaft von George W. Bush, als der Neo-Konservatismus die vorherrschende Ideologie der Rechten war und Kriegführen deren bevorzugte Tätigkeit. In den einzelnen Kapiteln hatte dies eine Überbetonung der Themen Krieg und Gewalt zur Folge, durch die ein anderes großes Thema der Konservativen – die Beschäftigung mit dem Markt – vollkommen in den Hintergrund gedrängt wurde.
Nunmehr habe ich versucht, dem Abhilfe zu verschaffen. Vier Kapitel über Krieg und Frieden sind entfallen, drei neue über die Wirtschaftsauffassung der Rechten hinzugekommen: eines über Edmund Burke und seine Werttheorie, eines über Friedrich Nietzsche, Friedrich von Hayek und die Österreichische Schule der Nationalökonomie sowie eines über Donald Trump. Im Ergebnis findet nun eine weitaus intensivere Auseinandersetzung mit den rechten Vorstellungen über den Zusammenhang von Krieg und Kapitalismus statt, aus der hervorgeht, dass die bedingungslose Bejahung eines freien Marktes weder besonders typisch für den amerikanischen Konservatismus ist noch eine neue Idee der Rechten darstellt. Die Spannungen zwischen Politik und Ökonomie, zwischen einer aristokratischen Auffassung von Politik und den Realitäten des modernen Kapitalismus haben eine lange Tradition und sind ein Leitmotiv konservativen Denkens in Europa und den Vereinigten Staaten – und damit auch ein Leitmotiv dieses Buchs.
Der zweite Grund für die Überarbeitung des Buchs war, dass es unter all den Einwänden, die gegen die erste Auflage vorgebracht wurden, einen gab, der mich besonders nachdenklich gemacht hat, und ich habe ihn eher von Leserinnen und Lesern gehört, als dass er in den Besprechungen zu lesen war. Er berührte weniger die Aussage als die Form meiner Darstellung: Das Buch beginne mit einer gut begründeten These, verliere sich dann aber in einer Ansammlung von Essays. Diese Kritik habe ich mir im Verlauf der Jahre zu Herzen genommen. Obwohl ich selbst bei der ersten Auflage des Buchs eine klare Struktur vor Augen hatte, war es mir offensichtlich nicht gelungen, diese auch meinen Leserinnen und Lesern zu vermitteln.
Für die vorliegende Ausgabe habe ich das Buch darum gründlich umgearbeitet. Es beginnt jetzt mit drei theoretischen Essays, welche die Grundlagen des konservativen Selbstverständnisses skizzieren. Das ist für mich sozusagen die allgemeine Einführung in den reaktionären Geist. Ich untersuche darin, worauf die Rechte reagiert (nämlich auf die Emanzipationsbewegungen der Linken) und was sie zu schützen und zu bewahren versucht (nämlich die Machtausübung als männliches bürgerliches Subjekt, im Privaten genauso wie im Geschäftsleben); wie sie ihre Gegenrevolutionen mittels Umgestaltung des Alten und Anleihen beim Neuen, vor allem bei der Linken, durchführt; wie sie Elitismus und Populismus miteinander verschmilzt und Privilegien popularisiert; und schließlich, welche zentrale Rolle der Gewalt unter ihren Mitteln und für ihre Zwecke zukommt.
Der Rest des Buchs ist chronologisch und geographisch gegliedert. Der zweite Teil führt an den Ursprungsort reaktionären politischen Handelns zurück: das Europa der alten Herrschafts- und Gesellschaftsordnungen vom 17. Jahrhundert bis zu den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts. In den Blick genommen werden dabei drei revolutionäre und gegenrevolutionäre Zeiten, der Englische Bürgerkrieg, die Französische Revolution und das proto-sozialistische Interregnum zwischen der Pariser Kommune und der Russischen Revolution. Anhand von Thomas Hobbes, Burke, Nietzsche und Hayek zeige ich auf, welche politischen Antworten Konservative auf das demokratische Zeitalter zu geben versuchten und mit welchen Strategien sie eine auf Privilegien gegründete Gesellschaftsordnung legitimierten. Die Kapitel über Burke, Nietzsche und Hayek widmen sich dabei besonders ihren Bemühungen, im Kontext eines kapitalistischen Systems eine aristokratische Politik des Krieges sowie eine aristokratische Politik des Marktes zu formulieren. Der dritte Teil des Buchs schildert schließlich die reaktionäre Apotheose des Konservatismus in den Vereinigten Staaten von den 1950er-Jahren bis heute. Hier werfe ich Schlaglichter auf vier Stadien des amerikanischen Konservatismus: Ayn Rands kapitalistische Utopie aus der Mitte des Jahrhunderts, die Verschmelzung der Ängste vor einer Aufhebung der Rassentrennung und der Gleichberechtigung der Geschlechter in der Republikanischen Partei von Barry Goldwater und von Richard Nixon, auf das Kriegstrommeln der Neokonservativen und auf die darwinistische Vorstellungswelt von Donald Trump.
Die Struktur des Buchs folgt dem Schema von »Thema und Variation« in der klassischen Musik. Der erste Teil führt das Thema ein. Der zweite und dritte Teil sind Variationen dieses Themas, wobei jedes Kapitel eine Erweiterung oder Abwandlung bedeutet. Allerdings handelt es sich bei meinem Buch um keine umfassende Geschichte der Rechten. Es ist eine Sammlung von Essays über die Rechte. Hinter dieser Gesamtkonzeption steht durchaus ein historisches Erkenntnisinteresse, ich verfolge quer durch die Zeiten Wandel und Kontinuität des konservativen Denkens und zeige auf, wie etwa bei Hayek und der Österreichischen Schule der Nationalökonomie bestimmte Gedanken formuliert werden, die bereits in Burkes Schriften über den Markt zu finden sind, oder dass Trumps Neigung zu Widersprüchlichkeiten wie ein fernes Echo auf Äußerungen Burkes oder seines Landsmanns Walter Bagehot zu Widersprüchlichkeit klingen. Dennoch ist die Struktur eher episodisch als streng historisch angelegt. Sämtliche Kapitel im zweiten und dritten Teil lassen sich als Exemplifizierungen der Thesen des ersten Teils lesen. Während jedoch die Leserin oder der Leser nach der Lektüre des ersten Teils möglicherweise etwas unbefriedigt zurückbleiben, wenn sie nicht die übrigen Kapitel zur Kenntnis nehmen, kann jedes der Kapitel aus dem zweiten oder dritten Teil auch als unabhängiger Essay über eine oder mehrere Personen, Themen oder historische Situationen gelesen werden.
Mit einer Ausnahme: dem letzten Kapitel dieses Buchs. Meine Ausführungen darüber, was im Fall von Donald Trump neu und was alt ist, beruhen auf meiner gesamten Interpretation der konservativen Tradition. So schockierend und aufwühlend Trumps Redeauftritte bisher auch gewesen sein mögen, viele davon unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen seiner Vorgänger. Um meine Annäherung an Trump richtig zu verstehen – warum ich manches so stark betone und anderes übergehe –, muss man das ganze Buch gelesen haben. Da ich zu viele Wiederholungen vermeiden wollte, musste ich für das abschließende Kapitel die Kenntnis der vorangegangenen Kapitel voraussetzen.
Ich bin mir im Klaren darüber, dass meine Argumentation dadurch womöglich falsch interpretiert oder sogar mein grundsätzliches Anliegen verkannt wird. So könnten Leserinnen und Leser der Meinung sein, dass ich den Aspekten, die sie bei Trump am verstörendsten finden, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe. Mit Blick auf die Zukunft – jenseits der Schlagzeilen von heute und in der Hoffnung, dass dieser Auflage eine längere Haltbarkeitsdauer beschieden sein möge als der ersten – habe ich mich jedoch dafür entschieden, auf den Vertrauensvorschuss des Lesers von heute und die historische Distanz der Leserin von morgen zu setzen.
… »nein« ist das wildeste Wort,das wir der Sprache anvertrauen …Emily Dickinson
I
Reaktion
Eine Einführung
Das Private ist politisch
Was Konservative bewahren wollen
Eine Partei kann feststellen, dass sie schon eine Geschichte hat, noch bevor sie sich ihrer Grundsätze bewusst wird oder sich auf sie geeinigt hat. Faktisch hat sie sich durch eine Folge von Wandlungen und Anpassungen gebildet, während deren einige Probleme sich selbst überlebt haben und neue aufgetaucht sind. Welches ihre wahren Grundsätze sind, lässt sich wahrscheinlich nur ermitteln, wenn man sorgfältig untersucht, wie die Partei sich im Laufe ihrer Geschichte verhalten hat und was die kontemplativ und philosophisch veranlagten Geister unter ihren Mitgliedern in ihrem Namen gesagt haben. Nur genaue Geschichtskenntnis und einsichtsvolle Analyse werden imstande sein, zwischen Dauerndem und Vergänglichem zu unterscheiden, zwischen jenen Lehren und Grundsätzen, an denen sie immer und überall festhalten muss, will sie sich nicht unglaubwürdig machen, und jenen anderen, die von besonderen Umständen ins Leben gerufen wurden und die auch nur im Lichte dieser Umstände verständlich und vertretbar sind.
T. S. Eliot, Die Literatur der Politik
Seit Beginn der Moderne sind Männer und Frauen aus gesellschaftlich benachteiligten Gruppen auf die Straße gegangen und haben gegen die Machthaber in Staat und Kirche, am Arbeitsplatz und in anderen hierarchischen Institutionen protestiert. Die Demonstrationen fanden unter verschiedenen Vorzeichen statt – Arbeiterbewegung, Frauenrechte, Abolitionismus, Sozialismus – und die Forderungen lauteten: Freiheit, Gleichheit, Bürgerrechte, Demokratie. Oder die Losung war schlicht und einfach: Revolution. Bei so gut wie jedem Schritt wehrten sich die Herrschenden dagegen mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, sei es mit oder ohne Ausübung von Gewalt, durch Gesetze gedeckt oder nicht, durch unverhüllte Drohungen oder mittels verdeckter Einflussnahme. Diese Bewegungen »von unten« für mehr Demokratie und die Gegenbewegungen »von oben« machen die Geschichte der modernen Politik aus, jedenfalls zu einem erheblichen Teil.
Dieses Buch befasst sich mit einer der beiden Seiten, nämlich dem Widerstand gegen diese emanzipatorischen Forderungen sowie den politischen Ideen, mit denen dieser Widerstand unterfüttert wurde. Diese wahlweise als konservativ, reaktionär, revanchistisch oder konterrevolutionär bezeichneten Vorstellungen und Ideale auf der rechten Seite des politischen Spektrums sind im Kampf und in der Auseinandersetzung entstanden. Seit ihrem Ursprung und ihrer ideologischen Verfestigung in der Französischen Revolution hat es sich dabei stets um Verteilungskämpfe zwischen sozialen Gruppen gehandelt. Mächtigere und weniger Mächtige standen einander gegenüber. Um die Bedeutung dieser Ideen zu verstehen, müssen wir uns zuallererst diesen Enstehungskontext vor Augen halten. Denn Konservatismus bedeutet vor allem eins: Die Erfahrung, Macht zu haben, diese Macht bedroht zu sehen und sie behalten oder zurückgewinnen zu wollen. Das Nachdenken darüber, die theoretische Überformung dieses Lebensgefühls, macht den Kern dieser politischen Ideologie aus.
Trotz aller historischen und sozialen Unterschiede haben Arbeiter in einer Fabrik, Sekretärinnen in einem Büro, Knechte auf einem Bauernhof, Sklaven auf einer Plantage und Frauen in einer traditionellen Ehe etwas gemeinsam: Sie leben und arbeiten unter Bedingungen ungleicher Machtverteilung. Sie unterwerfen sich ihren Chefs und Dienstherrn, Ehemännern und Gebietern, gehorchen ihnen und kommen ihren Wünschen nach. Andernfalls werden sie gemaßregelt und bestraft. Sie geben viel und bekommen dafür wenig zurück. Ihr Schicksal mag von ihnen vielleicht frei gewählt sein – Arbeitnehmer schließen mit ihren Arbeitgebern Verträge ab, Ehefrauen mit ihren Ehemännern –, doch die Folgen, die sich daraus ergeben, sind es nicht. Welcher Vertrag führt schon alle Einzelheiten auf – die alltäglichen Mühen, das Leiden unter einem Job oder in einer Ehe? Wie der Blick auf die Geschichte der Vereinigten Staaten zeigt, dienten gerade die Verträge häufig als Mittel zur Ausübung von Zwang und Unterdrückung, vor allem am Arbeitsplatz und in der Familie, an den Orten also, wo Männer und Frauen den Großteil ihrer Lebenszeit verbringen. Arbeits- und Eheverträge wurden von Richtern, die auf der Seite der Arbeitgeber und Ehemänner standen, dahingehend ausgelegt, dass die Ehefrauen und Arbeitnehmer mit ihrer Unterschrift einer Vielzahl ungeschriebener und ungewollter Dienstbarkeitsverpflichtungen zustimmten, selbst wenn die Betroffenen davon nichts wussten oder anderslautende Vereinbarungen treffen wollten.1
Bis 1980 war es einem Ehemann beispielsweise in allen amerikanischen Bundesstaaten gesetzlich erlaubt, seine Ehefrau zu vergewaltigen.2 Die Rechtfertigung hierfür lieferte eine 1736 posthum veröffentlichte Abhandlung des englischen Rechtsgelehrten Matthew Hale. Mit der Heirat habe sich die Frau implizit zum Beischlaf mit ihrem Ehemann bereit erklärt, so Hale, und diese Zustimmung könne sie, solange die Beziehung andauere, »nicht zurücknehmen«. Hierin bestehe die stillschweigende, auch bei Unwissen getroffene Übereinkunft. Hat die Frau einmal ja gesagt, kann sie nicht mehr nein sagen. Noch im Jahr 1957 – in der Ära von Earl Warren als Oberstem US-Bundesrichter – war in einem Standardkommentar zur Gesetzgebung zu lesen: »Ein Mann begeht keine Vergewaltigung, wenn er mit seiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau Geschlechtsverkehr hat, selbst wenn er diesen mit Gewalt und gegen ihren Willen vollzieht.« Wenn eine Frau (oder ein Mann) in den Ehevertrag eine Vereinbarung aufzunehmen versuchte, der zufolge ehelichem Sex jeweils explizit zugestimmt werden musste, waren die Richter durch die allgemeine Gesetzgebung dazu verpflichtet, dies zu ignorieren bzw. die Regelung für ungültig zu erklären. Die implizite Zustimmung war eine strukturelle Grundbedingung des Vertrags, die von keiner der beiden Parteien außer Kraft gesetzt werden konnte. Da eine Scheidung bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein als Ausstiegsoption nur in den seltensten Fällen infrage kam, verpflichtete eine Eheschließung die Frauen dazu, sexuelle Dienerinnen ihrer Ehemänner zu sein.3 Ähnliche Kräfteverhältnisse waren bei einem Arbeitsvertrag am Werk: Die Arbeiter stimmten ihrer Einstellung durch den Arbeitgeber zwar freiwillig zu, doch bis zum 20. Jahrhundert wurde diese Zustimmung juristisch als implizite und unwiderrufliche Verpflichtung zur Dienstbarkeit interpretiert; eine Kündigung war praktisch und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen bei weitem nicht so leicht möglich, wie viele vielleicht denken.4
Gelegentlich stemmen sich jedoch die Unterlegenen und Untergebenen dieser Welt gegen ihr Schicksal. Sie protestieren gegen ihre Lebensbedingungen, schreiben Briefe, verfassen Petitionen, schließen sich zu Bewegungen zusammen und stellen Forderungen. Was sie im Einzelnen verlangen, mag unbedeutend erscheinen und das eine nichts mit dem anderen zu tun haben – bessere Sicherheitsbestimmungen für Fabrikmaschinen, ein Ende der Erlaubnis zur Vergewaltigung in der Ehe. Doch indem sie solche Forderungen überhaupt erheben, rufen sie das Gespenst weitaus fundamentalerer Veränderungen herbei. Sie stellen die geltenden Machtverhältnisse infrage, hören auf, dienstbare Geister oder Bittsteller zu sein, und werden zu Handelnden, die in eigener Verantwortung sprechen und agieren. Mehr als die vereinzelten Reformen ist es diese Selbstermächtigung der Klasse der Untergebenen, was die herrschende Klasse in Unruhe versetzt. Auf einmal gibt es eine unabhängige Stimme, die beharrlich Forderungen stellt und Rechte einfordert. Bei der Agrarreform in Guatemala im Jahr 1952 wurden eineinhalb Millionen Morgen Land an 100 000 Kleinbauern umverteilt. Im Bewusstsein der Oberschicht des Landes war dies jedoch zu vernachlässigen, verglichen mit dem Aufruhr, den die politischen Debatten über dieses Gesetz mit sich brachten. Befürworter der Reformen, so beklagte sich der Erzbischof von Guatemala, würden ortsansässige Bauern »von natürlicher Redegewandtheit« in die Hauptstadt schicken, wo sie dann Gelegenheit erhielten, »in der Öffentlichkeit zu sprechen«. Dies schien nicht nur für ihn das Schlimmste an der Agrarreform zu sein.5
In seiner letzten größeren Rede vor dem Senat der Vereinigten Staaten benannte John C. Calhoun, ehemaliger amerikanischer Vizepräsident und Hauptwortführer der Südstaaten, die historische Weichenstellung, mit der die Spaltung des Landes in der Sklavenfrage unausweichlich geworden sei: der Kongressbeschluss Mitte der 1830er-Jahre, die Petitionen der Abolitionisten zur Anhörung zuzulassen. In seiner vierzigjährigen Karriere als Politiker, in der er als Befürworter der Sklaverei Niederlagen wie den Tariff of Abominations, die Nullification Crisis und die Force Bill miterleben musste, war die Tatsache, dass ehemalige Sklaven in der Hauptstadt das Wort ergriffen hatten, für den sterbenden Calhoun rückblickend das entscheidende Zeichen, dass die Revolution eingeläutet worden war.6 Und als ein halbes Jahrhundert später Calhouns Nachfolger den Geist des Abolitionismus zurück in die Flasche zwingen wollten, hatten sie es zuallererst auf solche Demonstrationen schwarzer Handlungsmacht abgesehen. In den 1890er- und 1900er-Jahren wurden in den Südstaaten zahlreiche Verfassungskonvente einberufen, um das Wahlrecht für die Schwarzen zu beschränken. Ein Delegierter erklärte dazu später: »Diese Bewegung wurde von einem großen Anliegen getragen […] der Entfernung der Neger aus der Politik in diesem Staat.«7
Die Arbeitergeschichte der Vereinigten Staaten steckt voller ähnlicher Klagen, dort aus dem Mund der Arbeitgeber und ihrer Verbündeten in der Regierung: Nicht etwa, dass die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter zu Gewalt neigten, Sand im Getriebe seien, den Gewinn minderten, nein, sie seien zu unabhängig und eigenständig. Tatsächlich erwiesen sich die Arbeiterorganisationen als so leistungsfähig, dass Arbeitgeber und Staat fürchteten, dadurch überflüssig gemacht zu werden. Während des großen Eisenbahnstreiks von 1877 (Great Upheaval) übernahmen die streikenden Arbeiter in St. Louis den Zugbetrieb auf eigene Faust. Die Eigentümer fürchteten, die Öffentlichkeit könnte daraus schließen, dass die Arbeiter auch gut selbst den Eisenbahnverkehr betreiben konnten, und setzten deshalb alles daran, diese Züge zu stoppen. So organisierten sie ihrerseits einen Streik, um zu beweisen, dass nur durch sie ein pünktlicher Zugverkehr garantiert war. Während des Generalstreiks in Seattle 1919 bemühten sich die Arbeiter, grundlegende staatliche Funktionen aufrechtzuerhalten, einschließlich Polizei und Gerichtsbarkeit. Dabei waren sie so erfolgreich, dass für Seattles Bürgermeister die Fähigkeit der Arbeiter, Gewalt und Anarchie zu unterbinden, fast die größte Bedrohung darstellte:
»Der sogenannte Solidaritätsstreik in Seattle war der Versuch einer Revolution. Die Tatsache, dass es zu keinen Ausschreitungen kam, ändert daran nichts […] Sicher, es gab keine Schüsse, keine Bomben, keine Toten. Revolution, ich wiederhole es noch einmal, schließt nicht unbedingt Gewalt ein. Der Generalstreik an und für sich, so wie er in Seattle durchgeführt wurde, ist selbst die Waffe der Revolution – und umso gefährlicher, wenn er wie hier ruhig und friedlich abläuft […] Es wird dadurch die Regierung außer Kraft gesetzt. Und darum geht es bei einer Revolution – egal auf welchem Weg.«8
Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden Gewerkschaftsmitglieder vor Gericht immer wieder beschuldigt, ihre Rechte nach Gutdünken zu definieren und in den Fabrikhallen nach selbstbestimmten Regeln handeln zu wollen. Solche Arbeiter sähen sich, wie ein Bundesrichter es formulierte, »als Vertreter eines höheren Gesetzes als desjenigen, dem die Gerichte verpflichtet sind«. Sie übten eine Macht aus, »wie sie nur der Regierung zusteht«, verkündete der Supreme Court, und betätigten sich als »selbsternanntes Tribunal« für Recht und Ordnung.9
Aus dieser Abwehr gegenüber der Selbstermächtigung der abhängigen Klassen ist der Konservatismus als theoretische Richtung entstanden. Er liefert in sich schlüssige und begründete Argumente dafür, warum es den unteren Bevölkerungsschichten nicht erlaubt sein sollte, ihrem unabhängigen, freien Willen zu folgen; warum sie nicht über sich selbst bestimmen oder das Gemeinwesen lenken sollten. Ihre Pflicht ist es, zu dienen und sich unterzuordnen. Die Handlungsmacht ist das Vorrecht der Elite.
Häufig wird behauptet, dass die Linke für Gleichheit steht und die Rechte für Freiheit, doch diese Entgegensetzung verkennt die tatsächlichen Unterschiede zwischen rechts und links. Historisch verhielt es sich nämlich so, dass die Konservativen Freiheit für die höheren und Unfreiheit für die niederen Stände proklamierten. Mit anderen Worten, was ein Konservativer an der Gleichheit nicht schätzt, ist gar nicht die Bedrohung der Freiheit, sondern deren Ausweitung auf alle Bevölkerungsschichten. Denn in dieser Ausweitung erkennt er den Verlust seiner eigenen Freiheit. »Wir sind alle für unsere eigene Freiheit«, verkündete Samuel Johnson. »Aber wir sind nicht für die Freiheit der anderen: Denn in dem Maße, wie wir sie uns nehmen, müssen sie andere verlieren. Ich glaube, wir alle wünschen uns kaum, dass der Pöbel die Freiheit haben sollte, uns zu regieren.«10 Genau das drohte für Edmund Burke durch die Französische Revolution: nicht nur Enteignungen und Gewaltexzesse, sondern die Umkehrung der wechselseitigen Verpflichtungen von Herr und Diener. »Die Gleichheitsapostel«, so verlautbarte er, »verändern und verkehren daher bloß die natürliche Ordnung der Dinge.«
»Das Geschäft eines Perückenmachers oder eines Seifensieders kann seinen Mann nicht ehren – noch weniger können es so manche andere Arbeiten, die niedriger und sklavischer sind. Leute aus solchem Stande müssen nie vom Staat unterdrückt werden, aber der Staat wird von ihnen unterdrückt, sobald sie sich einzeln oder vereinigt einen Anteil an der Regierung anmaßen.«11
Zwar räumt Burke ein, dass die Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen viele Rechte hätten – auf die Früchte ihrer Arbeit, auf das ihnen zustehende Erbe, auf Bildung und noch vieles mehr. Doch ein Recht wollte er nicht allen Menschen zugestehen, und das war »einen gleichen Anteil an Macht, Ansehen und Einfluss in die Führung des Staats«, den das Volk nun für sich beanspruchte.12 Selbst als die Forderungen der Linken sich mehr und mehr auf den Bereich der Wirtschaft verlagerten, blieb die Bedrohung durch eine solche Ausweitung der Freiheit bestehen. Wenn Ehefrauen und Arbeiter mit den ökonomischen Ressourcen versehen werden, um frei entscheiden zu können, erlangen sie nämlich auch die Freiheit, sich ihren Ehemännern und Arbeitgebern zu widersetzen. Aus diesem Grund vertrat Lawrence Mead, der sich in den 1980er- und 1990er-Jahren in Amerika als intellektueller Meinungsführer gegen den Wohlfahrtsstaat profilierte, die Meinung, die Empfänger staatlicher Leistungen müssten sich »in gewisser Hinsicht weniger frei fühlen, anstatt einen Zugewinn an Freiheit zu verspüren.«13 Für den Konservativen bedeutet Gleichheit mehr als einen gerechteren Zugang zu Ressourcen, Chancen und entsprechenden Erfolgen – obwohl er sicherlich auch von dieser Umverteilung nicht begeistert ist.14 Denn letztlich heißt Gleichheit Rotation auf den Sesseln der Macht.
Wenn die Konservativen darin die von der Linken ausgehende Bedrohung sehen, liegen sie nicht falsch. Kurz vor seinem Tod wies G. A. Cohen, einer der scharfsinnigsten marxistischen Analytiker der Gegenwart, darauf hin, dass das ökonomische Umverteilungsprogramm der Linken nicht als Einschränkung der Freiheit um der Gleichheit willen verstanden werden sollte, sondern als Ausweitung der Freiheit von einer Freiheit für wenige auf eine Freiheit für alle.15 Tatsächlich haben alle großen modernen Emanzipationsbewegungen – vom Abolitionismus und dem Kampf für Frauenrechte oder Arbeiterrechte bis hin zur Bürgerrechtsbewegung – stets eine Verbindung zwischen Freiheit und Gleichheit hergestellt. Der Ausbruch aus den Herrschaftsverhältnissen von Familie, Fabrik und Gutshof, wo Unfreiheit und Ungleichheit nichts als zwei Seiten derselben Medaille darstellten, bedeutete für die sich Emanzipierenden auch, Freiheit und Gleichheit als irreduzible und sich wechselseitig verstärkende Bestandteile eines großen Ganzen zu sehen.
Die Koppelung von Freiheit und Gleichheit hat allerdings nicht dazu geführt, dass den Rechten die bittere Pille gesellschaftlicher Umverteilung besser geschmeckt hätte. Oder wie die amerikanische Konservative Dorothy Fosdick sich über John Deweys Vision einer sozialen Demokratie beklagte: »Mit den Definitionen von Freiheit und Gleichheit wird so lange herumjongliert, bis beides ungefähr dasselbe meint.«16 Die Synthese von Freiheit und Gleichheit ist jedoch keineswegs ein linker Taschenspielertrick, sondern zentrales Postulat jeder emanzipatorischen Politik. Ob das realpolitische Handeln dem gerecht wird, ist eine andere Frage. Für den Konservativen bietet jedoch weniger der Verrat an diesem Postulat als dessen drohende Umsetzung Anlass zur Sorge.
Einer der Gründe, warum die Handlungsermächtigung der Unterdrückten die konservative Einbildungskraft so beschäftigt, liegt darin, dass sie sich zunächst im persönlichen, ja privaten Rahmen abspielt. Jeder großen politischen Umwälzung, die ihre Energie in Ereignissen wie dem Sturm auf die Bastille und den Winterpalast oder dem Marsch auf Washington entlädt, gehen unzählige kleine Akte des Aufbegehrens voraus: die Beanspruchung von mehr Rechten in der Familie, in der Fabrik oder auf dem Gutshof. Politiker und Parteien reden von der Verfassung und Gesetzesänderungen, von naturgegebenen Rechten und ererbten Privilegien. Doch der eigentliche Dreh- und Angelpunkt solcher Ausführungen ist die alltägliche Ausübung von Macht im persönlichen Nahbereich. »Hier liegt der Schlüssel für die Weigerung, der Gleichstellung der Frau im Staate zuzustimmen«, schrieb Elizabeth Cady Stanton. »Die Männer sind nicht willens, sie in ihrem Hause anzuerkennen.«17 Bevor es zum Aufruhr in den Straßen oder Debatten im Parlament kommt, gibt es immer das Dienstmädchen, das seiner Herrin ungebührlich antwortet, oder den Arbeiter, der Anweisungen nicht befolgt. Das ist der Grund, weshalb unsere politischen Debatten – egal ob sie die Familie, den Wohlfahrtsstaat, Bürgerrechte oder noch vieles andere betreffen – so viel Explosivkraft in sich bergen: Sie berühren die allerpersönlichsten Machtbeziehungen. Deshalb fällt auch so oft Romanschriftstellern die Aufgabe zu, uns das Politische im Privaten vor Augen zu führen. Auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung reiste James Baldwin nach Tallahassee. Ein imaginiertes Händeschütteln wird für ihn dort zum versteckten Zeichen der Verfassungskrise.18
»Ich bin der einzige Passagier am heruntergekommenen Flughafen von Tallahassee, der ein Neger ist. Die Sonne scheint, es ist drückend heiß. Ein schwarzer Chauffeur, mit einem Hündchen an der Leine, holt seine weiße Chefin ab. Er ist ganz mit dem Tier beschäftigt, meine Anwesenheit entgeht ihm dabei keineswegs; ihr begegnet er respektvoll, zugleich abwartend, merkwürdig auf der Hut. Die Frau ist mittleren Alters, stark geschminkt und strahlend, erfreut, die beiden Wesen zu sehen, die ihr das Leben so viel angenehmer machen. Ich bin mir sicher, ihr ist bisher kein einziges Mal der Gedanke gekommen, dass auch nur einer von beiden die Fähigkeit besitzt, einen wertenden Blick auf sie zu richten oder sie gar zu verurteilen. So wie sie auf ihren Chauffeur zugeht, könnte sie fast einen Freund begrüßen. Kein Freund könnte ihr Gesicht mehr aufleuchten lassen. Wenn sie mir so entgegenlächelte, würde ich gleich ein Händeschütteln erwarten. Sollte ich aber tatsächlich die Hand ausstrecken, würde ein Anflug von Panik, Verstörung und Furcht dieses Gesicht überziehen, die Atmosphäre würde sich verdüstern und die Luft wäre sogleich von Gefahr, ja von Todesdrohung erfüllt.
Solche kleinen Zeichen und Symbole machen die Kabbala der Südstaaten aus.«19
Der Konflikt um die Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten – düsterer Hintergrund der von Baldwin skizzierten Miniatur – liefert hierfür ein aufschlussreiches Beispiel. Eines der Merkmale der Sklaverei in den amerikanischen Südstaaten – im Unterschied zur Sklavenhaltung in der Karibik oder der Leibeigenschaft in Russland – war, dass dort viele Sklaven eng mit ihren Besitzern zusammenlebten. Die Herren kannten die Namen ihrer Sklaven; sie führten Buch über Geburten, Hochzeiten und Todesfälle und begingen diese Anlässe mit ihnen. Es gab eine ganz besondere persönliche Beziehung zwischen Herr und Sklave. Als der Landschaftsarchitekt Frederick Law Olmsted Virginia besuchte, fiel ihm »das enge Zusammenleben und Miteinander der Schwarzen und Weißen« auf und veranlasste ihn zu der Bemerkung, diese »Familiarität und persönliche Nähe« wäre »in fast jeder Gesellschaft des Nordens mit Erstaunen, wenn nicht gar offenkundiger Missbilligung zur Kenntnis genommen worden.«20 Nur die »Beziehungen zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Brüdern und Schwestern«, schrieb der Apologet der Sklaverei Thomas Dew, stifteten »ein noch engeres Band« als die zwischen Herr und Sklave. William Harper, ein weiterer Verfechter der Sklaverei, verkündete gar, es handle sich um »eine der intimsten gesellschaftlichen Beziehungen«.21 Nach der Abschaffung der Sklaverei bedauerten viele Weiße die Abkühlung im Verhältnis zwischen den Rassen. »Ich mag die Neger«, so ein Weißer aus Mississippi im Jahr 1918, »doch das Band zwischen uns ist nicht mehr so eng wie zwischen meinem Vater und seinen Sklaven.«22
Vieles an diesen Äußerungen war Propaganda und Selbsttäuschung der Weißen, aber in einer Hinsicht sicherlich nicht: Die Nähe zwischen Herr und Sklave führte zu einer ungewöhnlich persönlichen Form von Machtausübung. Die Herren bestimmten bis ins Detail, welche Regeln ihre Sklaven zu befolgen hatten, und sorgten für deren Einhaltung. Sie legten fest, wann sie aufzustehen, zu essen, zu arbeiten, zu schlafen hatten; wann sie Besuch empfangen durften und wann Gebetszeit war. Sie gaben den Kindern der Sklaven die Namen und trennten diese Kinder von ihren Eltern, wenn der Markt es gebot. Und während sie sich selbst – ebenso wie ihren Söhnen und den Aufsehern – uneingeschränkten sexuellen Zugriff auf die Körper ihrer Sklavinnen gönnten, untersagten und bestraften sie unerwünschte sexuelle Beziehungen zwischen ihren Sklavinnen und Sklaven.23 Aufgrund des engen Zusammenlebens konnten die Weißen das Verhalten ihrer Sklaven viel unmittelbarer kontrollieren als anderswo.
Die Konsequenzen dieses nahen Miteinanders bekamen nicht nur die Sklaven zu spüren. Es hatte auch Folgen für die Herren. Da sie Tag für Tag ihre Herrschaft in ihrer unmittelbarsten Umgebung ausübten, wurden sie völlig eins damit. Diese Identifikation ging so weit, dass jedes Anzeichen von Ungehorsam auf Seiten der Sklaven – von der Forderung nach Gleichberechtigung ganz zu schweigen – als unerträglicher Angriff auf die eigene Person verstanden wurde. Wenn Calhoun verkündete, die Sklaverei sei »mit unserer Gesellschaft und ihren Einrichtungen natürlich gewachsen und so damit verwoben, dass ihr Ende auch unser Ende bedeuten würde«, bezog er sich damit nicht auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit oder als Abstraktum.24 Vielmehr hatte er die vielen Männer im Sinn, die ganz in ihrer Alltagsaufgabe aufgingen, über andere Männer und Frauen zu herrschen. Nahm man ihnen diese Rolle weg, so war nicht nur der Herr kein Herr mehr, sondern er war als Mensch und Mann gescheitert – und mit ihm die vielen anderen, die gern so wie er ein Herr geworden wären oder sich selbst bereits als Herr betrachteten.
Weil der Herr so wenig Distanz zu seiner Herrenrolle hatte, war er bereit, zur Wahrung von Status und Besitz alle nur erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen. In ganz Nord- und Südamerika verteidigten die Sklavenhalter ihre Privilegien, doch nirgendwo mit derselben Intensität oder Gewalttätigkeit wie in den Südstaaten. Anderswo bedeutete das Ende der Sklaverei »die Liquidation von Vermögenswerten«, so C. Vann Woodward, in den Südstaaten »war es der Untergang einer Gesellschaft«.25
Auch als nach dem Ende des Bürgerkriegs die alte Herrenklasse unerbittlich um die Zurückgewinnung ihrer Privilegien und ihrer Macht kämpfte, war es die Unmittelbarkeit der Machtausübung – die ganz persönliche Herrschaft –, worauf es ihr ankam. Henry McNeal Turner, schwarzer Republikaner in Georgia, drückte es 1871 so aus: »Es stört sie gar nicht so sehr, dass der Kongress Neger in ihren Parlamenten zulässt […], zu Hause aber wollen sie sich von keinem Neger auf der Nase herumtanzen lassen.« Noch hundert Jahre später sollte ein schwarzer Farmpächter in Mississippi zum Vergleich mit dem häuslichen Familienleben greifen, um die Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen zu beschreiben: »Wir mussten ihnen gehorchen, so wie unsere Kinder uns gehorchen.«26
Wenn ein Konservativer auf eine demokratische Bewegung von unten blickt, dann zeigt sich ihm – neben der Selbstermächtigung der Aufbegehrenden – vor allem eins: eine fürchterliche Verwirrung in den privaten Macht- und Herrschaftsbeziehungen. Als Theodore Sedgwick im Jahr 1800 die Wahl Thomas Jeffersons zum Präsidenten miterleben musste, klagte er: »Der Adel der Tugend ist verschwunden, das Ansehen der Person zählt nicht mehr.«27 Manchmal übt der Konservative diese Herrschaft im Privaten selbst aus, manchmal nicht. Ungeachtet davon ist es sein Verständnis für die privaten Beweggründe hinter der öffentlichen Aufregung, was den theoretischen Reflexionen der Konservativen ihre rhetorische Wirkung und die Kraft moralischer Empörung verleiht. »Das wahre Ziel« der Französischen Revolution, so Edmund Burke 1790 in einer Rede vor dem Englischen Parlament, sei es, »all die natürlichen und bürgerlichen Bande zu zerschlagen, welche das Gemeinwesen mittels einer Kette der Subordination ordnen und zusammenhalten; Soldaten gegen ihre Offiziere aufzuwiegeln, Diener gegen ihre Herren, Kaufleute gegen ihre Kunden, Handwerker gegen ihre Werkstattmeister, Pächter gegen ihre Grundherrn, Pfarrer gegen ihre Bischöfe und Kinder gegen ihre Eltern.«28
Private Insubordination wurde rasch zum regelmäßig wiederkehrenden Thema von Burkes Äußerungen zur weiteren Entwicklung in Frankreich. Ein Jahr später schrieb er in einem Brief, wegen der Revolution sei »kein Haus vor den Dienern sicher, kein Offizier vor seinen Soldaten und kein Staat oder keine Verfassung vor Verschwörung und Aufruhr.«29 In einer weiteren Rede vor dem Parlament im Jahr 1791 verkündete er, »eine Verfassung, die auf das gegründet ist, was man Menschenrechte genannt hat«, habe überall in der Welt »die Büchse der Pandora« geöffnet, man denke nur an Haiti: »Schwarze erhoben sich dort gegen Weiße, Weiße gegen Schwarze und alle gegeneinander in mörderischer Feindschaft. Die Unterordnung war zerstört.«30 Nichts an den Jakobinern, so erklärte er gegen Ende seines Lebens, könne mit dem Begriff öffentlicher Tugend belegt werden, es sei denn, man verstehe darunter »den gewaltsamen Eingriff in das Private.«31
Diese Angst vor einer Umwälzung aller persönlichen Beziehungen ist so stark, dass sie einen Mann der Reform in einen Mann der Reaktion verwandeln kann. John Adams, der einmal der zweite Präsident der USA werden sollte, war bei der Aufklärung in die Lehre gegangen und überzeugt davon, dass »die Zustimmung des Volkes die einzige moralische Grundlage einer Regierung« sei.32 Als seine Frau jedoch vorschlug, diese Prinzipien in abgemilderter Form auch auf die Familie auszudehnen, war er überhaupt nicht begeistert. »Ach, und übrigens«, schrieb Abigail Adams in einem Brief an ihren Mann, »von dem neuen Gesetzeswerk, das Du dann ja ausarbeiten wirst, wünsche ich mir, dass Du die Frauen darin großzügiger bedenkst als Deine Vorfahren und ihnen geneigter bist. Lege keine so unbegrenzte Macht in die Hände der Ehemänner. Denke daran, alle Männer wären gern Tyrannen, wenn sie könnten.«33 Die Antwort des Ehemanns lautete:
»Uns ist zu Ohren gekommen, dass unser Kampf die Bande der Regierung bereits überall gelockert hat; dass Kinder und Lehrlinge ungehorsam werden; dass es an Schulen und Universitäten brodelt; dass die Indianer ihre Wärter beschimpfen und die Neger sich ihren Herren gegenüber ungebührlich verhalten. Dein Brief aber war die erste Androhung, dass darüber hinaus noch ein anderer Volksstamm, größer und mächtiger als der Rest, mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden sein könnte.«
Obwohl er seine Antwort mit Neckereien würzte – George Washington möge ihn bitte »vor dem Despotismus des Unterrocks« beschützen34 –, war Adams spürbar erschüttert von dieser Forderung nach demokratischer Verfasstheit der eigenen Privatsphäre. In einem Brief an James Sullivan drückte er die Sorge aus, dass »die Revolution alle Unterschiede verwischen und aufheben« werde. Wenn nämlich in der gesamten Gesellschaft ein so starker Geist des Aufbegehrens um sich greife, dass alle Ordnung sich auflöst, »dann wird es kein Ende nehmen.«35 Bei allen Forderungen nach mehr Demokratie im Staat solle die Gesellschaft dennoch eine Föderation privater Herrschaftsbereiche bleiben, in der ein Ehemann über seine Ehefrau und der Meister über den Lehrling herrscht – und jeder »seinen Platz kennt und auch keine Veranlassung sieht, ihn zu verlassen.«36
Historisch hat der Konservatismus die Durchsetzung der Demokratie im öffentlichen Bereich genauso wie in der Privatsphäre zu verhindern versucht. Denn Vorstöße im einen Bereich, davon war man überzeugt, würden zwangsläufig auch solche im anderen Bereich nach sich ziehen. »Will man das Volk von der Macht im Staate fernhalten«, schreibt der französische Monarchist Louis de Bonald, »muss man Frauen und Kinder von der Macht in der Familie fernhalten.«37 Auch in den Vereinigten Staaten waren diese Bemühungen immer wieder erfolgreich. Allen großen Erzählungen vom unaufhaltsamen Siegeszug der Demokratie zum Trotz handelte es sich beim Kampf um das Wahlrecht in den Vereinigten Staaten ebenso sehr um eine Geschichte von Beschränkungen und Rückschlägen, wie der Historiker Alexander Keyssar aufgezeigt hat. »Das größte Hindernis für ein allgemeines, gleiches Wahlrecht« stellten dabei vom späten 18. Jahrhundert bis in die 1960er-Jahre die »Klassenvorbehalte und Befürchtungen« aufseiten der politischen und ökonomischen Eliten dar.38
Die Haltung jedoch, die bei der Rechten am tiefsten verankert war und am längsten nachwirkte, war die von John Adams: Im öffentlichen Bereich dem politischen Fortschritt das Feld zu räumen, wenn es denn nicht anders ging, aber im Privaten standhaft zu bleiben. Allen Männern und Frauen zuzugestehen, dass sie gleichberechtigte Staatsbürger innerhalb der Demokratie wurden, doch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie in Familie, Fabrik und auf dem Gutshof Untertanen blieben. Der Erhalt der Herrschaftsverhältnisse im Privaten hatte für den Konservativen im politischen Wettstreit Priorität – sogar auf Kosten der Stärke und Integrität des Staats. Man kann diese politische Gewichtung etwa in der Entscheidung des Bundesgerichts von Massachusetts am Werk sehen, dass eine während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs mit ihrem Ehemann geflohene Frau lediglich als Gehilfin ihres loyalistischen Mannes anzusehen und deshalb nicht für die Flucht zur Verantwortung zu ziehen zu sei. Folglich dürfe ihr Besitz auch nicht vom Staat konfisziert werden. Auch die Weigerung der Sklavenhalter im Süden, ihre Sklaven für die Sache der Konföderierten zur Verfügung zu stellen, fügt sich in diese Logik ein. Oder die noch gar nicht so lange zurückliegende Entscheidung des Supreme Courts, dass Frauen nicht zu Schöffen verpflichtet werden dürften, da sie »nach wie vor als Mittelpunkt von Heim und Familie« zu betrachten seien, »mit ihren eigenen Verantwortlichkeiten.«39
Konservatismus definiert sich deshalb nicht durch die Forderung nach individueller Freiheit und einem schlanken Staat, auch nicht durch Skepsis gegenüber Veränderungen, den Glauben an Wandel durch Evolution und Reform statt durch Revolution, oder durch den Glauben an eine Politik der Tugend. Dies mögen Nebenprodukte des Konservatismus sein, sich wandelnde historische Ausdrucksformen. Doch nicht sie treiben ihn wirklich an und um. Auch handelt es beim Konservatismus keineswegs um einen eher zufälligen Zusammenschluss von Kapitalisten, Christen und Kriegern; denn dieser Zusammenschluss wird von einem elementaren Bedürfnis befeuert – dem Widerstand gegen die Befreiung von Männern und Frauen aus ihrem Untergebenenstatus, ganz besonders in der Privatsphäre. Diese Haltung mag meilenweit von der libertären Verteidigung des freien Markts entfernt erscheinen, mit ihrer Feier des atomistischen und autonomen Individuums. Doch das stimmt nicht. Wenn der Libertäre auf die Gesellschaft blickt, sieht er keine isolierten Individuen; er sieht private, oft hierarchische Gruppen, in denen ein Vater über seine Familie herrscht und ein Unternehmer über seine Angestellten.40
Es geht dabei nicht einfach nur um die Verteidigung des eigenen Platzes in der Gesellschaft und der eigenen Privilegien. Wie bereits erwähnt, muss der Konservative nicht unbedingt direkt in die Herrschaftspraktiken, die er verteidigt, eingebunden sein und davon profitieren – bei vielen, wie noch zu zeigen sein wird, ist es nicht der Fall. Deshalb entspringt die konservative Haltung vielmehr der unhintergehbaren Überzeugung, dass eine in sämtlichen Bereichen emanzipierte Welt nicht anders als hässlich, gemein, stumpfsinnig und brutal sein kann. Ihr fehlt nämlich der Glamour einer Welt, in der der Bessere über den Schlechteren herrscht. Wenn Burke im oben zitierten Brief ausführt, das »große Ziel« der Revolution sei es, »was man einen Aristokraten, Edelmann oder Gentleman nennt, auszulöschen«, bezieht er sich damit nicht nur auf die faktische Macht des Adels; er meint damit auch die soziale Unterscheidung, die durch Macht in die Welt gesetzt wird.41 Wenn die Macht verschwindet, verschwindet dieser soziale Unterschied ebenfalls.
Diese Vorstellung eines Zusammenhangs zwischen herausragenden Merkmalen und Macht ist es denn auch, die im Nachkriegsamerika drei Gruppen zu einer unwahrscheinlichen Allianz zusammengeschmiedet hat: Libertäre, für die der Arbeitgeber ungehindert durch staatliche Regulierungen der Boss in seinem Unternehmen zu sein hat, Traditionalisten, bei denen der Vater Herr im Haus bleiben soll, und der sogenannte einfache Mann aus dem Volk, der von einem Präsidenten als Held und Superman träumt, welcher der Welt seinen Stempel aufdrückt. Jeder von ihnen – Libertärer, Traditionalist und einfacher Mann – beglaubigt auf seine Weise das im 19. Jahrhundert in folgende Formel gegossene Bekenntnis zum Konservatismus: »Einem wahrhaft Überlegenen zu gehorchen […] ist eine der wichtigsten Tugenden – eine Tugend, die unabdingbar für das Erreichen von allem Großen und Bleibenden ist.«42
Die Feststellung, dass konservative Ideen so etwas wie eine Leitlinie konterrevolutionärer Praxis darstellen, wird wahrscheinlich aufseiten der Rechten wie der Linken bei nicht wenigen zu hochgezogenen Augenbrauen, wenn nicht gar zu gesträubten Nackenhaaren führen. Galt es doch lange Zeit bei der Linken als ausgemacht, dass die Verteidigung von Macht und Privilegien auf gar keinem Ideengebäude beruht. »Ideengeschichte ist nie fehl am Platz«, so unlängst eine Studie zum amerikanischen Konservatismus, führe jedoch nicht weiter, »um die Macht des Konservatismus in Amerika zu erklären.«43 Linksliberale Autoren haben stets dazu geneigt, rechtsgerichtete Politik eher als Sumpf der Affekte denn als Bewegung mit wohlbegründeten Ansichten aufzufassen: Bereits Thomas Paine, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, behauptete, die Konterrevolution bringe »die Auslöschung von Wissen« mit sich; der Literaturkritiker Lionel Trilling beschrieb den amerikanischen Konservatismus als eine Melange »mentaler Erregungen, die sich den Anschein von Ideen zu geben versuchen«; der Historiker Robert Paxton nannte den Faschismus »eine Blähung des Darms«, keine »Kopfgeburt«.44
Auch die Konservativen selbst denken über sich nicht sehr viel anders.45 Kein Geringerer als Palmerston, zu dem Zeitpunkt noch Parteimitglied der Torys, brachte als Erster die Rede von den »vertrottelten« Konservativen in Umlauf. Mit der Rolle des begriffsstutzigen, tumben Landjunkers machten sich die konservativen Abgeordneten die Haltung F. J. C. Hearnshaws zu eigen, der erklärte, es reiche bei Parlamentsdebatten im Allgemeinen aus, »wenn Konservative, ohne etwas zu sagen, nur dasitzen und nachdenken oder einfach nur dasitzen.«46 Die aristokratischen Beiklänge solcher Äußerungen schwingen heute zwar nicht mehr mit, doch haftet den Konservativen immer noch das Etikett mangelnder Intellektualität und Weltläufigkeit an. Das macht zugleich einen Teil ihres Charmes und ihrer volkstümlichen Anziehungskraft aus. Oder wie die konservative Washington Times schreibt: Republikaner »nennen sich oft selbst gerne die ›Partei der Trottel‹.«47 Nichts, wie wir sehen werden, könnte der Wahrheit weniger entsprechen. Konservatismus ist eine auf Ideen und Wertvorstellungen basierende politische Praxis, und kein noch so oberflächliches Gebaren bei der Rechten, keine noch so ätzende Polemik von der Linken kann die Summe der dort vorzufindenden geistigen Haltungen zusammenstreichen oder wegdiskutieren.
Konservative wiederum werden die Aussage, dass konservative Ideen als Anleitung zu konterrevolutionärer Praxis dienen, aus einem ganz anderen Grund bestreiten: Weil sie darin nämlich die Lauterkeit und den Gehalt ihrer konservativen Werte und Ideen in Abrede gestellt sehen. Mit dem Wort »Reaktion« verbinden viele ein geistloses, aus niederen Motiven erfolgendes Heischen nach Macht.48 Doch Reaktion meint nicht Reflex. Dahinter steht eine grundsätzliche Haltung – dass nämlich manche befähigt sind, andere zu führen, und deshalb auch die Pflicht dazu haben –, und in der Folge dreht sich alles darum, dieses Prinzip in Anbetracht der demokratischen Herausforderungen von unten neu zu justieren. Das ist nicht ganz einfach, denn schon dass es solche Herausforderungen gibt, kann als Widerlegung des Prinzips aufgefasst werden. Wenn eine herrschende Klasse wirklich die Befähigung zur Herrschaft besitzt, wie und warum konnte es dann dazu kommen, dass ihre Macht infrage gestellt wird? Was sagt dies über die tatsächliche Fähigkeit desjenigen aus, der an der Macht ist?49
Hinzu kommt für die Konservativen ein weiteres Problem: Wie nämlich ein solches Herrschaftsprinzip in einer Welt verteidigen, in der nichts mehr festen Bestand hat und alles in Bewegung ist? Von dem Moment an, als der Konservatismus die Bühne betrat, musste er sich gegen den Auflösungsprozess der antiken und mittelalterlichen Vorstellungen von einem geordneten Universum stemmen, in dem stabile Machthierarchien die ewige Struktur des Kosmos widerspiegeln. Der Sturz des Ancien Régime offenbarte nicht nur die Schwäche und Inkompetenz von dessen Führungsschicht, sondern brachte eine noch tiefere und weitreichendere Wahrheit zutage: dass nämlich der Welt ein gültiger Ordnungsentwurf fehlte. (Im Zeitalter des Intelligent Design mag die Vorstellung merkwürdig erscheinen, der Konservatismus sei als Reaktion auf die Erkenntnis zu verstehen, dass die Welt keine natürlichen Hierarchien aufweist. Doch wie Kevin Matton und andere aufgezeigt haben, basiert die Idee des Intelligent Design nicht auf denselben Grundannahmen wie die mittelalterliche Vorstellung einer festen, ewigen Struktur des Universums, und die gesamte Argumentation des Intelligent Design ist keineswegs von Relativismus und Skeptizismus unberührt. Tatsächlich gab einer der führenden Vertreter an, obwohl er »kein Postmodernist« sei, habe er doch »von der Postmoderne viel gelernt«.50) In einer Welt, die vom schwindenden Vertrauen in dauerhafte Hierarchien geprägt ist, die alte gesellschaftliche Ordnung wiederherstellen zu wollen, hat sich als Herkulesaufgabe erwiesen. Es dürfte kaum überraschen, dass dabei einige der bedeutendsten Werke des modernen Denkens entstanden sind.
Doch gibt es noch einen anderen Grund, weshalb wir uns davor hüten sollten, die reaktive Schubkraft des Konservatismus zu unterschätzen – und das ist das Gewicht der gesamten Tradition des Konservatismus selbst. Seit Edmund Burke sind die Konservativen stolz darauf, dass ihr Denken der Kontingenz Raum gibt. Anders als ihre Gegner von der Linken stellen sie an sich nicht den Anspruch, eine Blaupause möglicher künftiger Ereignisse zu liefern. Sie deuten Situationen und Umstände, keine Texte und Lehrbücher. Ihr bevorzugter Handlungsmodus ist Anpassung an die gegebenen Verhältnisse, das richtige Gespür für die Erfordernisse der jeweiligen Situation – nicht Belehrung und Welterklärung. Und wie noch zu zeigen sein wird, enthält diese Selbstwahrnehmung durchaus etwas Wahres: Der konservative Geist ist außerordentlich geschmeidig, reagiert auf Veränderungen der Geschicke und Umstände lange, bevor andere sie wahrnehmen. Mit dem tief verankerten Bewusstsein für Zeitlichkeit und Vergänglichkeit paart der Konservative eine Virtuosität im politischen Taktieren, die ihresgleichen sucht. Deshalb ist es nur logisch, dass der Konservatismus sich in enger Beziehung zu den oben skizzierten Bewegungen und Gegenbewegungen der Macht entwickelt hat, für die er auch später ein empfindsames Gespür haben sollte. Diese machen, wie eingangs erwähnt, die Geschichte der modernen Politik aus – und wie merkwürdig wäre es, wenn ausgerechnet ein Denken, das sich so stark mit Kontingenzen und steten Veränderungen in seinem Umfeld befasst, in dieser Geschichte nicht gut bewandert wäre. Nicht nur gut bewandert, sondern dadurch recht eigentlich zum Leben erweckt und zum Blühen gebracht.
Tatsächlich haben Konservative implizit immer wieder bestätigt, dass sich ihr Denken erst in Reaktion auf die Linke ausgebildet hat. Das reicht von Edmund Burkes Aussage, er und seinesgleichen seien von der Französischen Revolution »ins Nachdenken gefordert worden«, bis hin zum Eingeständnis des amerikanischen Theoretikers und Kritikers Russell Kirk, beim Konservatismus handle es sich um ein »Ideengebäude«, das »seit Beginn der Französischen Revolution […] Männer in ihrem Widerstand gegen radikale Theorien und sozialen Wandel bestärkt hat«.51 (Als seine »feste Überzeugung« schloss Burke daran noch die Bemerkung an, es habe »niemals ein größeres Übel« gegeben« als die Französische Revolution.)52 Manchmal wurde dies auch ganz direkt und unverblümt formuliert. Robert Cecil Salisbury, dreimaliger britischer Premierminister, schrieb 1859, »der Konservatismus definiert sich grundsätzlich über die Ablehnung des Radikalismus, eine unablässige und unerbittliche Ablehnung. Die Furcht, dass die Radikalen triumphieren könnten, ist letztlich der einzige Grund, den die Konservative Partei als Rechtfertigung für ihr Vorhandendsein nennen kann.«53 Mehr als ein halbes Jahrhundert später bekräftigte sein Sohn Hugh Cecil Salisbury – unter anderem Trauzeuge bei Winston Churchills Hochzeit und Provost in Eton – die Position seines Vaters: »Ich bin mir sicher, die Regierung wird irgendwann noch merken, dass es nur einen Weg gibt, um sich gegen revolutionäre Bestrebungen zur Wehr zu setzen, und der besteht darin, ein in sich stimmiges Gedankengebäude zu präsentieren, das nicht-revolutionär ist. Dieses Gedankengebäude nenne ich Konservatismus.«54 Andere, wie Robert Peel – einer der Gründerväter der Konservativen Partei in Großbritannien –, gelangten auf verschlungenerem Pfad zum selben Ergebnis:
»Mein großes Anliegen, auf das ich die vergangenen Jahre all meine Mühen verwandt habe, war es, den Grundstein zu einer bedeutenden Partei zu legen, die, im Unterhaus vertreten und ihre Stärke aus dem Willen des Volks beziehend, die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen den beiden beratenden Kammern unserer Legislative mindern und den Schock gegebenenfalls abzudämpfen vermag, so dass es nun möglich ist, uns dem unangebrachten Eifer allzu wohlmeinender Männer, die auf hastige und überstürzte Änderungen in der Verfassung und den Gesetzen unseres Landes drängen, entgegenzustellen und mit der Stimme der Autorität dem ruhelosen Geist des revolutionären Wandels zuzurufen: ›Bis hierher und nicht weiter, hier hat es mit deinen Erschütterungen ein Ende.‹«55
Falls jemand glaubt, solche Gefühlswelten – und rhetorische Umschweife – seien typisch britisch, so möchte ich nur darauf verweisen, wie George Nash, Hofgeschichtsschreiber der amerikanischen Rechten, 1976 an das Thema heranging. »Was ist Konservatismus?«, fragte Nash in seinem inzwischen zum Klassiker avancierten Buch The Conservative Intellectual Movement in America since 1945. Nachdem er sich eine ganze Buchseite lang herumgewunden hatte – Konservatismus widersetze sich einer Definition, er dürfe nicht »mit der radikalen Rechten verwechselt werden«, er weise »je nach Zeit und Ort erhebliche Unterschiede auf« (bei welcher politischen Idee ist das nicht der Fall?) –, rang er sich schließlich zu einer Antwort durch, die ebenso gut von Peel, Salisbury und Sohn, Kirk oder den meisten anderen erzkonservativen Vordenkern hätte gegeben werden können (und tatsächlich gegeben worden ist). Konservatismus, so Nash, definiere sich durch »den Widerstand gegenüber bestimmten Kräften, die als links oder revolutionär wahrgenommen werden und die alles, wozu Konservative sich zum betreffenden Zeitpunkt bekennen, was sie verteidigen und wofür sie vielleicht sogar sterben würden, zutiefst zu missachten scheinen.«56
Dies sind die expliziten Bekenntnisse zur konservativen Glaubensgemeinschaft. Interessanter sind jedoch die impliziten Aussagen, bei denen die Abwehr gegenüber jeder Form von Radikalität und gegenüber Reformen schon in der Struktur des Gedankengangs angelegt ist. Man nehme zum Beispiel die berühmte Definition des englischen Philosophen Michael Oakeshott aus seinem Essay »Konservative Wesensart«: »Konservativ zu sein, heißt somit, das Vertraute dem Unbekannten vorzuziehen, das Erprobte dem Unerprobten, das faktisch Gegebene dem Verborgenen, das Nächstliegende dem Entfernten, das Reale dem Möglichen, das Begrenzte dem Unbegrenzten, das Maß dem Überfluss, das Brauchbare dem Vollkommenen und die Fröhlichkeit einem utopischen Glück.« Offenbar kann man sich also nicht gleichzeitig an Faktum und Geheimnis, Nahem und Fernem, Lachen und Glückseligkeit erfreuen. Man muss sich entscheiden.
Oakeshott etabliert mit diesem Entweder-Oder nicht etwa eine simple Hierarchie der Vorlieben. Vielmehr signalisiert er damit, dass wir uns hier auf existentiellem Grund befinden, wo man nicht die Wahl zwischen einer Sache und ihrem Gegenteil hat, sondern zwischen einer Sache und ihrer Negation. Zwar räumt Oakeshott ein, dass der Konservative auch dann an vertrauten Dingen seine Freude hätte, wenn es keine gesellschaftlichen Kräfte gäbe, die auf ihre Zerstörung hinarbeiten. »Droht aber der Verlust dieser Dinge, ist sie am stärksten.« Der Konservative ist ein Mensch, »der genau weiß, dass er etwas zu verlieren hat, an dem er sehr hängt.« Oakeshott lässt zwar durchblicken, dass solche Verluste durch vielerlei Kräfte herbeigeführt werden können, doch am geschicktesten sieht er hierbei die Linke am Werk. (Marx und Engels seien »fraglos die Urheber des gewaltigsten aller unserer politischen Rationalismen«, schreibt er an anderer Stelle. Keine andere Utopie habe sich »unter der Vorspiegelung, konkretes Wissen zu sein, so sehr der Welt aufgedrängt.) Aus diesem Grund sei es »keinesfalls inkonsequent […], in Sachen des Staates und der Politik konservativ, im Hinblick auf fast jede andere Betätigung dagegen radikal zu sein«.57 Keineswegs ein Widerspruch – oder sogar notwendig? Radikalismus ist die raison d’être des Konservatismus – gibt es ihn nicht mehr, gibt es auch keinen Konservatismus mehr.58
Selbst wenn der Konservative versucht, sich diesem dialogischen Verhältnis zur Linken zu entziehen, gelingt ihm dies nicht. Denn ohne die Impulse und Reaktionen der Linken würden die hymnisch beschworenen Werte – organischer Wandel, unbefragte Übereinkunft, Freiheit in Ordnung, Besonnenheit, Wert von Vorbildern – kaum Resonanz finden. Wie Benjamin Disreali in seiner Streitschrift Vindication of the English Constitution (1835) erkannte, kann die Beschwörung alter, als selbstverständlich vorausgesetzter Weisheiten nur durch den Gegensatz zu einem vermeintlich revolutionären Rationalismus eine Wirkung auf das moderne Denken haben.
»Die Ausbildung einer freien Regierung in umfassendem Maßstabe ist nicht nur ganz gewiss eine der interessantesten Aufgaben der Menschheit, sondern mit Sicherheit die größte Errungenschaft des menschlichen Geistes. Vielleicht sollte ich sogar besser von einer übermenschlichen Errungenschaft sprechen; denn es wird dafür eine solch raffinierte Klugheit verlangt, solch umfassendes Wissen und solcher Scharfsinn im Urteil, verbunden mit beinahe unbegrenzter Kombinationsgabe, dass die Hoffnung beinahe vergeblich ist, all diese so seltenen Fähigkeiten könnten sich in einem einzelnen Kopf versammelt finden. Ganz gewiss nicht wird dieses summum bonum hinter einer revolutionären Barrikade oder in der von Blut überströmenden Gosse einer gebrandschatzten Metropole Wurzeln schlagen. Dieses große Werk lässt sich nicht von einem über eine Verfassung nachsinnenden Monarchen eines Morgens auf einen Briefumschlag kritzeln oder mit lächerlicher Leichtigkeit durch einen utilitaristischen Gelehrten in einer von Gemeinplätzen strotzenden, dünkelhaften Abhandlung skizzieren.«59
Hinter dieser antagonistischen Argumentationsstruktur steckt mehr als die schlichten Antinomien der Parteipolitik, das Einnehmen konträrer Positionen als Voraussetzung, um Wahlen zu gewinnen. Karl Mannheim zufolge unterscheidet sich der Konservatismus vom Traditionalismus nämlich dadurch, dass es sich bei ihm um das willentliche, bewusste Bemühen handelt, »die Bedeutsamkeit des Besonderen […] aus etwas hinter ihm Liegenden, aus der Vergangenheit« abzuleiten. Traditionalismus dagegen sei eine »allgemein menschliche seelische Veranlagung«, einer »vegetativen Eigenart« vergleichbar, die zu einem »Festhalten am Althergebrachten« führt und sich in unpolitischen Verhaltensweisen zeigt, wie der Weigerung, sich eine neue Hose zu kaufen, bevor die alte nicht vollkommen abgetragen ist. Jedoch erst »wenn dieser Traditionalismus zum Träger einer bestimmten, konsequent durchgehaltenen Lebens- und Denkeinstellung (im Gegensatz zum revolutionären Erleben und Denken)« wird, »bekommt er seine spezifisch ›konservativen‹ Züge.« Der Konservatismus ist somit »als Gegenbewegung bereits reflektiv.«60





























