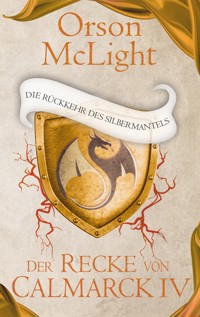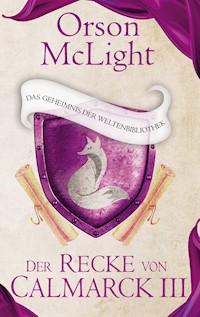Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Recke von Calmarck
- Sprache: Deutsch
Ritter und Schwerter gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Der legendäre Streiter Wolfram von Tannewick schwingt dagegen seit Jahrzehnten seinen Kriegshammer. Das ist es auch, was sein sechzehnjähriger Knappe Eike so sehr an ihm bewundert. Ritter müssen für das Gute einstehen und ihren Weg selbst wählen. Buckeln und Stiefellecken kann schließlich jeder! Als Eike und sein Herr vom König in die Hauptstadt berufen werden, ereilt sie eine bittere Nachricht: Der König wird von einer grausigen Krankheit verzehrt und ist auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Dieser soll aus den Reihen seiner treusten Ritter erwählt werden. Der Kampf um die Krone ruft eine uralte Legende auf den Plan, ohne deren Hilfe Eikes Leben bald schon verwirkt sein könnte ... Das Erbe des Silbermantels ist der erste Band aus der Reihe »Der Recke von Calmarck«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Recke von Calmarck 1
TitelSilbermantel und FackelscheinDie Geburt des ReckenZum WeltenhenkerDuell unter FreundenDer SauertopfKönig BordewinEin unerwartetes LosDrei KapuzenHildlins FluchtRaduhnDer HochmarktÜberbotenDie Augen des JungenWolframs ErbeDer erste KampfDie Prinzessin, die den Preis bezahlteWolkengrauHertwicus in NotZurück in RaduhnUnter TotenAzras VergangenheitUnterricht bei HertwicusDas Geheimnis der ZutatenDas Turnier beginntDas FinaleZeugenaufrufEpilogDanksagungImpressumOrson McLight
Der Recke von Calmarck
Das Erbe des Silbermantels
Fantasy
Silbermantel und Fackelschein
Die Welt war fest in der Hand des Winters, der seinen eisigen Umhang über die Ebenen von Calmarck legte. Schnee, weiß wie edler Marmor, bedeckte die Landschaft, so weit das Auge reichte. Die Äste der Bäume hingen unter der Last der weißen Pracht viel tiefer als üblich. Graue, bauchige Wolken wanderten am Himmel und versperrten der Sonne den Weg.
Der junge Knappe Eike, gehüllt in einen dicken Mantel und eine Fellmütze, versuchte dem Wetter zu trotzen; so ganz gelingen wollte es ihm allerdings nicht. Sein Herz pochte in einem wohligen Rhythmus, während das Blut gegen die Kälte in seinen Adern kämpfte. Der kalte Wind brannte auf seinen rosigen Wangen und aus seinem Mund stiegen dampfige Wölkchen verbrauchter Atemluft auf.
Seine Beine klammerten sich fest um den Rücken seiner alten Stute, die mit einem gemächlichen Schritt durch den Schnee trabte. Sommertau, so der Name der Stute mit dem grau gescheckten Fell, ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen, selbst dann nicht als ihr Reiter unwillkürlich, von einem eisigen Wind getrieben, an ihren Zügeln zog.
Eike blickte nach vorne. Vor ihm ritt sein Herr, Edler Wolfram von Tannewick, ein Ritter, der für den Umgang mit seinem Kriegshammer im ganzen Land bekannt war.
Die mächtige Waffe hatte Wolfram anstelle eines Schwerts an seinem Gürtel gebunden, obwohl er auch mit dem Umgang der Klinge vertraut war. Der Kriegshammer war stets einsatzbereit und wies zum Schwert keinen Nachteil auf – solange ihn Wolfram führte.
Genau das war es, was Eike an seinem Herrn so bewunderte, dass dieser seinen eigenen Weg ging. Der Ritter, der Eike ausbildete, hatte sich noch nie mit Leidenschaft dem Schwertkampf gewidmet und in seiner alten Starrköpfigkeit würde er dies auch nie tun.
Wozu auch? Wolfram hatte sich mit seiner einzigartigen Kampftechnik schon vor drei Dekaden einen Namen beim König gemacht und sich den Titel des Silbermantels verdient.
Dieser Titel war jenen Rittern vorbehalten, die dem König am nächsten standen und mit besonderen Aufgaben betraut wurden.
Wer zu diesem erlesenen Kreis gehörte, durfte einen speziellen blauen Umhang tragen, auf den ein Hirsch mit silbernem Faden gestickt war. Der Hirsch, das Wappentier des Königs, gestand einem so manche Freiheit zu. Wer das Zeichen des Königshauses offen trug, musste im Grunde nichts befürchten.
Passender für das Kleidungsstück wäre eventuell auch die Benennung Blaumantel gewesen, aber es war der kostbare silberne Faden, der dem Umhang seinen Namen gab.
Ob Eike jemals in die Fußstapfen seines Herrn treten könnte? Ein Ritter zu werden stand nicht zur Debatte. Nur noch ein paar Jahre und dann würde er selbst diesen Titel tragen dürfen. Spätestens mit dem Erreichen der Volljährigkeit – also zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag.
Aber ein Silbermantel zu werden – das schafften nur die wenigsten und wenn, meistens nur unter Einsatz ihres Lebens. Weder Familienbande, noch sonstige Bevorzugungen konnten einem zu diesem Status verhelfen. König oder Königin hoben einen Ritter nur nach einer hervorragenden Leistung in diesen Stand. Es wäre ja nichts Besonderes gewesen, wenn ein jeder Aussicht auf den Titel des Silbermantels gehabt hätte. Nein, nur die Tapfersten und zugleich die Klügsten, konnten in Zukunft auf den Silbermantel hoffen.
Das Heer des Königs umfasste ungefähr einhunderttausend Personen, davon waren vielleicht dreitausend ausgebildete Ritter, von denen wiederum hundertfünfzig den Titel eines Silbermantels ihr Eigen nennen konnten. Eine erlesene Auswahl der Besten, um das Land und die Königsfamilie zu schützen. Zerstreut über das ganze Reich, folgten sie den Befehlen des Königs, beschützten dessen Gebiete und Untertanen.
Der Blick des Knappen heftete sich wieder an den Kriegshammer, an dem er sich nie satt sehen konnte. An der einen Seite besaß die Waffe einen Hammerkopf, an der anderen eine axtförmige Klinge. Damit konnte man gleichermaßen Gliedmaßen von Feinden zertrümmern oder ihre Schädel spalten. Mit dem richtigen Schwung ließen sich mit der Klinge sogar Plattenharnische öffnen, wie die Schale bei einem Krustentier. Wie viele Menschen wohl durch die Waffe bereits ihre Leben verloren hatten? Sicherlich gerade genug, um dem König Gerechtigkeit zu zollen.
Tatsächlich war es nicht der stählerne Kopf des Hammers, der Eikes Blick so lange fesselte. Es war der hölzerne Stiel, in dem die Abbilder von vorangegangenen Königen geschnitzt waren, einer erhabener als der andere. Diesen Umstand hatten die Götzen auch Wolframs Knappen zu verdanken, der den Stiel regelmäßig mit Öl einrieb.
Eike selbst besaß lediglich ein Kurzschwert, welches bis jetzt nur dazu gedient hatte, erlegten Tieren das Fell vom Körper abzuziehen. Oder für ein paar belanglose Trainingskämpfe, um seine Fertigkeiten zu verbessern. Eine andere Waffe stand ihm noch nicht zu.
Der Silbermantel vor Eike kam mit seinem Pferd zum Stehen und die Stimme des so ehrenwerten Kämpfers durchbrach die winterliche Stille. »Eike! Komm herbei, das musst du dir ansehen!«
Der Junge lenkte seine Stute neben den namenlosen Rappen seines Herrn und konnte augenblicklich erkennen, warum der Ritter so aufgeregt war.
Umrisse einer imposanten Stadt, höchstens eine halbe Tagesreise entfernt, schoben sich am Horizont in die schneebedeckte Welt. Lavasteinrot glänzte die Stadtmauer, die Zinnen belegt mit weißem Zuckerguss, einem entgegen. Sie war gespickt mit Wehrgängen und Wachtürmen. Auf den höchsten baulichen Erhebungen tanzten Flaggen im Wind. Das Wappen des Königs war natürlich aus der Ferne nicht zu erkennen, aber was auch sonst sollte die Fahnen zieren?
Hinter den Mauern verbarg sich die Stadt Lavasteen, Sitz der Königsfamilie und Hauptstadt des Inselkontinents Calmarck. Türme, leuchtend wie Kaminfeuer, lugten aus dem Herzen der Stadt hervor, drohend wie Speere, die jeden Angreifer schon von weitem in die Knie zwingen sollten. Kein Ort in Calmarck war strahlender, prächtiger oder größer als dieser. Etwas Anderes wäre dem König auch nicht würdig gewesen.
Der sechzehnjährige Eike hatte in seinem ganzen Leben noch nie diesen Ort besucht. Umso verblüffter war er über das Ausmaß der Stadt.
»Das dort ist Lavasteen?«
Das Bollwerk der Stadtmauer verschlug ihm einfach den Atem. Zusammen mit Wolfram hatte er schon so viele Städte bereist, auch größere mit vierzigtausend oder mehr Einwohnern, aber Lavasteen übertraf alles, was er bis dato kannte.
Wolfram sprach durch seinen grauen Schnauzbart. »Das ist unsere schöne Hauptstadt. Das Herz von Calmarck. Heimat der königlichen Familie. Herberge für einhunderttausend Seelen.«
»Einhunderttausend Menschen leben dort?«, klang Eike verblüfft und sein Herz machte einen aufgeregten Hüpfer. Er konnte es kaum erwarten Lavasteen kennenzulernen und den Alltag des königlichen Hofes auf sich zukommen zu lassen. Und außerdem war ein strohgefülltes Bett unter seinem Leib schon lange ersehnt, denn die letzten Tage und Wochen hatten er und sein Herr in einem kleinen Zelt in dicken Schlafsäcken genächtigt. »Werden wir die Stadt heute noch erreichen?«
Der Horizont, an dem graue Wolken gemächlich vorbeizogen, näherte sich schon einem sanften Schwarz. So malerisch die Landschaft auch war, die Nacht schlich sich langsam heran und mit ihr noch niedrigere Temperaturen.
Wolfram lenkte seinen Rappen etwas abseits des Hauptweges und stieg ab. »Es dämmert bereits und die Stadttore sind bestimmt schon verschlossen. Vor morgen früh wird man uns keinen Einlass mehr gewähren. Wir schlagen heute noch einmal ein Lager im Freien auf. Und morgen verspreche ich dir, werden wir in einer Herberge unterkommen, dort vor dem Kamin unsere Socken trocknen und unseren Wanst mit köstlichen Speisen verwöhnen.«
Enttäuschung durchzuckte Eikes Gemüt, seine Hoffnung lag darauf, dass er heute schon in besagter Unterkunft einkehren würde. Aber nur noch einen Tag, diese letzte Nacht würde er wie die unzähligen davor überstehen. Er lenkte seine Stute zu seinem Herrn, stieg ab und lud sein Reisegepäck ab. Darunter waren auch getrocknete Holzscheite, die sein Herr im letzten Dorf gekauft hatte. Es war gerade genug Holz, um für die kommende Nacht ein Feuer zu entzünden, ohne welches man kaum überleben konnte.
Nicht mal die Zeltplane aus Tierhäuten, die mit einem Zauber gegen Kälte belegt war, konnte alleine gegen die Witterung helfen. Laut Wolframs Aussage, schuldete ihm der Hofzauberer des Königs einen Gefallen wodurch dieser ihm dann die Plane ausgehändigt hatte. Das Geheimnis des Zaubers hüteten Wolfram und Eike wie einen Schatz, denn solche Gegenstände waren rar und dementsprechend wertvoll.
Das Feuer spie von Zeit zu Zeit knisternde Funken aus, die in alle Richtungen hopsten, um als schwarze Ascheblättchen im Schnee zu sterben. An einer provisorischen Vorrichtung aus dicken Ästen trockneten einige Wäschestücke der beiden Reisenden, die sich Schlafsäcke über ihre Körper gezogen hatten. Diese waren aus mehreren Schichten gefertigt, darunter Bärenfell und Wolle.
In einem blechernen Topf erwärmten sie Wasser aus einem nicht weit entfernten Bach und an einem Spieß klebten die Reste eines Kaninchens, welches Wolfram mit seinem Hammer erlegt hatte. Genau zwischen die Augen hatte er die scharfe Klinge seines Kriegshammers in die Beute getrieben, der keine Chance zur Flucht geblieben war.
Knappe und Meister sahen sich stumm an, während sie sich an der heißen, geschmacklosen Flüssigkeit wärmten, die ihnen so wohlig die Kehlen runterfloss, als hätten sie die letzten Tage ohne Wasser in einer Wüste verbracht.
Wolfram riss an einem Knochen des Kaninchens rum, als plötzlich ein Knirschen zu hören war. Laut und deutlich war irgendjemand oder irgendetwas im Schnee versunken. Und wer immer dort auch versuchte sich heranzupirschen, er machte keinen Hehl daraus, dass er näherkam. Schritt für Schritt knarzte es. Die Pferde schnaubten nervös und stellten ihre Ohren auf. Ihnen entging nicht der winzigste Laut. Der Ritter gab seinem Knappen ein stummes Zeichen, das Feuer sofort zu löschen.
Eilig schob Eike eine dicke Schneeschicht über die Flammen, die kläglich erstarben. Der schwarze Rauch brannte dem Jungen in den Augen, aber durch die Dunkelheit konnte niemand mehr sehen, wo sein Herr und er sich befanden. Ein Atemzug lang herrschte völlige Ruhe, dann wieder dieses Knacken, das so bedrohlich wie ein wütender Bär schien. Vielleicht tatsächlich nur ein wildes Tier, das von den Resten des gebratenen Kaninchens angelockt worden war, vielleicht aber auch ein Halunke, der sich vom Feuer erhoffte, zu neuen Opfern geführt zu werden.
Wolfram schälte sich aus seinem Schlafsack, dürftig bekleidet musste er jetzt ziemlich frieren, packte seinen Kriegshammer und war auf alles vorbereitet, was da kommen sollte. Sein Körper dampfte in der kalten Nacht.
Eike, dessen Herz bis zum Hals schlug, griff nach seinem Kurzschwert und hoffte insgeheim darauf, dass nicht er der Erste war, der angegriffen wurde. Zu müde und erschöpft fühlte er sich für einen Kampf und die Angst stieg in ihm auf. Seit der letzten Begegnung mit Wegelagerern war schon eine ganze Weile vergangen und der Junge fürchtete, er sei aus der Übung gekommen. Noch war er nur ein Knappe, der sich hinter dem Namen eines großen Ritters versteckte. Seine Augen suchten in der Dunkelheit nach Bewegungen.
Wolfram durchstach die Finsternis mutig mit Worten. »Zeigt Euch! Oder Ich werde Euch alle Knochen im Leib zertrümmern! Das schwöre ich, so wahr ich diesen Kriegshammer zu führen weiß! Ich bin Ritter von Calmarck und treuergebener Silbermantel des Königs!«
Das Gesprochene wurde vom Winter verschluckt.
In Eikes Sichtfeld erschien plötzlich eine Flamme, eine Fackel, die ohne Zweifel menschlichen Ursprungs sein musste. Der Junge wandte sich mit zitternder Stimme an seinen Herrn. »Herr, seht doch! Da drüben ist jemand.«
Nun erblickte auch Wolfram das tanzende Licht und stemmte seinen Kriegshammer vor seinem Körper. Nur ein Ausholen war nötig, um was immer da auch kam, zu zerstören. Kein Schwert, keine Lanze, kein Morgenstern würde sich ihm entgegensetzen können. Ebenso würde auch kein Schild dem Angriff mit seinem Kriegshammer standhalten.
»Haltet ein, Silbermantel!«, schallte eine Antwort durch das Geäst und ein Mann trat aus der Dunkelheit hervor. Dieser hielt eine Fackel in der Hand und hob den anderen Arm hoch, um zu zeigen, dass er keine bösen Absichten hatte. »Mein Name ist Edler Günther Goldenstreich. Ebenso wie Ihr trage ich den Titel des Silbermantels.«
»Ein Silbermantel?«, forschte Wolfram bei dem Unbekannten nach. Im matten Fackelschein war der Umhang des Fremden kaum zu erkennen.
Der Angesprochene leuchtete seinen Mantel an, der tatsächlich einen blauen Schimmer zurückwarf. Ob dieser allerdings auch mit dem silbernen Hirsch bestickt war, konnten Wolfram und Eike nicht sehen, da ihnen der Fremde ins Gesicht blickte. Diese Unstimmigkeit klärte sich allerdings sofort, als ihnen der Mann den Rücken zudrehte.
Die silbernen Fäden leuchteten im Fackelschein. In den Mantel war eine Hirschkuh eingestickt, die von drei Kälbern umgeben war. Daraufhin ließ Wolfram seine Waffe sinken. »Ihr seid nicht nur ein Silbermantel, sondern auch ein Wächter der Königin?«
So war es. Wer die Hirschkuh mit den drei schutzbedürftigen Kälbern auf seinen Mantel mit silbernem Faden gestickt hatte, gehörte zu den persönlichen Beschützern der Königin. Eine besondere Aufgabe, die innerhalb der Silbermäntel nicht mal einer Handvoll zukam, die persönlich von der weiblichen Herrscherin ausgewählt waren, mit der gleichen Ehre wie jeder Silbermantel auch.
Günther hielt die Fackel vor sein Gesicht, sodass alle Anwesenden ihn erkennen konnten. Ein Mann, vielleicht vierzig Jahre alt, dunkelblondes, kurzes Haar, in dem sich einige Eiskristalle verfangen hatten, lächelte freundlich und machte einen sympathischen Eindruck.
»Nun, da Ihr meinen Namen kennt, verratet Ihr mir Euren?«
»Wolfram von Tannewick. Das ist mein Knappe Eike.«
Überrascht weiteten sich die Augen von Günther. Anscheinend war er Eikes Herrn noch nie begegnet. Schnell versuchte er seinen perplexen Gesichtsausdruck zu kaschieren. »Edler Wolfram, Ihr seid eine Legende, ich habe schon so manches von Euch gehört.« Danach fiel sein Blick auf den Kriegshammer, der zwar nicht mehr in Angriffsposition war, aber immer noch in den Händen von Wolfram steckte und somit der Umgebung eine bedrohliche Atmosphäre verlieh. »Ich möchte nicht zu den armen Tölpeln gehören, die mithilfe dieser Waffe den Tod finden.«
Skepsis lag in der Luft. Mochte da auch ein Silbermantel, ein Beschützer der Königin, stehen, es brannte etwas auf Wolframs Zunge. »Ich trage den Titel des Silbermantels nun seit mehr als dreißig Jahren, von einem Edlen Günther Goldenstreich habe ich aber noch nie etwas gehört.«
Eike sah sich das Gespräch zwischen den zwei Männern an. Konnte es sein, dass der vermeintliche Ritter Günther ein Betrüger war? Wenn Wolfram noch nie etwas von ihm gehört hatte, war das nämlich gut möglich.
Die Luft knisterte und Wolframs Augen verengten sich zu Schlitzen. In seinem über sechzigjährigen Leben hatte er schon alles erlebt und daher war er auch auf alles gefasst. Seine Hände krallten sich regelrecht in den Stiel seines Kriegshammers. Falten in seinem Gesicht verwandelten sich zu mit Misstrauen gefüllte Gräben. Weisheit, Lebenserfahrung und Vorsicht mischten mit.
Urplötzlich beugte Günther das Knie. »Edler Wolfram, ich bin erst seit wenigen Jahren im Dienst der Königin. Ihr seid schon länger nicht mehr in Lavasteen gewesen, oder?«
Die Geste des Niederkniens sah Wolfram als Zeichen der Verbrüderung. Seine Muskeln entspannten sich, auch wenn in seinem Kopf noch ein paar Fragen blieben. »Wenn Ihr ein Beschützer der Königin seid, warum seid Ihr dann nicht in Lavasteen?«
Die passende Antwort gab Günther ohne Umschweife. »Ich war im Auftrag von König und Königin unterwegs, sonst hätten wir Lavasteen niemals verlassen.«
Wir? Günther Goldenstreich war nicht allein. Aus der Schwärze der Nacht trottete eine junge Frau heraus, sie führte zwei Pferde hinter sich her.
»Das ist Hildlin«, erklärte Günther und ließ den Schein der Fackel zu Hildlins Gesicht wandern. Eine junge Frau mit schulterlangen blonden Haaren lächelte verhalten und verbeugte sich. Sie sah Günther so ähnlich, sie hätte seine Tochter sein können. »Sie ist mein Knappe. Noch jedenfalls, denn schon bald wird sie in den Stand einer Ritterin ausgerufen.«
»Sie ist ein Knappe? Aber sie ist ein Mädchen!«
Eike hatte das Wort ganz unwillkürlich erhoben. Soldatinnen, Wachfrauen, Bogenschützinnen und so weiter war er schon begegnet. Nur von einem weiblichen Ritter hatte der Junge noch nie etwas gehört. Dabei war es nicht selten, dass sich auch Mädchen zu Wächtern von Calmarck ausbilden ließen. Gerade in Familien mit blauem Blut, aus denen keine männlichen Erben hervorgingen, war es sehr beliebt die Mädchen zu Kämpferinnen auszubilden, damit sie Ländereien und Vermögen in ihrem Besitz halten konnten. Zu oft wurden alleinstehende Erbinnen um den Nachlass gebracht, da sie zu schwach und zu unwissend waren.
Etwas pikiert verzog Hildlin ihren Mund. »Ich bin ein Knappe, ja. Aber ich bin kein Mädchen; sondern eine Frau.«
»Wir haben das Lagerfeuer gesehen und dachten, dass sich hier ein paar Gesetzlose in die Wälder zurückgezogen haben«, erklärte Günther völlig aus dem Zusammenhang gerissen. »Deshalb sollte Hildlin hinter mir bleiben. Wir wussten ja nicht, dass uns ein Silbermantel mit seinem Knappen erwartet.«
Endlich fiel die ganze Spannung von Wolfram ab. Sein Gegenüber hatte so beruhigend und ehrlich gewirkt, dass er nicht mehr anders konnte. Er warf die harte Schale ab, die Schlitzaugen weiteten sich und sein Puls, auch wenn er kaum merkbar erhöht gewesen war, nahm wieder Normalfrequenz an. »Eike, entfache ein neues Feuer. Edler Günther und Hildlin sehen aus als könnten sie etwas Wärme gebrauchen.«
Als das Feuer wieder prasselte, hingen mehr Kleidungsstücke zum Trocknen darum als zuvor. Alle hatten sich in ihre Schlafsäcke verkrochen und um den Feuerplatz versammelt. Dabei knabberten sie an ein paar alten Brotkrusten.
»Jetzt erzählt mal«, stieß Wolfram forsch hervor. »Von wo kommt Ihr und wo führt Euch Euer Weg hin?« Neugier glänzte in den Augen von Eikes Herrn und ließ ihn wie einen vorlauten Bengel wirken.
»Ich hatte gehofft, dass Ihr das fragt«, gab Günther ehrlich zu. Er schlüpfte aus seinem Schlafsack, wanderte zu der Satteltasche seines Pferdes und holte eine Schriftrolle heraus. An der Rolle klebte ein rotes Wachssiegel, welches gebrochen war.
Wolfram war nicht überrascht. Genauso eine Schriftrolle hatte er vor wenigen Wochen von einem Boten aus Lavasteen überreicht bekommen. Nicht von irgendeinem Boten, sondern einem Gesandten des Königs.
Jetzt konnte er sich endgültig sicher sein, dass Günther Goldenstreich wirklich ein Silbermantel war. »Ihr habt also auch die Botschaft des Königs erhalten, dass wir umgehend zur Hauptstadt aufbrechen sollen?«
Nickend stimmte Günther zu. »Wir waren in der Nähe von Raduhn und sind von dort aus aufgebrochen. In der Stadt grassiert eine fürchterliche Epidemie, ein Fieber vor dem sich die Menschen mehr fürchten als vor dem schwarzen Tod. Auf unserer Reise sind wir noch einigen anderen Silbermänteln begegnet. Ausnahmslos alle Edlen mit dem Titel eines Silbermantels wurden nach Lavasteen beordert.«
»Kennt Ihr den Grund für diese Order? Das sieht dem König überhaupt nicht ähnlich. Wir patrouillieren und beschützen abgelegene Dörfer und Städte. Wenn er alle Silbermäntel auf einmal abzieht, ist das ein Risiko. Für Halunken ist das fast schon eine Einladung ihr Unwesen zu treiben. Von einfachen Soldaten und Wachposten lassen die sich nicht abschrecken.«
»Es gab nur diese eine Anweisung: Begebt Euch sofort nach Lavasteen. Den Anlass dazu kenne ich nicht, aber das Siegel des Königs lässt mich nicht an der Dringlichkeit zweifeln. Ohnehin wäre ich nach Lavasteen zurückgekehrt, die Order des Königs war nicht nötig. Schließlich bin ich ein Schützer der Königin.«
Die beiden Ritter schwiegen sich nun an. Sie gehorchten blind, und wussten nicht einmal weshalb es diesen eiligen Befehl gab. Nur eines war beiden klar: Etwas stimmte in der Hauptstadt nicht und sie würden es bald schon erfahren.
Jetzt blieb erst einmal Zeit, dass sie sich untereinander besser kennenlernten.
Eikes anfängliche Verwunderung über Hildlin hatte sich gelegt. Viel interessanter fand er, dass sie und Günther aus der Nähe von Raduhn angereist waren.
Die kleine Insel, zugleich auch Stadt, lag im Südwesten und war durch eine Brücke mit dem Festland verbunden. Das war es jedoch nicht, was Eikes Aufmerksamkeit geweckt hatte. Aktuell drangen nämlich Gerüchte aus dieser Gegend, dass dort drei Silbermäntel tot aufgefunden worden waren. Der Junge befragte Günthers Begleiterin ganz offen. »Stimmt es?«
Hildlin sah ihn mit großen, blauen Augen an. »Stimmt was?«
Eikes Schneidezähne drückten auf seine Unterlippe. In Anwesenheit von zwei Silbermänteln war es nicht besonders höflich über tote Ihresgleichen zu sprechen, doch die Neugier trieb den Jungen weiter. »Es heißt, dass in Raduhn drei Silbermäntel gemeuchelt wurden.«
Kaum vorstellbar, dass so etwas geschehen war, denn solch eine hinterhältige Mordserie war indirekt ein Angriff auf das Königshaus. Die Gerüchte begleiteten Wolfram und Eike schon seit Wochen, über deren Wahrheitsgehalt konnten sie jedoch nur spekulieren.
Die Klärung übernahm Günther. »Es scheint zu stimmen. Diese Neuigkeit haben wir auch schon gehört. Angeblich wurde ein Anschlag auf drei unserer Mitstreiter verübt. In einer einzigen Nacht, drei tote Silbermäntel. Alleine es auszusprechen, lässt das Blut in meinen Adern gefrieren. Hätte es die Order des Königs nicht gegeben, wäre ich in die Stadt gereist, um die Verantwortlichen zu stellen und zu bestrafen.«
»Also ist es wahr«, brummte Wolfram und sein Schnurrbart vergrub sich in einem Becher.
Gemunkel über schwächelnde Silbermäntel gab es immer mal wieder, aber es war eben nichts dran an diesen falschen Äußerungen. Zu hören, dass gleich drei Vertraute des Königs gemeuchelt worden waren, war weder schön noch gut. Und so wie es sich anhörte, hatte jemand ganz gezielt die Silbermäntel in Raduhn ausgeschaltet.
»Es ist nicht mehr zu ändern«, meinte Günther. Gleichgültigkeit lag in seinen Worten. Was geschehen war, war nicht mehr ungeschehen zu machen. Das aktuelle Augenmerk musste auf der Order des Königs liegen.
Nur Wolfram ließ es keine Ruhe mehr. »Ausgerechnet in Raduhn, die Stadt, die die Silbermäntel vor dreißig Jahren befreit haben.«
Wolfram wusste es am besten, denn er war bei der Befreiung selbst dabei gewesen. Gerade als Silbermantel gekürt, war er mitsamt seinen Kameraden und tausenden Soldaten nach Raduhn gesandt worden, um dort die seit Jahrhunderten währenden Missstände zu beheben.
Raduhn war damals ein Paradies – für Sklavenhändler, Sklaventreiber und Sklavenfänger. Fast alle Bewohner dieser Stadt, mit Ausnahme der Nutznießer, wurden unterdrückt und schufteten ohne Lohn. Von allen Ecken der Welt kamen Menschen her, nur um sich einen Sklaven zu kaufen oder sie gegeneinander kämpfen zu lassen – bis zum Tod.
Dies alles war vom jungen König Bordewin und den Herrschaftsgenerationen davor geduldet worden.
Und es wäre heute noch so, wenn nicht ein Sklavenfänger unwissentlich die Schwester des Königs in den Sumpf von Raduhn entführt hätte. Das änderte dann alles. Die Sklaverei wurde verboten und das königliche Heer rückte an, um allen geschundenen Seelen die Freiheit zu schenken und denen, die so lange die Macht in der Hand hatten, den Gar auszumachen.
Um das Verbot der Sklaverei zu besiegeln, heiratete der junge König Bordewin eine ehemalige Sklavin. Die Stände vereint, geführt in eine bessere Zukunft. Ja, die Königin, sie war einst ein Sklavenmädchen. Doch wer es heute wagen würde sie an diese Zeit zu erinnern, dessen Kopf endete in einem Weidenkorb. Das Wissen darüber sollte schweigen.
Wolframs geistiges Auge vibrierte und er kam nicht drum herum seine Gedanken gleich mitzuteilen. »Ich erinnere mich an die Befreiung von Raduhn, als wäre es gestern gewesen. Ich preschte mit meinem Ross durch die Gassen, schwang meinen Kriegshammer und riss damit unermüdlich Schädel von Hälsen. So viele hatten um ihre Leben gebettelt, Gnade schenkte ich keinem von ihnen. Haben sie doch selbst jahrelang Menschen gnadenlos geschunden, um sich selbst zu bereichern.« Ein verächtliches Zischen entfuhr ihm kurz, seine Schnurrbarthaare zuckten. »Nur einen läppischen Tag dauerte die Befreiung von Raduhn. Die Söldner, die angeheuert waren, um die Sklaven in Schach zu halten oder sie an einer Flucht zu hindern, hatten dem Heer des Königs nichts entgegenzusetzen. Bei dieser Schlacht trennte sich die Spreu vom Weizen.«
Plötzlich blickte Wolfram kritisch zu Günther Goldenstreich. »Jetzt weiß ich, warum Ihr mir so bekannt vorkommt. Ihr erinnert mich an einen Jungen, den ich während den Kämpfen in Raduhn sah. Er war ungefähr zehn Jahre alt, in Lumpen gehüllt, Rotz an der Nase, Tränen im Gesicht. Ein Sklavenkind, drangsaliert vom Leben. Inmitten des Chaos. Söldner versuchten Widerstand gegen Silbermäntel und königliche Soldaten zu leisten. Sklaven, die ihre Chance zur Flucht gekommen sahen, liefen planlos an dem Jungen vorbei. Daneben verzweifelte Sklaventreiber, die um ihr wertloses Dasein jammerten.« Die Lider des Ritters schauderten. »Ich könnte schwören, dass Ihr dieser Junge gewesen seid. Diese Augen könnte ich niemals vergessen. Edler Günther, seid Ihr damals nicht einer der Befreiten in Raduhn gewesen?«
Sicherheit lag in Wolframs Stimme, so als würde er genau wissen, dass er keine Antwort von Günther benötigte.
Günther blieb für einen kurzen Moment stumm, dann erhob sich seine Stimme ebenso sicher, wie die von Wolfram. »Da muss ich Euch leider enttäuschen. Ich stamme aus den nördlichen Wäldern und habe die ehemalige Sklavenstadt noch nie zu Gesicht bekommen. Nur durch den Auftrag unserer Kronenträger befand ich mich lediglich in der Nähe. Höchstwahrscheinlich werde ich Lavasteen so schnell nicht mehr verlassen.«
Trotz der ruhigen Antwort glich Wolfram im Inneren das Gesicht des Jungen mit dem markanten Gesicht des Beschützers der Königin ab. Zweifel blieben, immerhin waren dreißig Jahre vergangen. Was wohl aus dem Jungen geworden war? Der alte Silbermantel hoffte, dass aus dem Knaben ein prächtiger Mann geworden war.
»Bei der nächsten Gelegenheit, die sich bietet, werde ich nach Raduhn reisen und mir ansehen, wie sich die Stadt entwickelt hat.« Wolfram schien feste Reisepläne für die Zukunft zu haben.
Niemand antwortete darauf, Edler Günther schien sich ganz und gar nicht für dieses Thema zu interessieren, denn sein Blick war starr auf das Feuer gerichtet.
»Alleine schon wegen den drei gemeuchelten Brüdern würde sich eine Reise nach Raduhn lohnen. Eventuell kann ich dem Täter auf die Schliche kommen. Natürlich erst, wenn die dringliche Order des Königs erledigt ist«, murmelte Wolfram.
Eike war es, der den Sklavenjungen aus den Gedanken seines Herrn wischte. »Oh Herr, könnt Ihr uns nicht erzählen, wie es in Raduhn zugegangen ist? Wie die Sklaverei zerschlagen wurde? Wie es damals war, als Ihr noch jung gewesen seid?«
»Jung gewesen seid?« Ein Seufzer entfuhr Wolfram. Er erzählte nicht gerne von seinen früheren Heldentaten, erinnerte es ihn doch nur daran, dass er seine Jugend schon verlebt hatte. Manchmal wünschte er sich zurück in den Körper eines Dreißigjährigen. Bewundert von den Knaben, angehimmelt von den Mädchen, respektiert von den Männern, geliebt von den Weibern, Stolz von den Alten. Jetzt gehörte er ja fast schon selbst zu den Alten, welche Schutz suchend zu einer jüngeren Generation blickten.
»Es gibt nichts darüber zu erzählen. Blut und Tod, das war es dann auch schon«, blockte Wolfram ab.
»Edler Wolfram«, ging Günther hastig dazwischen und stocherte mit einem Ast im Lagerfeuer herum. »Man sagt, Ihr seid ein begnadeter Hammerschwinger und ebenso leidenschaftlicher Erzähler der alten Mythen. Ich würde zu gerne einer dieser Geschichten aus Eurem Munde höre. Wie wäre es mit der Sage um den Recken von Calmarck?«
Die alten Mythen, Legenden und Sagen. Davon gab es in Calmarck so viele. Fast jedes einzelne Dorf hatte seinen eigenen Helden, der vor hunderten von Jahren die Menschen vor einer Bedrohung gerettet hatte, aber es gab nur einen Kämpfer, den wohl wirklich jeder in diesem Land kannte: Den Ewigen Ritter. Manche nannten ihn wie Günther den Recken von Calmarck, aber er trug auch noch andere Titulierungen. Der Großherzige Galant, der Mutige Schwertkämpfer, der Tapfere Streiter, der Furchtlose Fechter. Meistens jedoch verband man die alte Legende mit der Ewigkeit.
Eike sah etwas verdutzt zu Edlem Günther, denn der Knappe wusste, dass Wolfram wirklich ein guter Erzähler war, er aber aus irgendwelchen Gründen sich mit Geschichten um den Ewigen Ritter zurückhielt.
»Ich würde Euch viel lieber Geschichten, wahre wohlgemerkt, von Menschen berichten, die Heldentaten vollbracht haben«, sagte Wolfram, wobei ein Anflug von Griesgram sein Gesicht streifte.
»Ihr wollt doch nicht behaupten, der Ewige Ritter hätte niemals existiert! Ich kenne nur die Erzählungen der Hofnarren in Lavasteen. Meines Erachtens legen sie viel zu viel Witz in die Geschichte, daher würde es mir eine Ehre sein, wenn Ihr diesen Mythos in ein anderes Licht rücken würdet.«
Wolframs Hand fuhr nachdenklich durch seinen Schnurrbart, er sah so aus, als würde er überlegen, welchen guten Grund er vorbringen konnte, um nichts vom Ewigen Ritter berichten zu müssen.
»Oh Herr«, flehte nun auch noch Eike, »ich habe die Geschichte vom Ewigen Ritter schon lange nicht mehr gehört! Auch ich würde gerne gespannt lauschen.«
»Wie könnte man seinem eigenen Knappen einen Wunsch verwehren?« Günther grinste siegessicher, denn sein Argument war hieb- und stichfest.
»Nun gut«, japste Wolfram.
Auch wenn er die Geschichte nicht zu mögen schien, es war besser als von den Bluttaten in Raduhn zu berichten. Denn nur törichte und prahlerische Nichtskönner brüsteten sich mit Taten, bei denen Menschen, egal ob gerechtfertigt oder nicht, durch ihre Hand gestorben waren.
Und auch wenn damals viele Menschen befreit wurden, Wolfram spürte immer noch das Blut, wie es an seinen Händen klebte und es sich seitdem auch nicht mehr abwaschen ließ.
Die Geburt des Recken
Wolframs Lippen bewegten sich, ganz ohne Wein, ohne Bier oder Schnaps und seine Zuhörer lauschten gebannt. Er nahm sie mit in eine andere Ära, die schon so lange vergangen war. Nicht mal sein Ur-ur-ur-ur-ur-urgroßvater hätte von damals berichten können. Nichts als Staub war übrig geblieben - und die Worte. Die Zunge des alten Silbermantels trug eine Legende von der Vergangenheit in die Gegenwart:
Der junge König Ulbrecht löste die blutverschmierten Platten seiner Rüstung und ließ sie achtlos zu Boden gleiten. Es klirrte im königlichen Thronsaal, aber niemand schenkte dem Geräusch Beachtung. Das Zeugnis der letzten Schlacht wirkte in dem protzigen Raum wie ein abartiges Gebilde. Grauglänzender Marmor am Boden, irgendwo darauf lag das Schwert des Königs, getränkt in Feindesblut - zwischen schillernden Symbolen von Macht und Reichtum völlig fehl am Platz.
Die Stiefel des Monarchen waren gesäumt von Matsch, Blut und Fleischfetzen, der Unrat färbte nun den kostbaren Läufer dunkel ein. Beeindruckende Fresken an der Decke blickten vorwurfsvoll hinab, wie konnte man diesen Ort nur mit Feindesüberresten entweihen? Die Urahnen drehten sich im Grab und ihre Geister wünschten sich ins Diesseits zurück, um diesen Frevel zu beenden. Dem König war es egal, der Kampf war zumindest für dieses Mal gewonnen, und das beutete, er war am Leben. Schließlich war es besser, den Königssaal durch Feindesblut zu entweihen, als wenn Feinde das Blut des Königs hier vergossen. Sein Blut.
König Ulbrecht, Siebzehnter in einer Generationenfolge, Herrscher über Calmarck und einer der wenigen Überlebenden aus der Königsfamilie, hatte das feindliche Heer der Vao-Hünen zurück auf die See getrieben. Dorthin, von wo aus sie gekommen waren. Und von dort aus würden sie sicher bald wieder vorrücken.
Die restlichen Teile seines Plattenharnischs glitten zu Boden und er setzte sich, bekleidet wie er war, in Wams und Leinenhose, auf seinen Thron. Seine Hände waren rau und schmutzig, in seinem Gesicht klebte Schweiß. Er fühlte sich wie ein Landsknecht. Ein solcher hätte niemals die Ehre erlangt diese Räumlichkeiten zu betreten.
Diese verdammten Nordmänner, dachte Ulbrecht verbittert und entsann sich unwillkürlich an die Männer, die in sein Herrschaftsgebiet eingefallen waren. Monströse Kerle, die fast schon nicht mehr menschlich waren, wahrscheinlich pochte Riesenblut in ihren Linien. Zum sechsten Mal waren sie mit Schiffen an der Westküste eingefallen, ein Heer von zweitausend Mann. Begnadete Seeleute, die sich bei Kontakt mit festem Untergrund in rasende Kämpfer verwandelten. Bis an die Zähne bewaffnet, nur ein Ziel vor Augen: Die Eroberung Calmarcks.
Wie viele von Königsvasallen hatte es wohl diesmal erwischt? Beim letzten Mal betrug die Zahl der Angreifer höchstens eintausend, Calmarck kostete es doppelt so viele Leben. Zwar zogen sich die Feinde nach ihren Angriffen immer wieder zurück, Verluste in ihren Reihen waren aber gering. Nach jeder Schlacht war die Zahl derer, die noch das Schwert für Calmarck erheben konnten, drastisch gesunken. Irgendwann würde nichts mehr übrigbleiben, sollte es so weitergehen.
Warum stand ihm in diesem Moment niemand bei? Ulbrechts erste Beraterin hatte gefälligst vor Ort zu sein, wenn er sich im Thronsaal befand.
Er kniff die Augen zusammen, um einen Augenblick der Ruhe erhaschen zu können, die ihm in letzter Zeit nicht oft vergönnt war. So hatte er sich das Königsleben nicht vorgestellt. Wo waren die rauschenden Feste? Die protzigen Empfänge? Die Vermählungen von adligem Gefolge? Die ritterlichen Turniere? Die urkomischen Gauklerveranstaltungen? All die Feierlichkeiten, die sein Vater nur zu gerne gegeben hatte und die ihm vom Prinzsein in Erinnerung geblieben waren.
Seit fast einem Jahr war davon nichts mehr übrig. Seit dem Tag, als die Vao-Hünen das erste Mal in Calmarck eingfallen waren. Ihre Schwerter waren aus besserem Stahl, ihre Rüstungen leichter und beweglicher, die Krieger kampferprobter und furchtloser. Ein Volk von hemmungslosen Eroberern, die selbst im Angesicht des Todes nicht zurückschraken. Ihr einziger Schwachpunkt war, dass sie immer in Unterzahl gekommen waren, sonst hätte der König schon längst eine weiße Flagge hissen müssen.
Eine große, burschikose Frau hatte den Thronsaal betreten. Jung war sie auf den ersten Blick, die Akademie des Königs konnte sie höchstens vor ein oder zwei Jahren abgeschlossen haben. Keinesfalls war sie älter als vierundzwanzig. Sie trug ein einfaches Gewand, unter ihren Arm hatte sie ein dickes Buch geklemmt. Der Einband war aus altem, brüchigem Leder.
Auf ihrer Nase thronten Lesegläser, welche ihre Augen um ein Vielfaches vergrößerten. »Hoheit!«
Ulbrecht sah auf. Es wurde aber auch Zeit, dass Azra erschien. »Wo bist du gewesen?« Die Wut in seiner Stimme hatte nicht Azras späte Ankunft heraufbeschworen, sondern die kürzlich geschlagene Schlacht. Eine Niederlage legte sich immer mit bitterem Geschmack auf seine Zunge.
Ein strenger Blick legte sich auf das Gesicht der Frau und ließ sie gealtert wirken. »Hoheit, Ihr habt mich doch selbst damit beauftragt die Verluste in Erfahrung zu bringen. Ich war bei den Hauptmännern Eurer Truppen. Zumindest bei denen, die noch leben und ließ mir von ihnen berichten.«
Er unterbrach sie mit einer Handbewegung und stand aus seinem Thron auf. »Wie viele?«
Azra schlug das Buch auf. Ein Teil des brüchigen Einbandes bröckelte, so wie es die Seele des Königs immer tat, wenn ein neuer Angriff der Vao-Hünen drohte oder wie in diesem Fall gerade überstanden war. »Die erste und zweite Division Eurer Soldaten wurden komplett vernichtet, zwei der sechzehn Bogenschützenkompanien ebenfalls. Mehrere Einheiten von Speer- und Lanzenträger, ich kann die genaue Zahl noch nicht sagen, sind im Kampf gefallen.«
Der König fuhr wütend herum. »Zwei ganze Divisionen! Das allein sind …«
»Zweitausend Mann«, fuhr Azra fort. Für die Zahl, die sie ausgesprochen hatte, musste sie aufgebrachte Blicke des Königs über sich ergehen lassen. Aus der Ruhe bringen ließ sie sich dadurch allerdings nicht. Immerhin war sie nicht verantwortlich für die Toten. »Ich konnte noch nicht die gesamte Anzahl der Dahingeschiedenen erfassen, aber insgesamt beträgt meine Schätzung etwa drei- bis viertausend Mann. Hinzu kommen noch die Verwundeten, über welche ich keinerlei Informationen habe. Auch über den Verbleib von einigen Hauptmännern kann ich noch nichts Genaues sagen.«
Das zornige Gemüt des Königs legte sich wieder. Nicht weil er mehr Tote erwartet hatte, sondern weil genau das Gegenteil der Fall war. Drei- bis viertausend Tote – es überstieg fast sein Denkvermögen. Wenn er es kurzerhand im Kopf überschlug, musste er in allen Schlachten mit den Vao-Hünen um die vierzehntausend Mann verloren haben. Sein Heer hatte deutlich an Größe eingebüßt und an die Invaliden und Verwundeten wollte er gar nicht denken. Viele von diesen Lädierten würden noch in den kommenden Tagen sterben und von den Überlebenden würden sich auch nicht mehr alle erholen. Schlachten forderten nun mal Opfer. Diese Erkenntnis stach wie ein vergifteter Dolch in das Herz des Königs.
Den nächsten Angriff der Vao-Hünen würde niemand mehr in Calmarck überstehen. Sie kamen immer zurück und immer wurden sie stärker und zahlreicher, wie Tiere, die aus jedem noch so kleinen Fehler lernten. Weder der König, noch Azra, noch die Soldaten, hatten jemals einen vergleichbaren Feind erlebt. Manchmal hatten sich größenwahnsinnige Fürsten verbündet und dem König abgeschworen, ihre Herrschaft konnten sie aber nie lange für sich beanspruchen. Und die Vao-Hünen waren nicht nur auf einzelne Ländereien oder Regionen aus, sondern auf das ganze Land.
Erschöpft ließ der König sich zurück in seinen Thron fallen. Vierzehntausend. Seine Schläfe pochte. Vierzehntausend. Sein Adamsapfel zuckte. Vierzehntausend!
»Wir huldigen den Göttern täglich, bitten sie um Vergebung unserer Sünden, knien bis unsere Nasenspitzen den Boden küssen«, knurrte er und dabei strich er sich nachdenklich über seine Bartstoppeln am Kinn. »Und sie schicken immer mehr Vao-Hünen zu uns. Als wäre das nicht schon genug, rauben die Götter auch noch die Seelen unserer Kämpfer! Dabei war unser Anflehen so innig und hörig. Haben wir jemals an unseren Gottheiten gezweifelt? Sodass sie uns einen Grund geben, dass wir zweifeln müssen?«
Azra sah den König hilflos an. Auch sie sandte täglich Gebete zu den Göttern hinauf, damit diese schrecklichen Angriffe aufhörten.
Ulbrecht krallte seine Fingernägel in die Armlehnen des Thrones. Er schälte die oberen Farbschichten ab, so wie er es immer tat, wenn er unzufrieden war. Genauso hatte es sein Vater getan. »Ab sofort verzichten wir auf den Beistand der Götter! Ich habe lange genug gewartet und ertragen. Sie sind uns nicht gnädig und haben unsere Hörigkeit nicht verdient. Bringt Kuno zu mir!«
Azra waren alle Gesichtszüge entglitten. Der Hofzauberer, der in den Diensten des Königs Zauber- und Heiltränke bereitete, galt als Hexer und fristete daher sein Dasein in den Katakomben der königlichen Burg, wo kein Strahl Sonnenlicht hinfiel. Von den Göttern wurde es gar nicht gerne gesehen, wenn jemand wie dieser Kuno aus dem Dunklen ins Licht der Welt treten durfte.
Lud man den Hexer in den Thronsaal, kam diese Tat einem Bund mit dem Teufel gleich. Dieser Zauberer wurde geduldet, solange er nicht öffentlich am Hofe wirkte und seine Arbeit im Verborgenen verrichtete. Die Geheimnisse und Ursprünge seiner Taten, so wirksam und verblüffend sie auch waren, waren Teufelsmagie.
»Hoheit, das wird den Göttern nicht gefallen«, versuchte Azra den König von seinem Vorhaben abzubringen. »Sie werden denken, dass wir uns von ihnen abgewandt haben. Zorn und Missgunst wären nur eine milde Strafe, die wir dafür zu erwarten hätten.«
»Was den Göttern gefällt oder nicht, interessiert mich nicht!«, fauchte der König wie ein zerstörungswütiger Ochse. Zu lange hatte er mitansehen müssen, wie der Feind eine blutige Schneise in Calmarck schlug und die Götter duldeten es. Nein, sie hatten auf die Machenschaften der Vao-Hünen keine Reaktion gezeigt.
Kuno war ein rundbäuchiger, alter Mann, dessen Hakennase krumm wie das Blatt einer Sense war. Sein ausgeprägter Buckel ließ ihn nur noch gebückt gehen. Er war in eine fleckige Kutte gehüllt, die aussah als wäre sie noch nie gewaschen worden. Die Gestalt verneigte sich, dabei krachte der knöcherne Rücken vor dem König, der sich inzwischen wieder in ein Gewand gekleidet hatte und stolz die Krone auf dem Kopf trug.
»Hoheit, Ihr habt mich rufen lassen?«, ertönte die Stimme des Zauberers wie ein krächzender Rabe in der Dämmerung. Der Mann erhob sich nicht aus seiner Verneigung, die überdimensionale Hakennase zeigte auf den Boden.
»Zaubermeister Kuno!«, sagte der König. »Schon zu Lebzeiten meines Großvaters habt Ihr mit Euren Kräften Krankheiten geheilt und Zauber zur Erheiterung des Prinzen vollführt. Ich weiß um die Mächte, die Ihr hervorrufen könnt. Sie können das Unvorstellbare bewirken.«
Der Kuttenträger schien sichtlich überfordert damit, als der König eine Geste machte, um ihn aus der Verbeugung zu bitten. Trotzdem folgte er dem Verlangen des Königs anstandslos. Wieder krachte der Rücken, fast schon so als würden die Knochen innerhalb des Körpers durch zwei Mühlsteine gejagt werden. »Hoheit, ich weiß, dass Euer Land schwächelt.« Eine kurze Pause folgte. »Schon sehr lange. Seit dem ersten Angriff der Vao-Hünen wusste ich, dass Ihr eines Tages auf mich zukommen würdet.«
»Bei all dem Wissen, habt Ihr Euch dann schon eine Lösung ausgedacht?«, fragte Ulbrecht und seine Augenbrauen zogen einen düsteren Bogen.
»Es gibt Mächte, die von den Göttern gesandt wurden. Und es gibt Mächte, die von Magie erzeugt wurden. Wenn sich diese vereinen, könnte ich einen Krieger erschaffen, unsterblich, unbesiegbar.«
Der König wurde ungeduldig. »Könnt Ihr es oder könnt Ihr es nicht?«
Über der Hakennase lugten zwei Knopfaugen hervor in denen kühne Blitze zuckten. »Ihr dürft Euch nicht von den Göttern abwenden! Denn sonst ist meine Magie wertlos! Ihr müsst knien und beten. Sie anrufen und anflehen. Betteln und bitten. Ihre Gunst muss Euch gehören.«
»Sprecht Klartext!«
»Die Götter blicken mit Unmut auf Menschen wie mich herab. Trotzdem haben sie mir das Wissen und die Macht gegeben Großartiges zu vollbringen. Wenn wir ihnen den Rücken zuwenden, wird auch meine Macht schwinden. Deshalb brauche ich Eure Gebete und das Leben eines mutigen Freiwilligen.«
»Ihr wollt einen unsterblichen Königstreuen erschaffen? Dann nehmt mich. Ich werde dieses Land auf ewig führen und von den fremdländischen Unterdrückern befreien!« Die Brust Ulbrechts war stolz vorgestreckt und die Schultern bewegten sich nach oben.
»Hoheit, bei allem Respekt«, die Kutte schluckte, sprach dann aber weiter, »die Götter würden es niemals zulassen, dass ein König solche Macht erhält. Es sollte ein Mann aus Euren Reihen sein. Treu und ergeben. Ein Schwertschwinger, der bereit wäre, sein Leben für jedes andere Leben zu geben. Egal ob das Leben einer Magd, eines Bauern oder Knechts. Selbstlos und mutig. Jemand der keinen Wert auf das Tragen einer Krone legt.«
Ein Atemzug verging und die Brust des Königs wirkte wieder verletzlich, die Schultern sanken nach unten. »Ich verstehe. Mir trauen die Götter diese Macht nicht zu. Dann werde ich ihnen auch nicht mehr meinen Glauben schenken. Oder gar meine Gebete.«
Fast vier Monate waren vergangen. Ulbrecht hatte sich geweigert vor den Göttern, die ihn und sein Reich so lange missachtet hatten, zu knien. Wenn sie ihn nicht für würdig hielten, warum sollte er sich dann ihnen wieder zuwenden?
Die Vao-Hünen waren wie erwartet zurückgekehrt. Mit dreieinhalbtausend Mann. Dutzende Langschiffe liefen nicht nur an der Westküste auf, sondern auch an der Nordküste. Wie ein Wirbelsturm waren die Feinde über den Kontinent gefegt und hatten Höfe, Dörfer und Städte vernichtet. Zurück ließen sie nur eine Schneise der Zerstörung. Selbst die, die überlebt hatten, waren innerlich zerbrochen. Und nun klopften die Feinde an des Königs Tür. Seine eigene Burg drohte zu fallen. Das Herz von Calmarck.
Völlig unter seinem Plattenpanzer versteckt saß König Ulbrecht im Thronsaal. Das Eingangstor zu diesem war mit mächtigen Balken verschanzt worden, aufgeregte Soldaten beäugten die letzte Instanz vor dem Feind kritisch. Vor dem hölzernen Bollwerk tobte der Kampf. Schreie und Waffengeklirr. Der Boden vibrierte heiß wie glühende Lava und der König tat nichts weiter, als auf seinem Thron zu sitzen und zu warten. Ein Warten auf den Tod.
»Seht Ihr, warum ich die Götter nicht mehr anbete?«, sagte der König und sein Blick lag starr auf dem Holztor.
Neben dem Thron stand der Zauberer. Die Kutte, die er noch immer trug, war dreckiger als jemals zuvor. Blutflecken, schon schwarz, hatten sich in den Stoff gesaugt. »Hoheit, betet endlich zu den Göttern. Sie werden Euch verzeihen. Dann kann ich Euch helfen. Meine Magie könnte grenzenlos sein.«
Zu den Göttern beten! Ulbrecht stieß ein verachtendes Lächeln aus und rief einen der Soldaten zu sich, der das Tor bewachte. Der Soldat kuschte sofort und machte eine Treue beschwörende Geste vor dem König.
»Du«, begann Ulbrecht, seine Augen müde und schwer, »wenn du die Macht hättest, würdest du dieses Land retten?«
Unwissend sah der Soldat zu seinem Herrscher auf. »Natürlich!«
»Würdest du dein Leben für das eines Knechtes hergeben?«
Etwas unbeholfen sah der Soldat zum König auf. »Wenn es Euer Befehl ist, natürlich!«
Der König blickte zu Kuno. »Tut es. Er soll der Held sein, der uns beschützt.«
»Hoheit«, warf der Zauberer ein. »Es wird nicht funktionieren, bevor Ihr nicht wieder an die Götter glaubt. Er wird sterben. So wie alle Freiwilligen vor ihm auch. Warum zeigt Ihr nicht endlich Einsicht? Es wäre ein Kompromiss von geringem Preis. Lediglich Euer Stolz wäre zu zahlen.«
Sterben? Der Soldat trat einen großen Schritt zurück und wusste nicht, was jetzt passieren würde. Worüber redeten der König und der Hexer überhaupt? Und was hatte das Ganze mit ihm zu tun?
»Tut es einfach!«, forderte Ulbrecht.
Kuno gehorchte. Seine Zunge sprach unbekannte Worte einer uralten Sprache aus, die fast schon vergessen war, seine Augen flackerten grün. Er schwang seinen Zeigefinger wie ein Schwert und richtete ihn auf den Soldaten. Gleißendes Licht durchzuckte den Raum, blendete alle, die sich darin befanden. Ein Knall ertönte und alles war vorbei. Das Licht verschwand und dort wo eben noch der Soldat gestanden hatte, blieb nur eine Blutlache übrig. Die rote Körperflüssigkeit war in alle Richtungen explodiert und die Kutte des Meisters labte sich an dem neuen Opfer. Der Geruch von Eisen lag in der Luft.
»Wie ich es gesagt habe«, klang Kuno emotionslos, da er mit keinem anderen Ergebnis gerechnet hatte. »Die Götter werden es nicht zulassen, solange Euch der Glaube fehlt. Warum sollten sie einem Ungläubigen dienen?«
Gerade wollte der König wieder aufbegehren, da erschien in seinem Rücken ein Ritter, gefolgt von Azra. Sie waren durch einen Geheimgang in den Thronsaal gelangt. Andernfalls hätten sie diesen Ort nicht lebend erreichen können.
»Hoheit!«
Der Titel ging dem König runter wie Öl, schmeichelte ihn wie Honig.
»Die Vao-Hünen haben die Überhand erlangt. Lavasteen wird fallen«, hatte der Ritter gesprochen. Ein Bild von einem Mann in einem Kettenhemd. Darüber trug er einen schlichten Waffenrock, der verriet auf wessen Seite er kämpfte. Groß und kräftig war er, nach so einem Körper strebten die meisten Jungen auf ihrem Weg zum Mannsein. Wallendes, langes, schwarzes Haar lugte unter seinem Topfhelm hervor. Das Visier war geöffnet und ein kantiges Gesicht, zeugte von bestandenen Kämpfen.
Der Kopf des Königs sank zu Boden. Nach den gesprochenen Worten des Ritters realisierte er endlich die Lage. Wenn er weiterhin so stur blieb, würde das Unausweichliche eintreffen. Ein lauter Schlag gegen das Tor zum Thronsaal beschleunigte seinen Entschluss. Er verkaufte seinen Stolz – aber nur an die Götter.
»Werter Meister Kuno«, den Ritter und Azra schien der König zu ignorieren. »Ich glaube an die Götter, die Allmächtigen im Himmel. Ich flehe sie an uns zu retten und uns die Kraft zu senden, diesen Tag unbeschadet zu überstehen. Ich bitte und bettle. Ich glaube und bete. Ich unterwerfe mich ihrem Willen.« Ulbrecht sank sogar auf die Knie, faltete seine Hände und pries die Götter an. Wie groß und mächtig sie seien und dass er an ihrer Herrlichkeit nie wieder zweifeln wolle.
Die Lippen von Kuno formten sich zu einem Lächeln. Der König hatte tatsächlich seinen Glauben wiedergefunden, wenn auch nur in der letzten verzweifelten Stunde. Nun konnte der Zauberer endlich jemanden die Macht geben Lavasteen und ganz Calmarck zu beschützen.
Eine fremde Sprache erfüllte den Raum. Grüne Augen leuchteten, der mächtige Zeigefinger, der auf den eben eingetroffenen Ritter zeigte. Es wurde hell. Ohrenbetäubender Lärm. Dieses Mal ging allerdings Kuno zu Boden, die vielen Zauber, die er ausgesprochen hatte, forderten ihren Tribut.
Aber der Ritter lebte und sah ihn an.
Hatte es funktioniert? Wo war der mächtigste aller Krieger? Die Augen des Königs weiteten sich. Nein, das durfte nicht sein! Dieser blöde Kuttenträger hatte den Ritter verfehlt und Azra getroffen.
Ihr Gesicht schien frischer und ihr Blick entschlossener. Reife und Erfahrung ging nun von der jungen Frau aus, die eben noch so unschuldig wie die ewige Jungfrau ausgesehen hatte. Sie nahm die Lesegläser ab und zuckte mit den Lidern. Sie brauchte die Sehhilfe nicht mehr.
Ulbrecht packte die Kutte am Kragen und zog ihn hoch, sodass sie sich Aug in Aug gegenüberstanden. Ohne das Gezerre des Königs wäre der Alte wohl zusammengesackt, so schwach war er.
»Ich will kein Weib als Beschützer! Ich brauche einen Krieger!«
Stöhnend befreite sich Kuno aus dem Griff des Königs. »Ich habe dieser Frau ewiges Leben geschenkt. Sie sollte mit der Zeit in ihre Aufgabe hineinwachsen können.«
»Ich weiß ja nicht mal wie man kämpft«, stotterte Azra, die ihre Veränderung bemerkt hatte. Ihr Geist war jedoch genau der von zuvor. Sie war nichts weiter als eine Beraterin, die noch nie ein Schwert in der Hand gehalten hatte. Wie sollte sie diesen Krieg beenden? Oder gar den König beschützen? Verängstigt ließ sie sich in eine Ecke des Thronsaals gleiten.
Jetzt spuckte Kuno Blut, die Verwandlung hatte an seinen körperlichen Fähigkeiten genagt. Rot und furchteinflößend lief ihm der Lebenssaft über das Kinn. Zum ersten Mal war es sein eigenes Blut, welches seine Kutte tränkte.
Gleichzeitig brachen die Balken des Tores unter einem gewaltigen Knall. Splitter schwebten durch den Raum und grimmige, bärtige Krieger stürmten in Massen herein. Grobschlächtige Männer, mit verwachsenen Gesichtern, die nichts fürchteten. Breite Schwerter führten sie wie mancher Schriftsteller die Feder über ein Blatt Papier. Die Soldaten am Eingang waren innerhalb eines Wimpernschlags tot. Niemand konnte die Feinde mehr zurückhalten. Sobald Ulbrecht tot wäre, würden sie ihren Anspruch auf Calmarck erheben.
»Zauberer«, glänzten die Augen des Königs hoffnungsvoll und auch panisch. »Ich glaube nicht nur an die Götter, ich glaube auch an Euch! Gebt diesem Ritter die Macht, die er braucht.«
Kuno krabbelte bereits auf allen Vieren, spuckte und röchelte wie ein sterbendes Tier. »Ich werde kaum noch Kraft haben ihm ewiges Leben zu schenken. Aber durch Blut sollten die magischen Kräfte von Generation zu Generation weitergegeben werden können. Somit sollte Calmarck auf alle Ewigkeit geschützt sein.«
Kuno würde sowieso sterben, also konnte er noch einen Versuch starten. Die verzauberten Worte waren mehr gestöhnt als gesprochen, seine Augen glühten nur schwach auf. Aber der Zeigefinger war zielgerichtet und zeigte auf den Ritter.
Die wütende Meute der Feinde hatte den König fast schon erreicht, als sie von dem Licht geblendet wurden und sich zurückhielten. Als das gleißende Licht abebbte, war Kuno tot, sein Körper starr wie ein Eisblock. Sogar das Blut tropfte nicht mehr aus seinem Mund, der Lebenskreis in seinen Adern war beendet.
Der Tod des einen, bedeutete die Geburt des anderen. Zu diesem Zeitpunkt erblickte der Ewige Ritter das Licht der Welt. Sein Kettenhemd schimmerte unter dem Waffenrock magisch auf und er war von einem hellen Schein umgeben. Es hatte funktioniert, der Zauberer und die Götter hatten König Ulbrecht endlich erhört. Die Götter hatten ihre Macht geteilt.
Der Galante schwang sein Schwert und mit nur einem Streich glitt es durch Feinde wie durch Papier. Niemand konnte dieser göttlichen Macht etwas entgegensetzen. Der Thronsaal flimmerte rot und das Blut der Feinde wanderte zwischen den Fugen des Marmorbodens. Einer nach dem anderen der schrecklichen Hünen glitt mit weit aufgerissenen Augen zur Erde. Ihre seelenlosen Gesichter waren der Balsam für des Königs Seele.
»Geh hinaus, Recke von Calmarck«, verlieh Ulbrecht seinem stärksten aller Kämpfer einen Titel. »Töte jeden, der es gewagt hat Verzweiflung und Hass über unser schönes Land zu senden. Mögen ihre lebenden Körper nicht mehr unsere Welt vergiften. Schicke sie dahin zurück, woher sie gekommen sind. Wer nicht flieht, soll keine Gnade oder Mitleid erfahren.«
Der Mann mit dem schimmernden Kettenhemd rammte seine Schwertspitze in den Boden, sodass der Marmor zerbarst und kniete davor nieder. »Für das Reich! Für den König!«
Und in nur wenigen Tagen wurden tausende Vao-Hünen verjagt, die Calmarck niemals hätten betreten dürfen. Seitdem kamen keine Schiffe mehr mit kampfeslustigen Hünen und sollten jemals wieder welche an unsere Küsten einlaufen, würden sie es bitter bereuen. Bis in alle Ewigkeit hatte Calmarck seinen Beschützer gefunden.
Zum Weltenhenker
»Der alten Legende nach tritt der Ewige Ritter überall dort in Erscheinung, wo er gebraucht wird. Klingt das nicht verrückt? Ich meine, wenn es den Ewigen Ritter jemals gegeben hat oder er immer noch existiert, dann würden wir doch etwas von ihm hören. Meiner Meinung nach ist er nur eine der unzähligen Figuren, um Abende wie diesen mit Leben zu füllen«, schloss Wolfram mit seiner Geschichte ab. »Diesen Mann, der überall für Gerechtigkeit sorgt, wo sie benötigt wird, gibt es nicht.«
Die Erzählung war so lebendig gewesen, dass sich die Zuhörer noch immer im Thronsaal stehen sahen, umringt von bärtigen Feinden, die die Größe eines Bären hatten. Überwältigt von der Kraft des Helden, der die Welt mehr als nur einmal rettete. Das Lagerfeuer züngelte nur noch schwach, die beiden Knappen waren bereits eingeschlafen.
»Eine Legende ist eben nun mal nur eine Geschichte aus aneinander gereihten Worten«, bemerkte Wolfram und beobachtete die Funken, die aus der Glut aufstiegen.
»Und jede Legende ist die Heimat von einem Funken Wahrheit«, entgegnete Günther.
»Bestimmt nicht«, murrte Wolfram und zog sich zurück in das Zelt.
Am nächsten Morgen war Eike als erstes wach. Er hatte sich bereits angezogen, das Feuer neu aufleben lassen und mit Holz gefüttert. Danach führte er die Pferde, auch die von Hildlin und Günther, an einen schmalen Wasserlauf. An den Rändern des Wassers hatten sich kleine Vereisungen gebildet, aber die Fließgeschwindigkeit hatte verhindert, dass der kleine Bach zufror.
Die Geschichte vom gestrigen Abend ließ den Jungen gar nicht mehr los. Was würde er tun, wenn er mit einem Schlag alle Feinde auslöschen könnte? Er tadelte sich selbst. Der Ewige Ritter, auch wenn ihn jedes Kind in Calmarck kannte, war nur ein Mythos. Erfunden, um den Hoffnungslosen Zuversicht zu schenken, den tapferen Soldaten einen Ansporn zu geben, niemals die gerechte Sache aus den Augen zu verlieren und um unerfahrene Jungspunde in das königliche Heer zu leiten.
Glücklicherweise gehörte Eike nicht zu den Hoffnungslosen oder in Verzweiflung getriebenen Menschen. Nein, er konnte sich nicht beschweren. Sein Dasein als Knappe bei Wolfram genoss er regelrecht, auch wenn er ungeduldig dem Rittersein entgegenfieberte.
»Dein Herr ist wirklich gewandt mit Worten«, meinte Hildlin, die mit einer Ich-bin-gerade-aufgestanden-Frisur an den kleinen Wasserlauf gekommen war. Sie füllte einen Trinkschlauch und trank gierig daraus. Im Anschluss widmete sie sich der groben Körperpflege. »Du glaubst gar nicht wie langweilig es mit Edlem Günther ist. Er ist meistens sehr schweigsam und verlässt nur selten die Burg in Lavasteen. Und wenn er auf interessante Reisen geht, trennen sich die Wege meines Herrn und mir. Dann lässt er mich bei begnadeten Lehrern ausbilden, bis er wieder zurückkehrt.«
»Die Reise in Richtung Raduhn war doch bestimmt spannend«, erwiderte Eike.
Hildlin rollte mit den Augen. »Wenn ich nur in die Nähe der Stadt gekommen wäre. Während Edler Günther seine Reise fortsetzte, wurde ich fernab der Stadt im Fechten unterrichtet.«
»Oh, das passiert dir wohl öfter.«
Die Frau nickte und sah ihrem eigenen Spiegelbild im Wasserlauf enttäuscht entgegen.
»Wann wirst du deinen Ritterschlag erhalten?«, fragte Eike, um das Gespräch am Leben zu halten. »Ich habe noch etwas mehr als vier Jahre bis zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag vor mir.«
Hildlin kicherte zufrieden, jetzt sah auch ihr Spiegelbild erheitert aus. »Solange noch? Ich muss nur noch ein paar Monate als Knappe durchhalten.«
Staunend klappte Eike seinen Kiefer runter. Hildlin war schon zwanzig Jahre alt? Dass sie älter als er war, war schnell zu erahnen, hatte sie doch schon so einen weiblichen Körper, dass nur Narren sie für ein Mädchen hielten. Aber zwanzig? Vielleicht siebzehn oder achtzehn. Sie sah keinen Tag älter aus.
Sie bemerkte seine Verwunderung. »Na, Knirps. Du hast wohl gedacht, dass wir auf einer Ebene stehen. Da hast du dich aber verrechnet.« Grinsend tauchte sie ihre Hand in die geöffnete Eisschicht und bespritzte Eike mit Wasser. So erwachsen wie sie tat, war sie dann doch nicht.
»Hildlin!«, polterte Günthers Stimme. »Sattle die Pferde. Wir wollen Lavasteen spätestens zur Mittagsstunde erreichen.«
Pah! Auch als Zwanzigjährige war Hildlin immer noch ein Knappe, welcher Befehle entgegennehmen musste, genau wie Eike. Ihm wurde warm ums Herz und ein bisschen schadenfroh war er auch. Dabei konnte er Hildlin recht gut leiden.
Die Sonne hatte sich gerade unter einer Wolkendecke versteckt, als die kleine Gruppe die Tore der Stadtmauer von Lavasteen erreichte. Schon seit gut hundertfünfzig Metern waren sie durch ein Spalier aus Wachsoldaten geritten, die unbeweglich in Reih und Glied standen. Stramme Burschen zur ihrer Rechten und zu ihrer Linken, die nicht mal mit den Lidern zuckten. An ihren rechten Flanken hielten die Bewegungslosen Hellebarden, die mit ihren spitzen Enden nach oben ragten. Die Hiebwaffen waren blank poliert, sodass man sich darin spiegeln konnte. Unter den beigen Waffenröcken der Soldaten lugten Kettenhemden hervor, die an den Köpfen zu Kettenhauben ausliefen, welche wiederum von silbrigen Spangenhelmen besetzt waren. In den Arm- und Beinschienen, die aus poliertem Stahl bestanden, war kunstvoll der Hirsch des Königs eingraviert. Nur Narren hätten versucht sich mit den gut ausgebildeten Königstreuen anzulegen.
Vor dem Stadttor, welches durch ein Fallgitter verschlossen war, löste sich diese geregelte Kette auf und die Soldaten beschäftigten sich mit der Kontrolle von Reisenden, Reitern, Karren und dubiosen Gestalten, die nach Einlass in die Stadt begehrten. Die Hellebarden waren dabei jederzeit einsatzbereit, um zu verhindern, dass Gesindel durch den Eingang ins Zentrum der königlichen Macht gelangte.
»Lasst ihn durch«, sagte ein Hauptmann, auf dessen Spangenhelm eine blaue Feder prangte.
Er hatte gerade einem Bauern mit Eselskarren Einlass gewährt. Zu beiden Seiten des Tores bildete sich eine Traube Soldaten, die zwei gigantische Räder bedienten. Das Fallgitter fuhr nach oben, sodass der Eselskarren passieren konnte. Kaum war das Gespann in der Stadt verschwunden, wurde das Gitter wieder gesenkt. Hier konnte sich niemand ungesehen durchschleichen, ohne eventuell zerquetscht zu werden.
Plötzlich herrschte Tumult in der Schlange der Einlassbegehrenden. Unter irgendeinem Wagen kam ein Mann hervorgekrochen. Ihm fehlte ein Auge und seine lumpige Erscheinung ließ die Wachsoldaten stutzig werden. Alleine schon die Tatsache, dass er sich unter einem Wagen versteckt hielt, machte ihn verdächtig. Seinesgleichen war in Lavasteen nicht willkommen.
Sogleich packten ihn zwei Wachleute, hievten ihn hoch und ein Dritter richtete seine Hellebarde in den Rücken des Verdächtigen. Der Hauptmann gab konkrete Befehle: »Bringt ihn gleich in eine gemütliche Zelle. Sein Gesicht ziert schon seit Wochen einige Steckbriefe in der Stadt. Dass er mit einigen Dirnen gesichtet wurde und sie nicht bezahlt hat, ist noch das mindeste Vergehen, was er begangen hat. Für den Griff in den Opferstock des Klerus wird er teuer bezahlen!«
Das Gitter wurde hochgekurbelt, insgesamt sechs Soldaten geleiteten den Gefangenen in die Stadt, wobei letzterer nicht mehr viel von dieser sehen würde. Höchstens noch den Weg bis zu seiner zukünftigen Unterkunft, einer feuchten Zelle, irgendwo unter den pulsierenden Adern von Lavasteen. Schon wurde das Gitter wieder herabgelassen und Normalität kehrte zurück.
Der Platz von den sechs fehlenden Soldaten wurde sogleich von Mitstreitern aus dem strengen Spalier übernommen. Alles funktionierte wie das Zahnrad einer Turmuhr, völlig reibungslos und ineinandergreifend.
Wolfram, Günther und ihre Knappen hatten weniger Probleme ins Innere der Stadt zu gelangen. Schon ihre Mäntel hätten für den Einlass genügt, zusätzlich zeigten sie dem Hauptmann die Briefe des Königs.
Nachdem das Gitter hinter Eike und dem Rest gesenkt wurde, sah der Knappe sich um. Das war die berühmte und hochgelobte Hauptstadt? Die nur so vor Reichtum und Macht strotzen sollte?