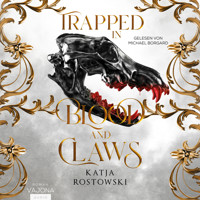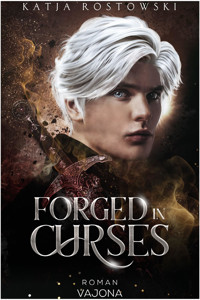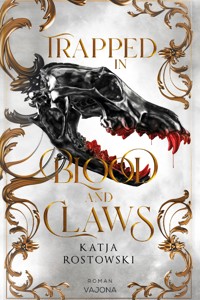6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vajona Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich hatte für uns gekämpft – und verloren. Dunkelheit. Das ist, was in Elliots Kopf herrscht, als er im Krankenhaus aufwacht. Weder weiß er, wer er ist, noch, was ihn dazu getrieben hat, von einer Brücke zu springen. Der einzige Halt in dieser für ihn fremden Welt ist Flora, die in jener Nacht Zeugin seiner Hoffnungslosigkeit geworden ist. Die junge Frau nimmt Elliot bei sich auf, obwohl sie weiß, dass er in der Lage ist, hinter ihre Fassade zu blicken und jemanden an die Oberfläche zu holen, der niemals wieder die Kontrolle über sie haben darf. Während sie gemeinsam versuchen, herauszufinden, wer das Mädchen in Elliots Erinnerungen ist und was es mit der Trauer in seinem Herzen auf sich hat, ahnt Elliot, dass die Wahrheit zu schmerzhaft ist, um sie erneut zu ertragen. Als plötzlich sein Bruder auftaucht, droht nicht nur seine Welt in Flammen aufzugehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katja Rostowski
Der Regen von gestern
Der Regen von gestern
© 2024 VAJONA Verlag GmbH
Originalausgabe bei VAJONA Verlag GmbH
Lektorat: Madlen Müller
Korrektorat: Lara Späth und Susann Chemnitzer
Umschlaggestaltung: VAJONA Verlag GmbH unter
Verwendung von Motiven von rawpixel
Satz: VAJONA Verlag, Oelsnitz
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Für Sarah.
Ich bin froh, in dir eine Freundin gefunden zu haben, mit der ich nicht nur über die Höhen und Tiefen des Mutterseins reden kann, sondern auch über meine Leidenschaft fürs Schreiben.
Hinweis
Der Roman behandelt potenziell triggernde Inhalte. Eine Übersicht findest du am Ende des Romans, da die Warnungen Spoiler enthalten.
1 Ein Meer aus glitzernden Splittern
Elliot
Wofür lebst du? Wofür kämpfst du? Was hält dich über Wasser, wenn du in der Dunkelheit zu ertrinken drohst? Und was bleibt, wenn dir dieser Grund genommen wird? Wenn es nichts mehr gibt, wofür du kämpfst und du keinen Sinn darin siehst, den Kopf oben zu halten, um den kostbaren Sauerstoff einzuatmen. Wenn das dunkle Nichts plötzlich tröstlicher erscheint als die Sonne hinter dem verdreckten Fenster.
Ich hatte gekämpft. So sehr. Für einen Traum, eine Zukunft, eine beschissene Chance. Für uns beide. Aber es gab kein uns mehr. Nur noch ein Mich. Ein trauriges, einsames Mich. In einer Welt, die mich brennen sehen wollte und Menschen, deren Hass mich an diesen Ort getrieben hatte.
Ich saß auf einem breiten Holzbalken, der als Brückengeländer diente, und sah nach oben in den dunklen Nachthimmel. Betrachtete mit einer wehmütigen Faszination das Meer aus glitzernden Sternen. Es war so ruhig hier draußen. So friedlich. Nur das beruhigende Rauschen des Flusses unter mir, die sanfte, warme Brise des Windes, der über meine Wangen strich. Sie liebkoste, als würde er versuchen, mir den unerträglichen Schmerz zu nehmen, der mein Herz und meine Seele so quälte. Doch sie waren zerbrochen, in winzige Splitter zerfallen, die mir in die Finger schnitten, sobald ich versuchte, sie wieder zusammenzusetzen.
Ich schloss die Augen. Suchte in meinem Inneren nach einem letzten kleinen Funken. Etwas, an dem ich mich festhalten konnte, das verhinderte, dass ich weiter in die Dunkelheit stürzte. Doch ich fand nur ein schmerzhaftes Nichts, das teilnahmslos zusah, wie ich langsam immer kleiner wurde, bis ich irgendwann gänzlich verschwinden würde.
Meine Finger gruben sich in das morsche Holz.
Ich hatte gekämpft.
Für uns.
Und verloren.
2 Schweigende Worte
Flora
»Idiot! Mistkerl! Großkotziger Kotzbrocken!«
Keuchend stieß ich weitere Beschimpfungen aus. Trat abgehakt und wütend in die Pedale, als könnte ich so den Zorn und die Enttäuschung aus mir hinaustreiben. Dabei ignorierte ich den verwunderten Angler, der mitten in der Nacht mit seinem Kumpel am Ufer des Flusses stand und mehrere Ruten vor sich aufgestellt hatte.
Stattdessen malträtierte ich mein armes, altes Fahrrad. Fuhr weiter den steilen Berg hinauf, bis es jämmerlich zu quietschen begann. Die Abfahrt hatte mehr Spaß gemacht. Aber da war noch alles in Ordnung gewesen. Da hatte ich Alex noch nicht mit dieser gertenschlanken, braun gebrannten Tussi mit den kilometerlangen Wimpern gesehen. Auf ihm. Nackt. Mit ihrem ach so perfekten, straffen Körper. Und diesem niedlichen kleinen Blumentattoo auf ihrer rechten Pobacke, das bei mir niemals so hübsch aussehen würde. Abgesehen davon, dass ich mir so etwas sowieso nicht leisten konnte.
Ich biss die Zähne zusammen. Verbot mir, auch nur eine Träne zu vergießen. Verdrängte das verräterische Brennen und schaltete stattdessen meine Gangschaltung höher, damit statt meiner Augen meine Oberschenkel brannten. Die, wie der Rest meines Körpers, mehr Bewegung vertragen könnten. Im Gegensatz zu der Tussi, die wahrscheinlich täglich ins Fitnessstudio rannte.
»Baka!« Keine Ahnung, warum mir dieses japanische Wort, das ich nur aus Mangas und Animes kannte, mehr Befriedigung verschaffte als all die anderen Beschimpfungen. Vielleicht, weil der Baka nicht wusste, was Baka bedeutete.
»Baka … Baka … Baka«, schnaufte ich atemlos, während ich immer langsamer wurde und durch die Steigung und den viel zu hohen Gang beinahe zum Stillstand kam.
Ich hatte gewusst, dass diese Party in einer Katastrophe enden würde. Das taten sie immer. Das war das Gesetz einer Studentenparty. Immerhin war ich bei einer von ihnen mit Alex zusammengekommen. Das sagte alles.
Ich durfte mich nicht ständig von Brit überreden lassen. Von ihren unschuldigen Rehaugen, ihrem hoffnungsvollen Lächeln. Ich war keine Studentin. Ich war selbstständig und hatte als Inhaberin eines Cafés nicht nur Verantwortung, sondern auch eine verdammte 80-Stunden-Woche. Diese Partys waren einfach nichts für mich. Das einzig Gute waren die kostenlosen Getränke, aber auf die konnte ich verzichten. Was auch immer in meinem Becher gewesen war, schwappte nun unangenehm in meinem Magen und brachte ihn zum Grummeln.
Solange ich mir das Gebräu nicht noch einmal durch den Kopf gehen lassen musste, würde ich damit klarkommen. Genauso wie ich das Ende meiner kurzen Beziehung verkraften würde. Vier Monate. Und ich Idiotin hatte schon von einer gemeinsamen Wohnung geträumt.
Dabei hatte er sich ständig über das Chaos bei mir beschwert. Dieses Chaos, das für mich Gemütlichkeit, Sicherheit und Zuhause bedeutete. Spätestens als er sich über das laute Plätschern meines Zwerggarnelen-Aquariums beschwerte, hätte mir klar sein sollen, dass das zwischen uns nicht funktionierte.
Schnaufend schüttelte ich den Kopf. Ärgerte mich über mich selbst, als ich endlich den Berg erklommen hatte und nach rechts auf die schmale Holzbrücke abbog. Sie führte über einen Fluss, der in der dunklen Nacht eine Beklemmung in mir auslöste, die selbst das schöne Glitzern, der sich spiegelnden Sterne nicht vertreiben konnte.
Ich wischte mir den Schweiß von der Oberlippe und bereute es, keine Jacke mitgenommen zu haben. Eigentlich hatte ich geplant, die von Alex zu stibitzen, aber dieser Plan war nun hinfällig.
Es war Sommer und auch nachts warm genug für mein blumiges T-Shirt und der kurzen, grünen Latzhose. Aber der Schweiß, der meinen Rücken hinab lief, ließ mich augenblicklich frieren. Hoffentlich fing ich mir keine Erkältung ein. Mich ein paar Tage ins Bett zu legen, um mich auszukurieren, war keine Option.
Ich folgte dem dunklen Pfad vor mir. Schnell, damit kein Irrer mich überfallen konnte oder kein Monster mit langen Klauen oder scharfen Reißzähnen auf meinen Rücken sprang.
Du liest zu viele komische Bücher, hörte ich Brits Stimme in meinem Kopf.
Automatisch verzog ich meine Lippen zu einem Lächeln. Manchmal vielleicht. Aber es waren schöne, komische Bücher, voller magischer Wesen und fremder Orte. Und an manchen Tagen waren die gefährlichen Abenteuer furchtloser Helden besser als das reale Leben vor meiner Tür.
Mein Lächeln erstarb in dem Moment, in dem ich die dunkle Gestalt vor mir auf der Brücke erkannte. Sofort schoss mein Puls in die Höhe. Ich blinzelte. Hoffte, mich getäuscht zu haben, aber mit jedem Meter, den ich näherkam, wurde die Gestalt deutlicher.
Serienkiller, schoss es mir durch den Kopf. Entflohener Psychopath.
Ich hielt an, sah kurz zurück, vergewisserte mich, dass kein Monster hinter mir stand, aber der Weg war verlassen und nur durch den schwachen Schein einer Laterne erleuchtet.
Aus dem Augenwinkel sah ich die Taschenlampen der Angler am Ufer leuchten. Vielleicht gehörte die Gestalt zu ihnen. Aber wer sagte mir, dass sie nicht auch psychopathische Serienkiller-Monster waren?
Meine Brust wurde eng und ich starrte die Gestalt an. Unschlüssig, ob ich es wagen sollte, mit Höchstgeschwindigkeit an ihr vorbeizurasen.
Ich wollte nicht zurück auf die Party. Zurück zu Alex. Ich wollte nach Hause, nur war diese Brücke der einzige Weg. Zumindest, wenn ich nicht noch eine weitere Stunde unterwegs sein wollte. Und das wollte ich nicht. Verdammt, in fünf Stunden musste ich wieder im Café sein.
»Bitte sei kein psychopathisches Serienkiller-Monster«, flehte ich leise und setzte mich wieder in Bewegung.
Doch nach nur wenigen Metern stoppte ich erneut.
Etwas stimmte nicht.
Mein Körper reagierte mit Entsetzen, bevor mein Gehirn verstand, was es da sah.
Die Gestalt, ein junger Mann, stand nicht auf der Brücke, sondern saß auf dem breiten Holzgeländer. Seine Beine hingen still über dem Fluss, dessen bedrohliches Rauschen bis zu uns nach oben drang. Es warnte uns, dass das Wasser uns verschlingen würde, wenn wir in seine Fänge gerieten.
Der Kerl sollte nicht dort sitzen. Nicht mit diesen hängenden Schultern, mit diesem gesenkten Kopf.
Nur wenige Meter vor mir lief gerade etwas gewaltig schief.
Meine Beine zitterten, als ich langsam von meinem Fahrrad stieg. Und das hatte nichts mehr mit meiner Unsportlichkeit zu tun.
Ich lehnte mein Gefährt gegen das Geländer und schlang schützend meine Arme um mich. Machte einen Schritt auf den Kerl zu. Er schien mich nicht zu bemerken und da es eine schlechte Idee war, ihn zu erschrecken, verlieh ich meinem leisen »Hey« so viel Liebe und Wärme, wie ich in dieser Situation konnte. Also nicht sehr viel. Es klang eher wie das Krächzen eines altersschwachen Raben im Stimmbruch.
Der Kerl hob langsam den Kopf, drehte ihn in meine Richtung und blinzelte, als würde er aus einem Traum erwachen.
Er wirkte nicht viel älter als ich, vielleicht dreiundzwanzig, und trug eine dunkel gerahmte Brille. Die gelockten Haare zum Teil unter der Kapuze seines ausgeblichenen Hoodies versteckt. Das Gesicht blass in dem schwachen Schein der entfernten Laterne und des zunehmenden Mondes.
»Kenne ich dich?«, fragte er verwirrt.
Ich presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf, bevor ich antwortete: »Ich glaube nicht.«
»Hm.« Er musterte mich nachdenklich, als würde er sichergehen, dass er mir nicht schon einmal begegnet war.
»Ist dir kalt?«, fragte er schließlich.
Die Sorge in seiner Stimme irritierte mich. Musste ich ihn nicht …? Wollte er nicht …?
Was tat ich hier? Was tat er hier? Bevor ich reagieren konnte, hatte er bereits seinen Hoodie ausgezogen und entblößte ein ebenfalls ausgeblichenes T-Shirt mit Ace von OnePiece darauf. Der Anblick hätte mir beinahe ein begeistertes Grinsen entlockt, wäre die Situation nicht so verdammt beängstigend gewesen.
Er streckte mir das Kleidungsstück entgegen, aber ich hob abwehrend die Hände.
»Ist schon okay, so schlimm ist es nicht.«
»Nimm ihn ruhig«, sagte er. »Ich brauche ihn sowieso nicht mehr.« Die emotionslosen Worte ließen alle Alarmsirenen in mir aufheulen.
Trotzdem nahm ich ihm den Hoodie aus den Händen. Drückte den warmen Stoff an mich und sah unentschlossen auf meine Schuhe hinab.
Der Kerl seufzte leise. Stoff raschelte. Sofort sah ich auf, aber er saß unverändert auf dem Geländer und starrte ins Leere.
»Darf ich mich zu dir setzen?«, fragte ich, unfähig, einfach weiterzufahren und ihn hier zurückzulassen.
Doch er schüttelte den Kopf. »Das ist zu gefährlich.«
Ich schnaufte. »Aber du darfst da sitzen?« Nun sah er mich wieder an. Direkt in meine Augen und die Intensität seines Blickes raubte mir den Atem. Er hatte seine Entscheidung getroffen.
»Ja.«
Mein Puls rauschte in den Ohren. Meine Gedanken überschlugen sich. Was sollte ich tun? Ich kannte ihn nicht. Hatte ich überhaupt das Recht, mich einzumischen? Konnte ich ihn aufhalten? Nein, ich musste es zumindest versuchen. Er durfte nicht … Das konnte ich nicht zulassen. Aber mein Körper war wie erstarrt. Die Kehle wie zugeschnürt.
Tu etwas, schrie ich mir zu. Irgendetwas! Bewege dich! Rede! Halte ihn auf!
Ich blieb regungslos.
»Nicht weinen«, flüsterte er mit einer Traurigkeit in der Stimme, die bis in die Tiefen meiner Seele drang.
Erst jetzt bemerkte ich die feuchte Spur auf meinen Wangen.
Seine Lippen zuckten leicht. Der Anflug eines Lächelns. »Es ist okay. Glaub mir.«
Es ist nicht okay, hätte ich sagen müssen. Du darfst nicht gehen. Nicht heute, nicht morgen, nicht … so. Es wartet noch so viel auf dich. So viele Kleinigkeiten, für die es sich lohnt zu bleiben. Der neue Marvel-Film, der nächsten Monat herauskommt. Die belgischen Waffeln, aus dem urigen Laden in der Einkaufsstraße. Das Open-Air-Festival in zwei Wochen. Oder Brits French-Fries-Sandwich, das wirklich abartig aussieht, aber verdammt lecker ist.
All die Worte wirbelten durch meinen Kopf, aber nicht eines kam über meine Lippen. Sie steckten in meiner trockenen Kehle fest. Ich konnte nur hier stehen und weinen. Dabei hatte ich mir das Weinen schon vor Jahren abgewöhnt. Das war nicht mehr ich.
Doch in diesem Moment verwandelte ich mich wieder in das ängstliche, schwache, stille Mädchen, das ich so sehr hasste.
»Ich weiß, dass es nicht meine Schuld war«, flüsterte er, sah kurz in den Himmel, bevor sein Blick wieder auf mich fiel. Den endlosen Schmerz, den ich darin sah, zerriss mir das Herz. »Und doch … fühlt es sich jeden verfickten Tag so an.«
Langsam nahm er seine Brille ab und legte sie so behutsam neben sich auf das Geländer, als hätte er Angst, sie zu zerbrechen. Warum hatte diese Geste so etwas Endgültiges?
Ich holte zittrig Luft.
»Nein«, stieß ich erstickt hervor. Geh nicht. Tränen liefen in einem endlosen Strom über mein Gesicht. Bitte geh nicht. Du bist nicht allein. Ich bin hier.
Verzweifelt schüttelte ich den Kopf, versuchte, irgendwie die Worte herauszubekommen, aber mehr als ein weiteres geflüstertes »Nein« brachte ich nicht zustande.
Es reichte nicht. Das Glitzern in seinen blassen, grauen Augen war das Letzte, was ich von ihm sah, bevor er nach vorne fiel.
Mein Schrei hallte durch die Nacht und mein Körper erwachte aus seiner Starre. Zu spät. Viel zu spät. Ich stürzte nach vorne, kämpfte gegen den Instinkt an, selbst hinterher zu springen. Der kleine Funke Vernunft in mir wusste, dass das meinen eigenen Tod bedeuten konnte.
Ich sah nichts, bis auf die dunkle Strömung, hörte nur den leisen Aufprall seines Körpers, der beinahe in dem dröhnenden Rauschen des Flusses und meinem eigenen Keuchen unterging.
Kleine Lichter blendeten mich. Taschenlampen am Ufer. Die Angler!
»Helft ihm!«, schrie ich und winkte panisch, ohne zu wissen, ob sie mich überhaupt sehen oder hören konnten. »Hilfe! Er ist gesprungen!« Ich deutete nach unten. »Ihr müsst ihm helfen!«
Die Lichtpunkte bewegten sich auf den Fluss zu. Ich hörte die Angler fluchen.
Hektisch atmend starrte ich auf die Lichter der Taschenlampen, die sich am Rand des Ufers hüpfend bewegten.
»Er ist gesprungen«, wisperte ich tonlos. Dann ballte ich die Hände zu Fäusten. Hitze schoss durch meine Venen, vertrieb die Kälte in ihnen wie eine brüllende Feuerwalze.
»Du bist gesprungen!« Wutentbrannt schnappte ich mir mein Fahrrad, klemmte den Hoodie unter meinen Arm und fuhr im halsbrecherischen Tempo den Weg zurück. Den steilen Berg hinab verlor ich beinahe die Kontrolle.
Schlitternd kam ich am Flussufer zum Stehen, warf das Fahrrad achtlos auf den Boden und rannte auf das Wasser zu.
Gehetzt suchte ich das Ufer in der Dunkelheit ab. Hörte in einiger Entfernung laute Rufe, rannte darauf zu, bis ich den Umriss einer Gestalt auf einem Steg entdeckte. Durch das Licht einer Laterne konnte ich erkennen, dass es einer der Angler war, der am Ende des Steges lag und sich nach vorne beugte. Die Taschenlampe zwischen die Zähne geklemmt, streckte er einen langen Kescher seinem Kumpel entgegen. Dieser schwamm mühsam gegen die Strömung an, konnte sich kaum über Wasser halten.
Ich hielt den Atem an. Starrte auf die Szene vor mir, die so unwirklich schien, als wäre es nur ein Film.
Der Angler im Wasser griff nach dem Kescher und der andere begann, ihn näher ans Ufer zu ziehen.
Hatten sie den jungen Mann retten können? Es war zu dunkel. Ich konnte nicht genug erkennen. Erst als der Angler auf dem Steg seinen Kumpel komplett aus dem Wasser gezogen hatte, sah ich die schlaffe Gestalt in seinen Armen. Die beiden Männer zogen den Körper weiter auf das trockene Gras am Ufer.
»Ruf … ruf einen Krankenwagen«, keuchte einer der beiden. Mein Blick blieb an dem regungslosen, nassen Körper hängen. »Schnell!«
Ich zuckte zusammen und mir wurde klar, dass er mich meinte.
Mit zitternden Fingern holte ich mein Handy aus der Tasche und wählte den Notruf. Hastig gab ich der ruhigen Stimme am anderen Ende der Leitung alle Informationen, bevor ich auflegte und auf die beiden Angler und den jungen Kerl zustürmte. Neben ihm gaben meine zittrigen Knie nach und ich fiel ins weiche Gras.
»Ist er …«, fragte ich, ohne den Satz beenden zu können.
Die Hände des Anglers schwebten zitternd und unsicher über der blassen, leblosen Gestalt. Wassertropfen vermischten sich mit Blut, das seine Schläfe hinablief.
»Ich weiß es nicht.«
3 Meine verschwommene, neue Welt
Elliot
Ich kämpfte. Kämpfte, um nicht zu ertrinken. In diesem grauen, dichten Nebel, der mich immer tiefer ins Nichts zog. Er schlängelte sich über meine Haut, über mein Gesicht, kroch in meinen Mund, in die Nase. Ich konnte nicht mehr atmen. Panisch schlug ich um mich. Aber der Nebel drang unaufhaltsam in mich ein. In meinen Körper, in meinen Kopf, in meine Gedanken.
Bis er plötzlich innehielt. Inmitten Tausender Bilder, die in der Dunkelheit schwebten, und dröhnender Stimmen, die durch den fremden Raum hallten. Der Nebel formte sich zu einer riesigen, wabernden Gestalt, aus deren leeren Augenhöhlen mir eine furchteinflößende Dunkelheit entgegenblickte. Mich fixierte. Dann begann es, sich den Bildern zu nähern, hüllte sie in seinen dichten Nebel und … verschlang sie. Eines nach dem anderen. Sie verschwanden in dem Wesen und ich konnte nichts dagegen tun. Nur zusehen, wie er die Stimmen und die Bilder verschluckte.
Was tust du, flüsterte ich. Die Worte klangen verzerrt an diesem seltsamen Ort, der immer leerer wurde.
Aber das Wesen achtete nicht auf mich, nahm sich immer mehr. Das Wimmern einer Frau, das Bild eines Zimmers. Schreie. Ein Brüllen. Das Bild einer blutenden Faust.
Das gewisperte »Nein« einer jungen Frau. Ein weiteres Bild. Lange, gewellte Haare. Eine Latzhose. Entsetzt beobachtete ich, wie der Nebel langsam über das Bild kroch. Ich streckte meinen Arm aus. Wollte es aufhalten. Stoppen.Nicht sie, rief ich und stolperte in der plötzlichen Leere. Ich sah mich um, drehte mich im Kreis, aber alle Bilder waren verschwunden, all die Stimmen, der Lärm. Da war nur die Dunkelheit, das nebelartige Wesen und – eine Tür. Eine alte, zerkratzte Holztür. Ein einzelnes weißes Blatt Papier war mit Klebestreifen daran befestigt. Darauf waren mit Buntstiften ein Haus, Strichmännchen, Blumen und eine Sonne gemalt.
Langsam öffnete sich die Tür und das Wesen trat hindurch.
Was hast du getan?, rief ich ihm hinterher, während die Tür sich wieder schloss.
Dich gerettet, hallte eine leise, dunkle Stimme durch das Nichts.
Und dann war ich allein. Die Tür verschwunden und um mich herum eine erdrückende Leere. Dunkelheit.
Ich bewegte mich. Wusste weder wohin noch in welche Richtung. Ich begann zu rennen. Immer schneller. Auf der Suche nach etwas. Nach irgendetwas. Aber ich fand nur die Dunkelheit. Ich rannte weiter. Rannte und rannte. Suchte nach … mir. Aber ich war weg. Alles von mir.
Irgendwann hörte ich ein Geräusch. Keuchend blieb ich stehen und lauschte. War da nicht etwas? Hoffnung keimte in mir auf und ich folgte dem schwachen, regelmäßigen Piepen. Es wurde lauter. Begleitete mich im Duett mit einem dumpfen Pochen in meinem Kopf.
Piep … Piep … Piep …
Es schmerzte in den Ohren. Ich presste die Augen zusammen. Und plötzlich war da ein Licht hinter meinen Lidern. Der Traum glitt von mir ab und ich bemerkte, dass ich auf etwas Weichem lag. Spürte die Schwere meines Körpers, den Schmerz in meinem Kopf. Ein Kribbeln breitete sich in meinen Fingerspitzen aus und ich zwang meine Lider, sich zu heben. Die Helligkeit stach mir in die Augen, trieb mir die Tränen hinein. Ich stieß ein schwaches Stöhnen aus, drehte den Kopf weg, aber es blieb hell und verschwommen. Das hektische Piepen neben mir brachte mein Herz zum Rasen. Oder war es andersherum? Ich musste einige Male blinzeln, bis es mir gelang, meine Augen halbwegs offen zu halten.
Ich versuchte, einen Arm zu heben, aber er gehorchte mir nicht. Das Piepen und mein Herzschlag lieferten sich ein Wettrennen.
Stimmen drangen zu mir. Sie hörten sich an, als hätte ich einen Wattebausch im Ohr. Ich konzentrierte mich auf sie, während ich immer wieder blinzelte, in dem Versuch, klarer sehen zu können.
»Hallo? Ähm, hallo? Hier … äh, ich glaube, er ist wach.«
Schritte näherten sich. Ein undeutlicher Schatten kam näher.
»Hey, alles ist gut.«
Sprach der Schatten mit mir? Verdammt, ich konnte nichts erkennen.
»Du bist im Krankenhaus.«
Mir gelang es, einen schlaffen Arm zu heben. Doch eine Sekunde später landete er unsanft auf meinem Gesicht. Unbeholfen rieb ich mir mit dem Handgelenk über die Augen, in der Hoffnung, den Schleier zu vertreiben. Ohne Erfolg.
»Ich …« Das Wort blieb in meiner ausgetrockneten Kehle stecken.
»Oh, warte.« Der Schatten, der hellen Stimme nach zu urteilen, eine junge Frau, holte etwas und steckte es mir zwischen die Lippen. Einen Strohhalm.
»Wasser«, sagte sie unnötigerweise, denn ich saugte bereits wie ein Irrer daran und benetzte die trockene Wüste in meinem Mund mit herrlich kühlem Wasser.
Natürlich verschluckte ich mich prompt und hustete, was in meinem gesamten Körper eine Welle aus Schmerz auslöste. Besonders im Kopf.
Ich hustete und stöhnte, während mir die junge Frau zaghaft auf den Rücken klopfte.
Dann tauchte ein weiterer, deutlich breiterer Schatten auf.
»Willkommen zurück, Kumpel. Immer schön langsam«, sagte eine ruhige, tiefe Stimme.
Das Bett bewegte sich und ich wurde Stück für Stück aufgerichtet, während mich ein weiterer Hustenanfall schüttelte.
»Du bist im Krankenhaus. Ein Arzt ist auf dem Weg. Aber mach dir keine Sorgen. Dass du wach bist, ist ein gutes Zeichen.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon der zweite Schatten sprach. Mir war übel und in meinem Kopf drehte sich alles. Aber zu meiner Erleichterung stellte er das hektische Piepen ab und richtete die Kissen in meinem Rücken zurecht. Danach hantierte er weiter an irgendwelchen Geräten neben meinem Bett herum. Ich begann mir erneut über die Augen zu reiben. Blinzelte. Kniff sie zusammen, aber meine Sicht wurde nicht besser.
Ich war im Krankenhaus? Warum? Ich versuchte, mich zu erinnern, aber stattdessen pochte es schmerzhaft in meinem Kopf.
Also konzentrierte ich mich auf den Schatten der jungen Frau. Sie stand etwas abseits, sah aus, als hätte sie die Arme um sich geschlungen.
»Ist dir kalt?«, fragte ich. Zumindest wollte ich es. Aber es hörte sich an, als hätte jemand meine Stimmbänder herausgenommen, durch den Fleischwolf gedreht und wieder eingesetzt. Sie hatte mich trotzdem verstanden und stieß ein belustigtes, zeitgleich trauriges Geräusch aus, bevor sie sagte: »Ist schon okay, so schlimm ist es nicht.«
Erst danach wurde mir klar, dass ich ihr nichts hätte geben können, bis auf das dünne Krankenhaushemd, das ich trug.
Meine Fingerspitzen kribbelten noch immer und ich hatte das Gefühl, so etwas schon einmal gehört zu haben. Dieselbe Stimme. Dieselben Worte.
Ich kniff die Augen zusammen, um sie besser erkennen zu können. Langes, dunkles Haar. Eine kurze Latzhose? Ich war mir nicht sicher.
»Kenne ich dich?«
Der Schatten zuckte leicht zusammen, schüttelte dann aber den Kopf. »Nein, nicht wirklich.« Aber warum kam sie mir so bekannt vor? In meinen Kopf bohrten sich immer mehr feine Nadeln und ich ließ mich stöhnend nach hinten fallen.
»Wie fühlst du dich?«, fragte der andere Schatten, wahrscheinlich ein Krankenpfleger.
»Geht so.«
»Irgendwelche Schmerzen? Fühlt sich irgendwas komisch an?«
Ich räusperte mich, horchte in meinen Körper. Bewegte Finger und Zehen.
»Fühlt sich an wie ein verdammter Muskelkater, mein Kopf tut weh und irgendwie funktionieren meine Augen nicht richtig. Alles ist verschwommen.«
»Oh, okay?«
Das war keine Reaktion, die mich beruhigte.
Die junge Frau kam einen Schritt näher. »Er hatte eine Brille auf.«
Ich entspannte mich ein wenig.
Mir fehlte nur eine Brille.
»Vielleicht liegt sie noch auf der Brücke.«
Welche Brücke? Meine Kopfschmerzen wurden immer stärker.
Irgendetwas stimmte nicht. Nicht wegen meiner Augen. Auch nicht wegen meinem Körper, der sich so schwach anfühlte, als wäre ich gerade einen Marathon gelaufen. Irgendetwas in mir stimmte nicht. Etwas fehlte. Aber ich konnte es nicht richtig greifen.
Eine Ärztin betrat den Raum. Sie stellte sich vor, aber ich vergaß ihren Namen sofort. Sie stellte mir dieselben Fragen wie der Krankenpfleger, bevor sie schließlich eine Mappe zur Seite legte und sich zu mir beugte.
»Okay, junger Mann. Wissen Sie, was passiert ist?«
Mein Puls beschleunigte sich wieder, denn je mehr ich versuchte nachzudenken, desto leerer wurde es in meinem Kopf.
»Nein«, sagte ich leise. »Ich habe keine Ahnung.«
Sie schwieg einen Moment. »Sie hatten einen Unfall und wären beinahe ertrunken.«
»Oh.« Was zu Hölle? Wie konnte ich das vergessen?
Bevor ich etwas sagen konnte, stellte mir die Ärztin bereits die nächste Frage.
»Wissen Sie, wie Sie heißen?«
»Klar, ich heiße … « Ich stockte. »Ich …« Eine Faust schloss sich um mein Herz. Ich räusperte mich. »Mein Name ist …« Panik stieg in mir auf, als ich in der Leere suchte. Ein zittriges Lachen kam über meine Lippen.
Ich wollte ihr antworten. Wollte es wirklich. Aber da gab es nichts, was ich ihr sagen konnte. Keinen Namen. Kein Alter. Kein Ich.
Meine Kehle zog sich schmerzhaft zusammen. Ich schluckte, presste die Augen zusammen. Suchte. Durchforstete weiter die dunkle Leere in meinem Kopf. Grub. Wühlte.
»Mein Name …«
Zitternd hob ich die Hände, griff mir in die Haare. Kratzte mit den Nägeln über meine Kopfhaut. Ich musste doch wissen, wie ich hieß.
Aber es blieb bei dem Nichts. Bei der Dunkelheit. Und je mehr ich mich konzentrierte, desto mehr fühlte es sich an, als würde ich mich darin verlieren.
Wer zur Hölle … war ich?
Das Atmen fiel mir schwer und die Panik kroch tiefer in mich hinein.
Eine kalte Hand berührte mich am Arm, drückte ihn sanft nach unten, sodass ich unwillkürlich meine Haare losließ.
»Schau mich an«, sagte die Ärztin mit leiser, warmer Stimme. Ich öffnete die Augen. Starrte in das verschwommene Gesicht. Ein Schluchzen schüttelte meinen Körper. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten.
»Würde ich ja gerne«, entfuhr es mir erstickt und ich kniff die Augen zusammen. »Aber ich kann Sie nicht erkennen. Ich bin ein verdammter Blindfisch!« Ich lachte verzweifelt auf. Die Ärztin beugte sich noch näher zu mir, nur wenige Zentimeter trennten uns, und wurde etwas deutlicher. Blonde Haare, hoher Zopf, braune Augen und ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Sie roch nach Desinfektionsmittel und einem fruchtigen Parfüm.
»So besser?«, fragte sie.
Ich nickte, atmete tief durch und fuhr mir über das Gesicht.
»Mach dir keine Sorgen, okay? Nach so einem Unfall ist es nicht ungewöhnlich, dass man für kurze Zeit sein Gedächtnis verliert. Das geht vorbei. Vielleicht in ein paar Stunden, spätestens in ein paar Tagen, glaub mir. Kannst du dich an irgendetwas erinnern, dass vor dem Krankenhaus passiert ist?«
Ich schüttelte den Kopf. »Da ist nichts«, flüsterte ich. »Nur Dunkelheit.«
»Okay.«
Nichts war okay! Was sollte daran okay sein?
Ein Telefon klingelte. Die Ärztin holte es aus ihrer Brusttasche, ging ran und wechselte wenige Worte mit jemanden, bevor sie wieder auflegte. Dann stand sie auf.
»Leider hattest du nichts bei dir. Kein Handy, keine Brieftasche. Daher müssen wir vorerst abwarten, bis wir wissen, wer du bist. Ruh dich erst einmal aus. Versuche zu essen, zu trinken. Entspanne dich und zwinge dich nicht, dich an etwas zu erinnern. Das kommt von ganz allein, glaub mir.«
Sie tätschelte meinen Arm und wollte gehen.
Das sollte es gewesen sein? Sie konnte mich doch nicht einfach so zurücklassen. Ohne… irgendetwas.
»Warten Sie!«
Sie blieb stehen.
»Was … was war das für ein Unfall?«
Und plötzlich überrollte mich die Angst. Angst vor der Antwort. Ich wusste, dass ich nicht einfach im tiefen Wasser untergegangen war, weil ich nicht schwimmen konnte. Es war etwas anderes passiert. Etwas Schlimmeres.
Warum sonst sollte mich mein Gedächtnis im Stich lassen.
Die Ärztin seufzte und deutete schließlich auf die junge Frau, die sich ans Ende des Raumes neben ein Fenster zurückgezogen hatte.
»Die junge Dame hat gesehen, wie du von einer Brücke gesprungen bist.«
Mein Körper erstarrte. Ich hörte auf zu atmen, mein Herz stolperte.
»Du wolltest dich umbringen.«
Tief verborgen in der Dunkelheit, versteckt hinter der Mauer aus Leere, spürte ich ihn. Den Schmerz. So unerträglich, dass er, wenn er durchbrechen würde, mein Herz und meine Seele zerreißen würde.
»Warum?«, fragte ich heiser.
»Sag du es mir. Du hattest verdammtes Glück, dass zwei Angler am Ufer waren. Das Mädchen hat ihnen zugerufen, dass sie dir helfen sollen, und es ist ihnen tatsächlich gelungen, dich rechtzeitig aus dem Fluss zu ziehen. Du warst bewusstlos, bist wahrscheinlich unglücklich mit dem Kopf auf dem Wasser aufgeschlagen und hast dir dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen.«
Ich starrte auf meine Hände, hörte ihr zu, aber es war, als würde sie von einem traurigen Film erzählen und nicht von mir und dem, was passiert war.
Ich hatte versucht, mich in einem verdammten Fluss zu ertränken?
»Verstehe mich nicht falsch«, sagte die Ärztin und ich blickte zu ihrer verschwommenen Gestalt auf. »Ich habe keine Ahnung, was dich zu dieser Entscheidung getrieben hat, aber vielleicht ist dein Gedächtnisverlust eine Chance. Du wirst dich bald wieder an alles erinnern«, sagte sie zuversichtlich. »Aber vielleicht hilft dir der Abstand, die Dinge anders zu sehen. Verstehst du, was ich meine?«
Ein nebelartiges Wesen blitzte in meinen Gedanken auf. Eine Stimme. Ein Wort.
Gerettet.
Ich antwortete der Ärztin nicht. Wusste nicht, was ich sagen, was ich denken sollte. Alles war so durcheinander und gleichzeitig so leer.
Sie seufzte leise. »Ruh dich aus. Morgen kommt ein Kollege zur Visite bei dir vorbei und klärt mit dir alles weitere.«
Dann verließ sie den Raum, der Krankenpfleger wollte ihr folgen, blieb jedoch noch einmal stehen.
»Die Besuchszeit ist eigentlich vorbei«, sagte er zu der jungen Frau. »Aber ich drücke ein Auge zu. Du kannst noch eine halbe Stunde bleiben, aber dann musst du wirklich gehen.«
»Alles klar, danke.«
Die Tür schloss sich mit einem leisen Klicken. Zurück blieben die junge Frau, deren Namen ich nicht kannte, und ich, dessen Namen ich auch nicht kannte.
4 Dein verblasster Hoodie
Flora
Unschlüssig und ein wenig unwohl stand ich neben dem Fenster und wusste nicht, wohin ich meinen Blick richten sollte. Ich sah von der weißen Tür zu den Geräten, dann zum Tisch mit den beiden Stühlen, dann wieder zur Tür. Nur nicht zu dem jungen Mann, der regungslos auf seinem Bett saß und seine Hände anstarrte.
Es war Sonntagabend. Ich hatte mir bereits Sorgen gemacht, als die Krankenschwester mir erzählte, dass er noch nicht aufgewacht war. Dass es jetzt, ausgerechnet in der Stunde, in der ich hier war, passierte, damit hatte ich nicht gerechnet.
Und nun fühlte ich mich fremd wie ein Eindringling an einem Ort, an dem ich nichts zu suchen hatte.
Ich kannte ihn doch gar nicht. Was machte ich hier überhaupt?
Zögernd richtete ich meinen Blick auf seine kurzen ungewaschenen Locken. Den leichten Bartschatten. Er konnte nicht viel älter sein als ich, wirkte in dem Krankenhaushemd aber wie ein trauriges, verlorenes Kind, gefangen in seinen eigenen Gedanken. Auf seiner Stirn prangte eine große Beule, auf der ein kleines Pflaster klebte. Zumindest die äußerliche Verletzung, die er sich durch den Sprung zugezogen hatte, schien nicht allzu schlimm zu sein. Aber wie sah es in seinem Inneren aus?
Dass er sich nicht erinnerte, wer er war … Ich konnte mir nicht vorstellen, wie er sich fühlen musste. Angst und Verzweiflung hatten sich deutlich in seinen blassen, grauen Augen widergespiegelt, als die Ärztin ihn nach seinem Namen gefragt hatte.
Nervös wippte ich auf meinen Fußballen, bevor ich mir einen Ruck gab und zu einem der Stühle ging. Über der Rückenlehne hing der verblichene Hoodie, den er mir auf der Brücke gegeben hatte.
Ich nahm ihn und hielt ihm das Kleidungsstück entgegen.
»Ich glaube, der gehört dir. Ich habe ihn auf der Brücke gefunden«, log ich.
Den Tag über hatte ich alles getan, um diesen Augenblick zu verdrängen. Ihm jetzt zu sagen, dass ich dabei gewesen war, dass ich es nicht geschafft hatte, ihn aufzuhalten. Dass ich den Mut nicht gehabt hatte und meine Glieder vor Angst erstarrt waren. Ich konnte es nicht, schämte mich für das Mädchen, zudem ich in diesem Moment geworden war.
»Ich wollte ihn waschen, aber irgendwie fühlte es sich falsch an.«
Langsam hob er den Kopf, blinzelte, genau wie in der Nacht.
Ich schluckte. Was machte ich hier?
Er nahm ihn entgegen. Seine Finger erstaunlich ruhig, während sie über den Stoff glitten, der bereits einige kleine Löcher aufwies.
Mit fahrigen Bewegungen suchte er in den Taschen nach Gegenständen. Doch ich wusste, dass sie leer waren. Ich hatte sie selbst durchsucht, als die Rettungskräfte am Flussufer eingetroffen waren.
»Danke«, sagte er leise.
»Kein Ding. Wenn du willst, nehme ich ihn heute mit, wasche ihn und bringe ihn dir morgen wieder vorbei. Dann hast du wenigstens … etwas zum Anziehen.«
Er schüttelte den Kopf, sah erneut zu mir mit dem Anflug eines schwachen Lächelns auf den Lippen. »Nein. Ich meine, danke, dass du mich gerettet hast.«
Meine Brust zog sich zusammen. Ich habe dich nicht gerettet. Ich habe es nicht geschafft.
Abwehrend hob ich die Hände.
»Die beiden Angler haben dich gerettet.«
Er hob kaum merklich die Schultern. »Aber ohne dich, hätten sie mich vielleicht gar nicht bemerkt.«
Dann kniff er die Augen zusammen, beugte sich vor und betrachtete mich eingehend. Dabei biss er sich konzentriert auf die Unterlippe und sah albern, aber auch niedlich aus.
»Das klingt jetzt komisch, aber könntest du etwas näherkommen? Anscheinend habe ich einen Dioptrienwert von Minus einhundert.«
Ich lachte und spürte, wie sich der Knoten in meinem Magen etwas löste. »Ich glaube nicht, dass es so einen Wert gibt.«
Aber ich tat ihm den Gefallen, stellte mich neben ihn ans Bett und beugte mein Gesicht etwas näher zu ihm. Obwohl er von einem Fluss ausgespuckt wurde, roch er nicht unangenehm. Nach Krankenhaus und etwas Süßem, das mich an einen gemütlichen Kinoabend erinnerte.
Er musterte mich konzentriert, dann seufzte er und rieb sich erschöpft die Augen, bevor er sich wieder zurücklehnte.
»Ich habe das Gefühl, dich zu kennen und doch wieder nicht.«
Mein Herz verkrampfte sich. »Ich war auch die Letzte, die du gesehen hast, als …«
Ich brachte den Satz nicht zu Ende. Konnte … nein, wollte nicht.
Er schloss die Augen und nach einiger Zeit dachte ich, er wäre einfach eingeschlafen, aber dann sagte er matt: »Was ist passiert? Auf der Brücke. Habe ich irgendetwas gesagt? Meinen Namen zum Beispiel?«
Ich zog einen Stuhl ans Bett und setzte mich. Ignorierte das Zittern meiner Hände. Ich schob es auf die Erschöpfung. Letzte Nacht hatte ich keinen Schlaf gefunden und nur der Stress im Café hatte mich tagsüber wachgehalten.
»Nein«, sagte ich nur. Seine Worte, bevor er gesprungen war, hatten keinen Sinn ergeben. Jetzt, wo er sich sowieso nicht mehr erinnern konnte, würde es ihm auch nicht weiterhelfen. Oder doch? Ich schloss kurz die Augen. Das schlechte Gewissen wickelte sich um meine Eingeweide, quetschte sie zusammen. Ich durfte es ihm nicht verschweigen, aber wenn ich ihm alles erzählte, würde er wissen, dass ich nichts unternommen hatte. Dass die Angst mich gelähmt hatte und ich lediglich ein stummer Zuschauer seines Selbstmordes gewesen war.
»Nicht weinen.«
Ich zuckte zusammen. Sah in ein Paar halbgeschlossene blassgraue Augen. Instinktiv hob ich meine Hand an die feuchten Wangen, starrte auf das Glitzern auf meinen Fingerspitzen. Schon wieder?
Euch dürfte es nicht geben. Ich habe euch verbannt.
Unsicher lachte ich und wischte mir schnell die Augen trocken. »Tut mir leid. Eigentlich weine ich nicht. Aber bei dir passiert mir das schon zum zweiten Mal.« Ich zwang die Fröhlichkeit zurück in meine Stimme und setzte ein Lächeln auf. »Ich habe auch keinen Grund dazu. Schließlich bin ich nicht diejenige, die ihre Brille und auch die Erinnerungen verloren hat.«
Er legte den Kopf schief. »Es ist okay, zu weinen. Es war sicher nicht einfach, das mit ansehen zu müssen. Also, dass ich …« Er verzog das Gesicht. »Du weißt schon. Tut mir leid.«
Ich schniefte und straffte meine Schultern. »Das muss es nicht. Mach dir keine Sorgen um mich.«
Wir sahen uns einige Sekunden schweigend an. Auch wenn ich mir nicht sicher war, wie klar er mich eigentlich sehen konnte.
Schließlich stand ich zögernd auf und nahm meine Tasche vom Tisch.
»Ich muss los, bevor mich der Pfleger aus dem Fenster nach draußen wirft. Aber ich komme dich morgen Abend wieder besuchen.«
»Warum?«
Ich hob die Schultern. Ich wusste es selbst nicht genau. Also sagte ich nur: »Nenn mir einen Grund, warum nicht?«
»Du kennst mich nicht.«
»Du kennst dich auch nicht«, entgegnete ich prompt.
Er zog die Augenbrauen zusammen. »Stimmt.«
Schmunzelnd hob ich zum Abschied die Hand. »Also bis morgen, Fremder.«
Er erwiderte die Geste matt, mit einem schwachen Lächeln. »Bis morgen, Fremde.«
Erst als ich die Tür hinter mir zuzog, fiel mir auf, dass ich ihm meinen Namen nicht verraten hatte.
Ich winkte dem Pfleger und den Krankenschwestern und verließ das Krankenhaus.
Eigentlich hatte ich gehofft, dass, sobald ich sah, dass es ihm gut ging, ich das alles hinter mir lassen konnte. Dass dieses Pflichtgefühl, diese Verantwortung für ihn, einfach verschwand, und jeder seinen eigenen Weg gehen würde. Aber dass er ohne Erinnerungen aufwachte, änderte alles.
Die Schwestern hatten mir verraten, dass ihn den Tag über niemand anderes besucht hatte. Niemand hatte angerufen, niemand hatte sich nach einem vermissten jungen Mann erkundigt. Also war ich gerade die einzige Person, abgesehen vom Krankenhauspersonal, die an seiner Seite war.
Ich konnte ihn jetzt nicht allein lassen. Ich konnte nur hoffen, dass seine Familie oder Freunde bald auftauchen oder seine Erinnerungen zurückkehren würden. Aber solange das nicht der Fall war, würde ich bei ihm bleiben. Wenn auch nur für ein bis zwei Stunden am Tag.
Es war neun Uhr abends, als ich mit meinem Fahrrad von dem Gelände des Krankenhauses in Richtung meiner Wohnung fuhr. Vorbei an dem hohen Bretterzaun, über die verlassene Kreuzung, zwischen den riesigen Gebäuden hindurch, durch die Einkaufsstraße, weiter bis zum großen Park, von dem aus eine Seitenstraße zu meiner kleinen, chaotischen Wohnung führte. Ich schloss die Haustür auf, manövrierte das Fahrrad durch den schmalen Flur eine Etage tiefer in den Keller. Ich stellte es auf dem freien Platz, neben das von meinem cholerischen Nachbarn. Öffnete den Verschluss seiner Satteltasche, einfach, weil ich es konnte und weil ich wusste, dass er durchdrehen würde, wenn er herausfand, dass ich seine Sachen anfasste. Ich konnte den Kerl nicht leiden. Und er mich auch nicht.
Dann machte ich mich an den Aufstieg in die sechste Etage. Auch nach zwei Jahren keuchte ich immer noch vor meiner Wohnungstür wie nach einem zehnstündigen Marathon.
Ich trat ein und stellte meine Schuhe auf die Fußmatte neben der schmalen Kommode.
Das leise Rauschen meines beleuchteten Aquariums begrüßte mich. Das Licht, das durch das leicht strömende Wasser an den Wänden rings herum flackerte, erhellte meine kleine Einraumwohnung, sodass ich die ungemütliche Deckenlampe nicht einschalten musste.
Ich ließ mich auf mein Bett fallen. Bücher stachen mir in den Rücken. Aber ich war zu erschöpft, um sie wegzuräumen, und zu erschöpft, um meinen knurrenden Magen zu füttern.
Die Anspannung der letzten Stunden fiel langsam von mir ab. Ebenso die Sorge. Die Sorge, dass der junge Mann von der Brücke nicht wieder aufwachte. Die Sorge, dass es zum Teil meine Schuld gewesen wäre.
Jetzt war er wach. Ihm ging es gut. Bis auf die fehlenden Erinnerungen.
Ich hatte die Worte der Ärztin gehört. Dass es für ihn eine Chance sein könnte. Ein Neuanfang. Ich stimmte ihr zu. Auch wenn ich ihn nicht kannte, nicht wusste, was ihn zu seiner Entscheidung getrieben hatte, hatte ich heute doch einen jungen Mann gesehen, der kaum Ähnlichkeit mit dem blassen Geist auf der Brücke hatte. Bevor ich meinem Körper und meiner Seele die dringend benötigte Erholung schenkte, zog ich eines der Bücher unter meinem Rücken hervor. Ich blätterte durch die Seiten. Sah mir die verschiedenen Namen an. So lange, bis ich einen passenden fand und zufrieden in einen traumlosen Schlaf glitt.
5 Mein Traum aus Chaos
Flora
»Hey, mein hübsches Blümchen.«
Brit stand bereits hinter dem Tresen aus dunkelbraun angestrichenen Paletten, die ich mit kleinen Hängepflanzen bestückt hatte. Sie musterte mich mit hochgezogener Augenbraue und einem schiefen Lächeln, während sie die ersten Schokoladenmuffins in das oberste Fach der Glasvitrine stellte.
Ich sah kurz auf meine beige Latzhose mit floralem Muster. Darunter trug ich ein schwarzes T-Shirt mit Rosen und auf meinem Kopf thronte ein Haarreif mit kleinen Sonnenblumen. Dazu trug ich große Hängeohrringe, ebenfalls mit Sonnenblumen.
»Too much?«, fragte ich und gähnte herzhaft, während mir der köstliche Duft von frisch gebackenem Kuchen in die Nase stieg.
»Du passt zur Einrichtung.«
»Dann ist doch alles gut.«
Ich schlurfte zu ihr hinter den Tresen und schnappte mir einen warmen Muffin vom Blech, bevor ich den großen Kaffeevollautomaten aus seinem Schlaf holte.
Brit schüttelte grinsend den Kopf und sah viel zu frisch und munter für die Uhrzeit aus.
»Wie kannst du mitten in der Nacht so fröhlich sein«, nuschelte ich mit vollem Mund.
»Es ist halb sieben Uhr morgens und für viele Menschen eine ganz normale Uhrzeit, um in den Tag zu starten.«
Brit drehte sich um und verschwand in der schmalen Küche, in der wir, besser gesagt sie, Kuchen und Sandwiches für unsere Gäste vorbereitete.
»Ich wünschte, alle würden ihren Tag erst um zehn starten, dann bräuchte ich hier nicht schon um sieben die Türen für die ersten Kaffeesüchtigen öffnen.«
Ich lehnte mich, erneut gähnend, gegen die mächtige Schrankwand, in der neben der großen Kaffeemaschine und den verschiedenen Röstungen, Sirups und weiteren Zutaten auch dutzende Bücher sowie Pflanzen standen.
Das ganze Café bestand aus nichts anderem. Und ich liebte es. Liebte jedes kleine Detail, liebte es mehr als alles andere in meinem Leben. Diesen Ort, der in den letzten zwei Jahren mehr ein Zuhause war als meine Wohnung.
Books, Cakes and Flowers von den Stammgästen liebevoll BCF genannt, verband meine drei Leidenschaften und war ein Café für alle Bücher- und Kaffeeliebhaber.
»Geh einfach früher ins Bett«, kam es von Brit aus der Küche.
Ich brummte zur Antwort und raffte mich auf, um die runden Tische abzuwischen, die Stühle zurechtzurücken und einmal durchzufegen. Ich goss einige Pflanzen, ordnete Bücher in den Regalwänden und setzte schließlich die Geldkassette in die Kasse ein. Zum Schluss schaltete ich das Radio ein. Aus zwei Boxen an der Decke drang leise Musik durch den Raum. Brit kam erneut aus der Küche und stellte einen dampfenden Apfelkuchen auf den Tresen.
»Was gibt es Neues von deinem Brücken-Typen?«
Ich war noch so müde, dass ich gar nicht an die wichtige Neuigkeit gedacht hatte.
Aber statt Freude oder Begeisterung breitete sich eine verwirrende Schwermut in mir aus.
Ich fummelte an einem Zuckerstreuer herum. »Er ist aufgewacht.«
»Das ist doch super! Hast du mit ihm geredet? Hat er dich wiedererkannt?«
Ich seufzte und drehte mich zu ihr um. »Ja und nein.«
Brit verschränkte die tätowierten Arme über ihrer schlichten, schwarzen Schürze. »Erzähl.«
Ich hob die Schultern. »Er hat sein Gedächtnis verloren.«
Ihre braunen Augen weiteten sich. »O Shit.«
Ich lachte kurz und freudlos. »Das kannst du laut sagen. Er hat keine Ahnung, wer er ist oder was passiert ist. Er kann nicht mal richtig sehen, weil seine Brille weg ist und er eine ziemlich beschissene Sehstärke hat.«
Brit schüttelte fragend den Kopf. »Und jetzt?«
Erneut hob ich die Schultern. »Keine Ahnung. Ich werde nach Feierabend zu der Brücke fahren. Vielleicht liegt sie noch dort.«
»Nein, ich meine mit seinen Erinnerungen?«
»Die Ärztin meinte, dass sie wieder kommen. Ich schaue heute Abend bei ihm vorbei.«
Brit sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Die blonden Haare unter einem Basecap verborgen, sah meine Freundin in dem Oversize-Shirt und der weiten Jeans wie die Lässigkeit in Person aus. Dass sie sich nachts in eine heiße Frau in einem engen, kurzen Kleid verwandelte und anderen Frauen hinterherjagte, hatte ich erst geglaubt, als ich sie in einen Club begleitete.
»Meinst du nicht, du solltest es … keine Ahnung … gut sein lassen?«
Ich biss mir auf die Lippe, hatte mir dieselbe Frage auch schon gestellt.
»Er hat niemanden, Brit. Ich kann nicht einfach zu Hause sitzen, während er völlig allein ohne Erinnerung im Krankenhaus liegt. Außerdem, wenn ich die Brille finde, will ich sie ihm vorbeibringen.«
Sie seufzte. »Du bist nicht für ihn verantwortlich, Süße. Eigentlich hast du schon genug zu tun mit deinem Café, deinen Autoren und den ganzen Aktionen.«
Ich verschränkte die Arme und starrte aus der breiten Glasfront auf den noch menschenleeren Bürgersteig dahinter.
Brit verschwand wieder in der Küche, sprach jedoch weiter.
»Du weißt, dass du nichts hättest tun können, oder? Du bist keine Polizistin oder Feuerwehrfrau, die Erfahrung mit solchen Situationen hat.«
Ich ballte die Hände zu Fäusten. Warum fühlte es sich trotzdem so an, als wäre es meine Schuld? Auch sie wusste nicht, wie nah ich ihm gewesen war. Dass ich nur meine Hand hätte ausstrecken müssen, um ihn aufzuhalten, dass ich nur meinen verdammten Mund hätte aufmachen müssen.
»Ich weiß«, sagte ich leise.
Zum Glück ging in dem Moment die Tür auf und lenkte mich von den unliebsamen Gedanken ab. Begleitet von dem leisen Klingeln der kleinen Glöckchen über der Tür, kam Danny in das Café geschlurft, warf seinen Rucksack hinter den Tresen und ließ sich schlaff auf einen der Stühle fallen.
»Morgen Danny«, begrüßte ich meine halbtags Baristakraft.
Er hob matt die Hand und versank augenblicklich in die Welt seines Handys. Der schweigsame Student verdiente sich genau wie Julia, meine Aushilfe am Nachmittag, neben der Uni ein bisschen was in meinem Café dazu. Er war ein großer, dünner Kerl mit der Körperhaltung einer krummen Banane, der das Talent hatte, mit seiner Umgebung zu verschmelzen, sodass man erst auf ihn aufmerksam wurde, wenn er etwas sagte. Was schon zu manchen peinlichen Momenten geführt hatte.
Auch wenn er nicht viel redete und in meinem Café nur das Nötigste tat, war er ein ziemlich guter Barista mit einem guten Geschmackssinn und einer geschickten Hand, mit der er beeindruckende Milchschaumkunstwerke zauberte.
Wenn er oder Brit nicht kommen konnten, war ich ziemlich aufgeschmissen. Ich konnte zwar Kaffee kochen und auch in Sachen Backen war ich keine absolute Niete, aber so viel Talent wie die beiden hatte ich definitiv nicht.
Dafür kannte ich mich mit Büchern aus. Und darum ging es schließlich auch in meinem Café. Die Wände waren voll von alten und neuen Romanen. Von Thriller über Romantasy bis hin zu Horror. Klassiker oder Neuerscheinungen. Hier konnte jeder herkommen, sich Bücher ausleihen oder direkt kaufen. Autoren konnten Lesungen abhalten oder ich selbst las nach Absprache mit eher schüchternen Schriftstellern einige Szenen vor. Ob Kinderromane am Vormittag oder Düsteres in der Nacht. Ich überlegte mir ständig neue Events, um neue Gäste anzulocken und die Stammkundschaft zu begeistern.
Ich war so stolz auf das, was ich hier erschaffen hatte. Zeitgleich hatte ich das Gefühl, dass es noch nicht genug war, dass ich mehr machen müsste. Mehr Ideen, mehr Neues, mehr Anderes.
Die Uhr verriet mir, dass ich gleich öffnen musste und ich machte die letzten Handgriffe, bevor ich mich auf einen neuen Elf-Stunden-Tag vorbereitete.
Der Vormittag verlief ereignislos. Bekannte und unbekannte Gesichter. Manche nahmen nur etwas mit, andere setzten sich an die Tische. Notebooks, Tablets oder Bücher, jeder hatte irgendetwas in der Hand. Recherchierte für die Uni oder saß mit Freunden zusammen. Zufrieden betrachtete ich meine Gäste. Ich konnte manchmal immer noch nicht glauben, dass es meine Gäste waren. Mein Geschäft. Ich hatte den Schritt gewagt, ich hatte es geschafft. Trotz ihrer Bedenken. Ihrer Angst. Würde beides nicht ihr Leben bestimmen, wäre sie sicher stolz auf mich.
Gegen elf Uhr legte Brit ihre Schürze ab. Die Küche befand sich in einem makellosen Zustand und der Kühlschrank war mit Kuchen und Sandwiches gefüllt, die für den restlichen Tag reichen sollten.
»Und du willst den Brücken-Typen wirklich wieder besuchen?«
Ich sah von dem Tablett auf, auf das ich gerade das benutzte Geschirr eines frei gewordenen Tisches räumte.
»Ja«, sagte ich nur.
»Und das hat nichts mit Baka Alex zu tun?«
Ich holte tief Luft, nahm das Tablett und trug es, vorbei an Brit, in die Küche.
»Nein, Baka Alex, existiert für mich nicht mehr. Und ich möchte, dass dieser Name in diesem Café nicht mehr benutzt wird.«
Ich hörte sie lachen, bevor ich wieder zu ihr ging.
»Und außerdem habe ich mir für den Brücken-Typen einen Namen überlegt, damit ich ihn nicht mehr so nennen muss.«
Brit hob eine Augenbraue. »Ich höre?«
Selbstbewusst und zufrieden verriet ich ihn ihr.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Den kannst du nicht nehmen. Da muss ich immer an den Kinderfilm denken.«
»Welchen Kinderfilm?«
»Kennst du den nicht? Der mit dem Jungen und dem Drachen.«
Fragend sah ich sie an, aber sie winkte ab. »Glaub mir, der Kerl wird nicht begeistert sein.«
Nachdenklich verzog ich den Mund. »Ich finde, er passt zu ihm.«
Brit hob abwehrend die Arme, bevor sie ihren Rucksack schnappte. »Ich habe dich gewarnt.«
Dann winkte sie mir zum Abschied zu und verließ das Café.
»Ich finde ihn ganz okay.«
Erschrocken zuckte ich zusammen. Danny stand neben mir am Kaffeeautomaten. Starrte gelangweilt aus der Fensterfront. Wie konnte man diesen riesigen Kerl übersehen?
»Danke«, sagte ich nachdrücklich und brachte einen der Gäste einen neuen Kaffee, den Danny vor mir auf den Tresen gestellt hatte.
Kurz darauf endete auch die Schicht meines Baristas. Für den Nachmittag hatte ich vor wenigen Monaten Julia gefunden, nachdem meine andere Aushilfe weggezogen war. Ich war mir nicht sicher, ob die Arbeit im Café etwas für sie war und ob es funktionieren würde. Aber zur Freude von uns beiden lief es wunderbar und die Gäste gewöhnten sich schnell an ihre spezielle Art.
Als die schüchterne junge Frau durch die Tür kam, richtete sich Danny ein wenig auf und sah für einen kurzen Moment nicht mehr aus wie eine krumme Banane.
»Hey, Julia«, begrüßte er sie.
Sie hob einen Arm, dabei zuckte er unkontrolliert und sie pfiff mehrmals hintereinander, bevor sie ihm leise antwortete: »Hey Danny. Ding-Ding-Dong.«
Ich war gerade dabei, zwei große Haselnuss Latte macchiatos abzurechnen und bekam ihr kurzes Gespräch nur mit halbem Ohr mit.
Aber die gelegentlichen Pfiffe und Julias zuckende Bewegungen erregten die Aufmerksamkeit der beiden Damen vor mir. Sie sahen Julia verwirrt und ein wenig abschätzig an. Ich hielt mich zurück und vermied es, die beiden aufzuklären. Wenn sie mit Julia nicht klarkamen, konnten sie ihre Latte macchiatos gerne woanders trinken.
Danny verabschiedete sich schließlich und Julia band sich die Schürze um.
Die Glocke klingelte leise, als neue Gäste hereinkamen und sich einen freien Tisch suchten.
»Ding-Ding-Dong«, stieß Julia hervor, oder besser gesagt Julias Tourette. »Na, wie ist die Lage?«
»Gut«, entgegnete ich lächelnd und überlegte nicht zum ersten Mal, ob ich die dämliche Glocke über der Tür nicht einfach abhängen sollte. Seit einigen Wochen schien sie Julias Tourette zu triggern und sie gab immer dieses Ding-Ding-Dong von sich, wenn sie läutete.
Aber ich wusste, dass sie sich unwohl fühlen würde, wenn ich wegen ihr etwas änderte. Direkt zu Beginn hatte sie uns gesagt, dass wir ihre Ticks einfach ignorieren sollten. An die motorischen Ticks hatten wir uns schnell gewöhnt, auch die Gäste. Aber manche sprachlichen Ticks waren doch sehr ungewöhnlich. Manchmal war es lustig, manchmal etwas unangenehm, wenn ihr ein Schimpfwort herausrutschte, und teilweise hatten wir uns erschreckt.
Aber irgendwie gehörte sie mittlerweile einfach mit zum Inventar. Um ehrlich zu sein, sie passte perfekt in dieses gemütliche Chaos, das ich hier erschaffen hatte.
Ich wollte mich nach ihr erkundigen, wusste ich doch, dass sie gestern eine Prüfung schreiben musste, die ihr im Vorfeld Sorgen bereitet hatte.
Aber mein Handy klingelte und ich zog mich kurz in die Küche zurück.
»Hallo Caroline.« Ich hatte die Nummer der Autorin gespeichert, wusste also sofort, wer mich anrief. In zwei Tagen würde sie hier eine Lesung halten. Ich rührte bereits ordentlich die Werbetrommel. Verteilte Flyer, hängte Plakate auf und postete regelmäßig in den sozialen Medien.
»Äh, ja, hallo«, kam es unsicher aus dem Telefon.
»Bist du schon aufgeregt wegen Samstag?«
Sie zögerte und sofort breitete sich ein flaues Gefühl in meinem Magen aus.
»Genau darum geht es«, begann sie. »Ich ... ich habe mich mit anderen Autorinnen unterhalten. Wegen Lesungen und so.«
Ich zog die Augenbrauen zusammen. »Okay? Hast du noch Fragen? Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Wir haben noch nie über Geld gesprochen«, platzte es aus ihr heraus und ich erstarrte, hatte sofort eine böse Vorahnung, lenkte das Thema aber trotzdem bewusst in die andere Richtung.
»Weil Geld auch kein Thema ist. Das Ganze ist für dich kostenlos, da brauchst du keine Angst zu haben.« Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Wir profitierten beide von der Lesung. Ich nahm Geld durch die verkauften Bücher und die trinkenden und essenden Gäste ein und sie steigerte ihren Bekanntheitsgrad und verdiente natürlich auch Geld durch die Verkäufe. Win-Win sozusagen.
»Du kommst hierher, bringst eine Handvoll Bücher mit und liest für die Gäste.« »Na ja, die anderen haben gesagt, dass man als Autor für eine Lesung Geld verlangen kann. Also …« Sie beendet den Satz nicht. Ich biss die Zähne zusammen. Sie hatte meinen Wink nicht verstanden.
»Du willst Geld dafür, dass du hier liest?«
Ich wusste, dass man bekannten Autoren Geld zahlen musste, damit sie bei einem lasen. Sie lockten natürlich viel mehr Gäste an. Es gab sicherlich auch Locations, die Debütautoren für eine Lesung bezahlten, aber ich konnte mir das mit meinem kleinen Café nicht leisten. Davon abgesehen, dass so etwas im Voraus geklärt werden musste und nicht wenige Tage vor dem Termin.
»Nicht viel, aber ich denke an hundert, hundertfünfzig.«
Meine Gesichtszüge entglitten, mein Puls beschleunigte sich und in mir wuchs das Unbehagen, sodass meine Hände zu schwitzen begannen. Hundertfünfzig? Es klang im ersten Moment nicht viel, aber für mich war jeder Cent überlebenswichtig.
»Caroline, wir planen schon seit über einem Monat. Wir haben uns die Druckkosten geteilt, es werden viele Leute kommen und einige werden mit Sicherheit dein Buch kaufen. Und jetzt, kurz vorher, kommst du und möchtest von mir Geld haben?«
»Äh, ja. Die anderen haben gesagt, dass ich das kann.«
Ich rieb mir die Stirn. Das konnte nicht wahr sein. Wenn sie absprang, wäre das ein riesiger Verlust für mich, aber ich sah es auch nicht ein, ihr nur einen Cent zu geben.
»Ich bin nur eine kleine Cafébetreiberin, die Autoren unterstützen möchte. Sei mir nicht böse, aber ich kann dir kein Geld für eine Lesung geben. Abgesehen davon, dass ich es mir nicht leisten kann, wäre es unfair, den anderen gegenüber, die hier schon zum Teil mehrfach gelesen haben.«
Das Schweigen am anderen Ende zog sich in eine beinahe unerträgliche Länge. Irgendwann sagte sie: »Hm, okay. Ich melde mich noch mal bei dir.«
Dann legte sie auf.
Was sollte das heißen? Sie meldete sich? Weswegen? Wollte sie wirklich absagen, bestand sie so sehr auf dieses lächerliche Geld?